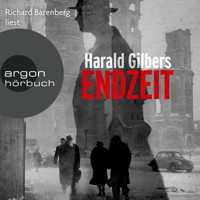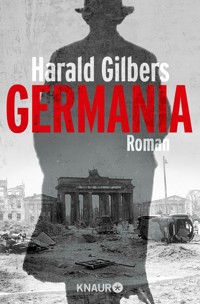
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kommissar Oppenheimer
- Sprache: Deutsch
Ein Serienmörder im Berlin des 2. Weltkriegs – Fall 1 für den jüdischen Kommissar Richard Oppenheimer und ein grandioser historischer Krimi Berlin, 1944: In der zerbombten Reichshauptstadt macht ein Serienmörder Jagd auf Frauen und legt die verstümmelten Leichen vor Krieger-Denkmälern ab. Alle Opfer hatten eine Verbindung zur NSDAP, doch laut einem Bekennerschreiben ist der Täter kein Regimegegner, sondern ein linientreuer Nazi. Als die Ermittlungen stagnieren, reaktiviert die Gestapo schließlich den suspendierten jüdischen Kommissar Richard Oppenheimer, einst erfolgreichster Ermittler der Kripo Berlin. Für Oppenheimer geht es nicht nur um das Überleben anderer, sondern nicht zuletzt um sein eigenes. Womöglich erst recht dann, wenn er den Fall lösen sollte. Fieberhaft sucht er einen Ausweg aus diesem gefährlichen Spiel. »Handlung, Hintergrund und Historie gehen eine selten so gelungene harmonische Verbindung ein, ohne dass die Spannung darunter leidet. […] ›Germania‹ wird zum doppelten Horrortrip. Die fieberhafte Jagd auf einen Killer führt durch die irrwitzige Realität von Hitlers Albtraumreich.« krimi-couch.de Für die historische Krimi-Reihe aus Berlin zur Zeit des Nationalsozialismus ist Harald Gilbers bereits mit dem Friedrich-Glauser-Preis und dem Prix Historia ausgezeichnet worden. Die historischen Kriminalromane mit Kommissar Oppenheimer sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Germania - Odins Söhne - Endzeit - Totenliste - Hungerwinter
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Harald Gilbers
Germania
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In der zerbombten Reichshauptstadt macht ein Serienmörder Jagd auf Frauen und legt die verstümmelten Leichen vor Kriegerdenkmälern ab. Alle Opfer hatten eine Verbindung zur NSDAP. Doch laut einem Bekennerschreiben ist der Täter kein Regimegegner, sondern ein linientreuer Nazi.
Der jüdische Kommissar Richard Oppenheimer, einst erfolgreichster Ermittler der Kripo Berlin, wird von der SS reaktiviert. Für Oppenheimer geht es nicht nur um das Überleben anderer, sondern nicht zuletzt um sein eigenes. Womöglich erst recht dann, wenn er den Fall lösen sollte …
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Nachwort
Literaturhinweise
Für Peter Dahmen, der alles bereits vorher wusste.
Prolog
Frühsommer 1939
Das Licht stand auf zehn Uhr Vormittag. In der Hauptstadt des Deutschen Reiches schimmerten die Straßenschluchten in blendendem Weiß. Doch nichts regte sich, alles wirkte wie erstarrt, festgefroren in einem ewigen Winter.
Es würde noch einige Zeit dauern, bis das alltägliche Chaos der Stadt Berlin in jene Winkel vorgedrungen war. In diesem Moment strahlten die Straßen in ihrer Verlassenheit noch Symmetrie und Ordnung aus, nirgends waren Fahrzeuge am Bordstein abgestellt, niemand flanierte durch die Alleen. Der ordentliche Eindruck wurde nur durch die getrockneten Leimbläschen gestört, die trotz der Gewissenhaftigkeit der Baumeister hier und da unter den Gebäuderiegeln auf die Wege gequollen waren.
Die breite Straßenachse lief pfeilgerade auf eine mächtige Kuppel zu, die man bereits in mehreren Kilometern Entfernung am Horizont erkennen würde. Irgendwann in ferner Zukunft. Was jetzt noch in weißer Pracht den Horizont dominierte, sollte dereinst im grünen Gewand des patinierten Kupfers die ganze Stadt überstrahlen. Die Große Volkshalle, die hundertachtzigtausend Menschen Platz bot, war ein Ort für noch nie gesehene Siegesfeiern.
Hoch über den Dächern erklang ein Flüstern: »Hervorragend, Speer.«
Hier war die Stimme nicht jenes ferne Kratzen mit dem rollenden »R«, das jeder Volksgenosse aus dem Rundfunk oder der Wochenschau kannte, und es war ebenfalls nicht das heisere Bellen, das der Diktator in seinem Repertoire hatte, wenn es galt, die Menschenmassen aufzupeitschen. Vor dem dreißig Meter langen Modell der künftigen Prachtstraße ertönte die Stimme, ganz privat in ihrem natürlichen Bariton, wirkte gedankenverloren, fast sanft. Das Hinterteil herausgestreckt, eine Pose, die er sonst vermied, bückte sich der Diktator, um eine erdnahe Perspektive zu erproben.
Es ließ sich nicht leugnen, dass er mit Albert Speer einen Baumeister gefunden hatte, der es gelegentlich schaffte, die kühnen Ideen seines Auftraggebers in Größe und Maßstab gar noch zu übertreffen. Die Paradestraße mit einer Länge von mehr als fünf Kilometern, der Triumphbogen mit seinen schattigen Säulengängen, der fast fünfzig Mal so groß wie der Pariser Arc de Triomphe sein würde, die Große Volkshalle, geplant als das größte Bauwerk der Welt, dessen Kuppel sich im Inneren über eine Höhe von zweihundertzwanzig Metern wölbte – die ganze Stadtplanung war ein Wettbewerb mit anderen Weltstädten, Stein gewordener Ausdruck eines empfindlich gekränkten Nationalstolzes, der nun mit aller Macht wieder auftrumpfen wollte.
Das Zentrum der Reichshauptstadt sollte sich in eine riesige Bühne für Aufmärsche und Paraden verwandeln. Die Frage, ob wirklich jemand in dieser Stadt leben konnte, kam dem Diktator dabei nur selten in den Sinn. Die umliegenden Wohnblocks waren nicht mehr als einförmige Quader, die man nach Belieben neu aufteilen konnte, wenn es die Verkehrsplanung verlangte.
Für das alte Berlin mit seinen Widersprüchen, für die schnodderige, manchmal zutiefst provinzielle Metropole, die es die längste Zeit über gewesen war, gab es in dieser grandiosen Vision keinen Platz. Der Diktator dachte seit geraumer Zeit darüber nach, dies gleich von vornherein deutlich zu machen. Berlin klang für seinen Geschmack zu schnöde, es musste ein neuer Name her, ein grandioser, monumentaler Name, einer Welthauptstadt würdig. Vielleicht ein Name wie Germania.
Der Blick des Diktators wurde immer wieder magisch von der Kuppel der Großen Volkshalle angezogen. Schließlich beäugte er kritisch den Aufbau auf ihrer Spitze, wo der Reichsadler auf dem Hakenkreuz thronte. Dann schüttelte er, von jäher Erkenntnis gepackt, den Kopf. »Das dort müssen wir ändern, Speer. Es ist besser, wenn der Adler hier nicht mehr über dem Hakenkreuz steht. Die Bekrönung dieses Bauwerkes soll der Adler über der Weltkugel sein.«
Als Hitler gegangen war, drehte sich Generalbauinspektor Speer nochmals im Türrahmen um. Nur das Lampensystem, mit dem er jegliche Tageslichtstimmung realitätsgetreu simulieren konnte, erhellte den Ausstellungsraum der Akademie. Das Stadtmodell ruhte im dunklen Zimmer, ein heller Fleck in einer schwarzen Unendlichkeit, eine Verheißung für die Zukunft. Bis dahin gab es noch viel zu tun. Speer schaltete die Beleuchtung aus.
Nacht fiel über Germania.
1
Sonntag, 7. Mai 1944
Sie sind gekommen, um mich zu holen, zuckte es ihm durch den Kopf. Als sich der Gedanke langsam setzte und ihm die Konsequenzen klarwurden, zog Oppenheimer instinktiv die Bettdecke um sich. Doch es war zu spät. Der ungebetene Besucher befand sich bereits in seinem Zimmer. Aufgrund der Verdunklung vor den Fenstern kam von draußen nicht der geringste Lichtschimmer in ihre enge Behausung. Der Eindringling war nicht mehr als ein wartender Schatten direkt gegenüber dem Bett.
Schläfrig hatte Oppenheimer den Arm um seine Gattin gelegt, als er plötzlich spürte, dass Lisas Körper angespannt war. Sie hatte sich halb aufgerichtet und wagte kaum zu atmen. Doch draußen war es still. Keine Sirene gellte durch die Nacht, keine Bomber dröhnten aus der Luft, keine Flakgeschosse trommelten in der Ferne. Es konnte also kein Bombenalarm sein, der Lisa in Schrecken versetzt hatte. Oppenheimer hatte sich zunächst fragend ihr zugedreht, bis auch er den Fremden wahrgenommen hatte, der in unmittelbarer Nähe stand.
Die undeutliche Gestalt verhielt sich ruhig, atmete regelmäßig. Ein Funke tänzelte in der Dunkelheit, bewegte sich nach oben und verwandelte sich in einen flammenden Punkt, als der Eindringling inhalierte. Aus dem finsteren Nichts ihres Zimmers wurde Oppenheimer Tabakgeruch entgegengeblasen.
Der Fremde konnte nur ein Mann von der Gestapo sein. Aufgrund seiner einschlägigen Erfahrungen mit der Berliner Unterwelt wusste Oppenheimer, dass sich kein normaler Einbrecher in ein Judenhaus verirren würde, um dann lässig rauchend darauf zu warten, dass die Opfer aufwachten und ihn bemerkten. Oppenheimer kennt seine Pappenheimer. Während seiner Jahre im Polizeidienst war dies bei den Kollegen ein vielzitiertes Sprichwort gewesen. Sich wegen ein paar lausiger Kröten unnötig ins Radar der Gestapo zu begeben, war für Diebe ein zu großes Risiko. Denn die jüdischen Bewohner dieser Häuser heimzusuchen und zu bestehlen, sahen die Gestapo-Männer als ihr ureigenes Privileg an. Wenngleich es in den letzten Monaten keine Hausdurchsuchungen mehr gegeben hatte, konnte sich Oppenheimer noch genau daran erinnern. Bei diesen Gelegenheiten pflegten gleich mehrere Gestapo-Leute anzurücken. Es galt als normal, dass sie den Bewohnern dabei ins Gesicht schlugen, sie bespuckten und Beschimpfungen brüllten. Doch dieser Mann hier war allein gekommen, in aller Heimlichkeit. Das war ein ausgesprochen schlechtes Zeichen. Wenn die Gestapo-Leute pöbelten, wusste man, woran man war. Waren sie jedoch still, konnte alles geschehen.
Für einen nicht enden wollenden Augenblick verharrten sie in ihren Positionen, Oppenheimer regungslos in seinem Bett, Lisa neben ihm und der Fremde gegen den Türrahmen gelehnt. Dann erklang die Stimme des Mannes. »Ich weiß, dass Sie wach sind, Oppenheimer. Sicherheitsdienst. Wollen Sie sich nicht langsam anziehen und mitkommen?«
Zwar war dies als Frage formuliert, doch der Ton war unmissverständlich. Der Sprecher würde eine Weigerung nicht tolerieren.
Oppenheimer wagte nicht, die Nachttischlampe anzuschalten. Innerlich bebend, stand er auf und angelte seine Kleider von der Stuhllehne. Er kam nicht einmal dazu, sich zu fragen, was eigentlich ein Mann vom SD hier zu suchen hatte. Mechanisch schritt er durch die Küche, die sie sich mit den anderen Bewohnern des Judenhauses teilten. Es überraschte Oppenheimer immer wieder, wie bereitwillig er gehorchte, wenn er verängstigt war, wenn er wusste, dass sein Schicksal in den Händen anderer lag. Kurz dachte er an Lisa, die er ungeschützt zurücklassen musste. Doch als amtlich nachgewiesene Arierin war sie ohnehin besser dran, wenn sie ihn töten würden. Danach wäre sie frei und nicht länger aus der Volksgemeinschaft ausgegrenzt, weil sie ausgerechnet einen Juden geheiratet hatte. Trotz seiner akuten Todesangst bot ihm dieser Gedanke einen gewissen Trost.
Im Treppenhaus brannte das Licht, und Oppenheimer sah den Fremden zum ersten Mal. Der Anblick war ernüchternd. Der Mann trug eine Brille und war eher klein gewachsen. Doch die Hand in der ausgebeulten Manteltasche verriet, dass er eine Feuerwaffe dabeihatte. Oppenheimer wunderte sich, dass keiner der anderen Bewohner auf den Beinen war. Nicht einmal die Schlesingers schlichen neugierig durch die Gänge. Offenbar hatte man es nur auf ihn abgesehen.
Der SD-Mann blickte auf den Koffer, den sein Gefangener bei sich trug, und runzelte die Stirn. Es war ein Reflex gewesen. Oppenheimer hatte beim Hinausgehen seinen Luftschutzkoffer mitgenommen. Alle wichtigen Habseligkeiten waren darin verstaut, so dass er sie immer bei sich tragen konnte, wenn er bei einem Luftangriff in den Keller musste. In Berlin sah man viele solcher Koffer.
»Den werden Sie nicht brauchen«, sagte der SD-Mann und winkte ihn zurück. Oppenheimer drehte sich um und stellte den Koffer in die unbeleuchtete Küche.
Vor dem Hauseingang warteten zwei Männer von der SS mit Gewehren in den Händen. Sobald der SD-Mann Oppenheimer auf den Gehsteig geschoben hatte, setzten sie sich in Bewegung. Wolken verbargen den Nachthimmel. Der dahinterliegende Mond war nicht mehr als ein diffuses Leuchten, das sich stumpf auf den Stahlhelmen der SS-Männer brach. Oppenheimer starrte beklommen auf die grauen Rücken, die sich im Gleichtakt bewegten, und hörte dabei das metallische Klappern ihrer Karabiner. Was konnte er nur tun? Gab es eine Fluchtmöglichkeit? Noch im selben Augenblick verwarf Oppenheimer diesen Gedanken. Solange er den Mann vom Sicherheitsdienst mit seiner Feuerwaffe im Nacken hatte, konnte er nichts unternehmen.
Sie gelangten zu einem Auto, das diskret in der nächsten Seitenstraße geparkt war. Die hintere Tür wurde geöffnet, und Schwärze umfing Oppenheimer.
Die letzten Tage war es in Berlin unüblich ruhig gewesen. Auch in dieser Nacht hatte es noch keinen Fliegeralarm gegeben. Doch jeder wusste, dass die Stille trügerisch war. Irgendwann würden die Flugzeuge wieder kommen. Unzählige Bomben hatten Gebäude zerstört und die Reichshauptstadt in eine Welt aus Schutt und Asche verwandelt. Neue Lücken in den Häuserreihen zeugten von den jüngsten Kämpfen. Die Einwohner hatten sich längst an die ständigen Veränderungen gewöhnt. In Berlin war das Leben schon immer sehr hektisch verlaufen, doch selbst nach diesen Maßstäben war der Bauwahn, der nach Hitlers Machtergreifung um sich gegriffen hatte, außergewöhnlich. Die Narben waren allerorts zu besichtigen. Die nationalsozialistischen Herrscher ließen die schönsten Plätze der Innenstadt zu Aufmarschflächen planieren, sie versetzten Brunnen und Denkmäler, hatten sogar in einer wahren Herkulesanstrengung die Siegessäule vom Reichstag mitten in den Tiergarten zum Großen Stern umgesetzt.
Als Oppenheimer während der Autofahrt aus dem Seitenfenster blickte, fuhr er plötzlich zusammen. Für einen kurzen Moment hatte er geglaubt, dass ihm ein verschrecktes Gesicht entgegenstarrte. Doch bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass ihm das Mondlicht einen Streich gespielt hatte. Die eingefallenen Wangen und die tief in den Höhlen liegenden Augen gehörten Oppenheimer selbst. Als er realisierte, dass er sich tatsächlich vor dem Spiegelbild seines eigenen Gesichts erschrocken hatte, kam er sich töricht vor.
Draußen glitt der haushohe Sockel der Siegessäule an ihnen vorbei. Der SS-Mann am Steuer des Wagens bog nach links ab, hielt auf der Ost-West-Achse direkt auf die Stadtmitte zu. Nach einer Weile fuhren sie durch das Brandenburger Tor. Oppenheimer hatte keine Mühe, sich trotz der Dunkelheit zu orientieren. Er kannte hier sogar die hintersten Winkel und brauchte nicht in die Luft zu blicken, um zu wissen, dass über ihren Köpfen steinerne Schwingen vorbeirauschten, die weit in die Nacht griffen.
Unter den Linden hieß der Straßenzug, den sie durchfuhren, doch Hitlers Baumeister hatten diese Bezeichnung bereits vor etlichen Jahren ad absurdum geführt. Sie hatten nichts Besseres zu tun gewusst, als die alten Bäume zu fällen, um Platz zu machen für unzählige Marmorsäulen, auf denen jetzt eine Formation von Reichsadlern thronte. Die jungen Linden, die man daraufhin neu gepflanzt hatte, wirkten in ihrer Zwergenhaftigkeit wie ein schlechter Witz.
Großer Jubel war hier zu hören gewesen, als die vom Völkerbund kontrollierten Gebiete wieder dem Deutschen Reich angegliedert wurden, noch größere Euphorie herrschte, als die ersten Erfolge an der Front verkündet wurden und die deutsche Wehrmacht von Sieg zu Sieg ganz Europa durcheilte.
Doch die lautstarke Zustimmung war zunehmend verhallt, als die Bomben fielen.
Und dann kam Stalingrad.
Das militärische Debakel in der Weite der russischen Steppe hatte den Geschmack des Erfolges schal werden lassen und das Vertrauen in die gut geölte, deutsche Kriegsmaschinerie nachhaltig untergraben.
Wenn die Sonne schien, überstrahlten Hitlers blendend weiße Marmorsäulen auch jetzt noch die Innenstadt, doch in der Nacht verwandelten sie sich auf unheimliche Weise in einen Schattenwald inmitten einer Geröllwüste, durch den sich ihr Auto jetzt mühselig seinen Weg bahnte.
Der Fahrer wich einem provisorisch ausgebesserten Krater in der Straße aus. Vom Scheinwerferlicht aufgeschreckt, hasteten graue Schatten mit funkelnden Augen in Deckung. Ratten. In den Trümmern hausten unzählige von ihnen. Trotz aller Zerstörungen eroberten sie Zentimeter für Zentimeter ihr altes Terrain zurück.
Der SD-Mann öffnete die Tür. Vage konnte Oppenheimer erkennen, dass in der Nähe ein weiteres Fahrzeug geparkt war. Weiter hinten standen im Dunkel Männer mit Taschenlampen.
»Aussteigen«, befahl der SD-Mann. Zögernd kämpfte sich Oppenheimer aus seinem Sitz. Die Fahrt hatte unerwartet lange gedauert. Irgendwann hatte er in der Dunkelheit schließlich die Orientierung verloren. Die Panik, die Oppenheimer zunächst verspürt hatte, war immer mehr einer großen Verwunderung gewichen. Als sie die Spree überquert hatten und er auf dem gegenüberliegenden Ufer die mächtigen Werkshallen der AEG erkannte, wusste Oppenheimer, dass sie sich im Vorort Oberschöneweide befanden. Die imposanten Industriebauten, die hier das nördliche Spreeufer säumten, waren jedem Berliner ein Begriff, doch was den Sicherheitsdienst wohl dazu bewogen haben mochte, ihn mitten in der Nacht dorthin zu kutschieren, konnte er sich beim besten Willen nicht erklären.
Oppenheimers Begleiter wies in die Richtung der tanzenden Lichtkegel. Mittlerweile hatte er seine Feuerwaffe aus der Manteltasche genommen und zielte damit in Oppenheimers Richtung. Widerwillig setzte sich dieser in Bewegung.
Der SD-Mann führte Oppenheimer zu einer Rasenfläche, in deren Mitte auf Granitstufen ein etwa drei bis vier Meter hoher Steinstumpf ruhte. In seiner Unfertigkeit schien der Klotz keinen erkennbaren Zweck zu erfüllen. Wahrscheinlich waren dies die kläglichen Überreste eines Mahnmals. In Berlin gab es unzählige davon. Die meisten waren jüngeren Datums und erinnerten an das Grauen des letzten Krieges. Jetzt, wo sich die Weltkriege numerieren ließen, war er als der Erste Weltkrieg bekannt, doch im Volksmund wurde er kurz und prägnant Anno Scheiße genannt. Da in heroischen Zeiten wie diesen jede Art von Metall knapp war, wurde dieses nicht zu unterschätzende Reservoir an Metallteilen unverzüglich eingeschmolzen, sobald der neue, noch größere Krieg begonnen hatte. Wo dereinst zweifelsohne eine Skulptur emporgeragt hatte, war jetzt nichts weiter als gähnende Leere.
Doch an diesem Morgen befand sich dort noch etwas anderes, das so gar nicht zu einem Denkmal passte.
Unmittelbar hinter dem Sockel hatte man notdürftig ein großes Tuch über den Boden gespannt. Oppenheimer erkannte sofort die Umrisse, die sich darunter abzeichneten: Vor ihnen lag ein menschlicher Körper.
Auch die Gesichter der zwei Männer konnte Oppenheimer im Widerschein der Taschenlampen besser erkennen. Beide trugen die graue Felduniform der SS. Hinter ihnen erhob sich ein großes Bauwerk, das eine Kirche sein musste.
Gesprächsfetzen drangen durch die kühle Morgenluft.
»Schöne Schweinerei das«, wisperte einer der beiden und starrte mürrisch auf die zugedeckte Leiche zu seinen Füßen. »Halten Sie es wirklich für klug, ausgerechnet einen Juden hinzuzuziehen?«
»Ich habe meine Gründe, Graeter«, sagte der zweite Mann und zündete sich eine Zigarette an.
»Sie können mir erzählen, was Sie wollen, Vogler. Ich halte es für einen Fehler.« Als der Sprecher bemerkte, dass sich Oppenheimer mit seinem Begleiter näherte, verstummte er betreten.
Der andere wandte sich den Neuankömmlingen zu. »Da sind Sie ja, Oppenheimer.«
Der SS-Mann namens Vogler richtete seine Taschenlampe auf die beiden. Der Lichtkegel verharrte kurz auf Oppenheimers gelbem Davidstern. Ein Ausdruck der Unsicherheit huschte über Voglers Gesicht, doch sofort war dieser wieder verschwunden hinter der forcierten Selbstsicherheit, die so typisch war für Hitlers Elite.
»Ich bin Hauptsturmführer Vogler. Vor zwei Stunden ist hier diese Leiche gefunden worden.«
Vogler schritt zu der Toten. Obwohl der Gesichtsausdruck des anderen Uniformträgers namens Graeter betont ausdruckslos war, seufzte er vielsagend, bevor die Plane zurückgeschlagen wurde.
Als Oppenheimer die getötete Frau sah, fühlte er wieder den altbekannten Stich in der Magengegend. Im Laufe seines Polizeidienstes hatte er zwar mit etlichen Toten zu tun gehabt, doch er war nicht derart abgestumpft, dass der Anblick eines Mordopfers in ihm keinerlei Gefühlsregung hinterließ. Gleichzeitig spürte er in sich auch den Reflex eines Mordkommissars, spürte, wie sein Gehirn auf altgewohnte Weise in die Gänge kam und seinen anfangs noch störrischen Augen den Befehl gab, genauer hinzublicken.
»Erzählen Sie uns, was Sie sehen«, befahl Hauptsturmführer Vogler.
Daran, dass der Körper dieser Frau zerstört war, blieb kein Zweifel. Als er die stählernen Markierungspfähle registrierte, die neben dem Leichnam in den Boden gerammt waren, wusste er, dass die Männer von der Spurensicherung längst mit ihrem Mordauto eingetroffen waren, um die ermittlungstechnische Untersuchung abzuwickeln. Unwillkürlich wollte Oppenheimer nach weiteren Hinweisen Ausschau halten, die den Spezialisten vielleicht entgangen waren, doch dann stutzte er.
Plötzlich ging ihm die Frage durch den Kopf, was er hier eigentlich zu suchen hatte. Er war schon längst suspendiert. Nach Hitlers Machtergreifung hatte man ihn, wie alle anderen Juden, aus dem Staatsdienst entfernt. Ins Mordkommissariat durfte er offiziell keinen Fuß mehr setzen, und dennoch stand er jetzt vor einer toten Frau.
Er blickte die Umstehenden fragend an. Panik kam in ihm auf. Wollten sie ihm einen Mord in die Schuhe schieben? Für so erfinderisch hatte er den Sicherheitsdienst nicht gehalten. Eine einfache Grube und ein Projektil in seinem Kopf hätten genügt, um Oppenheimer für immer verschwinden zu lassen. Warum dieser Aufwand?
»Können Sie uns keine Hinweise geben?«, fragte Vogler. »Sie enttäuschen mich. Ich hatte gewisse Hoffnungen in Sie gesetzt.« Er reichte ihm seine Taschenlampe.
Zögernd nahm Oppenheimer sie entgegen. Also Hinweise wollten sie von ihm. Er hatte keine andere Wahl, als mitzuspielen.
Bedächtig wandte er sich der Toten zu. Mit rauher Stimme begann er zu sprechen.
»Ich schätze sie auf vielleicht fünfundzwanzig Jahre. Es gibt Strangulationsmerkmale an ihrem Hals. Wahrscheinlich ist das die Todesursache.«
War es das, was die Männer von ihm hören wollten? Ihre trüben Mienen zeigten Desinteresse. Nur Hauptsturmführer Vogler schien bemüht, den Ausführungen zu folgen. Oppenheimer wollte den Körper abtasten, doch er hielt inne und wandte sich fragend an den Hauptsturmführer. »Kann ich sie anfassen?«
»Tun Sie, was Sie für richtig halten«, antwortete Vogler.
Vorsichtig befühlte Oppenheimer den Unterkiefer. Er ließ sich nur schwer bewegen. Die Handmuskulatur war hingegen verhältnismäßig locker.
»Die Totenstarre ist noch nicht sonderlich ausgeprägt. Körperabwärts hat sie teilweise noch nicht eingesetzt. Der Mord ist also erst vor kurzem geschehen. Ich schätze, etwa vor sechs Stunden. Aber ich könnte mich täuschen, bei Kälte setzt die Starre langsamer ein. Die Ärzte werden das exakter bestimmen können. Die Handgelenke sind wund gerieben. Wahrscheinlich war sie gefesselt.«
Oppenheimer richtete sich auf, betrachtete den Leichnam wieder zur Gänze. Der Unterleib der jungen Frau war genau zum steinernen Stumpf des Denkmals ausgerichtet, ihre Beine waren wie zum Liebesakt gespreizt. Die Position der Leiche wirkte geradezu pedantisch ausgewählt. Der Täter hatte viel Zeit damit verbracht, den toten Körper in dieser obszönen Weise vor dem Mahnmal zu arrangieren.
An der Innenseite eines Beins registrierte Oppenheimer plötzlich einen kleinen, verkrusteten Blutfleck. Er kniete neben der Leiche nieder, um zu ergründen, woher das Blut stammte. Der SD-Mann, der ihn hergebracht hatte, wandte sich schaudernd ab. Wollte er etwa nicht mit ansehen, wie ein Jude unter den Rock eines Mordopfers schaut? Oppenheimer wusste, dass die Toten keine Indiskretion empfinden, und hob den Saum in die Höhe.
Der Anblick, der sich ihm nun darbot, ließ ihn unwillkürlich zurückzucken. Noch im selben Augenblick verstand er die Reaktion des SD-Mannes.
»Ist etwas?«
Oppenheimer schüttelte auf Voglers Frage hin nur den Kopf, obwohl er spürte, wie sich seine Eingeweide zusammenkrampften. Er sog die Luft ein und reagierte, wie er es auch früher in ähnlichen Situationen getan hatte. Er schob den Ekel beiseite und konzentrierte sich darauf, methodisch vorzugehen.
Die Frau trug keine Unterwäsche. Ihr Schoß war eine einzige große Wunde.
»Hier ist eine große Verletzung. Die Geschlechtsteile wurden verstümmelt, vielleicht sogar entfernt.«
Als Oppenheimer glaubte, alles gesehen zu haben, richtete er sich auf und nahm zum ersten Mal wieder seine Umgebung wahr. Irgendwo über seinem Kopf raschelten Blätter. Während sich die umliegenden Häuser bereits schemenhaft abzeichneten, war der Leichnam immer noch in Dunkel gehüllt. Oppenheimers Verstand ordnete die Fakten, während um ihn herum allmählich das Leben erwachte.
Ahnungslos, dass nebenan etwas Grässliches geschehen war, schlummerten die Anwohner einen seligen Schlaf, den zur Abwechslung einmal kein Fliegeralarm gestört hatte. Andere standen gewohnheitsmäßig zu dieser frühen Stunde auf, obwohl sie heute nicht zur Arbeit gehen mussten, schlurften zur Toilette oder bereiteten ihr Frühstück zu. Die Dinge gingen ihren gewohnten Lauf wie an jedem beliebigen Sonntag. Obwohl durch die verdunkelten Fenster von all dem nichts zu sehen war, konnte Oppenheimer deutlich spüren, wie sich die Anwohner langsam zu regen begannen. Nicht weit von ihnen entfernt knatterte das erste Fahrzeug vorbei, doch das Geräusch verhallte zwischen den Häuserfronten. Nicht mehr lange, dann würden die ersten Kirchgänger zur Morgenandacht kommen. Und um zur Kirche zu gelangen, würden sie genau auf diesen Platz zusteuern.
»Und was ist Ihre Schlussfolgerung?«
Voglers Stimme riss Oppenheimer aus seinen Gedanken. Mittlerweile waren zwei weitere Männer mit einer Zinkbahre aufgetaucht, um die Leiche zu entfernen. Die anderen scharrten unruhig mit den Füßen. Nur Vogler stand regungslos da und fixierte Oppenheimer. Verlegen räusperte sich dieser. Seine jahrelange Erfahrung half ihm, sich nicht vollends zum Trottel zu machen und seine Beobachtungen mit knappen Worten zusammenzufassen.
»Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass sie nicht an dieser Stelle getötet wurde. Hier gibt es kaum Blut. Auf der Unterseite des Rocks befinden sich nur einige wenige Flecken, ansonsten noch in unmittelbarer Nähe der Wunde, und das war’s auch schon. Kein Blut auf dem Boden, keine Blutspuren in der Umgebung, nein, sie wurde woanders getötet und später hierhergebracht. Die Art und Weise, in der die Leiche hier präsentiert wurde, habe ich noch nie gesehen. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass es reiner Zufall ist. Dies hier ist ein öffentlicher Platz. Die Gefahr ist groß, erwischt zu werden. Nein, meine Herren, der Mann, der hierfür verantwortlich ist, hatte sich vorher einen Plan zurechtgelegt. Und er hat ihn bis ins letzte Detail ausgeführt. Erfolgreich, denn sonst wäre jemand auf ihn aufmerksam geworden. Das alles lässt nur eine Schlussfolgerung zu: Ein unvorstellbar kaltblütiger Mensch ist hier am Werk gewesen. Nur jemand mit bestialischen Veranlagungen kann eine Leiche derartig brutal verstümmeln und dann auch noch zur Schau stellen. Ich kann Ihnen keine Hoffnungen machen. Es wird nicht einfach werden, den Täter zu schnappen.«
Die Sirene jaulte ihr langgezogenes Auf und Ab. Das bedeutete Vollalarm. Oppenheimer lief automatisch los, doch er kümmerte sich kaum um die feindlichen Bomber, die im Anflug auf die Stadt waren.
Nachdem er in Oberschöneweide seine Einschätzung des Mordfalles abgegeben hatte, wurde er mit dem Auto wieder in die Innenstadt zurückverfrachtet. Niemand hatte auch nur die geringsten Anstalten gemacht, Oppenheimer die Situation zu erklären, in die er hineingeraten war. Sobald der Voralarm ertönte, hatte ihn der SD-Mann an der Hansabrücke abgesetzt und war mit dem Auto davongerauscht. Das war nicht weiter tragisch, denn das Judenhaus war von dort aus nur noch wenige hundert Meter entfernt.
Oppenheimer hätte nach dieser langen Nacht eigentlich müde sein müssen, doch sein Verstand arbeitete auf Hochtouren. Die Eindrücke wollten ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Während er sich seiner derzeitigen Behausung näherte, versuchte er, die Männer einzuschätzen, die ihn am Fundort der Leiche erwartet hatten. Die SS-Männer hatten identische Uniformen getragen, also konnte man davon ausgehen, dass sie beide Hauptsturmführer waren. Was die SS jedoch mit einem Mordfall wie diesem zu tun hatte, konnte Oppenheimer nicht sagen.
Im Gegensatz zu den beiden Hauptsturmführern hatte sein Begleiter vom Sicherheitsdienst schon eher einen Grund, bei einem Leichenfund anwesend zu sein. Bei schweren Gesetzesverstößen waren die Beamten vom SD schnell vor Ort. Dabei hatte diese Organisation ursprünglich nichts mit der Kriminalpolizei zu tun gehabt. Anfangs war der Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS nicht mehr als der parteiinterne Nachrichtendienst der NSDAP gewesen, doch nach Hitlers Machtergreifung hatten sich die Grenzen zwischen dem deutschen Staat und dem Parteiapparat der Nationalsozialisten zusehends verwischt. Die Organisationen der NSDAP bekamen immer mehr Kompetenzen zugesprochen, und so war es nur eine Frage der Zeit, bis SD, Gestapo und Kripo in dem neu gegründeten Reichssicherheitshauptamt zusammengeführt wurden. Mittlerweile hatten normale Kriminalbeamte nichts mehr zu sagen und waren nur noch Lakaien, die lediglich bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten selbständig aktiv werden durften. Schwere Delikte mussten von Parteimitgliedern bearbeitet werden. Warum ein Fall dann entweder beim SD oder bei der Gestapo landete, das war aufgrund des allgemeinen Kompetenzgerangels der einzelnen Parteiorganisationen schwer nachvollziehbar.
Oppenheimer war derart in Gedanken versunken, dass ihm nicht mal die geisterhafte Stille auffiel, die sich bleiern über seine Umgebung gelegt hatte. An diesem Morgen hatte er eine entscheidende Verwandlung durchgemacht: Seit langem verspürte er wieder ein Gefühl der Souveränität. Für eine kurze Zeit war er wieder der Kommissar Oppenheimer gewesen und nicht der Beamte, den man wegen seiner jüdischen Abstammung aus dem Staatsdienst entlassen hatte. Mit einem Mal war er nicht mehr Opfer von Hitlers Willkür, sondern wieder ein Jäger. Und so schlich er nicht wie sonst mit eingezogenem Kopf und nach unten gerichtetem Blick durch die Straßen, sondern betrat das Judenhaus, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt, dass er hier wohnte.
Da ohnehin Fliegeralarm war, stieg Oppenheimer die Treppe hinab. Der Keller war von den Bewohnern mehr schlecht als recht zum Bunker ausgebaut worden. Sie hatten auch keine andere Wahl, denn in die großen Hochbunker mit ihren meterdicken Betonmauern ließ man Juden nicht hinein. Wegen der mannshohen Holzbalken, die man im Kellergeschoss nachträglich verkeilt hatte, dachte Oppenheimer, dass es dort unten wie in einem Bergwerksstollen aussah. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen hätte die armselige Holzdecke einer Bombe im Ernstfall kaum Widerstand bieten können. Streng genommen wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, direkt im Freien Schutz zu suchen, denn dort war die Gefahr geringer, lebendig unter Schutthaufen begraben zu werden. Als potenzielle Staatsfeinde hatte man den Bewohnern des Judenhauses auch keine Gasmasken zugeteilt, Rundfunkgeräte durften sie ebenfalls nicht besitzen, nicht mal ein Drahtfunkempfänger im Keller war gestattet, um verfolgen zu können, was draußen vor sich ging.
Als Oppenheimer den Kellerbunker betrat, saßen die anderen Bewohner des Judenhauses schon beieinander: das Ehepaar Bergmann, die Schlesingers und Dr. Klein, der wie üblich die Hausapotheke bewachte und für den Notfall seinen Arztkoffer in Reichweite hatte. Der alte Schlesinger blinzelte Oppenheimer unter seinem Stahlhelm entgegen, ein Andenken an den Ersten Weltkrieg.
»Ist Ihre Frau heute in der Fabrik?«, fragte der Alte. »Sie ist noch nicht aufgetaucht.«
Oppenheimer war verblüfft. »Das wäre mir neu. Sie hat nichts davon erwähnt.«
»Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie nachsehen sollen, Schlesinger«, grummelte Dr. Klein in seiner Ecke. Schwerfällig stützte er sich auf, um seinen zentnerschweren Leib hochzuhieven.
»Lassen Sie es gut sein, Doktor«, sagte Oppenheimer. »Ich kümmere mich schon darum.«
Oppenheimer war die letzte Treppe zu seiner Wohnung halb hinaufgestiegen, als er erstarrte. Gas!
Irgendetwas war dort oben nicht in Ordnung. Oppenheimer rannte die letzten Stufen hoch und riss die Tür zur Küche auf.
Der Gasgestank schlug ihm entgegen. Benommen trat er einen Schritt zurück. Unerklärlicherweise war das Küchenfenster geschlossen. Lisa hatte sonst immer darauf geachtet, es bei einem Luftangriff sperrangelweit zu öffnen, damit das Glas nicht durch die Druckwelle einer Detonation zerschellte.
Oppenheimer holte tief Luft und hechtete dann quer durch den Raum. Seine Bemühungen, das Fenster zu öffnen, blieben erfolglos. Er war zu aufgeregt. Kurzerhand ergriff er den am Boden stehenden Sandeimer und zerschlug damit die Scheiben.
Vor der Öffnung japste Oppenheimer nach Luft. Gerade hatte er seine Lungen wieder mit Sauerstoff gefüllt, als er sah, dass am Herd einer der Gasbrenner eingeschaltet war. Der Wasserkessel stand auf der Platte, doch jemand musste vergessen haben, das Gas darunter zu entzünden.
Mit zwei großen Schritten war er am Herd und drehte das Gas ab. Er hatte kaum die Tür zu seinem Zimmer geöffnet, als er auch schon Lisa sah. Sie lag bewusstlos auf dem Bett, vollständig bekleidet. Oppenheimer stürzte zum Fenster und riss es mit einem Ruck auf.
Kühle Luft wehte ihm ins Gesicht. Im selben Augenblick hörte er schwere Motoren über ihr Haus hinwegdröhnen und das schrille Pfeifen fallender Bomben.
Es war, als seien sie unter einen D-Zug geraten. Draußen wütete ein ohrenbetäubendes Inferno. Detonation folgte auf Detonation. Am Himmel konnte Oppenheimer mit bloßem Auge erkennen, wie sich die Konturen der Flugzeuge vor die grauen Wolken schoben. Wenn sie so tief flogen wie jetzt, konnte auch die Flak nichts dagegen ausrichten. Doch Oppenheimer hatte keine Zeit, sich weiter darum zu kümmern. Er packte Lisa unter den Achseln und zerrte sie zum Fenster. Außer sich vor Entsetzen schlug er ihr auf die Wangen.
Plötzlich öffnete Lisa ihre Augen und atmete mit einem Seufzer tief ein. Oppenheimer hielt sie fest, spürte, wie sich ihr Körper verkrampfte, als sie das Gas aushustete.
2
Sonntag, 7. Mai 1944
Im Judenhaus war es in den letzten Monaten leer geworden. Das erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass die übriggebliebenen Mieter bald wieder in neue, noch engere Behausungen umziehen mussten. Die ehemaligen Mitbewohner waren nacheinander verschwunden, der Schaufensterdekorateur Schwartz, der genau wie Oppenheimer ebenfalls mit einer Arierin verheiratet war und ständig Zeichnungen gekritzelt hatte, die Familie Lewinsky mit den vier Kindern, der distinguierte Anwalt Dr. Kornblum, der sich liberal nannte und weder für das Reformjudentum noch für die Orthodoxie Verständnis zeigte und direkt neben den strenggläubigen chassidischen Eheleuten Jacobi wohnen musste, die ihm mit ihren ewigen Gebeten furchtbar auf die Nerven gegangen waren. Fort war auch der proletarisch angehauchte Glasbläser Franck, der stets große Vorbehalte gegen Ostjuden gehegt hatte. Sie alle hatten nach ihrer Evakuierung durch die Gestapo Leerstellen in dem Gebäude hinterlassen, zugesperrte Räume, die man nicht mehr betreten durfte.
Natürlich war das Wort Evakuierung, das die Behörden offiziell für die Abtransporte verwendeten, nichts weiter als Schönfärberei. Es ging keineswegs darum, Juden wie die Lewinskys oder Jacobis vor den Bomben in Schutz zu nehmen, die auf Berlin herunterprasselten, vielmehr hatte man sie weit in den Osten ins KZ verfrachtet. Oppenheimers Nachbarn wussten aufgrund der kursierenden Gerüchte, dass ihnen der Tod so gut wie sicher war. Doch bis zuletzt, wenn die Gestapo kam, um sie in einen Zugwaggon zu verfrachten, wollten sie die Hoffnung nicht aufgeben, dass die geflüsterten Schrecken übertrieben waren, dass es ihnen irgendwie gelingen würde zu überleben. Sicherlich würde die Gestapo auch bald Dr. Klein abholen. Da seine arische Ehefrau vor einer Woche verstorben war, stand er nicht länger unter dem Schutz der Mischehe. Doch Dr. Klein hoffte, aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nach Theresienstadt zu kommen, was allgemein als weniger schlimm galt. Nicht mehr lange, und auch sein Zimmer würde leer sein.
Und nun hätte beinahe auch Lisa in diesem Haus auf tragische Weise eine klaffende Lücke hinterlassen.
»Ich hab wohl vergessen, das Gas unter dem Wasserkessel anzuzünden«, murmelte sie benommen. »Die ganze Aufregung mit Richard … wollte mir einen Muckefuck machen.«
»Zum Glück wurde das Gas wegen dem Fliegeralarm abgestellt, sonst hätte das böse enden können, Frau Oppenheimer«, sagte Dr. Klein. Er packte seine Utensilien wieder in den abgewetzten Arztkoffer. Oppenheimer blickte grübelnd auf die zwei roten Stempelkarten der Gestapo, die auf der gegenüberliegenden Tür klebten. »Leider ist die Familie Lewinsky nicht mehr da. Sonst hätten sie den Gasgeruch sicher bemerkt.«
Dr. Klein musterte Lisa, die am Tisch saß. Der Kessel begann zu pfeifen. Auf Dr. Kleins Anweisung hin hatte Oppenheimer Wasser aufgesetzt.
»So, ich glaube, jetzt brauchen Sie wirklich einen Muckefuck. Oder, warten Sie …« Verstohlen fingerte Dr. Klein in seinem Koffer herum und zauberte urplötzlich Kaffeebohnen hervor. »Hier, um Ihren Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Das ist besser als der olle Ersatzkaffee«, bemerkte er.
Die Wirkung war ähnlich, als hätte er einen Klumpen Gold auf die Tischplatte fallen lassen. Für einige Sekunden war sogar Lisas Unglück vergessen, denn sie waren viel zu sehr damit beschäftigt, bestürzt auf die Kaffeebohnen zu starren. Lebensmittel wie Fleisch, Eier oder Milch waren rationiert und wurden vornehmlich an Reinblütige abgegeben. Mangelwaren wie zum Beispiel Tomaten oder Blumenkohl waren für Juden verboten. Von den Bewohnern des Judenhauses bekam nur Lisa gelegentlich ein paar Gramm arischen Kaffee zugeteilt. Er wurde vor allem als Sonderration nach schweren Angriffen verteilt, weswegen sich bald der Begriff Bombenkaffee eingebürgert hatte. Trotz ihrer belebenden Wirkung waren die schwarzen Bohnen offenbar ein wirksames Mittel, um die Bevölkerung ruhigzustellen.
Als Oppenheimer die Kaffeebohnen mahlte, fragte er sich, wo der Doktor wohl seine geheimen Verstecke hatte. Bei dessen ausladender Leibesfülle sprach viel dafür, dass er irgendwo Lebensmittel hortete, doch weder die Aufmerksamkeit der Mitbewohner noch die Plünderungen der Gestapo hatten bislang auch nur einen Krümel seines Vorrats zutage fördern können.
»Seit ich hier wohne, haben wir schon viele Abgänge gehabt«, bemerkte Dr. Klein. »Als Arzt schmerzt es mich natürlich, Sie verstehen schon, hippokratischer Eid und so weiter. Andererseits kann ich es aber auch verstehen, wenn jemand in unserer Situation sein Ableben selbst in die Hand nimmt. Jedoch sollte das nicht aus Versehen passieren.«
Vielsagend zwinkerte er Lisa zu. Wollte er andeuten, dass sie den Gashahn vorsätzlich aufgedreht hatte, um sich selbst zu töten? Oppenheimer war sich nicht sicher.
Lisa ignorierte die Anspielung des Doktors und nippte an dem dampfenden Getränk, das Oppenheimer vor sie hingestellt hatte.
»Ich bin schon wieder in Ordnung«, murmelte sie. »Wir brauchen neuen Sand gegen die Brandbomben, Richard hat ihn ausgeschüttet. Und dann muss der alte Schlesinger auch etwas wegen der kaputten Fensterscheibe tun.«
Als sie Anstalten machte, sich zu erheben, legte Klein seine Hand auf ihre Schulter. »Sie müssen sich jetzt ausruhen, Frau Oppenheimer. Ich sage dem alten Schlesinger Bescheid. Sie bleiben wohl besser hier, Herr Oppenheimer.« Ein verräterisches Blitzen erschien in seinen Augen. Oppenheimer verstand. »Müssen Sie diesen« – Oppenheimer suchte nach dem passenden Wort – »Vorfall melden?«
»Wenn mich unser Herr Hauswart nicht fragt, werde ich auch nicht lügen müssen. Aber wundern Sie sich nicht über die Gasrechnung, die Sie bekommen werden. An Ihrer Stelle würde ich ohne Kommentar bezahlen.«
Nachdem sich der Doktor verabschiedet hatte, legte Oppenheimer seinen Arm unbeholfen um Lisa. Er hatte ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber, da sie nur wegen ihm in diese Lage geraten war. Aber es waren nicht nur Gewissensbisse, die Oppenheimer plagten. In den letzten Jahren hatte sich die Furcht in ihre Liebe geschlichen. Oppenheimer wusste, dass diese Situation für Lisa nicht neu war, sie sorgte sich schon immer um ihn. Schließlich hatte er bei der Kripo allzu häufig mit zwielichtigen Gestalten zu tun gehabt. Doch erst seit die Bombardierungen begonnen hatten und sich auch Lisa in steter Lebensgefahr befand, konnte Oppenheimer verstehen, was sie die ganzen Jahre über durchgemacht hatte. Wenn er und Lisa nicht zusammen waren, lauerte in ihren Gedanken stets die Angst, dass dem jeweils anderen etwas zustoßen könnte.
»Wo bist du gewesen?«, fragte sie.
»Es war nichts. Eine Morduntersuchung, Routinekram«, beschwichtigte Oppenheimer.
»Aber du bist nicht mehr bei der Kripo.«
»Tja, ich weiß nicht, was sie wollen. Ausgerechnet von mir. Es ist wirklich verrückt, aber so wie es aussieht, brauchte mich die SS als Berater.«
Bei der Erwähnung der SS fuhr Lisa zusammen. Panik spiegelte sich in ihrem Blick.
»Es ist halb so wild«, versuchte Oppenheimer, sie zu beruhigen. »Sie haben mich ja wieder laufenlassen.«
»Du musst abtauchen«, drängte Lisa, »sofort. Du darfst hier nicht mehr übernachten. Sonst erwischen sie dich.«
»Die werden nicht mehr kommen.«
»Das ist zu unsicher. Geh zu Hilde. Ich muss später sowieso noch zu Hinrichs. Ich hatte Eva versprochen, vorbeizuschauen.«
»Du hast doch gehört, was Dr. Klein gesagt hat«, redete Oppenheimer ihr zu. »Du solltest nicht zu Hinrichs gehen, du musst dich ausruhen. Ich kann dich jetzt nicht allein lassen. Ich muss Hilde schließlich nicht an jedem Sonntag besuchen.«
Lisa schüttelte den Kopf. »Du verstehst nicht. Sie hat uns doch schon mal geholfen. Sie soll was für dich tun. Du hast gesagt, sie hat Verbindungen. Sie kennt Leute im Untergrund. Es ist zu gefährlich, wenn jetzt schon die SS anrückt. Du musst untertauchen!«
Oppenheimer widerstrebte diese Vorstellung zunächst, doch schließlich musste er sich eingestehen, dass Lisa recht hatte. Hilde war jetzt seine einzige Hoffnung. »Nun ja, vielleicht ist es möglich, da etwas zu organisieren. Aber es ist nicht nötig.«
»Richard, versprichst du mir, abzutauchen?«
Oppenheimer grummelte unverständlich vor sich hin. Er hasste es, wenn Lisa ihm ein Versprechen abverlangte. Das war ihre Art, Befehle zu geben.
Es war gut, am Wochenende dem Judenhaus zu entfliehen. Obwohl Oppenheimer und Lisa an sich eine harmonische Ehe führten, hatte sich herausgestellt, dass die Enge ihrer Behausung ein Belastungsfaktor war. Aus diesem Grund hatte es sich mit der Zeit so eingespielt, dass jeder am Sonntagnachmittag für ein paar Stunden seiner Wege ging.
Lisa begleitete Oppenheimer nur selten, wenn er Hilde besuchte. Er wusste, dass ihm eine andere Ehefrau wohl kaum erlaubt hätte, sich jeden Sonntag unbeobachtet mit einer Freundin zu treffen. Obschon Lisa ohnehin nie zu Eifersüchteleien geneigt hatte, war auffällig, wie gelassen sie reagierte. Oppenheimer konnte über die Gründe nur spekulieren. Möglicherweise lag es daran, dass Hilde gute zehn Jahre älter war als er und deswegen von Lisa nicht als Konkurrentin eingestuft wurde. Vielleicht spielte dabei auch eine Rolle, dass sie auf diese Weise die Gewissheit besaß, dass er in Sicherheit war. Hilde hatte wiederholt bewiesen, dass man auf sie zählen konnte.
Oppenheimer wiederum hatte Lisa in den letzten Jahren immer dazu ermutigt, ihren eigenen Bekanntenkreis zu pflegen, da er sie nicht zu sehr von sich abhängig machen wollte. Er konnte nicht ausschließen, dass die Gestapo ihn irgendwann abtransportieren würde. Zu viele Juden in einer Mischehe waren bereits umgebracht worden, als dass man sich darauf verlassen konnte, durch den arischen Partner geschützt zu sein.
Als Oppenheimer schließlich Hut und Mantel genommen hatte, um zu gehen, zögerte er. Schließlich holte er aus der Innentasche seines Mantels ein Medikamentenröhrchen hervor.
»Hier, nimm das«, sagte Oppenheimer und drückte Lisa eine seiner Pervitin-Tabletten in die Hand.
Lisa stutzte. »Aber du brauchst sie doch …«
»Ich habe noch genug für eine Weile«, flunkerte Oppenheimer und umarmte sie zum Abschied. Es widerstrebte ihm, Lisa wieder loszulassen, doch er musste fort.
Bevor sich Oppenheimer durch die Haustür wagte, nahm auch er eine Pervitin-Tablette. Da er kein Wasser hatte, zerkaute er sie und schluckte sie hinunter. Wenn sich Oppenheimer nicht gerade um Lisa sorgte, konnte er sonst kaum noch etwas fühlen. Zu vieles war in den letzten Monaten geschehen. Todesfälle gehörten mittlerweile zum Alltag. Selbst das eigene Schicksal ließ sich kaum beeinflussen. Doch er wusste, dass in knapp einer halben Stunde die Wirkung des Pervitins einsetzte, und dann konnte ihm nichts mehr etwas anhaben. Eine Tablette gab ihm die nötige Energie, um es durch den Tag zu schaffen. Da die Wirkung nach mehreren Monaten des regelmäßigen Konsums allmählich nachließ, hätte Oppenheimer eigentlich die Dosis erhöhen müssen, doch aufgrund seines knappen Vorrats gestattete er sich nur eine Tablette pro Tag.
Derart gestärkt trat er auf den Gehsteig hinaus. Brandgeruch drang in seine Nase. Das Licht war diesig, der Himmel schwefelgelb verhangen. Obwohl es erst zwei Uhr nachmittags war, schien es im Osten vorzeitig Nacht geworden zu sein, da schwarze Rauchwolken die Innenstadt verhüllten.
Oppenheimer überlegte kurz, ob es sinnvoll war, mit der Tram oder mit der U-Bahn zu Hilde zu fahren. Doch dann verwarf er diesen Gedanken. Nach dem heutigen Angriff waren die Abfahrtszeiten zweifelsohne völlig durcheinandergeraten. Um bis zu Hildes Haus zu gelangen, brauchte er zu Fuß knapp zwei Stunden. Also schlenderte er wie bei einem sonntäglichen Spaziergang über die Hansabrücke in Richtung der Siegessäule.
In der Regel reagierten die Passanten nur selten unfreundlich, sobald sie den Davidstern erspähten. Manchmal nickten sie sogar verständnisvoll. Vor Kindern und hundertfünfzigprozentigen Nazis musste man jedoch auf der Hut sein. Die Gestapo hatte sich merkwürdigerweise in den letzten Monaten still verhalten und schien die verbliebenen Juden in der Stadt zu ignorieren. Obwohl es wahrscheinlich daran lag, dass die Gestapo-Männer seit der Luftoffensive der Alliierten wichtigere Probleme hatten, fiel es Oppenheimer schwer, diesem Frieden zu trauen.
In der Zeit davor hatte die Gestapo noch mit eiserner Hand durchgegriffen. Auch Oppenheimer war nicht davon verschont geblieben. Vor knapp zwei Jahren hatte ihn einer der sogenannten Hundefänger der Gestapo in der U-Bahn erwischt und mitgenommen, um seine Personalien zu prüfen. Damals hatte Oppenheimer aus Trotz beschlossen, diese ganze Chose nicht mehr mitzumachen. Er hätte wie so viele andere zum Reichssippenamt des Innenministeriums pilgern können, beladen mit alten Photographien, Familienurkunden und anderen Unterlagen, um irgendwie nachzuweisen, dass die Familienähnlichkeit nicht sonderlich ausgeprägt war. Wenn man ein sogenanntes Kuckuckskind war, oder besser noch adoptiert, konnte man hoffen, als Halb- oder Vierteljude eingestuft zu werden. Doch Oppenheimer hatte dies gar nicht erst in Erwägung gezogen, sondern stattdessen eine Möglichkeit gesucht, um sich unauffällig des Judensterns zu entledigen.
Als er sich nun der Siegessäule näherte, war für ihn der Moment gekommen, um sein ganz persönliches Arisierungsverfahren zu vollziehen.
Am Großen Stern bog er nach links ab. Generalbauinspektor Albert Speer hatte zusammen mit dem gigantischen Pfeiler auch gleich das Bismarckdenkmal hierher versetzen lassen. In Bronze gegossen, stand der erste deutsche Reichskanzler abseits des Kreisverkehrs auf seinem roten Granitpodest, flankiert von den Statuen seiner ranghöchsten Militärs Roon und Moltke. Jeder dieser Feldherren hatte seinen eigenen Erker bekommen, der durch eine halbhohe steinerne Mauer von der umliegenden Parkanlage abgegrenzt wurde. Heute wählte Oppenheimer das Denkmal von Albrecht Graf von Roon aus.
Nachdem er sich vergewissert hatte, dass ihn niemand beobachtete, begann er, gemächlich den Sockel zu umrunden, schaute hinauf zum Grafen, dessen starres Antlitz mit den dämonischen Augenbrauen und dem spitzen Bart an einen Provinzschauspieler in der Rolle des Mephistopheles erinnerte, hätte der Porträtierte nicht eine Prunkuniform getragen und den Helm lässig auf seine Hüfte gestemmt. Die Rückseite des Sockels war breit genug, um sich dahinter zu verbergen. Mit einem herzhaften Ruck entfernte Oppenheimer den provisorisch angenähten Judenstern und steckte ihn in seine Innentasche. In Berlin taten dies viele Sternträger, weil sie wussten, dass sie von der Anonymität der Großstadt geschützt wurden.
Als er wieder hinter dem Denkmal hervortrat, hätte niemand auf diesen Herren mittleren Alters geachtet, denn ohne den Stern war Oppenheimer perfekt getarnt. Keiner sah ihm an, dass er eine Kennkarte hatte, auf der ein großes J für Jude stand, und dass er seit ein paar Jahren zwangsweise den zusätzlichen Vornamen Israel trug. Jeder Passant hätte geschworen, dass Richard Israel Oppenheimer nichts anderes sein konnte als ein waschechter Arier.
Oppenheimers Verhältnis zum jüdischen Glauben war schon seit frühester Jugend ambivalent. Obwohl seine Eltern auf Religion keinen großen Wert gelegt hatten, feierte selbstverständlich auch er mit dreizehn Jahren die Bar Mizwa. Die Zeremonie in der Synagoge, bei der jüdische Knaben die religiösen »Pflichten eines Mannes« übernehmen und Vollmitglieder der Gemeinde werden, gefiel dem jungen Oppenheimer; dass er aus diesem Anlass vor der versammelten Gemeinde aus der Tora vorlesen durfte, gefiel ihm sogar noch viel mehr. Doch als er in den vorangegangenen Monaten Gottes sechshundertdreizehn »ernste Verpflichtungen und unausweichliche Lasten«, die Mizwot, lernen musste, rebellierte er. Vielleicht sah er in einigen dieser Vorschriften keinen Sinn, vielleicht war ihm die Einhaltung der Mizwot auch nur zu umständlich – Oppenheimer konnte es sich im Nachhinein selbst nicht genau erklären. Jedenfalls wurde aus den Zweifeln Skepsis und aus der Skepsis später Abneigung gegen jegliche Art von Religion. Oppenheimer war ein geborener Zweifler, der zu viel gesehen hatte, um noch an die Existenz eines Gottes glauben zu können.
Als er beim Potsdamer Platz angelangt war, konnte er erkennen, wo die heutige Bombardierung die größten Schäden hinterlassen hatte. Da parallel zur Saarlandstraße eine undurchdringliche Rauchwand in der Luft hing, folgerte er daraus, dass wohl vor allem die Wilhelmstraße betroffen war.
Am Anhalter Bahnhof liefen aus der Richtung des Hochbunkers Frauen auf die Brände zu. Mit Kopftüchern und geschulterten Spaten marschierten sie paarweise in einer langen Reihe. An ihrer Kleidung konnte Oppenheimer einen blauen Aufnäher mit dem weißen Schriftzeichen Ost erkennen – es handelte sich also um Ostarbeiterinnen.
Vor knapp drei Wochen, als sich Hitlers Geburtstag jährte, der überall in Deutschland wie gewöhnlich mit großem Pomp und Trara begangen wurde, hatte die Furcht der Berliner Bevölkerung ihren Höhepunkt erreicht. Wie vom Propagandaministerium verordnet, hingen an diesem Tag unzählige rote Hakenkreuzflaggen aus den Fenstern. Einige Scherzbolde hatten sogar die zahlreichen Schutthaufen mit roten Papierfähnchen geschmückt. Doch kaum jemand nahm Notiz davon, wie sie im Wind raschelten, denn die Straßen waren längst leer. Wer immer es sich leisten konnte, hatte sich in überfüllte Züge gequetscht, um dem befürchteten Luftangriff zu entkommen. Es zeigte sich jedoch, dass sich die Strategen in den Hauptquartieren der Royal Air Force anscheinend nicht um Petitessen wie des Führers Wiegenfest kümmerten. Das Geburtstagsgeschenk in Form von mehreren Tonnen Explosivstoff blieb aus, und so war der Tag entgegen aller Erwartung ruhig verlaufen.
Der große Schlag folgte dann am Samstag vergangener Woche.
Als Oppenheimer die Halle des Anhalter Bahnhofs durchquerte, sah er, welch große Fortschritte die Aufräumarbeiten seitdem gemacht hatten. Es war kaum noch zu erkennen, dass während des Luftangriffs ein führerloser Schnellzug in vollem Tempo und mit brennenden Waggons auf den Kopfbahnhof zugehalten hatte. Wie ein flammendes Geschoss war der Zug in die Bahnhofshalle gerast, hatte dabei den Prellbock durchschlagen und den Bahnsteig vor den Gleisen umgepflügt. Doch die Überreste des Zuges hatte man bereits wieder entfernt und die klaffende Schneise im Pflaster mit neuen Steinen abgedeckt.
Am Ausgang zur Möckernstraße musste sich Oppenheimer durch eine Menschentraube drängen. Unter den Steinbögen des Vordaches standen die Ausgebombten, bei sich die Habseligkeiten, die sie während des letzten Angriffs aus ihren zerstörten Wohnungen hatten retten können. Kinder, die vor Schreck verstummt waren, unzählige Koffer und Taschen, dazwischen ein Greis in einem Schaukelstuhl – ein Panoptikum privater Katastrophen.
»Die Vergeltung musste ja kommen.« Apokalyptische Inbrunst schwang in der Stimme des Alten. »War doch klar, die Engländer lassen Coventry nich auf sich sitzen.«
»Lass sein, Vater«, beschwichtigte seine Tochter und blickte sich verstohlen nach Denunzianten um. Sicherheitshalber fügte sie noch hinzu: »Weiß doch jeder, dass die Engländer mit dem Bombenschmeißen angefangen haben.«
Ein Passant mit grauem Filzhut versuchte, in den Bahnhof zu gelangen. »Also bitte, meine Herrschaften! Hier müssen auch noch Leute durch! Vielen Dank.«
»Warten Sie nur ab, bis unsere Roboter-Flugzeuge angreifen«, sagte ein vielleicht zwölfjähriger Pimpf. Stolz prangte auf seiner Brust das kreisförmige Abzeichen des Deutschen Jungvolks. »Sie werden schon sehen, wie wir zurückschlagen.«
»Hoffentlich wird unsere Wunderwaffe bald fertig«, sekundierte ein weiterer Junge mit dem gleichen Abzeichen. »Wird langsam Zeit, es den Schweinehunden zu zeigen.«
»Jetzt redet keenen Kohl«, ereiferte sich der Alte. »Ihr habt doch jesehn, wat passiert is. Diese Terrorbomber kommen jetzt schon bei Tag. Bei Tag! Womit sollen wir denn gegenhalten?«
»Unsere Jäger konnten doch nicht hoch, wegen den Wolken«, erklärte einer der Pimpfe fachmännisch.
Wieder wollte der Alte etwas sagen, als ihn seine Tochter sanft, aber bestimmt zurück auf die Sitzfläche des Schaukelstuhles drückte. »Jetzt sei aber still!« Unsicher blickte sie zu den Jungen hinüber, als wolle sie sich für die Äußerungen des Alten entschuldigen. Doch dieser ließ sich nicht den Mund verbieten.
»Mir kann keener mehr wat. Is eh alles futsch! Alles!«
Dies war das Letzte, was Oppenheimer von dem Streit vernahm. Es gab genügend Leute, die einen Groll gegen Hitler hegten. Hilde hatte berichtet, dass man sich im Ausland zunehmend darüber wunderte, dass die Bombardierungen nicht den Widerstandsgeist des deutschen Volkes geweckt hatten. Es wurde gemeckert, doch weiter ging es nicht.
Hildegard von Strachwitz besaß ein großes Wohnhaus am Rand von Schöneberg. Ihr Onkel, ein Offizier der kaiserlichen Marine, hatte es um die Jahrhundertwende errichten lassen. Der kinderlose Mann hatte Hildegard als Alleinerbin eingesetzt, da sie sich in den letzten Jahren aufopferungsvoll um dessen Pflege gekümmert hatte und ohnehin die einzige Verwandte war, die sich von der zunehmenden Schrulligkeit des Alten nicht abschrecken ließ. Dass sie Ärztin war und eine gewisse Übung im Umgang mit schwierigen Menschen besaß, war ihr dabei zweifelsohne zugutegekommen. Von der Zeit davor wusste Oppenheimer lediglich, dass Hilde verheiratet war. Doch die Ehe verlief unglücklich und wurde bereits nach wenigen Jahren geschieden, woraufhin sie wieder ihren Mädchennamen angenommen hatte.
Neben dem imposanten Wohnhaus gab es auf Hildes Anwesen noch zwei kleinere Gebäude, die der Onkel erst nachträglich errichtet hatte. Es handelte sich dabei um eine Garage und ein separates Haus für den Chauffeur. Da Hilde weder für ein Auto noch für einen Chauffeur Verwendung fand, hatte sie vor etwa zehn Jahren darin ihre Arztpraxis eingerichtet. Doch weil sie nach Ansicht der Nationalsozialisten über mehr als genügend Platz verfügte, wurden in den letzten Monaten im großen Wohnhaus ausgebombte Familien einquartiert. Daraufhin hatte sie kurzerhand ihre Sachen gepackt und war in ihre Arztpraxis umgezogen.
Oppenheimer registrierte mit Erleichterung, dass Hildes Grundstück den heutigen Angriff unbeschadet überstanden hatte. Wie üblich bog er in die kleine Seitengasse ein, wo er unbeobachtet das hintere Tor benutzen konnte. Er hatte sich schon oft gefragt, woher Hilde den Mut nahm, sich allein mit ihm zu treffen. Schließlich drohte ihnen ein Prozess wegen Rassenschande, wenn jemand herausbekam, dass Oppenheimer ein Jude war. Doch Hilde kümmerte sich nur selten um die Vorschriften der nationalsozialistischen Herrscher.
Als Oppenheimer auf Hildes Arztpraxis zusteuerte, torkelte ihm eine Frau entgegen, die vielleicht Anfang dreißig war. Kaum war sie bei ihm angelangt, als sie auch schon stolperte und sich an seinem Arm festkrallte.
»Huch!«, rief sie vergnügt. »Die Stufe war vorhin noch nich da.«
Soweit Oppenheimer erkennen konnte, war auch jetzt keine Stufe vorhanden.
»Jessas! Sagen Se nich, dasse’s von mir ham, aber das Zeugs von Ihrer Ärztin ist viiiiel besser als der Markenschnaps.« Nach dieser Bemerkung schwankte sie zum Gehweg hinüber. Oppenheimer war viel zu überrumpelt, um auf die Idee zu kommen, ihr behilflich zu sein. Stattdessen betätigte er die Türklingel.
Als sich unmittelbar darauf die Pforte öffnete, stand sie vor ihm. Obwohl Hilde um diese Zeit nicht auszugehen pflegte, war sie wie üblich dezent geschminkt und hatte ihr Haar tadellos onduliert. Zwar wurde ihr Körper mit fortschreitendem Alter allmählich plump, was sie mit der Wahl ihrer adretten Kleidung halbwegs kaschieren konnte, doch ihre würdevolle Erscheinung war nach wie vor vom Zahn der Zeit verschont geblieben. Jeder Zentimeter von Hilde machte dem Betrachter klar, dass hier eine Dame von Welt stand. Obschon sie in ihrem Leben bereits vieles erlebt hatte, weiteten sich bei Oppenheimers Anblick ihre Augen.
»Verfluchte Scheiße, du siehst wirklich zum Kotzen aus«, entfuhr es ihr.
3
Sonntag, 7. Mai 1944
Zu behaupten, dass Hilde wie ein Rohrspatz zu schimpfen pflegte, wäre eine grobe Untertreibung gewesen. Vielmehr ähnelten ihre verbalen Ausfälle eher denen eines vierschrötigen Matrosen. Oppenheimer wurde nervös. Unvermittelt hatte ihn die Misslichkeit seiner Lage wieder eingeholt. »Vielleicht kann ich in der nächsten Zeit nicht mehr vorbeikommen.«
Hilde hielt kurz inne, dann zog sie ihn hinein. »Leg erst mal ab.«
Mutlos betrat Oppenheimer das kleine Behandlungszimmer. Er hängte Hut und Jacke an die Garderobe und folgte dann Hilde durch eine weitere Tür in ihre höhlenartige Behausung. Dass im privaten Teil der Chauffeurswohnung praktisch jeder freie Zentimeter dazu genutzt wurde, um zahllose Bücher zu verstauen, machte sie nur noch enger. Sogar die Fenstersimse quollen von Papier über.
Es war keineswegs nur Fachliteratur zur Medizin, die sich hier türmte. Ein halbwegs literaturkundiger Nationalsozialist hätte in Hildes Wohnung wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen, denn ein Großteil ihrer Sammlung bestand aus Büchern, die seit einigen Jahren als undeutsch galten. Die Schriften von Kurt Tucholsky befanden sich in Nachbarschaft von Erich Maria Remarques Romanen, die Traktate von Karl Marx standen neben den wissenschaftlichen Werken Albert Einsteins, Kafka traf auf Hemingway, Kästner stand in trauter Eintracht neben Maxim Gorki – alles Bücher, die nationalsozialistische Studenten wenige Jahre zuvor auf dem Opernplatz in die Flammen der nächtlichen Scheiterhaufen geworfen hatten.
Erbost über die Dreistigkeit der Bücherverbrennungen, hatte Hilde sofort damit begonnen, sogenanntes zersetzendes Schrifttum zu sammeln. Und halbe Sachen machte sie nicht. Hilde wollte ein Zeichen setzen, wollte die geächtete Literatur für spätere Generationen aufbewahren und die in Druckerschwärze geronnenen Gedanken konservieren, damit die Autoren in Zukunft wieder aus den Buchseiten zu den Lesern sprechen konnten. Fast kam es Oppenheimer so vor, als bildeten die vielen Bücher an den Wänden eine Art ideologische Palisade, die Hildes Gemüt gegen den Irrsinn abschirmte, der draußen tobte. Jedenfalls hatten in dieser kleinen Wohnung die Werke der verfemten Autoren ihre Zufluchtsstätte gefunden, und Hilde war ihre Schutzheilige.
Oppenheimer wollte sich auf dem Besuchersessel niederlassen, als er etwas unter seinem Hinterteil spürte. Er schreckte hoch.
»Oh, das hatte ich ja völlig vergessen«, sagte Hilde und griff nach der Zeitschrift, die auf der Sitzfläche lag. »Ich bin beim Umräumen.«
»Wegen der Besucherin vorhin?«
»Dir ist das hirnlose Wesen begegnet? Pah, diese olle Nazisse hab ich hier nicht reingelassen.«
Hilde legte die Zeitschrift auf einen Stapel und ging in die Küche. Oppenheimer saß verloren in dem viel zu großen Sessel. Die Stille, die entstand, sobald Hilde aus dem Zimmer war, hatte für ihn etwas Bedrückendes. Also versuchte er halbherzig, Konversation zu machen.
»Es ist nicht gerade nett, jemanden so zu nennen«, rief er ihr hinterher.
»Also bitte, diese Trine war von der NS-Frauenschaft«, erwiderte Hilde. »Jetzt sag mal, was hältst du von einer Dame, die ihre Kinder Adolf, Joseph und Hermann nennt? Genau in dieser Reihenfolge.«
»Alles gute deutsche Namen.«
Hilde erschien im Türrahmen. Obwohl die Chancen verschwindend gering waren, dass sie ausgerechnet hier von den Nachbarn belauscht wurden, wisperte sie: »Ja, das sind Namen von guten deutschen Arschlöchern. Hirnlosigkeit ist wirklich noch das Netteste, was man ihr unterstellen kann.«
Oppenheimer wusste, dass Hilde es sich manchmal gern einfach machte. »Ich kenne einen Juden mit dem Vornamen Adolf«, versuchte er, sie aus der Reserve zu locken. »Er war jahrelang beim Militär. Keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Vielleicht hat er ja seinen Vornamen ändern müssen.«
»Er war nicht zufällig Gefreiter und wohnt gerade in der Reichskanzlei?«
Oppenheimer winkte ab. Es war zwecklos. Er wusste nicht, wie sie es anstellte, aber Hilde schien ihm immer zwei Schachzüge voraus zu sein.
»Was wollte sie von dir?«
Hilde kam mit einem Glas und einer Zigarettenschachtel zurück. »Das war das Beste. Sie hat den Auftrag, die gesamte Nachbarschaft zu durchkämmen und alle Frauen, die nicht berufstätig sind, zum Arbeitseinsatz im Dienste der Volksgemeinschaft zu überreden. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Ehe ich meinen Rücken für die Nazis krumm mache, muss was anderes geschehen. Anstatt mit ihr zu diskutieren, habe ich die dumme Nuss lieber im Behandlungszimmer abgefüllt. So, wie sie zugelangt hat, wird sie sich morgen kaum noch an etwas erinnern.«
Oppenheimer musterte die halbleere Flasche, die Hilde ebenfalls zurückgebracht hatte.
»Schade um den Schnaps«, meinte Oppenheimer ohne großen Enthusiasmus.
»Tja, ich glaube, du hast ihn nötiger.« Sie füllte das Glas und schob es in seine Richtung. Oppenheimer starrte die Flüssigkeit an, als wüsste er nicht, ob sie ihm freundlich gesinnt war.
»Selbst destilliert. Findest nichts Besseres«, redete ihm Hilde zu. »Komm. Einen für Mutti …«
Schließlich überwand Oppenheimer seinen Abscheu und kippte den Inhalt des Glases in einem Zug hinunter. Als sich seine Augen unwillkürlich zu tränenden Schlitzen verengten, während sich Hildes Klarer seine Kehle hinabätzte, seufzte sie gespielt auf. »Dass du dich immer so anstellst. Na ja, wenigstens die Schnapsdrossel von vorhin wusste mein Zeug zu schätzen.«
Sie reichte Oppenheimer zwei Zigaretten. »Ich gebe sie dir wohl besser gleich. Hier.«
Dankbar nahm er sie entgegen. Sie pflegte ihm jeden Sonntag ein Paar zum Abschied mitzugeben. Oppenheimer kramte in der Jacke nach seiner Zigarettenspitze. Während er die Zigarette in den Halter steckte und entzündete, musterte Hilde ihn. »Vornehm geht die Welt zugrunde, was? So schlecht kann es dir eigentlich nicht gehen. Was ist überhaupt passiert?«
Nachdem Oppenheimer von seiner nächtlichen Exkursion mit dem Sicherheitsdienst berichtet hatte, leuchtete ihr Gesicht geradezu vor Aufregung. Psychologie war Hildes Steckenpferd, insbesondere die Erforschung des kriminellen Verstandes. Oppenheimer hatte schon vermutet, dass sie an dem Fall interessiert sein würde. Doch momentan nahm eine andere Frage ihre Aufmerksamkeit in Anspruch.
»Also, ich fress ’nen Besen«, sagte Hilde. »Warum, zum Teufel, muss ausgerechnet die SS diesen Mordfall aufklären?«
»Es kann nur bedeuten, dass diese Angelegenheit für die Partei sehr wichtig ist. Aber was genau dahintersteckt, keine Ahnung. Sie haben nichts rausgerückt.«
»Tja, was kann eine getötete Frau nur mit der Sicherheit des Staates zu tun haben?«
Die nächsten Minuten saßen sie schweigend da und überlegten. Als Oppenheimer den Rauch der zweiten Zigarette durch das Mundstück aus Meerschaum sog, fiel ihm auf, wie Hilde gierig den blauen Dunst einatmete.
»Sag mal, willst du dir nicht auch eine gönnen?«, fragte er.
»Nee, lass mal. Zu kostbar. Hast du eine Ahnung, was sich am Schwarzmarkt für einen Glimmstengel so alles organisieren lässt? Ist besser als jedes Papiergeld. Da lebe ich lieber abstinent.«
»Jetzt machst du mir glatt ein schlechtes Gewissen.«
»Ach, ich habe noch genügend in Reserve. Also, Richard, ich weiß nicht, ob das klug ist.«
»Was meinst du?«
»Na ja, diese Idee, jetzt abzutauchen. Ich kann Lisa zwar verstehen, doch so, wie es aussieht, ist die SS bereits auf dich aufmerksam geworden. Wenn du jetzt einfach verschwindest, sind sie sofort alarmiert. Die haben sicher schon spitzgekriegt, wo du arbeitest.«
Der Führer oder die deutsche Volksgemeinschaft oder wer auch immer hatte beschlossen, dass selbst ein Jude wie Richard Oppenheimer die Kriegswirtschaft zu unterstützen hatte. Demzufolge musste auch er seit einigen Monaten in einem kleinen Betrieb als Maschinenputzer schuften.
»Vielleicht kommen sie ja nicht mehr und lassen mich in Ruhe«, wandte Oppenheimer ein.
»Dann gäbe es auch keinen Grund, abzutauchen.«
»Wir drehen uns im Kreis.« Er stöhnte. »Ich nehme an, du hast noch deine Kontakte?«
»Im Zweifelsfall bringe ich dich schon irgendwo unter, da gibt es sicher Möglichkeiten. Es ist nicht einfach, aber vielleicht verpassen wir dir am besten gleich eine neue Identität. Weißt du, bei den ganzen Ausbombungen müssen eine Menge neuer Personalausweise ausgestellt werden. Es ist den Ämtern schon lange nicht mehr möglich, alle Angaben zu kontrollieren. Wir müssten erst einmal bei einem Bezirksamt eine Ausbombung bescheinigen lassen. Mit etwas Glück springt für dich dabei sogar ein arischer Lebensmittelkartenersatz für einen Monat heraus. Wenn es gelingt, dich irgendwo bei den An- und Abmeldungen einzuschmuggeln, besteht sogar die Möglichkeit, dass du mit einem fingierten Namen zu vollgültiger Bürgerschaft kommst. Solange sie dich nicht gerade mit heruntergelassenen Hosen erwischen, werden sie nichts merken.«
»Und wenn es nicht funktioniert?«
»Dann wird dir nichts anderes übrigbleiben, als dich bei Privatleuten zu verstecken und keinen Mucks von dir zu geben. Und deine Unterkunft musst du dann auch ständig wechseln. Du wirst die ganze Zeit auf der Flucht sein. Ich hoffe, dass dir das klar ist.«
»Ich fürchte, ich habe keine andere Wahl«, entgegnete Oppenheimer trübsinnig.
Hilde überlegte kurz. »Also schön. Wir machen es folgendermaßen: Schlaf noch einmal über die Sache, während ich alles in Gang bringe. Abblasen können wir die Sache dann immer noch. In der Zwischenzeit musst du dich vorbereiten.«
»Die paar Sachen, die ich habe, sind bereits gepackt.«
»Wie sieht es bei der Arbeit aus?«
»Zwei Tage kann ich ohne ärztliches Attest schwänzen. Wenn es länger dauert, brauche ich eines von einem Vertrauensarzt.«
Hilde erwog die Optionen. »Hm, mit welchen Kollegen hast du einen engen Kontakt?«
»Da ist erst einmal Arnold. Ich hab dir schon mal von ihm erzählt, der Jude, mit dem ich zusammen die Maschinen putzen muss und der wie Siegfried höchstpersönlich aussieht. Und dann gibt es noch Ludovic. Er kommt immer, um mit uns zu reden, obwohl er es eigentlich nicht darf.«
»Ein Franzose?«
»Ja. Leider spricht er genauso schlecht Deutsch wie ich Französisch. Er ist ein junger Kerl aus Avignon, so viel hab ich herausbekommen. Ist dort zum Arbeitseinsatz eingezogen worden.«
»Ah, haben sie ihn nach Berlin gekarrt. Na bravo.« Hilde schüttelte kurz den Kopf. »Also gut. Dann spiele ihnen morgen ein paar Symptome vor. Am besten wären Gleichgewichtsstörungen, Atembeschwerden, so etwas in der Art. Lass dir was einfallen, aber übertreibe es nicht. Ich weiß doch, was für ein schlechter Schauspieler du bist. Komm morgen bei mir vorbei. Die anderen Dinge sollte ich bis dahin größtenteils abgeklärt haben.«