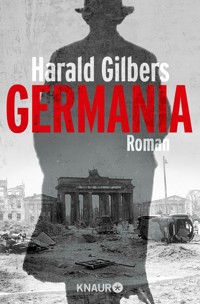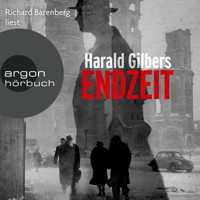9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kommissar Oppenheimer
- Sprache: Deutsch
Kommissar Oppenheimers dritter Fall: ein packender Zweiter-Weltkriegs-Krimi über die Atompläne der Nazis von Glauser-Preisträger Harald Gilbers. Berlin, Ende April 1945: Die letzten Tage des Dritten Reichs verbringen Kommissar Oppenheimer und seine Frau Lisa in einem Unterschlupf des Ganoven Ede. Doch in den chaotischen Wirren der Niederlage werden sie getrennt. Als Oppenheimer in Edes Auftrag einen verschwundenen Schuldner aufspüren soll, bekommt er unverhofft einen Hinweis auf Lisas Vergewaltiger, den russischen Deserteur Grigorjew. Er stößt auf ein Netz aus Lügen und Täuschungsmanövern, in dessen Zentrum ein Koffer mit brandgefährlichem Inhalt steht. Denn auch andere Mächte sind hinter Grigorjew her. Offenbar sollte er Material schmuggeln, das bei den Atomplänen der Nazis eine Rolle spielte. Und Oppenheimer weiß mehr von der Affäre, als er zunächst ahnt. "Historisch sehr akkurat, atmosphärisch dicht und zudem noch ungemein spannend." FAZ
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Harald Gilbers
Endzeit
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Berlin, Ende April 1945: Die letzten Tage des untergehenden Dritten Reiches verbringen Kommissar Oppenheimer und seine Frau in einem Unterschlupf. Dennoch wird Lisa, wie so viele andere Frauen, von einem russischen Soldaten vergewaltigt. Bei dem Täter soll es sich um einen Deserteur namens Grigorjew handeln. Als Oppenheimer dessen Spur verfolgt, stößt er auf ein Netz aus Lügen und Täuschungsmanövern, in dessen Zentrum ein Koffer mit brandgefährlichem Inhalt steht. Offenbar will Grigorjew Material über die Atompläne der Nazis schmuggeln. Und darum hat nicht nur ein Geheimdienst seine Hand im Spiel …
Inhaltsübersicht
Feuer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Asche
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Licht
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Epilog
Anhang
Glossar der sowjetischen Staatsorganisationen
Nachwort des Autors
Literaturhinweise
Teil 1
Feuer
1
BerlinFreitag, 20. April 194512 Tage vor der Kapitulation der Berliner Truppen
Seine Welt war auf wenige hundert Quadratmeter geschrumpft, doch Oppenheimer hatte in den vergangenen sechs Wochen gelernt, sich damit zufriedenzugeben. Der Horizont war nicht mehr als eine schnöde Kalksteinmauer, während der Himmel aus roten Backsteinen von Eisensäulen gestützt wurde.
Und hinter dieser Hemisphäre aus übereinandergeschichtetem Baumaterial wehte ein von Menschen entfesselter Feueratem. Der Gärkeller in den Katakomben der stillgelegten Brauerei war nicht unbedingt als Nachtlager für versprengte Menschen wie Oppenheimer und seine Frau Lisa gedacht, aber sie hatten keine Alternative. Obgleich er so umsichtig gewesen war, die improvisierte Kochstelle direkt unter einem seitlichen Luftschlitz zu errichten, hatten der Qualm und die Essensgerüche bereits nach wenigen Tagen den säuerlichen Gestank des Brauereibetriebs überdeckt. Jetzt war die Luft so dick, dass man sie schneiden konnte.
An dem künstlichen Himmelsrund in zehn Metern Höhe gab es weder Sonne noch Sterne, und so waren auch die Leuchtziffern seiner Taschenuhr keine große Hilfe. Die Ausrichtungen der Zeiger waren in Oppenheimers Vorstellung nur noch willkürliche Einteilungen, deren eigentlicher Sinn verlorengegangen war. Dafür gab es andere Indizien, an denen sich ablesen ließ, dass man jenseits des Kellers die Zeit noch in Tage einteilen konnte. Gelegentlich fiel ein heller Schimmer durch die Luftschlitze; der beste Hinweis auf einen beginnenden Tag war jedoch, wenn die Deckenlampen brannten. Oppenheimer ließ sie eingeschaltet, weil es Strom ohnehin nur noch sporadisch gab. Und wenn die Glühbirnen zur Abwechslung einmal aufleuchteten, konnte man davon ausgehen, dass es hinter den dicken Mauern früher Morgen war. Zu diesen Stunden war das Elektrizitätswerk in der Regel freigiebig mit den Stromzuteilungen. Die dunklen Phasen dazwischen waren in der letzten Zeit jedoch immer länger geworden.
Abends wiederum war die Stunde der Sirenen, deren Gejaule sogar bis in den Gärkeller drang. Wenn sie erklangen, fand draußen normalerweise der tägliche Angriff im Schutze der Dunkelheit statt.
Obwohl die Fundamente des Kellers sicher bald wieder unter der tödlichen Last der Bomber erzittern würden, fühlte sich Oppenheimer zwischen dem guten Dutzend Gärbottiche sicherer als inmitten einer verschreckten Menschenmenge in einem Betonbunker. Und erst recht war dieser Platz den verputzten Holzdecken des Judenhauses vorzuziehen, in dem er zwangsweise viele Jahre hatte wohnen müssen.
Die Sirenen und Fliegerbomben waren beileibe nicht mehr die einzigen Kriegsgeräusche. Seit einigen Tagen trug der Wind von Osten her das Grollen der Artillerie in die Stadt. Obgleich sich Oppenheimer danach sehnte, endlich von der Herrschaft der Nationalsozialisten befreit zu werden, fand er das anschwellende Toben der Kriegsmaschinerie beunruhigend. So ganz ohne Radio hatte er nicht einmal mehr einen Überblick, was an der Front vor sich ging.
Auch an diesem Morgen gab es Strom, und so wurde Oppenheimer von dem künstlichen Licht der Deckenlampen geweckt. Lisa schlief noch, wegen der feuchten Kälte war auch sie dick in Decken eingepackt, so dass man kaum die Konturen ihres Körpers erkennen konnte. Ihr Nachtlager aus zusammengeschobenen Holzkisten war besser, als auf dem Betonboden zu schlafen, komfortabel war allerdings beides nicht.
Oppenheimer stützte sich mit den Ellbogen auf den Holzkisten ab und setzte sich auf. Dann schälte er sich aus dem Kokon von Lumpenschichten und rieb mürrisch eine schmerzende Stelle an seinem Rücken. Wenige Augenblicke später kroch bereits die Kälte unter seine Anzugjacke, und er fröstelte.
Die Decke über seine Schultern gehängt, tappte Oppenheimer zur Feuerstelle, um Kohle nachzulegen. Beißender Rauch stieg ihm in die Augen, doch er war dankbar für die Wärme. Während einer seiner Expeditionen oben in der verlassenen Brauerei hatte er bei der Heizkesselanlage einige Reste der schwarzen Brocken aufgestöbert. Er musste sich zurückhalten, damit er nicht gleich mehrere Stücke ins Feuer warf. So kühl es auch sein mochte, sie mussten sparsam sein. Schließlich hatte niemand eine Ahnung, wie lange sie es hier unten noch aushalten mussten, bis der Kampf um die Stadt Berlin beendet war.
Plötzlich war Oppenheimer hellwach.
Er glaubte, etwas gehört zu haben.
Doch das konnte nicht sein, schließlich waren sie allein hier unten. Die Tür zur Klimaschleuse war geschlossen. Außerdem quietschten die Scharniere so laut, dass ihn die Geräusche sicher aufgeweckt hätten, falls jemand eingedrungen wäre.
Oppenheimer konnte diesen Gedanken kaum weiterverfolgen, als er erneut etwas hörte.
Es klingelte.
Der schrille Ton schien aus einer entfernten Ecke des Kellers zu kommen. Aber wegen der gewaltigen Gärbottiche drang nur ein ferner Widerhall an Oppenheimers Ohren.
»Telefon«, maulte Lisa. Als ihr bewusst wurde, was sie, noch halb im Schlaf, gesagt hatte, setzte sie sich überrascht auf und zog die Decken fester um sich zusammen.
Oppenheimer war ebenso verwundert. Er wusste nicht, was ihn am meisten erstaunte: dass es hier überhaupt ein Telefon gab oder dass jemand ausgerechnet diese Nummer gewählt hatte. Aufs Geratewohl ging er in die Richtung, aus der das Klingeln zu kommen schien.
Und tatsächlich, im Schatten eines Gärbottichs hing ein Wandapparat. In dem ewigen Halbdunkel war er Oppenheimer bislang nicht aufgefallen. Als er das Telefon endlich aufgespürt hatte, war das Geklingel bereits wieder verstummt. Nach einer Weile hörte er Lisas Schritte. Er spürte, wie sie über seine Schulter einen Blick auf das Gerät warf.
»Was meinst du«, flüsterte sie verschreckt, »wer kann das gewesen sein?«
Oppenheimer hatte keine Ahnung. Obwohl sie zweifelsohne allein im Keller waren, unternahm jemand von außen den Versuch, in diese Räume einzudringen.
War es ein Freund oder ein Feind?
Auch Lisa war sich der Gefahr bewusst. »Vielleicht sollten wir lieber nicht drangehen«, sagte sie. »Sonst wissen sie, dass wir hier unten sind.«
Natürlich, der Anrufer konnte durchaus jemand von der Gestapo oder vom SD sein, obgleich es nicht wahrscheinlich erschien, dass sie per Telefon nach untergetauchten Juden wie Oppenheimer fahndeten.
Unschlüssig räusperte er sich.
»Und wenn es Ede war? Eigentlich kann nur er die Nummer kennen.«
Um diesen weniger alarmierenden Gedanken zu bekräftigen, nickte Oppenheimer. Ede. Das musste es sein. Schließlich hatte der Gauner dafür gesorgt, dass sie hier in seiner geheimen Lagerstätte untergekommen waren. Der Schwere Ede, wie er in Verbrecherkreisen genannt wurde, und seine Helfershelfer wussten als Einzige, dass sich hier unten jemand befand. Und bestimmt kannten sie auch die Nummer des Telefonanschlusses.
»Dann muss es wichtig sein«, spann Lisa den Gedanken weiter. »Wenn Ede extra anruft.«
»Wahrscheinlich. Wenn es wichtig ist, wird er es sicher wieder versuchen. Aber …« Oppenheimer kam nicht dazu, den Satz zu beenden, denn unvermittelt begann das Telefon wieder zu vibrieren, und das aufdringliche Schrillen ertönte aufs Neue.
Er spürte einen Zwiespalt in sich, ob er wirklich den Hörer abnehmen sollte. Schließlich verfiel er auf die Idee, sich mit falschem Namen zu melden, um zu erfahren, wer am anderen Ende der Leitung war. Wenn es sich um Ede handelte, würde dieser Oppenheimers Stimme erkennen und die Finte durchschauen.
Nachdem er tief Luft geholt hatte, nahm Oppenheimer den Hörer ab und meldete sich mit dem erstbesten Namen, der ihm in den Sinn kam. »Hier bei Schulze.«
Aus dem Hörer drang ein solcher Radau, dass der Gesprächspartner den falschen Namen ohnehin nicht verstehen konnte. Im Hintergrund war das Lachen von Männern zu hören. Nein, sie lachten nicht, sondern johlten vor Ausgelassenheit.
»Hallo?«, fragte Oppenheimer verblüfft. Obwohl der Gesprächspartner wegen des Tumults direkt in die Sprechmuschel brüllte, konnte Oppenheimer die Worte nicht verstehen. Trotz allem begriff er sinngemäß, das der Iwan hier war.
»Iwan sdes!«, rief die rauhe Stimme und ratterte dann weitere russische Sätze herunter, von denen Oppenheimer nur so viel mitbekam, dass offenbar von einer faschistischen Bestie die Rede war. Anfang der zwanziger Jahre hatten in den Ortsteilen Charlottenburg und Schöneberg russische Sprachbrocken aufgrund der dort angesiedelten Emigranten zum Alltag gehört. Wenigstens konnte sich Oppenheimer noch an einige der aufgeschnappten Vokabeln erinnern. Dann schloss der Fremde mit dem Aufruf: »Smert nazistskowo wraga!« Er wünschte dem Nazifeind den Tod.
Reflexartig warf Oppenheimer den Telefonhörer auf die Gabel. Er wollte diese Stimme nicht so nahe an seinem Ohr haben. Er wusste, dass von ihr eine Gefahr ausging. Sie sollte nicht in den Gärkeller eindringen. Niemals.
Lisa starrte ihn fragend an. »Was ist?«
Oppenheimers Kehle fühlte sich plötzlich trocken an. Er schluckte und wusste zunächst nicht, was er antworten sollte.
Wozu sollte er das Offensichtliche auch noch aussprechen? Gestern hatten die Sirenen Panzeralarm gegeben. Die Stadt war seitdem im Daueralarmzustand, das Endspiel hatte begonnen. Das von Hitler entfesselte Inferno würde nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Nun war Realität geworden, worüber man seit der Winteroffensive der Roten Armee im Januar schon so häufig hinter vorgehaltener Hand gesprochen hatte. Unaufhaltsam bewegte sich von Osten her die Front auf sie zu. Nur wenige Kilometer von ihnen entfernt brachten zigtausend Tonnen Maschinerie, Waffen und Munition die Erde zum Beben. Der alles vernichtende Koloss würde erst zum Stillstand kommen, wenn das Ziel erreicht war: Berlins Regierungsviertel.
Lisas Blick drängte weiterhin nach einer Antwort, also sagte Oppenheimer mit einem Schulterzucken: »Die Russen kommen.«
Jeder bereitete sich auf seine eigene Weise auf den nahenden Untergang vor. Wem es irgendwie möglich war, der suchte sein Heil in der Flucht und versuchte, so weit wie möglich von der Hauptstadt fortzukommen, ehe die Falle endgültig zuschnappte und der Ring der russischen Truppen um die Stadt geschlossen war.
Nur der Fahrer am Lenkrad des altersschwachen Adler Trumpf fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Auch er befand sich in einem Rennen gegen die Zeit, denn er hoffte, in die Innenstadt zu kommen, rechtzeitig dort unterzutauchen, noch ehe die Rote Armee in die Stadt einfiel. Vielleicht war er verrückt, sich freiwillig der Gefahr auszusetzen, doch nur so konnte sein Plan aufgehen.
Er lenkte nach rechts, um eine Panzersperre zu umfahren. Mittlerweile hatte der Volkssturm diese Hindernisse an allen wichtigen Kreuzungen errichtet. Die mit Trümmern beschwerten Straßenbahnwaggons erweckten den Eindruck, dass sie nicht einmal einen Windhauch aushalten würden, geschweige denn den Raketenbeschuss einer Stalinorgel.
Als er die mit Koffern beladenen Menschen an sich vorbeihasten sah, wusste er, dass sie es kaum noch schaffen würden, den inneren Verteidigungsring entlang der S-Bahn zu überqueren. Wahrscheinlicher war, dass die wehrfähigen Männer unter ihnen schon vorher an den Kontrollposten von der Feldgendarmerie aussortiert und zurückgeschickt wurden. Goebbels’ Anordnung, dass kein kampftauglicher Einwohner Berlin verlassen dürfe, wurde buchstabengetreu befolgt. Es gab unzählige Festnahmen, und an eine Ausnahmegenehmigung des für die Verteidigung der Hauptstadt verantwortlichen Wehrmachtsstabs zu kommen, das war praktisch aussichtslos. Offenbar gab es immer noch genügend Leute, um die Papiere der Ausreisenden zu überprüfen.
Er selbst hatte es vor zwei Tagen nur knapp geschafft, die thüringische Ortschaft Stadtilm zu erreichen. Und das war nur möglich gewesen, weil er die erforderlichen Papiere vorweisen konnte, Passierscheine, ausgestellt von der Reichspost. Zum Glück hatte niemand bemerkt, dass er auf den alten Formularen kurzerhand das Datum geändert hatte.
Auf dem Rückweg nach Berlin war er hingegen kein einziges Mal kontrolliert worden. Niemand schien auf die Idee zu kommen, dass ein Fahnenflüchtiger wie er freiwillig in den Hexenkessel zurückkehren wollte.
Der Fahrer begann zu grinsen, als er daran dachte, dass alles letztendlich eine Frage der Perspektive war. Es gab mehrere Realitäten, die nach der Niederlage eintreten konnten. Und er glaubte, für sich selbst die beste ausgewählt zu haben.
Momentan herrschte regelrechtes Aprilwetter, doch jetzt um die Mittagszeit kam zwischen leuchtend weißen Wolkentürmen die Sonne zum Vorschein. Ein strahlender Tag zum Geburtstag des Diktators wurde von der Bevölkerung Führerwetter genannt. Der Fahrer des Wagens überlegte, ob man diesen Begriff bald mit Stalinwetter ersetzen musste. Die Zeit der generalstabsmäßig geplanten Feierlichkeiten, die bisher in ganz Deutschland zu diesem Anlass ausgerichtet worden waren, war vorbei. Es schien so gut wie sicher, dass Hitlers sechsundfünfzigstes Wiegenfest auch sein letztes sein würde.
Trotz allem würden die Parteibonzen heute noch ein letztes Mal beim selbsternannten Führer antanzen, nur um sich später fluchtartig nach Tempelhof zu begeben, wo startbereite Flugzeuge mit knatternden Motoren auf sie warteten.
Bei diesem Gedanken blickte er zum Himmel empor. Natürlich war dies sinnlos, denn hinter dem grauen Schleier der Tarnnetze ließ sich ein einzelner Flieger nur mit Mühe erkennen. Am Straßenrand ragten einige dürre Kamine in den Himmel, und die Form der wenigen übrig gebliebenen Seitenwände ähnelten schlaffen Handtüchern. Propagandaminister Goebbels malte das Bild des heroischen Widerstandes, würdig einer epischen Verklärung. Und tatsächlich besaßen die Rauchsäulen an manchen Tagen eine gewisse Ähnlichkeit mit den Schlachtengemälden aus vergangenen Jahrhunderten. Nur die Kämpfer sahen anders aus, denn sie besaßen weder ordentliche Uniformen, noch waren sie muskelbepackte Hünen wie in der altgriechischen Mythologie. Der vielbeschworene heldische Kampf gegen den bolschewistischen Massenansturm wurde von Knaben in zu großen Uniformen geführt, von ständig übermüdeten Schattengestalten, von alten und lahmen Volkssturmmännern. Doch sogar unter ihnen gab es immer noch genügend Verblendete, die bereit waren, ihrer Ideologie so manches Menschenopfer darzubringen.
Zumindest er gehörte nicht dazu. Nicht mehr.
Der allgegenwärtige Kalkstaub in der Luft vermischte sich mit dem Schweiß, so dass seine Stirn bald von einem klebrigen Film überzogen war.
Es schien, als hätte er genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Es war sicherer gewesen, seinen Plan so spät wie möglich umzusetzen, damit die Kriegswirren alle Spuren seiner Aktivitäten verwischen konnten. Aus dem letzten Wehrmachtsbericht hatte er schließlich herausgelesen, dass er unverzüglich handeln musste. Mittlerweile wurden dort bereits Stadtnamen wie Müncheberg genannt. Jeder mit einer gewissen Kenntnis der unmittelbaren Umgebung von Berlin wusste, was das hieß. Die Rote Armee hatte die letzte Hauptverteidigungsstellung bei den Seelower Höhen nach einem mehrtägigen Gefecht überrannt. Nun trennte kein Bollwerk mehr die russischen Truppen von der Hauptstadt. Wahrscheinlich gab es nicht einmal mehr eine geordnete Front.
Sie alle waren den Russen jetzt hilflos ausgeliefert. Sich noch zu wehren war selbstmörderischer Wahnsinn.
Bei diesem Gedanken presste der Fahrer unwillkürlich die Lippen zusammen.
»Achtung!«, hörte er neben sich.
Er reagierte fast zu spät.
Reifen quietschten, als er auf die Bremse trat.
Wenige Zentimeter vor dem Kühler fuhr unbeirrt ein Lastwagen vorbei. Es war ein Truppentransport. Anscheinend willkürlich wurden die Soldaten zwischen den Verteidigungsposten hin und her geschoben. Die Männer auf der Pritsche des Wehrmachtfahrzeugs hatten von dieser Beinahe-Karambolage kaum Notiz genommen. Die Wangen der Soldaten waren eingefallen, die Blicke stumpf. Nach einem Auffahrunfall ins Lazarett eingeliefert zu werden wäre für sie jetzt ein Glück gewesen.
»Jetzt reißen Se sich ma’ een bissken zusammen!«, sagte sein Beifahrer mit der Schlägermütze. »Wenn Se die Kiste zu Schrott fahr’n, dann kriegen Se nich eenen roten Heller dafür!« Dann steckte er wieder seinen Zahnstocher in den Mund und blickte grimmig durch die Frontscheibe.
Der einzige Kommentar des Fahrers war ein flüchtiges Kopfnicken. Das Geld hatte er ohnehin nicht nötig, wenn alles nach Plan verlief. In Gegenwart eines Gauners wie diesem Paule war es nicht ratsam, das hinauszuposaunen. Mit zahnstocherkauenden Wesen wie ihm hatte er bislang nichts zu schaffen gehabt, was wieder einmal bewies, dass man in Zeiten der Not nicht wählerisch sein konnte.
Hektisch warf der Fahrer einen Blick in den Rückspiegel. Sein Koffer lag noch auf dem Rücksitz. Das war gut. Solange er das Gepäckstück bei sich hatte, besaß er eine Rückversicherung.
Hinter ihnen hupte jemand. Abrupt trat er aufs Gaspedal und musste wieder abbremsen, weil er fast einen radelnden Halbwüchsigen in Uniform auf die Kühlerhaube genommen hätte. Erschrocken machte der Junge mit der Hakenkreuzbinde einen Schlenker zur Seite. An seiner Lenkstange waren zwei Panzerfäuste angebracht, eng anliegend vom Scheinwerfer bis zur Vorderradachse. Die beiden überzähligen Rohre wirkten fast so, als gehörten sie zur Standardausstattung des Zweirads.
Paule verzog seinen Mund. Er machte den Eindruck, als wollte er etwas sagen, behielt es dann jedoch lieber für sich. Schließlich signalisierte er, dass die Straße frei war, und sie setzten ihre Fahrt fort.
»Wo soll ich überhaupt unterkommen?«, fragte der Fahrer. »Wie weit ist es denn?«
»Gleich dahinten«, knurrte Paule. »Da is ne alte Brauerei.«
Ebenso unvermittelt, wie der Strom an diesem Morgen zur Verfügung gestanden hatte, fiel er wenige Stunden später wieder aus.
Oppenheimer und Lisa saßen vor den brennenden Kohlen, über denen in einem Topf Wasser köchelte, das er von seinem letzten Pumpengang mitgebracht hatte. Obwohl sie sich in einer ehemaligen Brauerei befanden, kam aus den Hähnen nur noch braune Brühe.
»Was meinst du«, fragte Oppenheimer. »Wie lang kommen wir noch hin?«
Lisa blickte in die Ecke mit den Wassereimern. »Vielleicht noch drei Tage, wenn wir sparsam damit umgehen.«
Oppenheimer nickte. Wie auch die anderen Berliner musste er bald wieder das Risiko auf sich nehmen, mit Eimern beladen zur nächsten Wasserstelle zu laufen. Doch wenn die Luft erst mal mit dem Blei der russischen Angreifer gefüllt war, würde es gefährlich werden. Vielleicht war es ja besser, möglichst bald zu gehen und die Vorräte aufzufüllen, ehe die Kämpfe begannen. Zwar gab es in den Lagerräumen auch einige Kisten mit Alkohol, doch Oppenheimer scheute davor zurück, sich darüber herzumachen. Schließlich wusste er nicht, ob es Restbestände der Brauerei waren oder ob Ede sie hier eingelagert hatte.
Einzig eine Flasche Whiskey hatten sie geköpft, weil es keine andere Möglichkeit gab, die Zähne zu putzen. Mit dem Destillat konnte man sie wenigstens desinfizieren. Allerdings kostete es Oppenheimer eine gewisse Überwindung, mit der scharfen Flüssigkeit zu gurgeln, da er hochprozentigen Alkohol verabscheute. Und das, obwohl ihn seine gute Freundin Hildegard von Strachwitz immer wieder ermuntert hatte, ihre selbstgebrannten Schnäpse zu kosten.
Bei dem Gedanken an Hilde ließ er den Kopf sinken.
»Ich frage mich, was sie jetzt macht«, murmelte er vor sich hin.
Lisa quittierte dies mit einem verständnisvollen Nicken. Auch ohne dass er den Namen genannt hatte, wusste sie, von wem hier die Rede war. Oppenheimer hatte sich diese Frage in den vergangenen Wochen schon unzählige Male gestellt.
Alles war noch so frisch in seinem Gedächtnis: die Mordanklage, seine Versuche, entlastende Hinweise zu finden, und schließlich das Warten, während Hilde vor dem Volksgerichtshof stand und er nichts mehr tun konnte, als zu hoffen, dass diese Farce glimpflich ausgehen würde.
Er hatte umsonst gehofft.
Und als alles vorbei war, mussten er und Lisa bereits in Edes Gärkeller Unterschlupf suchen. Seitdem hatte er keine Verbindung mehr zu Hilde oder seinen ehemaligen Mitstreitern. Hildes Rechtsanwalt, Gregor Kuhn, wollte ein Gnadengesuch einreichen, doch was damit geschehen war, ob sie die verhängte Todesstrafe bis zum Kriegsende hinausschieben konnten, wusste Oppenheimer nicht.
Seine Überlegungen wurden vom gedämpften Knall einer schweren Tür unterbrochen. Es musste die Außentür des Transportgangs sein. Dieser Eingang verfügte über zwei Türen, weil er ursprünglich als Klimaschleuse gedient hatte.
Aufmerksam lauschte Oppenheimer in die Finsternis jenseits der Gärbottiche. Wahrscheinlich war es Paule.
Er kam auf Geheiß von Ede gelegentlich mit Konserven vorbei, denn je seltener sie sich an der Oberfläche blicken ließen, umso besser blieb das Sammelsurium seiner Schwarzmarktwaren verborgen. Die allgegenwärtigen Blockwarte hatten die unschöne Eigenschaft, neugierig zu werden, wenn in ihrer Nachbarschaft urplötzlich fremde Gesichter auftauchten. Offenbar waren die Lagerbestände so wertvoll, dass es sich für Ede lohnte, seine Schützlinge lieber mit Lebensmitteln zu versorgen, als das Risiko einzugehen, sie stundenlang vor den Geschäften auf Zuteilungen warten zu lassen.
Oppenheimer runzelte seine Stirn, da heute etwas anders war.
Als Lisa seinen alarmierten Blick auffing, bemerkte auch sie, dass etwas nicht stimmte. Obwohl sie so klug war, keinen Laut von sich zu geben, hielt Oppenheimer vorsichtshalber seinen Zeigefinger an die Lippen.
Es dauerte unüblich lang, ehe die innere Tür geöffnet wurde. Konnte er sich überhaupt sicher sein, dass es Paule war? Sprach die Verzögerung nicht dafür, dass es Fremde waren, die sich nur vorsichtig auf unbekanntes Terrain wagten?
Oppenheimers Atem beschleunigte sich bei diesem Gedanken. Dann versetzte ihn das Geräusch der Schritte in Alarmbereitschaft.
Das war keine einzelne Person. Trotz des lauten Widerhalls in dem Transportgang glaubte Oppenheimer klar und deutlich zu hören, dass sich mindestens zwei Personen näherten. Oppenheimer konnte sich nicht vorstellen, dass Paule einfach so einen Mitwisser ins Geheimlager führen würde.
Sie mussten sich verstecken.
Das Feuer der Kochstelle konnten sie nicht mehr löschen, ohne verräterische Geräusche zu machen. Aber wenigstens ließen sich die Schatten nutzen.
Oppenheimer raffte die Decken zusammen und zog Lisa mit sich. Gemeinsam liefen sie um den hinteren Bottich herum und kauerten sich vor die Wand. Dann bedeckte er Lisa mit den Decken. Vielleicht würde die Finte ja funktionieren. Vielleicht dachten die Eindringlinge, dass nur ein Lumpenhaufen auf dem Boden lag.
Aus der Richtung des Eingangs drang das Krächzen der rostigen Scharniere. Die Steinmauern warfen das Geräusch zurück. Oppenheimer zog seinen Kopf ein. Er konnte noch knapp über den Wäschehaufen blicken und machte sich bereit für die Ankunft der Eindringlinge.
Bei jedem der zögernden Schritte knirschte fein zermahlener Schutt. Dann war es für einige Augenblicke ruhig.
Oppenheimer konnte sich gut vorstellen, was außerhalb seines Blickfelds vor sich ging. Seine lebhafte Phantasie hatte ihn schon so manches Mal vor Gefahren gewarnt.
Jemand verharrte in der Eingangstür, spähte ins Zwielicht der Schatten, registrierte die Feuerstelle, ahnte, dass er nicht allein im Keller war.
Oppenheimer hielt den Atem an, seine Nerven waren zum Zerreißen gespannt.
Der nächste Laut war unerwartet. Völlig arglos pfiff jemand eine Melodie. Davon geht die Welt nicht unter. Ohne große Vorsichtsmaßnahmen schlurfte einer der Eindringlinge in den Kellerraum. Für einen kurzen Moment wischte der scharfe Lichtkegel einer Stablampe über den Boden.
Dann erklang eine Stimme. »Wat steh’n Se da so rum? Machen Se sich’s jemütlich.«
Oppenheimer atmete auf. Es war Paule. Und er hatte eine weitere Person mitgebracht.
»Alles in Ordnung«, flüsterte er Lisa zu und erhob sich. Solange Oppenheimer nicht wusste, wer der Neuankömmling war, blieb er allerdings vorsichtig. Mit der Decke über den Schultern schlich er Zentimeter für Zentimeter um den nächsten Gärbottich herum.
Vor der Feuerstelle stand eine Gestalt und begutachtete die neue Umgebung. Im Widerschein der Flammen konnte Oppenheimer außer der hellen Silhouette des hageren Profils nicht viel erkennen. Der Fremde trug nur ein einziges Gepäckstück bei sich, Oppenheimer hielt es auf den ersten Blick für einen Arztkoffer. Medikamente und Verbandszeug bei sich zu führen war zweifelsohne praktisch.
Auch Oppenheimer und Lisa war es in Fleisch und Blut übergegangen, ständig ihre Luftschutzkoffer mit den wichtigsten Habseligkeiten in Griffweite zu haben. Sicherheitshalber.
Oppenheimer kniff seine Augen zusammen, als ihn etwas blendete. Paule hatte ihn zwischen den großen Fässern entdeckt.
Rasch hielt er seine Hand vor den gleißend hellen Kreis der Stablampe.
»Na, Paule, seit wann gefällt dir Zarah Leander?«, fragte Oppenheimer zur Begrüßung.
Der Fremde wandte sich überrascht um. Für einen Moment sah es so aus, als wolle er seinen Koffer gegen die Brust drücken, doch als er erkannte, wie entspannt Paule reagierte, ließ er den Arm wieder sinken.
»Ick dacht schon, ihr wärt ausjebüchst.«
Aus irgendeinem Grund irritierte Paules offenkundige Heiterkeit Oppenheimer, daher antwortete er schroff: »Denkst du, ich gehe hier freiwillig raus?«
»Na, na, Herr Kommissar«, beschwichtigte Paule halbherzig. »Man kann ja nich wissen. Ick hab wat für Sie für den Fall.«
Er reichte Oppenheimer einen Gegenstand aus Pappe.
»Was ist das denn?«, fragte Oppenheimer.
»Dit iss ’n Ausweis, falls Se mal rausmüssen und dem Heldenklau in die Arme loofen.«
Zwar kannte Oppenheimer diesen Begriff noch nicht, doch er ahnte, was es damit auf sich hatte. Bestimmt waren SS und Wehrmacht mittlerweile dazu übergegangen, Passanten von der Straße zu verschleppen und dazu zu zwingen, die Stadt zu verteidigen.
Oppenheimer ging mit dem Ausweis zur Kochstelle und musterte im Feuerschein den Aufdruck. Er war mit der Unterschrift des Reichsverteidigungskommissars Dr. Goebbels versehen, doch die Signatur ähnelte eher den Schreibbemühungen eines Grundschülers.
»Ede hat die organisiert. Jeder von uns hat jetz so eenen. Die Unterschrift vom Goebbels hab ick jut hinjekriecht, wa?«, fragte Paule stolz.
Obwohl Oppenheimer von Paules kalligraphischen Fertigkeiten nicht wirklich überzeugt war, nickte er ihm aufmunternd zu. Er konnte nur hoffen, dass die Greifer in den Straßen ebenso wenig wussten, wie die Unterschrift des Propagandaministers aussah.
Erst jetzt wandte er seinen Blick wieder dem Neuankömmling zu. Der Mann hatte ihn die ganze Zeit über eingehend gemustert. Oppenheimer wurde sich plötzlich bewusst, dass er, in die staubige Decke eingewickelt, wie ein Lumpenmatz aussehen musste.
Wie um diese Tatsache Lügen zu strafen, begann Paule, sie miteinander bekannt zu machen.
»Darf ick vorstellen.« Paule zeigte mit einem breiten Grinsen auf Oppenheimer. »Dit is Kara Ben Nemsi.«
Es war das erste Mal, dass Paule in seiner Gegenwart einen Witz gerissen hatte. Der kleine Ganove gefiel ihm wesentlich besser, wenn er nicht versuchte, geistvoll zu sein. Oppenheimer machte aber gute Miene zu dem abgeschmackten Witz und verzog seinen Mund zu etwas Ähnlichem wie einem Lächeln.
»Richard«, korrigierte er. »Mit wem habe ich die Ehre?«
Der Fremde antwortete zögernd. Er wollte nicht zu viel von sich preisgeben. »Nennen Sie mich Dieter.«
Als Oppenheimer ihm die Hand reichte, verfing sich sein Arm in den Decken. Erst im Widerschein von Paules Stablampe konnte er von dem Mann namens Dieter mehr als einen Schattenumriss erkennen. Trotz der tiefen Falten schätzte er ihn auf vielleicht Ende dreißig. In Oppenheimers Vorstellung glich der Neuankömmling mit dem melancholischen Blick und der geduckten Haltung einem traurigen Geier, nur die vollen Lippen wollten nicht zu diesem Bild passen. Die Frisur war alles andere als militärisch. Die zerzausten Haare lichteten sich am Scheitel bereits. Sicher würde Dieter bald eine Glatze bekommen. Auch die Bewegungen und die melodische Stimme passten eher zu einem Zivilisten.
»Habe ich das richtig verstanden? Sie sind von der Polizei?«, fragte Dieter. Unbeabsichtigt hatte sich ein alarmierter Unterton in seine Stimme geschlichen.
Oppenheimer tat so, als hätte er dies nicht bemerkt, und winkte ab. »Ach, das war mal. Jetzt warte ich nur noch auf das Vierte Reich.«
Dieter schmunzelte höflich.
»Und Sie?«, fragte Oppenheimer. »Was machen Sie beruflich?«
»Ich? Nun ja, man könnte sagen, ich bin Postbeamter.« Oppenheimer sah ihm an, wie er bei dieser Antwort in sich hineinlachte. Er konnte sich diese plötzliche Heiterkeit nicht erklären, doch er ahnte, dass Dieter nicht die volle Wahrheit sagte.
2
Freitag, 20. April 194512 Tage vor der Kapitulation der Berliner Truppen
Haste schon jehört?«, raunte Barbe. »Die Politischen woll’n se jetzt umbringen.«
Hilde blickte auf. Aus ihren Augen quollen Tränen, doch das lag an den Ausdünstungen der geschälten Zwiebeln. Es dauerte eine Weile, bis ihr Verstand diese hastig geflüsterten Worte sortiert hatte. Dabei bemerkte sie nicht, wie eine Zwiebelknolle ihren Fingern entglitt und mit einem dumpfen Aufschlag auf den Boden prallte.
Da war es also. Nun stand die Nachricht im Raum, vor der sich Hilde schon seit dem Beginn ihres Haftaufenthalts gefürchtet hatte.
Wenn es zutraf, dass es jetzt bereits den politischen Gefangenen an den Kragen ging, dann befand sie sich in höchster Gefahr. Schließlich hatte man sie wegen defätistischer Äußerungen eingebuchtet – und darauf stand die Todesstrafe. Nur die Winkelzüge ihres Anwalts hatten die Vollstreckung des Urteils bislang verzögert.
Hilde rieb sich die Augen, bis sie ihre Mitgefangene wieder deutlich erkennen konnte, das dickliche Mädchen namens Barbe, mit dem sie sich im Zuchthaus Moabit angefreundet hatte. Barbe war mit ihren fünfundzwanzig Jahren ungefähr halb so alt wie Hilde, vielleicht suchte sie in dieser feindlichen Umgebung einen Mutterersatz. Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr.
In den dreizehn Wochen ihrer Gefangenschaft hatte Hilde die Erfahrung gemacht, dass man sich an die Todesfurcht nicht gewöhnen konnte. Allenfalls ließ sie sich verdrängen. Doch nun war sie wieder da, drang mit eisiger Klarheit in ihr Bewusstsein und überdeckte alles, was sie bislang hinter den Gefängnismauern gesehen oder gefühlt hatte.
Es war Nachmittag, und sie befanden sich ausnahmsweise in der Gefängnisküche. Nach dem Aufstehen hatte Hilde wie üblich mit den übrigen Insassen noch Uniformen ausgebessert, bis sie nach einer Stunde mit Barbe zum Zwiebelschälen abkommandiert wurde.
In der spartanisch eingerichteten Küche blubberte auf den Herden das Essen in den Kesseln. Ein kleinerer Topf war für das Wachpersonal bestimmt, während die verdünnte Brühe in den großen Töpfen für die Häftlinge vorgesehen war. Barbe hatte sich über die Abwechslung gefreut, denn wenigstens war es möglich, in der Küche unter einem geöffneten Fenster zu sitzen und sich für eine Weile von der Sonne den Rücken wärmen zu lassen.
Gerade wollte sie Barbe eine Frage stellen, als sich ihnen eine Hilfsaufseherin näherte. Sobald Hilde sie aus den Augenwinkeln registriert hatte, schloss sie wieder den Mund. Zwar wusste sie, dass diese Aufseherin im Gegensatz zu den meisten anderen freundlich war, doch es war besser zu schweigen, solange sie sich mit ihnen im Raum befand.
Als die Hilfsaufseherin vor ihr stehen blieb, schaute Hilde irritiert auf. Der Blick unter dem gestärkten weißen Häubchen war spöttisch. »Aber, aber, Frau von Strachwitz«, sagte die Hilfsaufseherin milde tadelnd.
Hilde wusste zunächst nicht, was sie meinte, doch dann erinnerte sie sich daran, dass zwischen ihren Füßen eine halb geschälte Zwiebel lag. Sie rechnete es der Hilfsaufseherin hoch an, dass sie von ihr mit dem Namen angesprochen wurde. An einem Ort wie diesem war es eine Wohltat, nicht als Nummer angesehen zu werden, als gesichtslose Verwaltungsmasse.
Instinktiv wollte sich Hilde bücken, wäre da nicht der altbekannte Widerstand in ihr gewesen. Die Aufseherin mochte zwar eine nette Person sein, doch sie wollte es ihr nicht zu leicht machen, genauso wie Hilde im Gefängnis auch ihren anderen Aufgaben aus Prinzip nur mit dem größten Widerwillen nachkam.
Wozu hätte sie sich auch anbiedern sollen? Etwas Schlimmeres als die Todesstrafe konnte es sowieso nicht geben. Hilde sah es geradezu als ihre Pflicht an, aufzumucken und den Ablauf zu stören, wo es nur ging, damit sie zwischen diesen Mauern nicht ihre Selbstachtung verlor.
Darum räusperte sie sich nur und beschimpfte die Zwiebel mit einem gemurmelten: »Blödes Ding.«
Lächelnd wandte sich die Aufseherin ab und trat zu den Köchinnen. Hilde saß regungslos da und starrte auf die Zwiebel. Es war ein klägliches Exemplar, so kläglich wie alle Lebensmittel, die sie hier bekamen. Die Knolle war weich, und aus dem Kopf spross bereits ein grüner Keim hervor.
Hilde umklammerte mit ihrer Rechten das Schälmesser, bis ihr die Finger schmerzten. Unverhofft hatte sie eine Bestätigung bekommen, dass ihr Leben in höchster Gefahr war.
In den vergangenen Wochen hatte Hilde beobachtet, dass immer mehr politische Häftlinge verschwanden. Es hieß, dass sie in andere Gefängnisse verlegt wurden, damit sie nicht dem Feind in die Hände fielen. Die Gesetzgebung der Nationalsozialisten, der zufolge bereits der Zweifel an dem Sieg der Herrenmenschen ein todeswürdiges Vergehen war, hatte dafür gesorgt, dass die Haftanstalten im schrumpfenden Reichsgebiet hoffnungslos überfüllt waren. Und so wurden die Gefangenen auf eine ziellose Odyssee geschickt, von Kittchen zu Kittchen.
Auch Hilde hatte sich innerlich darauf vorbereitet, eines Tages aufgerufen und in Gefängniskleidung und mit Holzpantinen in einem Spießrutenlauf durch Berlins Straßen zur Anlegestelle der Lastkähne getrieben zu werden.
Doch jetzt war die Stadt umzingelt. Alle Ausgänge waren versperrt.
Die Situation wurde zunehmend brenzlig. Um sie herum wankte das Tausendjährige Reich in einem Todestaumel. Würden die Nationalsozialisten kurz vor ihrer Vernichtung tatsächlich noch auf den Gedanken kommen, mit ihren ehemaligen Gegnern abzurechnen? Hilde ahnte, dass es den Hundertprozentigen durchaus zuzutrauen war. Kein noch so guter Verteidiger würde ihr dann helfen können. Nicht einmal ihr Anwalt Kuhn, der als Parteimitglied über gute Verbindungen verfügte und bewiesen hatte, dass er jede Möglichkeit ausnutzen würde, um Hilde zu helfen. Gegen die letzten Zuckungen des Machtapparats würde selbst er machtlos sein.
Still ging sie im Kopf ihre Möglichkeiten durch. An Flucht war nicht zu denken. Und schon gar nicht mit einem Messer in der Hand, mit dessen stumpfer Klinge sie nicht einmal eine Zwiebel vernünftig schneiden konnte.
Hilde begann, nach Ausreden zu suchen. Vielleicht war es lediglich eines dieser haltlosen Gerüchte, die in jedem Gefängnis herumschwirrten. Vielleicht hatte Barbe ja nur etwas falsch verstanden. Es schien durchaus möglich zu sein, denn ehrlich gesagt war Barbe nicht gerade die Hellste.
Erst als sich die Hilfsaufseherin zusammen mit den Köchinnen in einen Nebenraum begab, bestand wieder die Möglichkeit, ihr etwas zuzuflüstern.
»Wo hast du das her?«, zischte Hilde Barbe zu, sobald die schwere Tür mit einem satten Schmatzen ins Schloss gefallen war.
»Die Michalina hat es mir vorhin auf dem Gang erzählt.«
Michalina war eine Polin und befand sich bei ihnen in der Gemeinschaftszelle. Zum Glück hatte sie mittlerweile so viele deutsche Sprachbrocken aufgefangen, dass man sich mit ihr unterhalten konnte. Hilde versuchte einzuschätzen, ob ihre Sprachfertigkeit ausreichte, um die Meldung richtig wiederzugeben, kam jedoch zu keinem Ergebnis.
»Aber was hat Michalina genau gesagt?«, wollte Hilde wissen.
Barbe zuckte ihre Schultern. »Ick weeß nur so viel, dasse irjendwo im Ruhrpott noch auf’n letzten Drücka Jefangene hinjerichtet ham. Henker waren nich mehr da, also ham die Aufseher Zigaretten dafür jekriecht.«
»Woher will die das denn wissen?«
Barbe wirkte so niedergeschlagen, als ob dieses drohende Todesurteil auch ihr gelten würde. »Ick weeß nich. Da musste die schon selber fragn.«
Unzufrieden stieß Hilde die Luft aus. Sicher würde es noch mehrere Stunden dauern, ehe sie wieder in ihre Gemeinschaftszelle durften. Bis dahin würde sie nur herumgrübeln und den Teufel an die Wand malen. Ein weiterer trostloser Nachmittag, bei dem die Zeit nicht verging.
Hilde wollte gerade die Zwiebel aufheben, als von draußen ein Donnerschlag erklang. Die Schallwellen ließen die Fensterscheiben vibrieren und den Rahmen klappern.
Barbe und Hilde fuhren zusammen.
Das Gewummer war noch nicht verhallt, als sich schon die Küchentür öffnete und mit hochrotem Kopf die Hilfsaufseherin hereinschaute. Ihren Gefangenen schenkte sie nur einen wirren Blick, ehe sie den Gang zum nächsten Zellentrakt entlangeilte.
Das alles hatte sich in Sekundenbruchteilen abgespielt.
»Das war draußen!«, rief Hilde und rückte eilig ihren Schemel unter das Fenster. Als sie daraufstieg, konnte sie knapp über das Fenstersims blicken. Allerdings sah sie nicht viel mehr als nach oben ziehende Rauchschwaden vor blauem Himmel.
»Verdammt noch mal, welche Richtung ist das?«
Barbe war ebenfalls auf ihren Hocker gestiegen. Da sie einige Zentimeter größer als Hilde war, hatte sie einen besseren Überblick. »Da is wat runterjekommen. Irjendwo beim Reichstag.« Unwillkürlich legte sie ihren Kopf in den Nacken. »Aba wo is der Flieger?«
»Das war kein Flieger«, sagte Hilde. Ihr Herz schlug mit einem Male so wild, dass es ihr fast aus der Brust zu springen drohte. »Wir sind schon in Reichweite ihrer Geschütze!«, jubelte sie, doch sosehr sie auch in die Höhe hüpfte, es war nichts zu machen, sie konnte trotzdem nichts erkennen.
Schließlich wurde es Hilde zu bunt, und sie kletterte kurzentschlossen auf die Arbeitsplatte mitten in der Küche.
Die Köchinnen warfen ihr einen entsetzten Blick zu. Offenbar hatte sich noch niemals ein Häftling in ihrer Küche derart ungehörig aufgeführt.
Hilde kümmerte sich nicht darum, sondern starrte gebannt nach draußen.
Macht dem braunen Kroppzeug endlich den Garaus, dachte sie. Sie wollte nicht sterben, nur weil es irgendeinem Parteisoldaten gerade in den Kram passte. Nicht so knapp vor dem Ende.
Sie wollte leben, verdammt noch mal, leben!
Für die Klänge des Concertgebouw-Orchesters war die Akustik des Gärkellers nicht geschaffen. Ein weiteres Problem war der Dirigent, denn das lyrische Gleiten in Wohllauten, das man von Beethovens Pastorale erwartete, war seine Sache nicht. Im ersten Satz trieb Prof. Dr. Willem Mengelberg die Musiker dermaßen zügig durch die Partitur, dass er ein wenig einem Holzfäller glich, der sich durch Gestrüpp hackte. Jedoch war es die einzige Aufnahme der Sinfonie Nr. 6 in F-Dur, op. 68, die Oppenheimer besaß. Immerhin besserte sich die musikalische Leitung im zweiten Satz, in dem der Komponist mit dem Orchester das Murmeln eines dahinfließenden Baches nachahmte und im Schlussteil sogar Nachtigall, Wachtel und Kuckuck erklingen ließ. Da kapitulierte selbst die Nüchternheit eines Mengelberg und verführte den Dirigenten für einige kurze Momente zum klanglichen Schwelgen.
Oppenheimer hatte das Grammophon näher ans Lagerfeuer gerückt, obgleich er befürchtete, dass seine sorgsam gehüteten Schallplatten vom Ruß verkleben würden. Einen halbwegs vernünftigen Klang gab es nur, wenn man relativ dicht am Trichter des Grammophons saß. Einige Meter weiter entfernt, und schon dominierte der Hall des steinernen Gewölbes und ließ die Musik zu einem Einheitsbrei verschmelzen.
Er war froh, noch ein altmodisches Grammophon mit einem Kurbelantrieb zu besitzen. Wenn wie jetzt der Strom ausgefallen war, hätte er nicht einmal Musik hören können. Die von Telefunken gepresste Aufnahme der Beethoven-Sinfonie hatte schon etliche Jahre auf dem Buckel. Erst vor wenigen Monaten hatte Oppenheimer sie gegen Lebensmittelmarken eingetauscht, in der kurzen Zeit, in der er sich als arischer Volksdeutscher ausgegeben hatte. Diese Zeit war nun endgültig vorbei.
Dass er die Schallplatten nach den Turbulenzen der vergangenen Jahre überhaupt noch einmal zu Gesicht bekommen würde, war eine Überraschung gewesen. Der Schwere Ede hatte sich nicht lumpen lassen und seine Leute auf Oppenheimers Geheiß zu Hildes versiegeltem Häuschen geschickt, um sie zu entwenden.
Hilde. Da war es wieder. Bei dem Gedanken an sie spürte Oppenheimer einen Stich im Magen. Er hatte immer noch nicht akzeptiert, dass er nichts mehr für sie tun konnte.
Um sich abzulenken, wandte er sich dem Grammophon zu und überlegte, welche Musik er danach auflegen würde. Vielleicht die Alpensinfonie, op. 64, von Richard Strauss? Hübsche Musik, wenngleich ein wenig vulgär und nicht im Geringsten mit den sperrigen Tönen zu vergleichen, die dem Komponisten noch wenige Jahre zuvor aus der Feder geflossen waren.
Doch gerade hübsche Musik brauchte Oppenheimer jetzt am dringendsten. Die unmittelbare Zukunft war bereits grimmig genug, als dass er sie noch mit den schicksalsdräuenden Klängen von Beethovens anderen Sinfonien hätte untermalen müssen. Oder sollte er nicht lieber gleich die Ouvertüre zum Sommernachtstraum von Mendelssohn Bartholdy auf den Plattenteller legen? Offiziell durfte die Musik nicht mehr öffentlich gespielt werden, weil der Urheber der Spross einer jüdischen Familie gewesen war. Zum Glück waren Schallplatten geduldig und scherten sich nicht um die offiziellen Vorschriften der nationalsozialistischen Machthaber.
Trotz dieser Überlegungen ertappte sich Oppenheimer immer wieder dabei, wie er Dieters schwarzem Lederkoffer mit den Messingschließen verstohlene Blicke zuwarf. Er konnte einfach nicht anders. Peinlich berührt schaute er kurz zu dessen Besitzer hinüber, aber der schien von Oppenheimers Neugierde nichts bemerkt zu haben.
Es kam Oppenheimer so vor, als hätte Paule ihm eine Zeitbombe ins Hirn eingepflanzt, als er ihn vor seinem Verschwinden kurz zur Seite genommen hatte, um ihm einige hastige Worte zuzuflüstern. Irgendetwas war in dem Koffer, ein wertvoller Gegenstand, und Oppenheimer sollte im Auftrag von Ede darauf Obacht geben.
Also schien es sich dabei nicht um einen handelsüblichen Arztkoffer zu handeln. Doch was konnte sich darin befinden? Nicht einmal Paule wusste das. Vor allem irritierte es Oppenheimer, dass er nicht die Order bekommen hatte, auf den neuen Gast aufzupassen. Nur der Koffer schien wichtig zu sein.
Das nagende Verlangen, einen Blick hineinzuwerfen, wurde nicht befriedigt. Dieter öffnete ihn kein einziges Mal, denn alle dringend benötigten Utensilien bewahrte er in den Blasebalgtaschen seines Mantels auf. Sie waren regelrechte Wundertüten, aus denen er routiniert einen Gegenstand nach dem anderen hervorzog, ganz so wie ein Zauberer die Kaninchen aus einem Zylinder.
Durch die Lüftungsschächte fiel schon seit mehreren Stunden kein Licht mehr in den Keller. Dafür schwoll fast unmerklich über der Schallplattenmusik das Grollen der Geschütze an. Unruhig fragte sich Oppenheimer, wann der volle Lautstärkepegel des Gefechtslärms erreicht sein würde, mit dem auch die ersten russischen Soldaten einträfen.
Da zu vorgerückter Abendstunde allmählich wieder die Kälte vom Boden her heraufkroch, hatten sie sich vor die Kochstelle gesetzt, ganz so, als würde es sich um ein Lagerfeuer handeln. Oppenheimer war froh darüber, dass ein Fremder bei ihnen hier unten war, denn damit hatte das Grübeln um seine und Lisas Zukunft vorerst ein Ende. Bei einem Gespräch ließ sich leicht an andere Dinge denken, und zum Glück hatte Dieter amüsante Anekdoten parat. Interessanterweise lieferte allerdings keine dieser Geschichten einen Hinweis auf seinen Hintergrund. Dieter wusste anscheinend, wie man seine Identität im Ungefähren verbarg.
Jetzt zog er ein blassrosa Heftchen aus seinem Mantel hervor.
»Hier, das werden Sie sicher brauchen«, kommentierte Dieter.
Oppenheimer hielt das Büchlein unter den Schirm der Petroleumlampe, um die Aufschrift entziffern zu können. Es war ein deutsch-russisches Soldatenwörterbuch.
»Herzlichen Dank«, sagte Oppenheimer, nachdem er sich vergewissert hatte, dass er das Heftchen auch wirklich behalten durfte. »Ich konnte mal ein bisschen Russisch, musste aber feststellen, dass mir fast alles entfallen ist.«
Er blätterte durch das Wörterbuch und las dann schmunzelnd vor: »Der Krieg hat gezeigt, mit welch einfachen Mitteln sich derdeutsche Soldat überall verständigen kann. Die richtigen Wörter, ohne Rücksicht auf Grammatik nebeneinandergestellt, genügen fast immer.« Oppenheimer schüttelte den Kopf. Wie arglos hier der Krieg geschildert wurde, ganz so wie ein großes Abenteuer. Da unterschied sich das Wörterbuch nicht von den übrigen Erzeugnissen von Presse und Literatur. Das Heft in seinen Händen wäre für Hilde eine willkommene Steilvorlage für ihre gewohnt zynischen Kommentare gewesen. Oppenheimer fiel nur eine einzige geistreiche Bemerkung ein. »Klar, wenn man ergänzend zu dem Buch noch eine geladene Waffe mit dabeihat, springt jeder nach deiner Pfeife. Klingt ja wie ein Kinderspiel.«
Lisa war an Oppenheimer herangerückt. Beim Betrachten des Einbands runzelte sie die Stirn. »Dreitausend Wörter für Feldgebrauch und tägliches Leben steht da. Ob das wohl ausreicht?«
»Wer weiß«, sagte Dieter und lächelte hintergründig. »Allerdings erscheint mir die Auswahl ein wenig irreführend.«
»Stillgestanden«, murmelte Lisa, während ihre Augen über das Papier flogen. Rechts neben dem deutschen Wort standen kyrillische Buchstaben, und dahinter folgte eine Transkription in Lautsprache. Spielerisch formten ihre Lippen die fremden Wörter. »Ssmirna?«
»Ja, wahrscheinlich wird das so ausgesprochen«, stimmte Oppenheimer zu und blätterte zu den wichtigsten Redensarten auf den ersten Seiten des Büchleins. »Oder hier: Ruki wjärch!«
»Was soll das heißen?«
»Hände hoch! Und jetzt weiß ich endlich, was Haubitze auf Russisch heißt. Ga-ubiza oder so ähnlich.«
Sie brachen in Gelächter aus, denn es erschien unwahrscheinlich, dass ein deutscher Soldat jemals diese Worte benutzen würde.
Inmitten dieses Heiterkeitsausbruchs meldete sich in Oppenheimers Hinterkopf eine warnende Stimme. Immerhin wussten sie nicht, wer ihr Gast war. Vielleicht war es ja gefährlich, über Führer und Volk zu lästern. Obwohl die Wahrscheinlichkeit eher gering war, ließ sich nicht ausschließen, dass sie mit einem linientreuen Parteigenossen im Keller saßen. Schlimmstenfalls konnte er sie immer noch verraten.
Im gleichen Moment lief die Nadel des Grammophons in die Leerrille. Anstatt die Schallplatte umzudrehen, damit der nächste Teil des Allegros erklang, entschied sich Oppenheimer dazu, Dieter ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Und so schob er die Platte zurück in das blaue Klappalbum und legte als Nächstes die Sommernachtstraum-Ouvertüre auf.
»Ich hoffe, es ist Ihnen recht, wenn ich etwas anderes spiele?«, fragte er.
Dieter nickte gönnerhaft. Dann kam ihm eine Idee. »Haben Sie zufällig etwas von Franz Schubert?«
»Ähm, nein«, log Oppenheimer. Gleichzeitig rieb er geistesabwesend mit dem Daumen über den Schorf auf dem rechten Ringfinger, wo sich ursprünglich sein Fingernagel befunden hatte. Es würde noch einige Zeit dauern, bis Oppenheimer wieder unbefangen Musik von Schubert anhören konnte. Aber das war eine andere Geschichte, und er wollte sie Dieter keinesfalls verraten.
Als die ersten Takte von Mendelssohns Ouvertüre erklangen, zeigte ihr Gast außer einem Lächeln keinerlei Reaktion. Missmutig seufzend lehnte sich Oppenheimer zurück.
Um das Thema zu wechseln, zeigte er auf das Wörterbuch in Lisas Händen. »Da haben Sie meiner Frau das Richtige mitgebracht. Sie ist ausgebildete Sprachlehrerin.«
»Russisch kann ich leider nicht«, fügte Lisa hinzu.
Dieter deutete lediglich ein Nicken an. Oppenheimer fragte sich, was hinter diesem unverbindlichen Lächeln vor sich ging. »Tja, die wichtigen Begriffe stehen wohl nicht drin«, sinnierte er.
»Sie meinen so etwas wie: Bitte nicht schießen, wir ergeben uns?«, fragte Dieter.
»Dazu reicht es doch, mit einem weißen Tuch zu wedeln«, warf Lisa ein.
Jetzt ließ sich auch Dieter von ihrem Frohsinn anstecken. Als er seine makellosen Zähne zu einem Lachen entblößte, ließ Oppenheimer schuldbewusst die Zunge über seinen hohlen Backenzahn gleiten. Aufgrund seines erhöhten Konsums des Aufputschmittels Pervitin war sein Gebiss in den letzten Jahren ziemlich fleckig geworden. Wenngleich er es letztendlich geschafft hatte, von der legalen, aber trotz allem abhängig machenden Modedroge loszukommen, musste er sich eingestehen, dass sein Körper wohl auch so manch irreparablen Schaden davongetragen hatte.
Plötzlich erstarb Dieters Lächeln, und in seine Augen trat ein gehetzter Ausdruck.
Dann hörte auch Oppenheimer den Grund für diesen Stimmungswandel. Draußen heulten wieder die Sirenen. Es war ein Voralarm.
Das durch Mendelssohns Musik hervorgerufene Bild eines verzauberten Waldes mit umherschwirrenden Elfen war schlagartig vergessen. Oppenheimers Atem beschleunigte sich, als er daran dachte, dass sich Flugzeuge der Stadt näherten. Sicher war es ein Moskitoangriff, das war üblich während der Nachtstunden. Lisa zog unwillkürlich den Kopf ein, bereit, den Luftschutzkoffer zu packen und in den nächsten Bunker zu laufen.
Aber sie konnten in keinen Bunker, sie mussten auf die solide Bauweise des Kellergewölbes vertrauen. Ohne sich dessen bewusst zu sein, war einem unbekannten Architekten vor vielen Jahren die Aufgabe zugefallen, ihr Überleben zu sichern. Oppenheimer konnte nur hoffen, dass der Mann gute Arbeit geleistet hatte.
Dieter schien auf ähnliche Gedanken gekommen zu sein. Skeptisch schaute er zur Decke.
»Wenn das nicht hält, dann weiß ich auch nicht«, versuchte Oppenheimer, ihn zu beruhigen. Oder wollte er sich etwa selbst in Sicherheit wiegen? »Nebendran ist noch ein weiterer Keller. Der wird als öffentlicher Luftschutzraum benutzt. Aber das ist ein separater Gebäudeteil, von uns werden sie nichts mitbekommen. Es gibt keine Verbindung.«
Dieter runzelte die Stirn. »Wieso wurde dieser Keller nicht auch zum Bunker ausgebaut?«
Oppenheimer hatte auch schon über diese Frage nachgedacht, und er glaubte mittlerweile, eine Erklärung gefunden zu haben. »Sehen Sie da hinten?« Er zeigte auf die Finsternis hinter den Gärbottichen. »Dort sind lauter Verschläge mit Stahlschlössern. Ede lagert jetzt seine Waren darin, aber ich glaube, der Keller sollte ursprünglich zu einer unterirdischen Fabrik ausgebaut werden. Wahrscheinlich wollte sich ein wehrwirtschaftlich wichtiger Betrieb hier einquartieren.«
Dieter hörte kaum zu, stattdessen blickte er auf seine Armbanduhr. »Ah ja, ich verstehe«, murmelte er zerstreut.
Oppenheimer schaltete das Grammophon ab. Wenn erst einmal die Erde unter den Bombeneinschlägen erzitterte, war es keine gute Idee, eine Schallplatte laufen zu lassen. Sie würde nur zerkratzen, mal ganz abgesehen von den anderen verheerenden Schäden, die mehrere Tonnen Sprengstoff anrichten konnten. Es ließ sich nicht ändern, in den nächsten Tagen musste er eine sichere Stelle finden, wo er das Grammophon und die Schallplatten verstauen konnte.
»Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden?« Voller Unruhe war Dieter aufgestanden und blickte sich um. Er wollte bereits nach dem Koffer greifen, doch dann änderte er seine Meinung und ließ ihn auf dem Boden stehen.
»Sanitäre Einrichtungen haben wir leider nicht«, erklärte Oppenheimer. »Aber dort hinten ist ein Eimer.«
Seine harmlose Erklärung für Dieters Unruhe war nicht zutreffend, denn dieser schüttelte nur den Kopf und sagte: »Vielen Dank, aber nein, nein. Ich gehe kurz mal raus, bevor es losgeht.«
Perplex sah Oppenheimer dabei zu, wie sich Dieter dem Ausgang näherte und wie selbstverständlich einen an einer Kordel befestigten Schlüssel aus seinem Hemdkragen hervorzog.
Er wollte tatsächlich nach draußen! Gerade jetzt, wo er sich doch in Sicherheit befand.
Oppenheimer und Lisa tauschten verwunderte Blicke.
»Ich würde das an Ihrer Stelle nicht tun«, mahnte Oppenheimer. »Wir dürfen nur im Notfall raus. Ede will nicht, dass man sein Lager aufspürt.«
»Ich gebe schon acht«, antwortete Dieter leichthin, zauberte dann aus seinen Taschen auch noch eine Stablampe hervor und schaltete sie ein. Er war noch nicht einmal zwischen den nächstgelegenen Gärbottichen angelangt, als ihn bereits die Schwärze umfing. Nur der Lichtkegel der Stablampe, der über den Boden huschte und dann hinter dem Rund eines Fasses verschwand, war zu sehen. Ein wenig später quietschten bereits die Türscharniere.
Dieter war verschwunden. Fast so unvermittelt, wie er bei ihnen aufgetaucht war.
»Merkwürdiger Kauz«, meinte Lisa.
»Vielleicht ein Frischluftfanatiker«, murmelte Oppenheimer. »Wenigstens hat er den Koffer dagelassen.«
Als Lisa ihm bei diesem Kommentar einen fragenden Blick zuwarf, wusste Oppenheimer, dass er ihr von seiner vertraulichen Konversation mit Paule berichten musste.
3
Samstag, 21. April 1945 – Montag, 23. April 194511 bis 9 Tage vor der Kapitulation der Berliner Truppen
Der Mann namens Dieter hatte sich am Freitagabend nicht lang draußen aufgehalten. Bereits nach einer Viertelstunde war er zurückgekehrt – gerade noch rechtzeitig, ehe die Sirenen Vollalarm signalisierten. Zu diesem Zeitpunkt konnten sie noch nicht ahnen, dass es der letzte Luftangriff auf Berlin sein sollte.
Nach fast zwei Stunden war der Spuk wieder vorbei, dafür setzte in den frühen Morgenstunden des folgenden Samstags allerdings erneut das Dröhnen der Artillerie ein.
Und zwar lauter als jemals zuvor.
Besorgt stellte sich Oppenheimer genau unter einen der Luftschächte, um herauszufinden, was draußen vor sich ging.
Heulend schlugen Granaten ein. Danach erklangen in rascher Folge Detonationen. Eine Gewitterkaskade pflanzte sich zitternd im Erdreich fort, so dass sich Oppenheimer reflexartig an der Steinwand festhielt. Dann folgte von oben das tiefe Grollen fallender Steine.
Wahrscheinlich war in ihrer unmittelbaren Umgebung ein Gebäude getroffen worden. Vom Tonnengewölbe rieselte feiner Zementstaub herab. Wenn sie Pech hatten, war das Brauereigebäude über ihrem Keller jetzt komplett zerstört. Bei diesem Gedanken wurde Oppenheimer unruhig. Auch in Lisas Gesicht spiegelte sich das blanke Entsetzen. Schließlich bestand die Gefahr, dass ihr einziger Ausgang nun durch Trümmer versperrt wurde.
Aber da war noch etwas anderes.
Unmittelbar vor den Einschlägen war Oppenheimer ein scharfes Zischen aufgefallen. Einen ähnlichen Klang hatte er noch nie zuvor gehört.
Er schluckte hart und rief dann in Dieters Richtung: »Haben Sie eine Ahnung, was das ist?«
Der Mann gesellte sich zu ihm und lauschte dem Treiben auf der Erdoberfläche. Als ein weiteres Gewitter herabgeprasselt war, erklärte er, die Stirn gerunzelt: »Raketen. Da sind Stalinorgeln am Werk.«
Oppenheimer nickte. Sie befanden sich bereits in Reichweite der berüchtigten sowjetischen Fernwaffen.
»Das heißt also, dass die Russen bis auf fünf Kilometer an uns herangerückt sind«, fuhr Dieter fort. »Aber wer weiß, wie lang es noch dauert, bis sie eintreffen.«
Ebenso unvermittelt, wie das Inferno über ihnen entfesselt worden war, brach es gegen Mittag wieder ab. Eine beklemmende Stille senkte sich über Berlin, ein kurzes Atemholen vor der nächsten Todessalve.
Oppenheimer beschloss, die Feuerpause zu nutzen, um den Kellerzugang zu überprüfen. Wenn sie verschüttet waren, mussten sie unverzüglich nach einem anderen Ausweg suchen. Vielleicht gab es ja noch irgendwo Notausstiege, wie man sie in Kellerbunkern fand.
Dieter schien geradezu darauf erpicht zu sein, ebenfalls an die Oberfläche zu gelangen, und so durchquerten sie gemeinsam im Schein seiner Stablampe die Klimaschleuse.
Zu Oppenheimers Erleichterung ließ sich die Außentür problemlos öffnen. Während er in die ungewohnte Helligkeit blinzelte, spürte er, wie ihm ein feuchter Windhauch entgegenblies. Was ihm zunächst unglaublich hell vorgekommen war, entpuppte sich als ein trüber Regentag mit tief hängenden Wolken.
Auf Zehenspitzen schlich Oppenheimer die unebene Backsteintreppe hoch, bis seine Augen auf Erdhöhe waren und er die Umgebung überblicken konnte.
Nichts. Keine Bewegung.
Oppenheimer verharrte schweigend. Als er sich vergewissert hatte, dass tatsächlich keine Sterbensseele zu sehen war, wollte er Dieter Entwarnung geben, doch dieser drängte sich bereits an ihm vorbei und erklomm die Treppenstufen.
Wieder einmal wunderte sich Oppenheimer über das Verhalten des Neuankömmlings. War es Kaltblütigkeit oder einfach Gedankenlosigkeit, die ihn antrieb?
Als er ins Freie getreten war, stellte Oppenheimer irritiert fest, dass sich Dieter in Luft aufgelöst zu haben schien.
Die leere Gebäudehülle der Brauerei stand noch, dafür hatten die Geschosse direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen rauchenden Krater in die Häuserwand gerissen. Gleich daneben befand sich eine Metzgerei, vor der die Leute bereits wieder in Viererreihen anstanden. Wie überall versuchten die Zivilisten auch in diesem Viertel, ihre letzten Lebensmittelkarten noch schnell abzuverkaufen, um Vorräte zu hamstern.
Obwohl die Anwohner den Kampf gegen das um sich greifende Chaos bereits vor mehreren Wochen aufgegeben hatten, wurde irgendwo laut gehämmert. Vermutlich wurde abgerissene Verdunklungspappe wieder vor die Fenster genagelt.
Nicht weit von der Menschenschlange entfernt pinselte ein Greis mit mürrischem Blick eine Propagandabotschaft an eine Hauswand.
Berlin eine Festung – jedes Haus eine Fes…
Weiter war er noch nicht gekommen.
Oppenheimer eilte in den Gärkeller, um seinen Korb zu holen, und begab sich dann zu den Brennnesseln auf der kleinen Grasfläche vor dem Brauereigebäude. Lisa hatte ihm erklärt, dass diese Pflanzen essbar waren. Und tatsächlich, als sie es ausprobiert hatten, fand Oppenheimer, dass sie gekocht fast wie frischer Spinat schmeckten.
Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass jemand an dieser Stelle ebenfalls Brennnesseln abgepflückt hatte. Anscheinend war also auch so manch verwöhnter Großstädter bereits auf die Idee gekommen, die brachliegenden Grünflächen nach Nahrung abzusuchen.
Oppenheimer rupfte mit seinem Taschentuch einige Pflanzenstiele ab. Sein Korb war noch nicht gefüllt, als wieder das Grollen der Haubitzen erklang. Instinktiv kauerte er sich zusammen.
Im Gegensatz zu Oppenheimer ließen sich die Menschen vor der Metzgerei von dem Lärm nicht beeindrucken. Obwohl die meisten von ihnen kaum den Reflex unterdrücken konnten, bei den Detonationen zusammenzuzucken, blieben sie doch stoisch in der Reihe stehen. Nur der ältere Herr mit dem Farbeimer war verschwunden. Beim letzten Wort war er noch bis Festun gekommen, der letzte Buchstabe war allerdings nicht mehr als ein hastig hingepatschter Farbklecks.
Als der Beschuss anhielt, hastete Oppenheimer geduckt zum Keller. Im Schutz des Treppenabgangs blieb er stehen und fragte sich, ob er auf Dieter warten sollte.
Suchend schaute er sich um, bis sein Blick auf das erste Stockwerk der Brauerei fiel. Starr wie eine Statue stand dort oben Dieter und blickte angestrengt in die Ferne. Hinter der leeren Fensteröffnung wie auf einem Präsentierteller, wäre er ein leichtes Ziel für einen Scharfschützen, von der zerstörerischen Gewalt der Granaten ganz zu schweigen.
»Verdammt noch mal«, brüllte Oppenheimer gegen den Lärm an. »Kommen Sie da runter!«
Schließlich nahm Dieter Oppenheimers Winken wahr und verschwand aus der Fensteröffnung. Wenige Sekunden später kam auch er die Stufen der Kellertreppe heruntergehastet. Oppenheimer riss die Tür auf und ließ sie dann wieder ins Schloss fallen.
Schwärze umfing sie.
Sie befanden sich in Sicherheit.
In der Nacht zum Montag wälzte sich Oppenheimer schlaflos auf den Holzkisten hin und her. Das Wochenende war ereignislos verlaufen, wenn man vom unablässigen Hämmern der Geschosse absah. Bis auf das Wummern einer einsamen Flak drang jetzt kein Geräusch mehr in den Keller.
Im Vergleich zu den vorherigen Nächten war es geradezu verdächtig still.
Zu still für Oppenheimers Geschmack. Er ahnte, dass sich irgendetwas zusammenbraute.
Lisa schien kein Problem mit Schlaflosigkeit zu haben, und auch Dieter schlummerte ruhig auf einer weiteren improvisierten Ruhestätte aus Holzkisten. Oppenheimer fragte sich, was Dieter immer wieder nach draußen trieb. Auch am Sonntag hatte er eine kurze Feuerpause genutzt, um erneut eine Expedition in die Umgebung zu starten.
Irgendwann nickte Oppenheimer wieder ein, ohne es zu bemerken, denn als er aus seinem Kokon aus Decken und Laken die Taschenuhr hervorkramte, zeigte sie bereits halb fünf morgens an.
Der Widerschein des Kochfeuers blieb an diesem Morgen die einzige Lichtquelle, denn seit Samstag war der Strom endgültig ausgefallen.
Oppenheimer seufzte. Er hatte es ja kommen sehen. Trotzdem spürte er eine gewisse Niedergeschlagenheit, da es tatsächlich eingetreten war.
Mit schmerzendem Rücken richtete er sich auf, setzte seine rebellierenden Beingelenke in Bewegung und ging zu den Wassereimern hinüber.
Er zählte sechs Behälter mit abgekochtem Wasser. Das konnte knapp werden, vor allem, da sie jetzt eine weitere Person zu versorgen hatten.
Kurzerhand schnappte sich Oppenheimer einen leeren Eimer und entzündete die Petroleumlampe. Erst als er die Flamme hochgeregelt hatte, wagte er sich in die Finsternis jenseits der Gärbottiche. Obwohl er im Mittelgang den herumliegenden Unrat größtenteils beseitigt hatte, konnte man immer noch leicht über lose Steine und freiliegende Kabel stolpern.
Sein Ziel war das unterste Stockwerk des zweigeschossigen Kellers. Dort befand sich im ehemaligen Bierkeller ein Tiefbrunnen, aus dem man früher mit einer Winde das Wasser entnommen hatte. Soviel Oppenheimer erkennen konnte, war er jetzt versiegt und nicht viel mehr als ein kreisrundes Loch im Boden, aber zumindest gab es dort auch einige Wasserhähne. In den letzten Wochen hatten er und Lisa immer wieder versucht, sie aufzudrehen, doch jedes Mal ohne Erfolg. Ehe er den gefahrvollen Weg zur nächsten Wasserpumpe auf sich nahm, wollte Oppenheimer zumindest noch einen letzten Versuch starten, dort an Wasser zu kommen.
Mit tastenden Schritten bewegte er sich an den von Ede abgesperrten Verschlägen vorbei, bis er auf die schmale Wendeltreppe stieß. Der Abstieg war schwierig, denn die Metallstiege war schwarz lackiert, und so konnte Oppenheimer trotz der Lampe kaum erkennen, wohin er den Fuß setzte.
Als er wieder auf festen Boden trat, atmete er auf. Der niedrige Raum des Bierkellers war allerdings nichts für Leute mit Platzangst, und selbst Oppenheimer, der sich über solche Probleme normalerweise nicht zu beklagen hatte, spürte ein gewisses Unbehagen.
Die Luft kam ihm so abgestanden vor wie in einer jahrhundertelang verschlossenen Gruft. Auch hier hatte man nachträglich Verschläge errichtet, während in den nicht genutzten Zwischenräumen unzählige Kisten mit Leerflaschen standen. Ihr stumpfer Glanz verfing sich unter einer dicken Staubschicht.
Oppenheimer atmete tief durch und bahnte sich vorsichtig den Weg zum Brunnenschacht, an dessen Seite sich die Wasserhähne befanden. Erwartungsvoll hängte er den Eimer darunter und drehte an den Griffen.
Dann wartete er. Eine Sekunde. Fünf Sekunden. Zehn Sekunden.
Als nach etwa einer halben Minute immer noch kein Wasser aus den Hähnen plätscherte, gab er schließlich auf.
Nein, es war nichts zu machen. Trübsinnig drehte er die Hähne wieder zu.
Es gab keine Alternative. Entweder er wagte sich nach draußen, oder sie würden hier unten verdursten.
Oppenheimer klappte den Kragen seines Mantels hoch, als er aus dem Gärkeller trat, denn es war bitterkalt. Irgendwo in der Ferne nahm er ein tiefes Grollen wahr, das wie ein schweres Sommergewitter klang. Doch das Donnern und die kurzen Blitze kamen nicht aus den Wolken, sondern vom Boden, und die Ursache davon schien nur wenige Kilometer entfernt zu sein.
Immer wieder zuckten Lichtblitze, abgeschossene Leuchtmunition schwirrte mit hellblauem Feuerschweif durch die Luft, während der Osten der Stadt in feuerrotes Glühen getaucht war. Der Stadtteil musste lichterloh brennen.
Ein heilloses Durcheinander, in dem beide Kriegsparteien wild in jede erdenkliche Richtung schossen. Artilleriebeschuss der russischen Truppen wurde von reichlich nutzlosen Salven der Flaks beantwortet, an anderer Stelle schoss jemand rote Leuchtkugeln in den Himmel.
Es war jetzt halb sechs Uhr morgens. Obwohl es um diese Zeit normalerweise zu dämmern begann, blieb der Himmel heute aufgrund der dichten Wolkendecke dunkel. Oppenheimer musste so früh zur nächsten funktionierenden Wasserpumpe aufbrechen, damit die Warteschlange nicht bereits den ganzen Häuserblock entlang bis zur Pappelallee reichte, denn dann konnte die Wartezeit schon mal zwei bis vier Stunden betragen. Jetzt, wo die Trinkwasserversorgung vollständig zusammengebrochen war, holten gleich mehrere tausend Familien ihr Wasser von dieser Pumpe. Außerdem galt sechs Uhr morgens als die beste Zeit, weil zu dieser Stunde nur selten Luftangriffe stattfanden und auch der Beschuss durch die Kleinkaliber erst später einzusetzen pflegte.
Ansonsten gab es nur noch die Alternative, sich bei den zwei Feuerlöschteichen zwischen der Schönhauser Allee und der Greifenhagener Straße zu bedienen. Allerdings konnte man nicht wissen, was dort in dem trüben Wasser so alles herumschwamm.
Prüfend blickte Oppenheimer nach oben. Dicke Regentropfen fielen ihm ins Gesicht. Für einen Moment überlegte er, ob es nicht besser wäre, einfach an dieser Stelle die Eimer abzustellen, um den Regen aufzufangen.
Doch wenn jemand die Eimer entdeckte, würde derjenige die Metallkübel zweifellos mitgehen lassen. Oppenheimer wusste nicht so recht, ob es ein Zeichen des allgemeinen Sittenverfalls war, jedenfalls schreckte kaum noch jemand vor Diebstahl zurück. Wenn man Besitztümer unbeobachtet ließ, war man selbst schuld, so lautete zumindest die allgemeine Meinung. Was man gebrauchen konnte, das nahm man sich einfach, ohne zu fragen. Die Berliner nannten diese Tätigkeit kurz Zappzarapp-Machen.
Normalerweise brauchte Oppenheimer etwa zwanzig Minuten, um zur Pumpe zu gelangen. Wenn er allerdings sicherheitshalber seinen gewohnten Umweg nahm und über die Trümmerhaufen kletterte, anstatt sich auf die Hauptstraße zu begeben, wo man Gefahr lief, dem Heldenklau in die Arme zu laufen, konnte schon mal eine halbe Stunde daraus werden.
Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen gab es keine absolute Sicherheit.