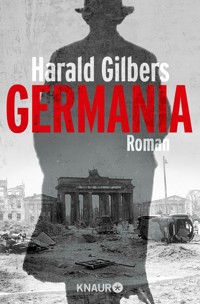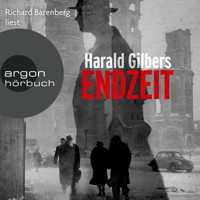9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kommissar Oppenheimer
- Sprache: Deutsch
Selten ist Geschichte so spannend: Der 6. historische Berlin-Krimi mit Kommissar Oppenheimer spielt 1948 zur Zeit der Berlin-Blockade in der vielleicht gefährlichsten Phase des Kalten Krieges, als lediglich die »Rosinenbomber« der Luftbrücke die Versorgung mit dem Nötigsten sicherstellen. Das weiß ein Serienmörder für sich zu nutzen ... Im vom Westen abgeschnittenen Berlin des Jahres 1948 finden Kinder beim Spielen am Spreeufer ein abgetrenntes Bein. Wenige Tage später werden menschliche Organe auf einem Schiff entdeckt, die allerdings von einem zweiten Opfer stammen müssen. Kommissar Oppenheimer steht vor einem Rätsel. Bald darauf stößt er in einer Ruine auf ein bizarres Stillleben: ein Toter am Esstisch, nackt und offensichtlich aus verschiedenen Leichenteilen zusammengesetzt. Die ohnehin schwierigen Ermittlungen zwischen den Besatzungszonen gestalten sich im heraufziehenden Kalten Krieg beinahe unmöglich. Und der Mörder scheint genau zu wissen, welche Schlupflöcher ihm die aufgeheizte Lage bietet … »Mit seiner historischen Krimi-Reihe zeichnet der Historiker Harald Gilbers ein packend-realistisches Bild der 40er-Jahre in Berlin.« Märkischer Sonntag Die historische Krimi-Reihe um den jüdischen Kommissar Oppenheimer aus Berlin ist in folgender Reihenfolge erschienen: 1. »Germania« (1944) 2. »Odins Söhne« (1945) 3. »Endzeit« (1945) 4. »Totenliste« (1946) 5. »Hungerwinter« (1947) 6. »Luftbrücke« (1948)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Harald Gilbers
Luftbrücke
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Nachwort
Literaturhinweise
1
Mittwoch, 16. Juni 1948
Unwiderrufliche Veränderungen im Leben kündigen sich selten vorher an. Sie kommen überraschend, aus dem Hinterhalt. Auch die vier unruhigen Schüler, die sich nach dem Ende der letzten Stunde sehnten, konnten noch nicht ahnen, dass sie an diesem Tag die erste Bekanntschaft mit dem Tod machen würden.
Der Klassenraum war staubig vom herabbröckelnden Kalk. Sven fand, dass dies hervorragend zu dem knochentrockenen Lehrstoff passte. Ungeduldig saß er auf dem Holzstuhl und wippte mit den Füßen. Eigentlich hätte die Schulglocke schon längst schrillen müssen, um das Unterrichtsende zu verkünden.
Heute hatte es Sven besonders eilig. Endlich war wieder Sommer. Und wie jedes Jahr schienen sich um diese Jahreszeit die Tage ins Unendliche zu dehnen. Es gab genügend Zeit, um draußen etwas zu unternehmen, nachdem man der Schule entkommen war. Sven war elf Jahre alt und hatte drei gleichaltrige Kumpane, mit denen er gewöhnlich das Nordufer der nahe gelegenen Rummelsburger Bucht unsicher machte. Dicke Freunde waren sie, die besten überhaupt. Sven konnte sich auf sie verlassen. Er wusste das mit einer Gewissheit, wie sie nur Kinder kennen.
Das Klingeln der Glocke unterbrach die monotonen Erklärungen des Lehrers. In Windeseile räumte Sven seine Bücher in den Tornister und sprang vom Sitz auf. Erst der mahnende Blick des Lehrers erinnerte ihn daran, den Stuhl ordentlich auf die Schulbank zu stellen. Seine drei Kumpels erwarteten ihn bereits auf dem Gang. Mit geschulterten Tornistern stürmten sie die breite Treppe ins Erdgeschoss hinunter und rannten lärmend über den Pausenhof, ihre hellen Stimmen so laut, dass sie sogar das Klappern des angehängten Blechgeschirrs für die Schulspeisung übertönten.
Wie an jedem Tag verweilten sie nur kurz zu Hause. Auch Sven warf seine Schulsachen in die Ecke, kaum dass er eingetreten war, meldete sich eher pflichtschuldig bei der Mutter zurück und nahm dann die erste Gelegenheit wahr, um wieder nach draußen zum Spielen zu gehen. Diesmal bestand seine Mutter allerdings darauf, dass er die Schirmmütze aufsetzte, dessen Seitenklappen über Svens Ohren flatterten. Leider drohte der Sommer, ein Reinfall zu werden. Trotz der angenehmen Temperaturen waren die Tage grau, und gelegentlich prasselten sogar Regenschauer herab. Und auch der typische Sommergeruch fehlte noch, den Sven genau kannte, wenn die Luft in der Hitze flirrte.
Fest entschlossen, den Wetterkapriolen zu trotzen, machte sich Sven auf den Weg zum Medaillonplatz. Wie an jedem Tag traf er sich auf dem Parkgelände mit seinen Freunden. Erst alberten sie herum, bis sie schließlich zum See liefen. Das bewaldete Ufer war ihr eigentlicher Spielplatz. Ein Ort, an dem sie herumtollten und neue Streiche ausheckten.
An diesem unfreundlichen Tag befanden sich nicht viele Menschen in der Nähe. Auch von den Heimkindern aus dem benachbarten Waisenhaus war kaum eines zu erblicken. Svens Mutter hatte ihm ausdrücklich verboten, mit diesen Jungen und Mädchen zu spielen. Sie meinte, dass sie gefährlich wären, nur weil sie gehört hatte, dass in den Knabenhäusern auch einige schwer erziehbare Kinder untergebracht waren. Die anderen Mütter teilten diese Ansicht, und so existierte eine unsichtbare Barriere zwischen Svens Freundeskreis aus geordneten Familienverhältnissen und den Waisenkindern.
Auch das junge Mädchen mit den Zöpfen gehörte zu den anderen. Sven sah sie als Erster, als sich die Jungen dem Ufer näherten. Sie stand direkt vor der Böschung. Wenn das Mädchen nicht vollständig bekleidet gewesen wäre, hätte man meinen können, dass es ins Wasser waten wollte. Starr blickte das Kind in die Fluten, die einzige Bewegung war der im Wind flatternde Rock.
Sven verlangsamte seine Schritte und blieb dann stehen. Er konnte sich die Regungslosigkeit des Mädchens nicht erklären und spürte, dass hier etwas Ernstes vor sich ging. In diesem Moment kam sich Sven sehr erwachsen vor. Gerade noch rechtzeitig fing er Schorsch ab, der Anstalten machte, um einen Baum herumzupirschen, um die Kleine fortzuscheuchen.
»Lass das«, zischte Sven ihm zu.
Schorsch blickte ihn überrascht an und runzelte seine zu kurz geratene Nase. »Der Sache gehen wir auf den Grund«, murmelte er schließlich schmallippig, wie es seine geliebten Westernhelden in den Filmen taten, und übernahm die Führung. Vorsichtig näherten sie sich dem Mädchen. Bald ließ sich erkennen, dass sie am Daumen lutschte. Das Gesicht war gerötet, die Augen waren gesenkt. Sven begriff, dass sie Angst hatte. Und doch war sie gleichzeitig fasziniert von dem Bild, das sich ihr darbot.
Sven folgte ihrem Blick. Die raschelnden Baumkronen tauchten das Ufer in einen sanften Halbschatten. Er musste ein Stück näher kommen, um den fremden Gegenstand deutlich erkennen zu können. Wenige Schritte von dem Mädchen entfernt lag er im seichten Wasser. Zuerst sah Sven im Schlamm der Uferböschung nur einen fahlblauen Schimmer. Dann ließen sich die Konturen ausmachen.
Vor ihnen lag ein Stück Fleisch. Die Schnittfläche war dunkelrot. In der Mitte stach ein blendend weißer Knochen heraus. Sven hatte so etwas gelegentlich beim Metzger gesehen. Einer seiner Freunde murmelte aufgeregt. Auch er hatte erkannt, um was es sich handelte.
Im Schlamm lag ein Unterschenkel. Auch der Fuß war erkennbar. Allerdings stammte er nicht von einem Schwein oder Rind, sondern von einem Menschen.
Die Hände in den Taschen seines Regenmantels, näherte sich Oppenheimer bedächtig der Fundstelle an der Rummelsburger Bucht. Es handelte sich dabei um eine Seitenbucht der Spree, die von der Halbinsel Stralau und dem Berliner Bezirk Lichtenberg eingefasst wurde. Das Leichenteil befand sich auf der Lichtenberger Seite im Norden. Das Areal war den Anwohnern als Bolle-Ufer bekannt, weil die gleichnamige Meierei hier gewöhnlich im Winter das Eis für die Kühlung ihrer Molkereiwaren schlug. Von Eis war jetzt im Juni weit und breit nichts zu sehen. Im Gegenteil, Oppenheimer fühlte sich unangenehm klebrig vom Schweiß, denn sein Mantel war für kältere Temperaturen gedacht als momentan vorherrschten. Er versuchte, es positiv zu sehen. Ein wenig Hitze war immer noch besser, als von einem Regenguss überrascht zu werden.
Zwischen der Handvoll Polizisten am Ufer stach Oppenheimers Assistent Wenzel sofort hervor, denn er war so spindeldürr, dass er stets wie eine verkleidete Vogelscheuche wirkte. Trotz seiner klapprigen Gestalt zeigte er überraschend viel Energie und konnte durchaus zupacken. Voller Tatendrang war er sofort losgelaufen, sobald Oppenheimer das Einsatzfahrzeug in der Stichstraße zum Ufer geparkt hatte. Oppenheimer erinnerte die reibungslose Zusammenarbeit mit seinem Assistenten ein wenig an das Vertrauensverhältnis mit dem verstorbenen Kollegen Billhardt. Sie harmonierten sehr gut miteinander, und als eingespieltes Team verzichteten sie längst auf die gängigen Höflichkeitsfloskeln. Das hatte auch der Dienststellenleiter Cordes erkannt, und so schickte er sie immer häufiger gemeinsam auf Verbrecherjagd.
»Was haben wir denn da?«, fragte Oppenheimer.
Wenzel drehte sich zu ihm um.
»Die Jungs haben dieses Bein hier gefunden und dann die Polizei gerufen.« Er wies auf das abgetrennte Körperteil im Schlamm und nickte zu den Kindern hin, die aufgeregt verfolgten, was die Erwachsenen dort taten. Eine Frau in Zivil stand neben ihnen. Vermutlich war es bereits die angeforderte Kollegin von der Weiblichen Kriminalpolizei. Obwohl es ihre Aufgabe war, sich um die minderjährigen Augenzeugen zu kümmern, konnte auch sie die Aufmerksamkeit kaum von dem Beinfund abwenden.
»Es sieht ganz danach aus, als sei das Bein hier angetrieben worden«, fügte Wenzel hinzu. Dann führte er Oppenheimer aus der Hörweite der Polizisten und murmelte: »Das muss schon einige Stunden her sein. Zuerst trafen die Streifenpolizisten hier ein, um den Fundort zu sichern, dann wurde die Wasserschutzpolizei verständigt. Und erst danach kam jemand auf die Idee, uns hinzuzuziehen.« Er schüttelte den Kopf.
Oppenheimer nickte zerstreut. Er würde sich später um diesen bürokratischen Irrgarten kümmern. Seine Aufmerksamkeit galt jetzt nur dem Körperteil. Er ließ Wenzel stehen und balancierte ungeschickt die steile Uferböschung hinunter. Schließlich stand er dicht genug bei dem abgetrennten Bein, um die Einzelheiten erkennen zu können. »Wenigstens haben wir Hinweise für die Identifizierung«, murmelte er.
Wenzel trat ebenfalls näher und nickte. »Die fehlenden Zehen, ja, das ist ein auffälliges Merkmal.«
Mit knirschenden Gelenken ging Oppenheimer in die Hocke, um sich ein besseres Bild zu machen. Es handelte sich um ein rechtes Bein. Die beiden Zehen neben dem Großzeh fehlten. Oppenheimer betrachtete die Schnittstellen genauer.
»Das sieht gut verheilt aus«, bemerkte er. »Die Amputation dürfte einige Jahre zurückliegen.« Er umrundete das Fundstück, wobei sich nicht vermeiden ließ, dass er mit den Schuhen ins feuchte Erdreich einsank. »Hach, Gummistiefel müsste man haben«, meckerte Oppenheimer mit gesenkter Stimme. Nach einem letzten prüfenden Blick wandte er sich wieder Wenzel zu. »Was hältst du von der Schnittfläche?«
Bei Oppenheimers Frage war der Kollege gerade damit beschäftigt, sich eine Zigarette anzuzünden, da er es nicht lange ohne Nikotin aushielt. Wenzels Beobachtungen bestätigten dann auch Oppenheimers Schlussfolgerung. »Wenn das ein Unfall war, fress ich ’nen Besen. Das Bein wurde glatt abgetrennt, die Schnittkanten sind sauber, praktisch nicht eingerissen. Eine Schiffsschraube kommt auf keinen Fall infrage. Die hätte das Bein regelrecht zerfetzt.«
»Hier ist jemand mit chirurgischer Präzision vorgegangen.« Oppenheimer sinnierte eine Weile vor sich hin. Es geschah etwa alle anderthalb Jahre, dass im Stadtraum von Berlin Leichenteile gefunden wurden. Fast immer ging es dabei um die Verschleierung eines Mordes. Oppenheimer richtete sich auf und sagte mit gesenkter Stimme: »Gehen wir also von einer vorsätzlichen Tat aus. Vermutlich sollte dieses Bein in der Spree entsorgt werden. Das alte Spiel, ohne Leiche lässt sich kein Mord nachweisen.«
»Das muss hier ganz in der Nähe geschehen sein.« Auf Oppenheimers fragenden Blick hin präzisierte Wenzel: »Das Bein befindet sich noch nicht lange im Wasser, das Gewebe ist kaum aufgedunsen. Und das Fließtempo der Spree ist hier recht gering. Das Körperteil kann also nicht weit getrieben sein. Der Täter hat es flussaufwärts ins Wasser geworfen, irgendwo in der Nähe.«
Oppenheimer blickte in die Richtung, von der Wenzel gesprochen hatte. Dort tuckerte ein Lastkahn an den Schloten des Großkraftwerks Klingenberg vorbei. Unablässig spien die hohen Schornsteine schwarzen Qualm aus, als würde unter ihnen die Glut der Hölle lodern. Hier in der Seitenbucht staute sich ein Teil des Spreewassers, damit bestand auch die Möglichkeit von Unterströmungen. Oppenheimer beschloss, gründlich vorzugehen.
»Wir dürfen nichts ausschließen. Zumindest jetzt noch nicht. Beide Ufer kommen infrage und auch die komplette Bucht.«
Wenzel verzog den Mund, woraufhin Oppenheimer abwehrend seine Hände erhob. »Ich weiß, wir müssen es in einem praktikablen Rahmen halten. Konzentrieren wir uns erst mal auf die unmittelbare Umgebung und schauen dann, wohin es uns führt.«
Nach dieser Anweisung kämpften sich Oppenheimer und Wenzel wieder die steile Uferböschung hinauf. Es dauerte eine Weile, bis sich einer der Polizisten erbarmte und ihnen die Hand entgegenstreckte.
Oben angekommen, klopfte Oppenheimer seine Hosenbeine ab. Dann blickte er sich um. Links von ihnen, flussaufwärts, führte eine lange Backsteinmauer zum Flussufer. Von ihrem Einsatzfahrzeug kommend, war Oppenheimer bereits auf der Straßenseite um das mehrere Hektar große Gelände herumgewandert.
»Das dort müsste das Arbeits- und Arresthaus sein, wenn ich mich recht entsinne.«
Wenzel blickte zum steinernen Wall und lachte auf. »Solch eine riesige Anlage als Haus zu bezeichnen, das finde ich stark untertrieben.« Er reckte den Kopf. Bis auf einen einzigen Turm in der Mitte des Geländes ließen sich keine Wachposten erkennen. »Soll das ein Gefängnis sein?«, fragte er dann. »Dafür ist die Bewachung ziemlich lasch.«
Oppenheimer zuckte mit den Schultern. »Während der Nazizeit wurden hier psychisch Kranke eingesperrt und Leute, die als Asoziale gebrandmarkt waren. Ich glaube, ursprünglich war das eine Besserungsanstalt und gehörte zum Waisenhaus. Die Häuser mit den Kindern sind noch in Betrieb. Hier, auf der anderen Seite von uns. Wir stehen genau dazwischen.«
Wenzel blickte entlang des Ufers von einem Gebäude zum anderen. »Also gibt es auch jede Menge potenzieller Augenzeugen.«
»Entschuldigung«, unterbrach eine Frau. Oppenheimer wandte sich um und erkannte, dass die Dame zu ihnen herangetreten war. »Murr, von der WKP«, stellte sie sich vor. »Brauchen Sie die Kinder noch zur Befragung? Es wird spät. Sie müssen bald zum Abendessen nach Hause. Die wichtigsten Fakten habe ich schon zusammengetragen.«
Fräulein Murr mochte vielleicht Mitte zwanzig sein. Die grünen Augen hatte sie vor Eifer weit aufgerissen. Sie boten einen interessanten Kontrast zu den kastanienbraunen Haaren. Wenzels langer Seitenblick ließ erahnen, dass er von der jungen Kollegin sehr angetan war.
»Dieser Junge, Sven, hat die Polizei gerufen«, fuhr Fräulein Murr fort.
Als der Halbwüchsige hörte, dass von ihm die Rede war, trat er einige Schritte zu den Erwachsenen heran. Oppenheimer schätzte ihn ein wenig älter ein als sein Pflegekind Theo, vielleicht elf oder zwölf Jahre. Er trug eine viel zu große Schirmmütze mit Seitenklappen, vermutlich die Mütze eines älteren Jungen, die er auftragen musste. »Ich bin sofort los, um einen Erwachsenen zu holen«, antwortete Sven wie auf Kommando.
»Da hast du völlig richtig gehandelt.« Oppenheimer bekräftigte sein Lob mit einem Kopfnicken. »Wer hat denn das Bein zuerst entdeckt? Warst du das?«
Enttäuscht verzog Sven den Mund. »Das war eine aus dem Heim. Sie stand schon da und schaute hinunter, da wollte ich auch wissen, was da war.«
Fräulein Murr registrierte, dass sich Oppenheimer suchend umblickte. »Das war Evi. Sie ist noch sehr jung und war völlig verschreckt. Ich hielt es für besser, sie vom Fundort zu entfernen. Evis Befragung sollten wir in den nächsten Tagen durchführen, wenn sie sich wieder beruhigt hat.«
Oppenheimer brummte zustimmend. Dann wandte er sich erneut Sven und den anderen drei Jungen zu. »Und was war in den letzten Tagen? Habt ihr in der Nachbarschaft vielleicht verdächtige Vorkommnisse beobachtet?«
Die Kinder tauschten Blicke. Sven runzelte die Stirn. Er sah sich wohl als Anführer, also antwortete er: »Ich weiß nicht, Herr Polizist. Aber wir können uns mal umhörn.«
Die Ernsthaftigkeit des Jungen amüsierte Oppenheimer. Er zwinkerte ihm zu und sagte: »Wir kommen auf dich zurück.«
Auf der Rückfahrt von dem Fundort des abgetrennten Körperteils fühlte sich Oppenheimer ein wenig nervös. Dies hatte allerdings nichts mit dem Fall zu tun, sondern lag an der sich abzeichnenden Währungsreform. Schon seit zwei Wochen kursierten Gerüchte, und in den letzten Tagen waren die Hinweise immer konkreter geworden. Auch Oppenheimer hielt es für wahrscheinlich, dass die Tage der alten Reichsmark endgültig gezählt waren. Was danach kommen sollte, wusste freilich niemand so genau. Um größere Wertverluste zu vermeiden, schien es eine gute Idee, das alte Geld in der Brieftasche auf den letzten Drücker noch schnell in Waren anzulegen, die man nach einer Währungsumstellung gegebenenfalls wieder verkaufen konnte. Diese Strategie hatte allerdings einen gewaltigen Haken, da fast alle Leute zur gleichen Zeit auf dieselbe Idee gekommen waren. Und so waren sie schon vor Tagen in Scharen losgezogen, um ihren Zaster zu versilbern. Auf dem Berliner Schwarzmarkt gab es bereits seit Längerem kaum noch etwas zu kaufen. Oppenheimer ahnte, dass es die illegalen Händler vorzogen, ihre Waren selbst zu horten, um nicht am Schluss auf einem Berg entwerteten Geldes sitzen zu bleiben.
Es war jetzt später Nachmittag. Um noch eine Chance zu bekommen, vor der Schließung der Ladengeschäfte das Warenangebot zu sichten, sollte Wenzel Oppenheimer bei der Rückfahrt zur Dienststelle gleich am Alexanderplatz absetzen.
Die Eindrücke vom Fundort waren allerdings noch so frisch, dass sie die ganze Fahrt über mit Spekulationen über die Herkunft des abgetrennten Körperteils verbrachten.
»Am besten wird es sein, wenn du morgen gleich Fräulein Murr kontaktierst«, sagte Oppenheimer. »Die Kinder müssen noch mal eingehend befragt werden. Momentan sind sie unsere beste Chance, an Hinweise zu kommen.«
Bei dem Gedanken an die Kollegin begann Wenzel, unwillkürlich zu strahlen. Oppenheimer wunderte es nicht, dass ein alter Schwerenöter wie sein Assistent diese Aufgabe mit Freuden übernahm. Obgleich er Wenzels Gattin noch nicht persönlich kennengelernt hatte, wusste Oppenheimer, dass sein Kollege verheiratet war. Doch das hatte Wenzel nicht davon abgehalten, ein Techtelmechtel mit ihrer attraktiven Sekretärin Fräulein Böttcher einzugehen.
Je weniger Oppenheimer von Wenzels Umtrieben wusste, umso besser. Also versuchte er sofort, das Gespräch auf die wichtigen Punkte zu lenken. »Wir müssen auf jeden Fall herausbekommen, ob in den letzten Tagen eine verdächtige Person am Bolle-Ufer gesichtet wurde. Mit etwas Glück hat der Täter vorher Erkundigungen angestellt, um herauszubekommen, wo er das Bein unauffällig in der Spree loswerden konnte.«
Wenzel spann diesen Gedanken weiter. »Vielleicht beobachtet er auch jetzt das Treiben am Ufer. Es wird ihn sicher brennend interessieren, ob wir ihm auf die Spur gekommen sind.«
Oppenheimer zog dies in Betracht. »Denkbar wäre es. Leider ist der Uferabschnitt zu lang, um ihn zu bewachen.«
Noch bevor Wenzel am Alexanderplatz in den Kreisverkehr einbog, hielt er kurz am Straßenrand. Es hatte wieder zu regnen begonnen. Oppenheimer klappte den Kragen des Regenmantels hoch und zog die Hutkrempe nach unten. Mit einer knappen Verabschiedung stieg er aus und hastete über den feucht glitzernden Bürgersteig zum nächsten Vordach.
Im gedämpften Licht des Regentags wirkten die leer gefegten Auslagen der Warenhäuser auf Oppenheimer besonders deprimierend. Aus einem Geschäft drang ein aufgeregtes Gespräch nach draußen. Hinter der Glastür stritt ein Kunde wild gestikulierend mit dem Ladeninhaber.
Wenige Meter von ihm entfernt standen zwei Passanten und tuschelten, die Köpfe zusammengesteckt.
»Tausendzweihundert Mark für ein Pfund«, sagte der eine. »Letzte Woche war es noch halb so teuer.«
»Für ein einziges Pfund Kaffee?«, fragte der andere. »Das kann doch nicht sein. Das ist reiner Wucher.«
»Aktueller Preis, heute früh am Bahnhof Zoo. Bestimmt ist es in den letzten Stunden noch teurer geworden.« Der Sprecher kommentierte seine Antwort mit einem Glucksen.
Umgerechnet zweitausendvierhundert Reichsmark für ein Kilo Kaffee schien tatsächlich übertrieben. Andererseits konnten Oppenheimer die Preisexzesse des Schwarzmarkts für Mangelwaren schon lange nicht mehr beeindrucken.
Nach einer Viertelstunde des Umherschlenderns vor den Geschäften war er nahe dran, seine Suche nach Sachwerten aufzugeben. In fast allen Schaufenstern hing ein Schild mit dem gefürchteten Wort Ausverkauft. Da kam ihm plötzlich eine Idee. Er beschleunigte seine Schritte und lief durch den Regenschleier schnurstracks zur Pfandleihe, in der er im vergangenen Jahr Lisas Weihnachtsgeschenk erstanden hatte. Seine Frau hatte sich sehr über die weinroten Lederhandschuhe gefreut. Möglicherweise gab es dort auch jetzt noch etwas zu kaufen. Von dieser Hoffnung angetrieben, eilte Oppenheimer derart beschwingt dahin, dass ihn nicht mal eine Beinahekollision mit einem Fahrradfahrer aufhielt. Vielleicht war ja das Glück auf seiner Seite, und er stieß in der Pfandleihe auf etwas ähnlich Kostbares wie Kaffee.
2
Mittwoch, 16. Juni 1948 – Donnerstag, 17. Juni 1948
Mit leichtem Geldbeutel und einem in Zeitungspapier eingewickelten Kasten kehrte Oppenheimer anderthalb Stunden später zur Villa seiner langjährigen Vertrauten Hilde zurück. Er schritt die Stufen des Eingangsportals empor und zog die schwere Holztür auf. Nachdem er sich der nassen Sachen entledigt hatte, stieg Oppenheimer mit seiner Neuerwerbung in den ersten Stock, in dem sich sein Zimmer befand. Sorgsam hielt er das Paket aus der Pfandleihe unter den Arm geklemmt. Es war ein Kaffeebesteck aus Sterlingsilber. Zumindest hatte es ihm der Ladeninhaber als solches aufgeschwatzt. Oppenheimer wäre kaum in der Lage gewesen, kostbare Löffel und Kuchengabeln zu erkennen. Aber das zerkratzte Besteck war der klägliche Rest des Warenangebots gewesen.
Abgesehen von den leer geräumten Geschäften, trieb die Kaufpanik in Berlin noch ganz andere, seltsame Blüten. Die Gäste in den Restaurants und Cafés trugen immer häufiger Spendierhosen. Generös rundeten sie auf, manchmal wurden jetzt sogar Zehner und Hunderter für Trinkgelder verprasst. Obwohl Oppenheimer nicht unbedingt knauserig war, scheute er sich vor solchen Exzessen. Schließlich konnte man nicht wissen, wie lange man mit den letzten Kröten noch auskommen musste.
Bevor er am oberen Ende der Treppe angelangt war, knarrten dort die Stufen. Breit grinsend kam Franz Schmude herab, ein Mitglied von Hildes verschworenem Zirkel aus verdeckt agierenden Nazigegnern. In den Zeiten der Unterdrückung hatte Schmude tatkräftig mitgeholfen, untergetauchte Juden wie Oppenheimer zu versorgen. Schmude war Anwalt, doch in einem Karriereschlenker unter Hitlers Willkürjustiz hatte er die unpolitische Arbeit eines Modesaloninhabers vorgezogen und war als unbescholtener Regimegegner jetzt problemlos bei der Stadtverwaltung untergekommen.
»Du siehst wie die Katze aus, die gerade einen Vogel verspeist hat«, bemerkte Oppenheimer.
»Besser als das, mein Lieber, viel besser als das.« Schmude stellte sich zu ihm auf die Treppenstufe. »Haarwasser«, sagte er und klopfte Oppenheimer dabei mit seiner Handprothese auf die Brust. »Mit Brennnesselextrakt und Koffein. Pflegt die Kopfhaut und fördert die Durchblutung. In der Drogerie habe ich die letzten sechzig Liter bekommen. Die Hälfte habe ich schon eingelagert, den Rest muss ich morgen noch abholen.«
»Sieh mal einer an, Franz Schmude, der Haarwasserbaron von Berlin. So wachsen wir in schwierigen Zeiten über uns selbst hinaus.«
Schmude war so begeistert, dass er Oppenheimers Spöttelei nicht wahrnahm. »Kostprobe gefällig?« Ohne auf eine Antwort zu warten, holte er aus seiner Manteltasche ein Glasfläschchen und reichte es ihm. Oppenheimer sah eine gelbe Flüssigkeit und stellte das Kaffeebesteck zwischen seinen Beinen ab, ehe er die Kappe aufschraubte. Das angebliche Haarwasser hatte einen undefinierbaren Geruch. Oppenheimer beschlich das ungute Gefühl, dass der geschäftstüchtige Drogist Schmude gefärbtes Leitungswasser angedreht hatte.
Unter dessen Beifall heischenden Blicken suchte Oppenheimer krampfhaft nach einer positiven Antwort, brachte letztendlich jedoch nur ein Kopfnicken zustande. Zum Glück wurden sie unterbrochen. Mit einem tiefen Knarren zog jemand die Haustür auf. Es war ihre Mitmieterin, die Witwe Vogt. Seitdem ihr Mann vor anderthalb Jahren in der klirrenden Winterkälte erfroren war, trug sie ausschließlich schwarze Kleidung. Sie wirkte wie ein gramgebeugter Schatten, der unablässig durch das Haus wanderte, um die Bewohner an die Endlichkeit des irdischen Daseins zu erinnern. Doch heute war sie zur Abwechslung einmal nicht mürrisch. Zum ersten Mal seit unzähligen Monaten lag in ihren Augen so etwas wie Zufriedenheit.
Bei diesem unverhofften Anblick erstarrten Schmude und Oppenheimer. Der Grund für Frau Vogts gute Laune befand sich in den zwei Einkaufsnetzen, mit denen sie sich mühsam die Treppe hochkämpfte.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?« Oppenheimer klemmte sich das Silberbesteck rasch wieder unter den Arm.
Frau Vogt antwortete atemlos: »Ach, lieben Dank. Ich bin die ganze Strecke vom Fehrbelliner Platz gelaufen.«
Oppenheimer nahm ihr eines der Einkaufsnetze ab und fand es nicht sonderlich schwer, aber er hatte damit auch keine fünf Kilometer zu Fuß zurückgelegt.
Schmude neigte den Kopf zur Seite, während er die Beschriftung von Frau Vogts zahlreichen Tütchen begutachtete. »Was ist das? Etwa Abführmittel?«
»Eine einmalige Gelegenheit«, erwiderte sie aufgeregt. »Da musste ich zugreifen. Die kann ich nach der Geldumstellung sicher wieder an den Mann bringen.«
Oppenheimer verschwieg seine Vorbehalte. Er fragte sich, was die Leute mit Abführmitteln anstellen wollten, wenn die ihnen zugeteilten Nahrungsrationen gerade mal das Nötigste abdeckten. In einer solchen Lage erschien ihm Verstopfung wie ein Luxus.
Nachdem Oppenheimer das volle Einkaufsnetz vor dem Zimmer von Frau Vogt abgestellt hatte, ging er kurz in sein eigenes, um das Kaffeebesteck zu verstauen. Er zog die große Kiste unter dem Bett hervor, in der seine kostbare Schallplattensammlung untergebracht war. Bevor er den hölzernen Besteckkasten dort einlagerte, warf er noch einen kurzen Blick hinein. Auf dem roten Stoff schimmerten die Löffel und Kuchengabeln silbrig. Plötzlich kamen ihm Zweifel, ob er wirklich einen so guten Fang gemacht hatte. Er zuckte mit den Schultern. Jetzt ließ sich sowieso nichts mehr ändern.
Wie gewöhnlich trollte er sich in die Kellerküche, um Muckefuck aufzubrühen. Schmude saß bereits am Tisch vor einer dampfenden Kanne und lud Oppenheimer ein.
Feixend murmelte er ihm zu: »Ich kann mir kaum vorstellen, dass es großen Bedarf an Abführmittel gibt.«
Oppenheimer nickte wortlos. Einen ähnlich großen Bedarf wie nach Haarwasser, dachte er.
Am folgenden Morgen musste Oppenheimer wieder seinen üblichen Ritt auf der Rasierklinge vollführen. Denn wie alle wichtigen Verwaltungsstellen der Polizei und Kripo befand sich auch seine Dienststelle im Ostsektor. Also pendelte er täglich von Hildes Villa im US-amerikanischen Sektor in den Machtbereich der Sowjetischen Militäradministration.
An der S-Bahn-Station Tempelhof stieg er aus und hastete mit eingezogenem Kopf über den feuchtkalten Bahnsteig. Wie gewöhnlich wollte er sich auf dem Weg zur Arbeit noch mit den neuesten Nachrichten versorgen. Der Kiosk im Erdgeschoss hatte ein umfangreiches Angebot, sodass es möglich war, sich rasch über die aktuelle Lage zu informieren.
Interessiert ließ Oppenheimer seinen Blick über die Tageszeitungen aus den Westsektoren schweifen, die immer noch die verlässlichsten Fakten boten, wenngleich auch die Berichterstattung in der Westpresse ideologisch gefärbt war und die Redakteure manchmal, was die Polemik betraf, den Kollegen im Ostsektor in nichts nachstanden.
In den Frühnachrichten des Radiosenders RIAS hatte er mitbekommen, dass die Vertreter der Sowjetischen Militärregierung in der Nacht aus der Alliierten Stadtkommandantur von Berlin ausgetreten waren. Oppenheimer war bestürzt über diese Eskalation. Und jetzt, vor dem Ständer mit den Tageszeitungen, rang er mit sich selbst. Um weitere Informationen zu bekommen, hätte er sich am liebsten eine Ausgabe des britisch lizenzierten Telegraf gekauft. Doch um in seiner Dienststelle keine unliebsame Aufmerksamkeit zu erregen, war es besser, ein Presseerzeugnis aus dem Sowjetsektor zu kaufen. In der Gewissheit, dass Hilde ihn bestimmt über die aktuellen Entwicklungen aufklären würde, griff er sich schließlich ein Exemplar der Berliner Zeitung. Ungeachtet ihrer Nähe zur kommunistischen Einheitspartei SED, hob sich diese lokale Tageszeitung mit dem kritischen Profil positiv vom offiziellen Zentralorgan Neues Deutschland ab.
Wegen des unfreundlichen Wetters fuhr Oppenheimer mit der U-Bahn weiter. In dem üblichen Getümmel kurz vor Arbeitsbeginn gelang es ihm nicht, einen Sitzplatz zu ergattern. Er zwängte sich notgedrungen in eine Ecke, schlang seinen Arm um die senkrechte Haltestange und versuchte, so gut es ging, einen Blick in die Zeitung zu werfen. Zu seiner Enttäuschung war noch kein detaillierter Bericht über den Auszug der sowjetischen Delegation aus der Allied Kommandantura zu finden. Vermutlich war die Zeit bis zum Redaktionsschluss zu knapp gewesen. Also faltete er die sechs Seiten dünne Tageszeitung zusammen und steckte sie in die Tasche seines Regenmantels.
Die Passagiere in dem beleuchteten Abteil machten einen verschlafenen Eindruck. Teilnahmslos ließen sie sich zum Arbeitsplatz bringen. Jeder war mit seinen täglichen Sorgen beschäftigt, zu denen sich erst vor zwei Tagen eine neue gesellt hatte, nämlich dass der Versorgungsweg von Berlin zu den westlichen Besatzungszonen jetzt unterbrochen war.
Die wichtigste Route durch den Sowjetsektor in Richtung Westen war die Autobahn zwischen Helmstedt und Berlin, die seit vorgestern auf unbestimmte Zeit gesperrt worden war, offiziell wegen dringender Reparaturarbeiten an der Elbbrücke bei Magdeburg. Die Bevölkerung der Berliner Westsektoren hielt diese Begründung für eine unglaubwürdige Ausrede. Dazu passte auch, dass immer häufiger Post- und Güterzüge aufgehalten wurden. Die Kontrollstelle an der Sektorengrenze in Marienborn glich einem schwarzen Loch, in dem Waren und andere Sendungen verschwanden. Der Passagierverkehr funktionierte zwar noch, doch es kursierten bereits schauderhafte Gerüchte über die willkürliche Verhaftung von Reisenden und den Bau neuer Grenzanlagen zum Westen hin.
Was sich zwischen den deutschen Zonen abspielte, wurde im Kleinformat auch in Berlin nachvollzogen, denn hier mussten die vier Alliierten auf engstem Raum miteinander auskommen. Die Risse zwischen den beiden großen Lagern traten mittlerweile so deutlich zutage, dass sie mit wohlfeilen Sonntagsreden nicht mehr übertüncht werden konnten. Oppenheimer nahm an, dass sowohl die Schwierigkeiten im Interzonenverkehr als auch das gestrige Scheitern der Stadtkommandantur eine Reaktion auf die Sechs-Mächte-Konferenz in London vor zwei Wochen war. Angesichts des fehlenden Kooperationswillens der Sowjets hatten die Westalliierten damit gedroht, eine eigene Regierung für die drei westlichen Besatzungszonen zu bilden. Oppenheimer beschlich das ungute Gefühl, dass sich die Entwicklungen überschlugen. Er und alle anderen Einwohner von Berlin befanden sich auf einer Fahrt ins Ungewisse.
Den Tag über verbrachte Oppenheimer am Bolle-Ufer auf der Suche nach potenziellen Augenzeugen. Und dabei zeigte sich, dass sogar im Ostsektor der typische Berliner Galgenhumor vor dem Zwist der Großmächte nicht haltmachte.
»Haben Se den schon gehört? In den Westsektoren soll der Osterhase nächstes Jahr durch den Westerhase ersetzt werden.« Frau König kicherte, während sie sich ein dunkelgrünes Kopftuch umband. Auch Oppenheimer lachte auf.
Obwohl er in den angrenzenden Mietshäusern bereits bei zwei Dutzend Wohnungen geklingelt hatte, war Frau König erst die dritte Person, mit der er sprechen konnte. Fast alle Anwohner waren ausgeflogen. Und auch Frau König hatte es eilig, aus dem Haus zu kommen.
Sie hatte Oppenheimer nicht in die Wohnung gebeten. Er stand in der geöffneten Tür zum Treppenhaus und beobachtete, wie sie im Flur in dem Wust der aufgehängten Mäntel hektisch nach ihrer Einkaufstasche suchte. Bei seiner Frage, ob sie in den vergangenen Tagen am Rummelsburger See zufällig ein verdächtiges Treiben beobachtet habe, verharrte sie kurz, um die Brille auf der Nase zurechtzurücken.
»Also, ick kann mich beim besten Willen nich erinnern«, murmelte sie, strich noch kurz eine braun gefärbte Locke unter das Kopftuch und kramte dann auch schon weiter. Schließlich richtete sie sich auf, warf der Garderobe einen kritischen Blick zu und murmelte: »Nein, hier isse nich. Moment, ick muss noch mal kurz ins Wohnzimmer.«
Oppenheimer kam sich merkwürdig fehl am Platze vor. Alle Leute, denen er begegnete, waren zerstreut und gingen kaum auf seine Fragen ein. Er konnte nur hoffen, dass sein Assistent Reinmann mehr Glück hatte.
Frau König öffnete die gegenüberliegende Tür zum Wohnzimmer und versperrte sofort routiniert den Spalt mit dem Bein. Doch zu spät. Ein schwarz-weißer Blitz flitzte hinaus und rannte direkt auf Oppenheimer zu.
»Aufpassen«, rief Frau König. »Patachon darf nicht raus!«
Schnell bückte sich Oppenheimer und konnte in letzter Sekunde einen Kater abfangen, noch ehe er im Treppenhaus verschwand.
Er nahm den vorwitzigen Vierbeiner, der überraschend schwer war, auf den Arm. Da er den Namen einer Hälfte des dänischen Komikerduos Pat und Patachon trug, musste es noch ein weiteres Haustier geben. »Na, wen haben wir da? Wo ist denn dein Kollege?«
»Der ist zum Glück hier drinne«, antwortete Frau König, als sie mit der Einkaufstasche zurück in die Diele kam. Bei dem Anblick ihres Stubentigers in Oppenheimers Arm atmete sie auf.
»Den lass ick nich mehr so schnell raus, nachdem er mir letzte Woche ausjebüchst ist. Du Lausebengel.«
Das Tier legte missvergnügt die Ohren an, als seine Besitzerin es entgegennahm. »Am Freitag hab ick die janze Nachbarschaft nach ihm abjesucht. Ick dachte schon, er sitzt irjendwo in einem Baum und kommt nich mehr runter.« Plötzlich hielt Frau König inne. »Sagen Sie, wann soll ick wat Unjewöhnliches beobachtet haben?«
Von dem abrupten Themenwechsel überrascht, hatte Oppenheimer erst mal keine richtige Antwort parat. »Ich würde sagen, in der letzten Woche«, erklärte er schließlich. »Wenn Ihnen etwas aufgefallen ist, egal, wie nebensächlich es Ihnen auch erscheinen mag, es könnte uns helfen. Ist vielleicht einer Ihrer Nachbarn verschwunden?«
Die letzte Frage war ein Schuss ins Blaue. Solange die Spezialisten in der Rechtsmedizin noch mit dem Bein beschäftigt waren, lagen Oppenheimer keine Hinweise vor, zu welchem Personenkreis das Opfer gehörte.
»Da war tatsächlich wat.« Frau König zog die Nase kraus. »Ick will ja nich, dass jemand wegen mir in Schwierichkeiten kommt, aber als ick Patachon jesucht hab, ist mir so ’n Mann aufjefalllen. Der stand am Bolle-Ufer und sah sich um. Als würd er nach wat suchen oder Ausschau halten.«
»Wann war das genau?«, hakte Oppenheimer nach.
»Na, am Freitag, hab ick doch jesacht. Kurz nach Mittag. Ick dachte, der Mann hätte zufällig meinen Kater jesehen. Also bin ick hin, aber wie er mich ankommen sah, hat er Reißaus jenommen. Wollte nix mit mir zu tun haben.«
Oppenheimer zückte sein Notizheft. »Wäre es Ihnen möglich, mir eine Beschreibung zu geben? Sie sagten, dass es sich um einen Mann gehandelt hat?«
»Richtich jesehen hab ick ihn nich, aber er hatte so ’ne Pletschkappe uffm Kopp und ’ne Latzhose an. Darunter ein Karohemd. Arbeitskleidung halt, bestimmt ’n Handwerker. Er sah dick aus, unförmig irjendwie, war dafür aba ziemlich flink auf den Füßen. Vielleicht lag et an all dem Jedöns, dasser anhatte. Er hatte noch ’nen jefütterten Mantel drüber, aba so kalt war’s ja nich. Der muss janz schön jeschwitzt haben.«
Oppenheimer runzelte die Stirn. Die Angaben kamen ihm merkwürdig vor. Vielleicht schmückte Frau König die Beobachtungen nachträglich aus. So etwas kam relativ häufig vor.
»Konnten Sie das Gesicht erkennen? Oder die Haarfarbe? Gab es auffällige Merkmale?«
Frau König zeigte auf ihre Brille. »So jute Augen hab ick leider nich mehr. Der war zu weit weg. Ick würde sagen, der hatte dunkle Haare, aber beschwören könnt ick et nich.«
In Gedanken hakte Oppenheimer diese Details ab. »Und wo war das? Der genaue Ort?«
»Der stand auf der Höhe der Liebesinsel. Gleich neben der Besserungsanstalt.«
Oppenheimer kniff die Augen zusammen und stellte sich die Karte von Berlin vor. Die Mauer des weitläufigen Geländes war ihm gestern aufgefallen, als er mit Wenzel das abgetrennte Bein begutachtet hatte. Allerdings meinte Frau König die andere Seite nach Osten hin. Sie hatte den Arbeiter mit dem merkwürdigen Verhalten also flussaufwärts circa siebenhundert Meter von dem späteren Fundort entfernt beobachtet. Oppenheimer konnte es nicht verhindern, dass er sofort Spekulationen anstellte. Vielleicht hatte Frau König tatsächlich den Täter erwischt, der gerade dabei war, sich nach einem unauffälligen Platz umzusehen, an dem er das Körperteil in die Spree werfen konnte. Es schien möglich, dass das Bein von dieser Stelle abgetrieben war, an der Besserungsanstalt vorbei, und dann bei den Knabenhäusern wieder ans Ufer gespült wurde.
Da Oppenheimer immer noch grübelnd den Ausgang blockierte, wurde Frau König unruhig. »Entschuldigen Se, aber ick muss jetzt wirklich los. Noch die letzten Einkäufe erledigen, ehe unsere olle Mark abjeschafft wird.«
Oppenheimer trat verdutzt ins Treppenhaus zurück. Während Frau König die Tür hinter sich zuzog und abschloss, fragte er: »Ist die Währungsreform jetzt etwa beschlossene Sache?«
»Sie war’n wohl die janze Zeit unterwegs, wa? Vor ein paar Stunden kam’s im Radio. Morgen Nachmittag um sechs wird der Termin bekannt jemacht. Die Umstellung is nur inne Westzonen, betrifft uns hier inne Sowjetzone eijentlich nich, aber wer weiß. Man muss ja vorsorgen. Bestimmt jibt et dann bei uns auch bald ’ne Russenwährung. Lieber die Mäuse in Naturalien anlegen. Kann man ja immer noch zurücktauschen.«
Hitze schoss Oppenheimer in den Kopf. Die letzten paar Geldscheine brannten förmlich in seiner Brieftasche.
Frau König verabschiedete sich und stieg hastig die knarrende Holztreppe hinab. Oppenheimer blieb unschlüssig im Flur stehen. Er musste sich geradezu zwingen, seinen Verpflichtungen nachzukommen und auch an den letzten drei Wohnungstüren zu klopfen. Zum Glück waren die Bewohner nicht zu Hause, sodass er hier nicht noch mehr Zeit verschwendete.
Reinmann hatte die beiden obersten Stockwerke des Miethauses übernommen. Oppenheimer wollte ihn bei seiner Runde unterstützen, als er ihm auf der Treppe begegnete. An seinem Gesichtsausdruck ließ sich kaum etwas ablesen. Mit dem melancholischen Blick und der tropfenförmigen Nase wirkte Reinmann ohnehin wie die Personifikation der Erfolglosigkeit. Wenn er wie jetzt auch noch die Schultern hängen ließ, war es allerdings ein untrügliches Zeichen dafür, dass er nichts herausgefunden hatte.
Da Oppenheimer von Frau König einen Hinweis auf eine verdächtige Person bekommen hatte, beschloss er, mit Reinmann wieder zur Dienststelle zu fahren. Mittlerweile musste auch Wenzel von der Befragung der Kinder zurück sein. Sie hatten an diesem Tag kein Einsatzfahrzeug bekommen, also nahmen sie die S-Bahn zum Alexanderplatz. Während Oppenheimer beobachtete, wie die Straßenzüge entlang der Spree an ihnen vorbeizogen, wurde er endlich wieder ruhiger. Sein kritischer Verstand setzte ein. Der Drang, auch noch das letzte Geld zu verprassen, kam ihm jetzt töricht vor. Da er im US-amerikanischen Sektor wohnte, war Oppenheimer von der geplanten Geldumstellung direkt betroffen. Andererseits sollte morgen vorerst nur der Termin für den Umtausch bekannt gegeben werden. Niemand wusste, wie lange es bis dahin dauern würde. Eventuell mussten sie alle noch mehrere Wochen mit der alten Reichsmark über die Runden kommen. Deshalb schien es sinnvoll, die letzten Reserven erst einmal zu behalten. Der Besitz von harten US-Dollar war für Deutsche strafbar, und bestimmte Dinge waren schon seit Wochen kaum noch zu bekommen. Nein, es war längst zu spät. Oppenheimer beruhigte sich mit dem Gedanken, dass er mit dem Silberbesteck eine gewisse Vorsorge getroffen hatte. Jetzt konnte er nur noch abwarten.
Bei der Rückkehr fanden sie die Dienststelle verlassen vor. Obwohl noch lange nicht offizieller Feierabend war, schritten Oppenheimer und Reinmann durch hallende Korridore. Die einzige lebende Seele, die Sekretärin Fräulein Böttcher, war ebenfalls in Aufbruchstimmung. Gerade nahm sie ihren modischen Regenmantel vom Kleiderständer. Bevor sie ihnen entwischte, erkundigte sich Oppenheimer nach Wenzel.
»War Gregor heute schon da?«
»Der war kurz hier, ist aber schon wieder weg«, hauchte Fräulein Böttcher. Die hochgezogenen schwarzen Augenbrauen wirkten wie gemalt. Auch die knallrot geschminkten Lippen erinnerten auf der weißen Haut an ein Verkehrswarnschild im Schneegestöber. »Er wollte in der Stadt noch was besorgen. Gregor hat Ihnen etwas dagelassen, so viel weiß ich.«
Oppenheimer ahnte, dass auch Wenzel sein letztes Geld in Waren umsetzen wollte. Die Erwähnung einer Nachricht machte ihn aber neugierig. Schnell lief er zu seinem Zimmer und riss die Tür auf. Ein gefalteter Zettel lag auf Oppenheimers Schreibtisch. Er griff nach dem Papierstück und überflog die handgeschriebenen Zeilen.
»Gibt’s was?«, fragte Reinmann beim Betreten der Schreibstube.
Oppenheimer brummte missgelaunt und zerknüllte den Zettel in seiner Faust. »Die Kinder haben ebenfalls einen Verdächtigen gesehen, aber Wenzel schweigt sich über die Details aus. Er will uns morgen informieren.« Damit warf er den Papierball in den Abfallkorb, schüttelte den Kopf, trat zu den großen Fenstern und schaute, die Arme verschränkt, auf die Neue Königstraße.
»Heute ist es wohl zu spät.« Er seufzte. »Ist ja keiner mehr da. Am besten, wir packen ebenfalls ein.« Dann wandte er sich Reinmann zu. »Eine Sache habe ich aber noch. Morgen früh gehe ich als Erstes zum Leichenschauhaus, um Gebert auf den Zahn zu fühlen. Spätestens um zehn bin ich wieder hier, dann besprechen wir unsere Vorgehensweise. In der Zwischenzeit kannst du unserem Phantombildzeichner Bescheid geben, er soll ebenfalls kommen.«
3
Freitag, 18. Juni 1948
Dr. Gebert verzog das Gesicht, als wäre er auf einen besonders hartnäckigen Krankheitserreger gestoßen. Tatsächlich stand nur Oppenheimer in seiner Bürotür. Mit Gebert verband ihn seit jeher eine gewisse Abneigung, die auf Gegenseitigkeit beruhte. Und heute hatte der Rechtsmediziner besonders schlechte Laune.
»Erst anklopfen«, ermahnte er Oppenheimer mit erhobener Stimme und warf unwirsch seine Papiere auf den Schreibtisch.
Nicht zum ersten Mal war Oppenheimer übereifrig in Geberts Büro geplatzt. Er behielt die Klinke der geöffneten Tür in der Hand und rechtfertigte sich: »Der Sektionsassistent meinte, Sie sind beschäftigt, und ich kann hier auf Sie warten.«
»Natürlich bin ich beschäftigt, und zwar mit meinen Berichten. Nicht mit einer Obduktion. Dieser Trottel von einem Gehilfen.« Gebert raufte sich die schlohweißen Haare und winkte Oppenheimer dann genervt zum Besucherstuhl vor dem Schreibtisch. »Na kommen Sie schon. Treten Sie ein und machen diese, diese Tür zu.«
Einigermaßen beruhigt, dass er nicht mehr das Objekt von Geberts Verärgerung war, setzte sich Oppenheimer. Dennoch fand er das Arbeitszimmer mit den Milchglasscheiben alles andere als einladend. Der Rechtsmediziner räumte seine Unterlagen zur Seite und musterte Oppenheimer, eine Augenbraue hochgezogen. »Also, kurz und schmerzlos, worum handelt es sich?«
»Ein Bein«, antwortete Oppenheimer prompt. »Vorgestern aufgefunden am Rummelsburger See.«
Gebert nickte. »Ach ja, das Körperteil. Ich dachte, ich hätte den Bericht schon an die Dienststelle weitergeleitet.«
»Vermutlich verspätet. Die Kollegen sind gerade ein wenig abgelenkt.«
»Sauhaufen«, murmelte Gebert. »Ein wahrer Sauhaufen.«
Vor allem eine Frage brannte Oppenheimer auf der Seele. »Stammt das Bein von einem Toten?«
»Das ist hier vermutlich der Fall.« Gebert lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Wir konnten im Gewebe fixierte Totenflecke feststellen. An der Schnittfläche befanden sich keine Hämatome. Also hatte die Blutzirkulation bereits ausgesetzt. Zur Todesursache ließen sich leider keine Hinweise finden.«
Oppenheimer holte sein Schulheft hervor und notierte eifrig mit.
»Können Sie etwas zum Schnitt sagen?«
»Ein einfacher Zirkelschnitt, sauber ausgeführt, vermutlich mit einem scharfen Messer. Der Täter verfügt mit Sicherheit über anatomische Kenntnisse. Der Schnitt ist gezielt gesetzt. Es gibt keine Anzeichen für spätere Korrekturen.«
Bei dieser Angabe hielt Oppenheimer inne. »Nun gut, dass der Täter anatomische Kenntnisse hat, das muss nicht unbedingt heißen, dass er beruflich damit zu tun hat. Es könnte sich auch um einen Freizeitjäger handeln.«
Bei den laut geäußerten Überlegungen hob Gebert die Hände. »Das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Diese Spekulationen überlasse ich voll und ganz Ihnen. Was den ehemaligen Besitzer dieses Beins betrifft, kann ich allerdings recht genaue Angaben machen. Kommen Sie mit.«
Gebert sprang mit einer Agilität von seinem Stuhl hoch, die man von der grauen Eminenz unter den Berliner Rechtsmedizinern kaum erwartet hätte. Er führte Oppenheimer zu den Kühlräumen. Während sie lange Korridore durchschritten, zählte Gebert seine Erkenntnisse auf.
»Das Bein gehört zu einem erwachsenen Mann. Er hatte dunkelblonde Haare. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können wir davon ausgehen, dass es sich um einen ehemaligen Soldaten handelt. Ich habe auch eine Ahnung, wo er eingesetzt worden war.«
In Erwartung der kalten Atmosphäre im Kühlraum knöpfte Oppenheimer bereits auf dem Gang seinen Mantel zu. Kunstlicht reflektierte von weiß gekachelten Wänden und blank polierten Stahlfronten. Gebert tauchte in die schattenlose Helligkeit ein und trat zu der Wand mit den Metallschubfächern. Mit lautem Ratschen zog er eine Bahre heraus, schlug das Tuch zur Seite und enthüllte das abgetrennte Bein.
»Hier wurde eine Nekrektomie durchgeführt. Abgestorbenes Gewebe wurde entfernt.« Mit der Kappe seines Füllfederhalters deutete er auf die Stelle, an der die beiden Zehen fehlten.
Selbst bei genauem Hinsehen konnte Oppenheimer nicht viel erkennen. »Das sieht verheilt aus«, sagte er.
»Das ist nicht nur verheilt, sondern sehr gut verheilt.« Gebert blickte Oppenheimer fest in die Augen, um diese Bemerkung zu unterstreichen. »Der Eingriff wurde vor einer längeren Zeit vorgenommen. Es gibt keine Hinweise auf Zuckerkrankheit oder Durchblutungsstörungen. Also ist eine Erfrierung die wahrscheinlichste Ursache für die Entfernung der Zehen.«
Das bestätigte auch Oppenheimers ursprüngliche Einschätzung am Fundort. »Könnte sich dieser Mann die Erfrierungen im Winter vor anderthalb Jahren zugezogen haben? Oder liegt es länger zurück?«
Gebert stützte sich auf dem Kopfteil der ausgezogenen Bahre ab. »Rein theoretisch wäre das möglich. Aber mit Abstand die meisten Männer haben ihre Kälteschäden Anfang 1942 an der Ostfront erlitten. Kollegen haben mir von Russland berichtet. Die Soldaten waren damals eingekesselt und mussten oft tagelang verwundet liegen bleiben, und das bei arktischen Temperaturen. Bei den Rückmärschen kam es ebenfalls zu zahlreichen Frostschäden, weil es für die Truppen praktisch keine Quartiere gab. Sie mussten irgendwo im Freien übernachten. In den Lazaretts wurden meistens Erfrierungen dritten Grades behandelt. Vor allem auf der Krim war das besonders gefährlich, weil es dort nicht nur kalt, sondern auch nass war. Deswegen trat dort sehr häufig die feuchte Gangrän auf.«
Ohne seinen Blick von dem Bein abzuwenden, nickte Oppenheimer. »Und das würde alles zu dieser verheilten Wunde passen«, fasste er zusammen.
Nach seiner Unterredung mit Gebert war Oppenheimer guter Dinge. In dem neuen Fall gab es erste Resultate, und so war auch seine Irritation über die prekäre Lage in Berlin wie weggeblasen. Die neuen Hinweise versprachen, die Suche nach dem Opfer deutlich zu beschleunigen, da sich die Personengruppe jetzt eingrenzen ließ. Voller Elan betrat er seine Dienststelle, stieg freudig pfeifend die große Treppe hinauf und zog noch im Laufen den Regenmantel aus.
Die Tür zu seiner Schreibstube stand offen. Schon von draußen ließ sich erkennen, dass Oppenheimers Assistenten Wenzel und Reinmann bereits an ihrem Doppelschreibtisch saßen.
Oppenheimer warf seinen Mantel über den Kleiderständer. »Wie ich sehe, ist schon Verstärkung da?«
Er nickte zu den zwei weiteren Personen im Zimmer. Fräulein Murr von der Weiblichen Kriminalpolizei kannte er bereits. Der fremde Herr mit der kreisrunden Hornbrille und dem hässlich senfgelben Pullover war der Phantombildzeichner. »Kopp«, stellte er sich zackig vor, sodass Oppenheimer einen militärischen Hintergrund vermutete.
»Neu bei uns?«
»Wie man es nimmt«, antwortete Kopp. »Seit zwei Monaten.«
»Wir haben auch gleich einen Fall, bei dem Sie Ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen können.«
Reinmann schien Schwierigkeiten zu haben, Oppenheimers Schwung mit den frühen Morgenstunden in Einklang zu bringen. Als er endlich zu Wort kam, fragte er: »Gibt es Fortschritte?«
Oppenheimer setzte sich an seinen angestammten Platz hinter dem Schreibtisch. »Das kann man so sagen. Mehr dazu später. Reden wir erst einmal über die Kinder.« Damit wandte er sich Wenzel zu. »Leider bin ich aus deiner Notiz gestern nicht schlau geworden. Die Bengels wollen also etwas gesehen haben?«
Wie auf Kommando erhob sich Fräulein Murr von dem Besucherstuhl. »Zwei von ihnen haben verdächtige Aktivitäten zu Protokoll gegeben.«
Wenzel war die vorwitzige Reaktion seiner Kollegin peinlich. Blitzschnell erklärte er: »Sabine ist sehr an der Arbeit bei der Kripo interessiert. Deshalb wollte sie persönlich an unserer Besprechung teilnehmen.«
»Bei der WKP haben wir es meistens nur mit Sittendelikten zu tun«, erklärte Fräulein Murr.
Amüsiert registrierte Oppenheimer, dass Wenzel sie bereits beim Vornamen nannte.
»Was haben unsere kleinen Zeugen denn gesagt?«
Sichtlich froh darüber, dass Oppenheimer keine Einwände erhob, fasste Fräulein Murr die Aussagen zusammen. Auch den Kindern war ein Mann in Arbeitskleidung und mit Kappe aufgefallen. Allerdings konnten sie den Wochentag nicht sicher benennen, und ähnlich wie Frau König hatten sie das Gesicht nur von Weitem gesehen.
Trotz der fehlenden Details klang das nach einem brauchbaren Hinweis. Schließlich war die Beschreibung des Mannes von mehreren Quellen bestätigt worden. Vergnügt trommelte Oppenheimer mit den Fingern auf die Tischplatte.
»Dann schlage ich vor, dass ihr in Begleitung von Herrn Kopp noch einmal die Kinder aufsucht. Er wird eine Zeichnung anfertigen. Je mehr Einzelheiten, umso besser. Am Nachmittag komme ich vorbei und werde ihn dann zu Frau König begleiten. Wenn es tatsächlich Hinweise gibt, dass es sich um dieselbe Person handelt, wären wir schon ein Stück weiter.« Damit erhob sich Oppenheimer, öffnete die Tür und blickte die zwei Gäste auffordernd an. »Wenn Sie uns bitte entschuldigen möchten, ich muss noch einige Details mit meinen Mitarbeitern durchgehen. Fräulein Böttcher, unsere Sekretärin, wird Ihnen sicher gern eine Tasse Muckefuck zubereiten.«
Kopp verabschiedete sich, doch die Mitarbeiterin von der Weiblichen Kriminalpolizei war sichtlich enttäuscht. Offenbar hatte sie gehofft, in die Ermittlungen einbezogen zu werden. Oppenheimer bedauerte es, sie abschieben zu müssen, doch eine Zusammenarbeit war nur mit dem Segen des Dienststellenleiters Cordes möglich. Schließlich nahm Fräulein Murr die Handtasche, warf Wenzel einen kurzen Seitenblick zu und trat hinaus.
»Die ist sehr ehrgeizig«, sagte Wenzel, sobald Oppenheimer die Tür geschlossen hatte.
Dieser reagierte mit einem Schulterzucken. »Vielleicht ergibt sich ja eine Kooperation.«
Danach fasste er die Hinweise der Rechtsmedizin zusammen. Ein zufriedenes Lächeln umspielte Reinmanns Lippen. »Damit können wir doch etwas anfangen. Männlich, dunkelblonde Haare und Kriegsteilnehmer. Das höchste Wehrtauglichkeitsalter war fünfundvierzig.«
Wenzel war etwas schneller im Kopfrechnen. »Dann müsste das Opfer jünger als achtundvierzig oder neunundvierzig gewesen sein.«
Oppenheimer nickte. »Ich werde mich in der Nachbarschaft weiter umhören. Vielleicht hat jemand eine Ahnung, wer der Mann sein könnte. Gregor, du besuchst mit Fräulein Murr und unserem Zeichner die Kinder.«
Wenzel nickte. Noch ehe Oppenheimer weitere Anweisungen geben konnte, sagte Reinmann: »Das bedeutet also, dass ich die letzten Vermisstenfälle durchgehen soll?«
Oppenheimer nickte. Die Abläufe bei ihnen waren so gut eingespielt, dass die Koordination der Arbeiten fast von allein funktionierte.
»Mal sehen, was wir alles rausfinden.« Damit beendete Oppenheimer die Unterredung.
Nach Feierabend hatte es Oppenheimer eilig, nach Hause zu kommen. Auf jeden Fall wollte er noch rechtzeitig vor der Radiodurchsage zurück sein, damit er endlich erfuhr, zu welchem Termin die Geldumstellung in den Westzonen offiziell geplant war. Bei seinem Eintreffen war es erst halb sechs, also hatte er noch genügend Zeit für ein schnelles Abendessen.
Lisa befand sich mit Theo bereits in der Kellerküche. Obwohl sie bei der britischen Militärverwaltung in Schöneberg als Dolmetscherin arbeitete und deswegen meistens bis zum späten Nachmittag unterwegs war, hielt sie es für ihre Pflicht, für Oppenheimer und das Pflegekind zu kochen. Auch heute wunderte er sich, woher seine Frau die Zeit und Kreativität nahm, die immer gleichen, rationierten Zuteilungen in schmackhafte Abendessen zu verwandeln. Oppenheimer tat sein Bestes, um Lisa bei den alltäglichen Aufgaben ein wenig zu entlasten, indem er das zeitraubende Einkaufen auf sich nahm. Seit ein paar Monaten hatte er zudem im Turnus mit Hilde die Pflege ihrer Gemüsezucht im Garten übernommen. Es war eine willkommene Aufstockung der kargen Zuteilungen, und auch heute stammte ein Teil des Abendmahls von der heimischen Scholle.
Lisa hatte gestern Sellerie-Kartoffeln gemacht. Oppenheimer fand, dass sie auch kalt gut schmeckten, und so verzehrten sie die Reste zusammen mit ein paar Scheiben Brot. Theo beugte seinen verstrubbelten Kopf dicht über die Tischplatte und aß mit langen Zähnen. Vermutlich hätte er lieber eine Wurst verspeist, doch er beklagte sich nicht. Trotz seiner zehn Jahre verstand er, dass sie sich bis zur nächsten Zuteilung der Lebensmittelmarken gedulden mussten.
Theo hatte mitbekommen, dass seine Pflegeeltern noch kurz bei Hilde vorbeischauen wollten, um gemeinsam mit ihr die Radionachrichten zu hören. Theo hatte an Tante Hilde, wie er sie nannte, einen Narren gefressen. Vielleicht lag es ja daran, dass sie keine Anstalten machte, ihn erziehen zu wollen, sondern den Halbwüchsigen wie einen Erwachsenen behandelte. Kaum dass sein Teller leer war, sprang Theo auf, polterte die Treppe empor und lief ihnen voraus.
Mit etwas Verspätung folgten Oppenheimer und Lisa ihm. Es war so frisch draußen, dass es ratsam war, für die kurze Strecke zum Nachbarhäuschen die Mäntel anzuziehen. Hilde bewohnte ein Gebäude, in dem ursprünglich der Chauffeur ihres Onkels untergebracht war, ein Arrangement, auf dem sie bestand, solange fremde Mieter in ihrer Villa einquartiert waren. Immer noch lebten die Berliner zwischen den Ruinen. Im Krieg waren zahllose Mietshäuser zerstört und noch nicht wieder aufgebaut worden. Oppenheimer machte sich nichts vor. Angesichts des knappen Wohnraums würde es noch lange dauern, bis Hilde endlich in das herrschaftliche Anwesen umziehen konnte.
Auf dem Weg zu Hilde legte Oppenheimer den Arm um Lisas Taille und vergrub sein Gesicht kurz in ihren dunkelbraunen Haaren. Vor zwei Wochen hatte sie ihren fünfundvierzigsten Geburtstag gefeiert. Trotz der Schicksalsschläge in den vergangenen Jahren war sie in Oppenheimers Augen immer noch die junge Frau, in die er sich damals verliebt hatte. Es war gut, ihre Nähe zu spüren.
Die Villa, in der sie untergebracht waren, mochte zwar geräumig sein, dafür gab es aber auch mehrere Mitmieter. Meistens herrschte so viel Trubel, dass es außerhalb des eigenen Zimmers kaum Platz für Intimitäten gab. Lisa blieb stehen und lehnte sich an Oppenheimers Schulter. Ein gestohlener Moment der Zweisamkeit. Ihre Stirn war gerunzelt. Etwas schien sie zu beschäftigen.
»Bei den Briten wird es Veränderungen geben«, sagte sie schließlich.
Oppenheimer schrak zusammen. »Du bist doch nicht etwa …«
»Nein, mir wurde nicht gekündigt«, antwortete Lisa eilig, um seine Befürchtungen zu zerstreuen. »Nur, es ist Carruthers. Er wurde abkommandiert. Kaum hat man sich an die Leute gewöhnt, da reisen sie wieder ab.«
Oppenheimer kommentierte dies mit einem zustimmenden Brummen. Carruthers war als Ingenieur der Abteilung Public Works and Utilities mit dem Wiederaufbau der Berliner Brücken beschäftigt. Lisa hatte ihm geholfen, mit den einheimischen Bautrupps zu kommunizieren. Die beiden waren ein gut eingespieltes Team.
»Erst Otto und jetzt auch noch Carruthers.« Die Erwähnung des Apothekers Otto Seibold bedrückte Oppenheimer. »Manchmal scheint es, als ob alle Leute Berlin den Rücken kehren«, murmelte er.
»Wenigstens geht es Otto im Westsektor gut, das hat er ja geschrieben. Abgesehen von seinen Problemen mit dem fränkischen Dialekt.«
Trotz der traurigen Begleitumstände lachte Oppenheimer auf.
»Wenn Carruthers fort ist, werden die Briten sicher andere Aufgaben für dich haben.«
Lisa nickte. Sie standen eine Weile in enger Umarmung auf dem Trampelpfad, bis Oppenheimer schließlich unruhig wurde. Bald würde die Radiodurchsage kommen. Die Straße vor Hildes Anwesen war bereits wie leer gefegt. Nur eine einzige Frau mit Kopftuch schob hastig einen Bollerwagen den Gehweg entlang. Auch sie wollte es noch rechtzeitig zum nächsten Radioempfänger schaffen. Die ganze Stadt hielt den Atem an, gebannt warteten die Leute auf diese Entscheidung, die das Leben nachhaltig beeinflussen würde.
»Ich glaube, wir müssen los«, murmelte Oppenheimer. »Sonst kriegen wir die Meldung nicht mehr mit.«
Beim Betreten von Hildes Wohnzimmer quäkte bereits der Lautsprecher in dem Bakelitgehäuse. Oppenheimer atmete auf. Im Radio spielte immer noch Unterhaltungsmusik, also waren sie rechtzeitig eingetroffen. Neben Theo hatten sich auch schon die Eheleute Schmude vor dem Radio versammelt. Sie waren in Begleitung ihrer beiden Kinder, die in einer Ecke des Wohnzimmers zusammensaßen und sich selbst beschäftigten. Der Sohn Kurth war zwei Jahre jünger als Theo, doch dieser zog wie üblich die Gesellschaft der Erwachsenen vor und hockte mit baumelnden Beinen auf einem viel zu hohen Stuhl. Daneben saß Hilde in einem Sessel zwischen zerlesenen Tageszeitungen. Sie hatte es sich so behaglich gemacht, dass sie wie ein Buddha wirkte. Und zu einer angenehmen Atmosphäre durfte auch der Hochprozentige nicht fehlen. Sie prostete Oppenheimer mit dem gefüllten Schnapsglas zu.
»Noch drei Minuten, und wir wissen, wie der Hase läuft.« Dabei schwenkte sie den selbst destillierten Fusel, sodass etwas davon über den Rand schwappte. »Aber was auch geschieht, wir verlieren sowieso. Zankerei zwischen West und Ost wird es in jedem Fall geben.«
Bei ihrem Anblick blieb Oppenheimer der Mund offen stehen. Mit Hilde war eine drastische Veränderung geschehen. Die dunklen Haare waren jetzt wieder sauber geschnitten und onduliert, die grauen Strähnen waren fortgezaubert. Obwohl diese Art der Wellenfrisur vor fünfzehn oder zwanzig Jahren modern gewesen war, wirkte Hilde an diesem Tag jünger als eine Frau, die geradewegs auf die sechzig zuging.
Anscheinend fiel seine Reaktion nicht so positiv aus, wie Hilde es erhofft hatte. Sie zog die Mundwinkel nach unten und blickte Oppenheimer kritisch an. »Na, sag schon. Hässlich, nicht wahr?«
Während er noch um eine Antwort rang, kam Lisa ihm zu Hilfe. Freudig riss sie die Augen auf und lief auf Hilde zu, um ausgiebig die neue Frisur zu betrachten. »Aber das steht dir sehr gut! Wo hast du nur diesen Friseur gefunden?«
»Ist immer noch der Alte«, antwortete Hilde ein wenig besänftigt. »Aber ich habe ihn ermutigt, mal was auszuprobieren.«
Dabei fing Oppenheimer Hildes Seitenblick auf. Seine Antwort ließ sich nicht mehr länger hinauszögern. Oppenheimer konnte schlecht sagen, dass er sich an das neue Aussehen noch gewöhnen musste. Also verfiel auf die erstbeste Nettigkeit. »Macht dich irgendwie dünner«, sagte er.
Die Tatsache, dass aufgrund der schlechten Versorgungslage ohnehin fast jeder Berliner spindeldürr war, entwertete dieses Kompliment, doch das begriff Oppenheimer erst, nachdem er es ausgesprochen hatte.
Hilde machte eine wegwischende Geste. »Komm, setz dich lieber, eh du dich um Kopf und Kragen redest.«
Schuldbewusst setzte sich Oppenheimer in den Kreis vor dem Radiogerät, hockte zusammengesunken zwischen Lisa und den Schmudes, in der vagen Hoffnung, Hildes Aufmerksamkeit zu entgehen. Franz Schmude hatte den Schlagabtausch mit amüsiertem Grinsen verfolgt. Und es fiel ihm schwer, eine Miene aufzusetzen, die zu dem ernsten Anlass der Währungsreform passte. Seine Frau Inge saß am äußersten Rand der kleinen Gruppe, eine statuenhafte Erscheinung mit hochgesteckten platinblonden Haaren und durchgedrücktem Rücken.
Als im Radio die Musik verstummte und nur noch ein gelegentliches Knacken zu hören war, herrschte in dem kleinen Wohnzimmer eine angespannte Stille. Hilde lauschte mit gesenktem Kopf. Lisa hielt den Atem an. Schmude umkrallte instinktiv mit der Linken den schwarzen Handschuh über der Handprothese an seinem rechten Arm. Sogar seine kühle Frau wirkte jetzt ein wenig ungeduldig.
Die Radiodurchsage fiel dann recht knapp aus. Doch die wenigen Sätze hatten es in sich. In den westlichen Sektoren sollte die alte Reichsmark bereits am Montag aus dem Verkehr gezogen werden. Das neue Geld hieß Deutsche Mark. Die Abwertung beim Umtausch der alten Geldscheine sollte zehn zu eins betragen.
Für Berlin gab es allerdings eine Sonderregelung. Gespannt beugte sich Oppenheimer nach vorn, bis sein Kopf fast die Stoffabdeckung des Lautsprechers berührte.
»Die Währungsneuordnung erstreckt sich zunächst nicht auf Berlin«, verkündete der Sprecher. Oppenheimer bemerkte, wie Schmude neben ihm scharf die Luft einsog. »Berlin als Viermächtestadt behält vorläufig seine alte Geldrechnung.«
Der Sprecher beteuerte zwar, dass es zwischen der Stadt und den Westzonen keine wirtschaftlichen Schranken geben sollte, wie sich das aber mit den unterschiedlichen Währungen in der Praxis umsetzen ließ, verriet er nicht.
Während Hilde noch konzentriert zuhörte, war Schmude bereits in Panik geraten. Aschfahl im Gesicht murmelte er: »Verdammt noch eins, was mach ich jetzt?« Trotz der moderaten Temperaturen zog er ein Taschentuch hervor und fuhr damit über seine feuchte Stirn. »Wo komm ich jetzt an Bargeld ran?«
Sicher hatte er sein komplettes Geld in Waren umgetauscht, und das nächste Gehalt bekam er erst in anderthalb Wochen. Ganz ohne Barreserven versprach das eine lange Durststrecke zu werden.
»Warum hast du nicht auf mich gehört«, zischte seine Frau ihm von der Seite zu. »Du mit deinem unnützen Haarwasser.« Schmudes einzige Antwort war ein flehentliches Händeringen.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Dauerzustand bleibt«, sagte Hilde. Um ihr Fazit zu betonen, knallte sie das Schnapsglas auf die Regalplatte neben dem Radio. »Früher oder später wird die neue Währung auch bei uns kommen. Aber die Westalliierten warten erst mal die Antwort der Sowjets ab.«
»Die werden mit Sicherheit beleidigt sein«, führte Oppenheimer den Gedanken weiter. »Aber wie könnte die Reaktion ausfallen?«
Missvergnügt goss sich Hilde Schnaps nach und brummte: »Die drei westlichen Zonen von Berlin sind Stalins Faustpfand. Wenn die Russen wollen, können sie uns einfach verhungern lassen. Der Warenverkehr zwischen Berlin und Westdeutschland wird ja bereits torpediert. Jetzt müssen die Sowjets nur noch den Personenverkehr unterbinden, und die Blockade wäre perfekt. Der größte Witz dabei ist, dass die Russen damit noch nicht einmal gegen irgendwelche Abkommen verstoßen. Der Zugang der Westalliierten über den Landweg nach Berlin ist nirgends vertraglich fixiert. Im Prinzip kann die Sowjetische Militärverwaltung tun und lassen, was sie will. Es war bislang reine Kulanz, dass sie überhaupt jemanden durchgelassen haben.«
Schmude schenkte diesen Ausführungen kaum Aufmerksamkeit. Weinerlich fragte er: »Ja, aber wann führen sie dann bei uns die neue Währung ein?«
Darauf hatte niemand eine Antwort. In der gespannten Stille hörte man nur, wie im Radio wieder Musik zu spielen begann.
Oppenheimer war betroffen, dass sich Schmude mit seiner Investition in Haarwasser in eine solch schwierige Situation manövriert hatte.
»Also, vielleicht könnte ich dir etwas von deinem Haarwasser abkaufen.« Schnell fügte Oppenheimer hinzu: »Nur zum Eigengebrauch, natürlich, keine Großmengen.«
Schmude wandte sich ihm zu, ohne etwas zu sagen. Vermutlich rechnete er sich gerade aus, wie lange er mit dem Verkauf einer Flasche über die Runden kam.
»Ja, vielen Dank«, sagte er etwas verspätet. »Das würde mir sehr helfen.«
Neben ihm schüttelte Inge noch einmal vorwurfsvoll den Kopf. »Ihr Männer«, murmelte sie.
Auch Lisa war nicht erfreut. Auf dem Rückweg zur Villa flüsterte sie Oppenheimer zu: »Eine Flasche. Eine Flasche und nicht mehr.«
4
Samstag, 19. Juni 1948 – Montag, 21. Juni 1948
Reinmann war derart aus dem Häuschen, dass er unter lautem Gepolter die Tür zu Oppenheimers Büro aufriss. »Ich hab ihn!«, rief er triumphierend und wedelte mit einem Blatt Papier.
Oppenheimer war völlig überrumpelt. So aufgeregt hatte er Reinmann selten gesehen. Und vor allem passte es nicht zu der Wochenendruhe, die sich in der Dienststelle üblicherweise gegen Samstagmittag breitmachte, wenn die Gedanken der Mitarbeiter bereits um den bevorstehenden freien Tag kreisten. Er holte tief Luft und sagte: »Nun mal ganz langsam. Was ist geschehen?«
Wenzel stand von seinem Schreibtisch auf und näherte sich interessiert dem Kollegen. »Du hast eine passende Vermisstenanzeige gefunden?«
Reinmann streckte das Blatt Oppenheimer entgegen. »Norbert Schroeter, Jahrgang 1906.«
Oppenheimer überflog die Notizen und runzelte die Stirn. »Hier stehen aber sieben Namen.«
Reinmanns Optimismus ließ sich von solch nebensächlichen Details nicht erschüttern. »Ich bin die Vermisstenfälle der letzten vierzehn Tage durchgegangen. Dies sind alle verschwundenen Personen, die zu Geberts Beschreibung passen. Ich habe herumtelefoniert, mit Nachbarn und Verwandten gesprochen, und Schroeter ist der Einzige, der nachweislich an der Ostfront war. Einen Haken hat die Geschichte allerdings: Schroeter wohnte nicht in der Nähe des Bolle-Ufers, sondern in Prenzlauer Berg, in der Hufelandstraße.«
»Das ist doch gleich hier in der Nähe«, bemerkte Wenzel.
Oppenheimer blickte aus dem Fenster. Am blauen Himmel hingen weiße Schafswölkchen, die Temperatur betrug etwa zwanzig Grad, und es regnete nicht. Für Oppenheimer, der sowohl große Kälte als auch übermäßige Hitze verabscheute, war das das ideale Wetter. Also beschloss er, die Ortsbesichtigung zu nutzen, um sich die Beine zu vertreten.
Reinmann sollte sie telefonisch beim Hausmeister anmelden, während Oppenheimer bereits Mantel und Hut vom Kleiderständer nahm und zur Hufelandstraße vorauslief. Es war eine Strecke von gerade mal zweieinhalb Kilometern.
Sogar im Schatten fand Oppenheimer es draußen so sommerlich, dass er den Regenmantel nach wenigen Schritten auszog und sich über den Arm legte.