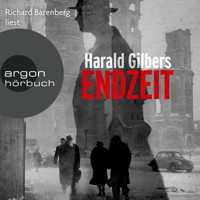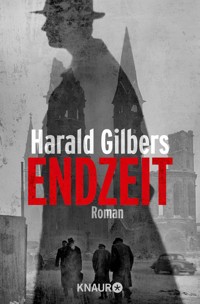9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kommissar Oppenheimer
- Sprache: Deutsch
Kommissar Oppenheimer jagt den Al Capone von Berlin: »Trümmertote« ist der 7. Teil der preisgekrönten historischen Krimi-Reihe aus dem Berlin der 40er Jahre. Berlin 1949: Während tagsüber die Aufräumarbeiten voranschreiten, blüht nachts das Verbrechen. Besonders Gewaltdelikte nehmen rasant zu, und so ist Kommissar Oppenheimer nicht sonderlich überrascht, als auf einer Schuttdeponie eine Leiche entdeckt wird. Eine genauere Untersuchung des Areals fördert zwei weitere Tote zutage; alle drei Männer wurden brutal ermordet. Von einem Kontakt in der Berliner Unterwelt erfährt Oppenheimer, dass ein Jugendlicher namens Jo seinen Aufstieg zum Verbrecherkönig nach dem Vorbild Al Capones vorantreibt. Wer sich ihm und seiner Bande in den Weg stellt, hat sein Leben verspielt … Mit seiner historischen Krimi-Reihe »Ein Fall für Kommissar Oppenheimer« hat Harald Gilbers eine packende Mischung aus Fakten und Fiktion geschaffen, die das Berlin der Nachkriegszeit lebendig werden lässt. Die historischen Kriminalromane um den jüdischen Kommissar Richard Oppenheimer aus Berlin sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Germania (1944) - Odins Söhne (1945) - Endzeit (1945) - Totenliste (1946) - Hungerwinter (1947) - Luftbrücke (1948) - Trümmertote (1949)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Harald Gilbers
Trümmertote
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kommissar Oppenheimer jagt den Al Capone von Berlin:»Trümmertote« ist der 7. Teil der preisgekrönten historischen Krimi-Reihe aus dem Berlin der 40er Jahre.
Berlin 1949: Während tagsüber die Aufräumarbeiten voranschreiten, blüht nachts das Verbrechen. Besonders Gewaltdelikte nehmen rasant zu, und so ist Kommissar Oppenheimer nicht sonderlich überrascht, als auf einer Schuttdeponie eine Leiche entdeckt wird. Eine genauere Untersuchung des Areals fördert zwei weitere Tote zutage; alle drei Männer wurden brutal ermordet. Von einem Kontakt in der Berliner Unterwelt erfährt Oppenheimer, dass ein Jugendlicher namens Jo seinen Aufstieg zum Verbrecherkönig nach dem Vorbild Al Capones vorantreibt. Wer sich ihm und seiner Bande in den Weg stellt, hat sein Leben verspielt …
Mit seiner historischen Krimi-Reihe »Ein Fall für Kommissar Oppenheimer« hat Harald Gilbers eine packende Mischung aus Fakten und Fiktion geschaffen, die das Berlin der Nachkriegszeit lebendig werden lässt.
Die historischen Kriminalromane um den jüdischen Kommissar Richard Oppenheimer aus Berlin sind in folgender Reihenfolge erschienen:Germania (1944)Odins Söhne (1945)Endzeit (1945)Totenliste (1946)Hungerwinter (1947)Luftbrücke (1948)Trümmertote (1949)
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Nachwort
Literaturhinweise
1
Mittwoch, 16. Februar 1949
Die Blutspur ließ sich leicht erkennen, sogar in der dunklen Seitengasse. Der massige Mann mittleren Alters, dem der Schmerz Furchen ins Gesicht gegraben hatte, stieß bei dieser Erkenntnis einen unterdrückten Fluch aus. Es war kurz vor der Sperrstunde, und er kauerte verborgen hinter einem bereits geschlossenen Schnellimbiss. Mit angehaltenem Atem lauschte er in die Nacht, während er krampfhaft seinen verwundeten Arm umklammerte und hoffte, nicht entdeckt zu werden.
Er hieß Erwin Hupke. Als bekannte Gestalt in der Berliner Unterwelt genoss er ein gewisses Ansehen. Jetzt wusste Hupke, dass es ein Fehler gewesen war, den üblichen Tagesablauf beizubehalten. So zu tun, als wäre nichts geschehen. Nichts war mehr beim Alten, seitdem er die Polizei eingeschaltet hatte. Zum wiederholten Mal an diesem Abend verfluchte er sein Schicksal und fragte sich, wieso er in diese tödliche Klemme geraten war.
In einer Großstadt wie Berlin gab es viele Möglichkeiten, um an Geld zu gelangen. Und Erwin Hupke hatte sich auf die weniger legalen Methoden spezialisiert. Skrupel kannte er so gut wie gar nicht, er machte bei jedem krummen Ding mit, das ihm angeboten wurde. Sein eigentliches Talent bestand jedoch im Verhökern heißer Waren.
Hupke waren seine hervorragenden Verbindungen in den Ostteil dabei besonders zugutegekommen. Denn um den Schwarzmarkt auszutrocknen, betrieb die Sowjetische Militäradministration in Weißensee seit einigen Jahren eine offizielle Ankaufstelle, bei der sich Waren jeglicher Art losschlagen ließen. Meistens handelte es sich bei den Kunden um Privatleute, die ihre Erbstücke in Bargeld verwandelten, um die kargen Standardrationen aufzubessern. Der Andrang bei der Ankaufstelle war derart groß, dass es nicht einmal Aufsehen erregte, wenn Hupke dort in schöner Regelmäßigkeit mit Koffern voller Juwelen aufkreuzte. Die vor etwas mehr als sieben Monaten eingeläutete Blockade der westlichen Stadtsektoren hatte Hupke allerdings genötigt, sein Geschäftsmodell zu überdenken, weil seitdem die Schlupflöcher für illegale Waren eines nach dem anderen dichtgemacht wurden. Neuerdings mussten sich die Berliner an den Grenzen zum Sowjetsektor sogar Taschenkontrollen gefallen lassen. Doch der gewitzte Hupke hatte bald die Vorteile erkannt, denn momentan besaßen ohnehin nur die amerikanischen Besatzungssoldaten das nötige Kleingeld, um Wertgegenstände zu kaufen. Und weil gleich Tausende G.I.s nach passenden Liebesgaben für die Familie, die Verlobte oder die Ehefrau in der fernen Heimat suchten, florierten auch Berlins Antiquitätengeschäfte. Kistenweise wurden Gemälde, Meißener Porzellan – und dazwischen auch so mancher wertloser Nippes – über den Atlantischen Ozean geschickt. Und nicht wenige der feilgebotenen Preziosen stammten aus Hupkes illegalen Quellen. Ohne Umwege gelangte die heiße Ware ins Ausland, wo sich ihre Spur für immer verlieren würde.
Und Hupkes Virtuosität beim Losschlagen von Diebesgut war in der Berliner Unterwelt nicht lange ein Geheimnis geblieben. Angesichts seiner Berühmtheit als zuverlässiger Hehler hatte er sich nichts dabei gedacht, als vor ein paar Wochen neue Kunden bei ihm aufkreuzten. Es waren junge Schnösel, denen Hupke auf den ersten Blick nicht viel zugetraut hätte. Doch die notdürftig in einem Stofftaschentuch eingewickelten Brillanten waren zweifelsohne echt, und so hatte sich Hupke schließlich breitschlagen lassen, den Schmuck anzukaufen.
Niemals hätte er damit gerechnet, von seinen neuen Kunden so schnell wieder Besuch zu bekommen. Und vor allem nicht zu nachtschlafender Stunde. Dass nur ein dünner Vorhang Hupkes Nachtlager von seinem improvisierten Ladengeschäft trennte, war letztendlich ein Glück gewesen, denn vor drei Tagen hatten ihn verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Hupke musste nur den Vorhang zur Seite ziehen, um zu erkennen, dass Diebe versuchten, von außen ein Loch durch die Wand zu schlagen, um an Hupkes Tresor zu gelangen. Aber die Öffnung war noch zu klein, um den Metallquader hindurchziehen zu können.
Bei ihrer Entdeckung durch Hupke waren die Diebe immer noch damit beschäftigt, die Steine aus der Wand zu lösen. Also hatte der erzürnte Hehler nicht lange gefackelt, sich eine Taschenlampe sowie seine Schusswaffe geschnappt und war dann lautlos aus dem Seitenfenster gestiegen und ums Haus herumgelaufen. Festnageln ließen sich die Ganoven zu Hupkes Bedauern nicht mehr. Bereits vor seinem Eintreffen hatten sie Lunte gerochen und waren getürmt.
Doch er war nicht bereit, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Obwohl zu Hupkes üblichen Geschäftspartnern Gauner jeglicher Couleur zählten, hielten sich doch alle an die ungeschriebenen Gesetze der Unterwelt. Keiner von ihnen wäre auf die Idee verfallen, den eigenen Hehler zu beklauen. Also war sich Hupke sicher, dass nur diese Halbstarken dahinterstecken konnten. Angesichts einer solchen Unverfrorenheit fühlte er sich nicht länger an den Kodex der Ganoven gebunden. Er hatte sich bei seinen Unterweltkontakten umgehört und war mit den Informationen schließlich zur Kripo gegangen.
Und genau das sollte sich in dieser Nacht rächen.
Diese jungen Habenichtse waren wohl doch nicht so dämlich, wie sie aussahen. Irgendwie waren sie dahintergekommen, dass Hupke sie verpfiffen hatte. Und so waren vor gerade mal zehn Minuten zwei schmächtige Jungs vor seiner Wohnung aufgekreuzt.
Hupke war von seiner üblichen Runde durch die Nachbarschaft zurückgekommen und dabei nichts ahnend in die Falle getappt. Die Häscher hatten in der Nähe seiner Wohnung herumgelungert. Hupke hatte ihnen kaum Aufmerksamkeit geschenkt, denn sie waren nichts weiter als ein paar halbwüchsige Bengels, die nicht einmal die Mäntel richtig ausfüllten. Lediglich die abstehenden Ohren verhinderten, dass ihnen die Hüte über die Brauen rutschten. Doch so traurig diese Gestalten auch aussahen, ihre Taten waren von tödlicher Konsequenz. Wie üblich war Hupke zu Fuß unterwegs gewesen. Als er sich der Hofeinfahrt auf etwa zehn Meter genähert hatte, waren sie ihm plötzlich mit gezückten Waffen entgegengesprungen und hatten ihn mit einem Bleihagel begrüßt.
Zum Glück waren Hupkes Möchtegernmörder miserable Schützen. Profis hätten versucht, die Distanz zum Opfer weiter zu verringern. Und so war es Hupke gelungen, den Kugeln auszuweichen. Flink wie ein Hase war er zwischen geparkte Autos gesprungen und hatte dann die Beine in die Hand genommen. Dass sie ihn trotzdem am Arm erwischten, war reines Pech gewesen.
Seitdem befand sich Erwin Hupke auf der Flucht.
In seinem Versteck kam ihm die Stille allmählich verdächtig vor. Er konnte sich sowieso nicht die ganze Nacht hinter dem Schnellimbiss verstecken. Vorsichtig reckte er sich, um die Gasse zu sondieren. Kein Passant war zu sehen. Hupke überlegte, ob er es wagen konnte, die Deckung zu verlassen. Er hatte noch einen anderen Unterschlupf, nur lag dieser in der Nähe des Steglitzer Stadtparks. Bis dorthin waren zwei unendlich lange Kilometer zu überwinden. Hupke berechnete seine Überlebenschancen. Das Resultat gefiel ihm nicht.
Trotzdem verließ der seine Deckung und schleppte sich den Lichtern der Hauptstraße entgegen. Er war so angeschlagen, dass ihm der Schweiß auf die Stirn trat.
Nach ein paar Metern glaubte er, hinter sich Schritte zu hören. Die Augen weit aufgerissen, drehte er sich im Laufen um. Augenblicklich zuckten höllische Schmerzen durch seinen Arm. Er hatte die Schusswunde unterschätzt. Beim ersten Adrenalinschub hatte er lediglich ein kurzes Stechen bemerkt. Es war aber offensichtlich doch mehr als nur ein Kratzer, und vermutlich steckte die Kugel noch in seinem Muskel. Hupke musste stehen bleiben, bis der Schmerz abgeflaut war. Dabei blickte er die Straße entlang. Sie war leer. Auch die hallenden Schritte waren verklungen. Hupke gelangte zu dem Schluss, dass er vermutlich seine eigenen Schritte gehört hatte. An der Ecke zur Schloßstraße angelangt, warf Hupke schnelle Blicke um sich. Strom und Gas waren immer noch streng rationiert und zu kostbar, um damit die Hauptstraßen von Westberlin lückenlos zu erhellen. Und so brannte nur jede zweite oder dritte Straßenlaterne. Hupke war sich bewusst, dass in den weitläufigen dunklen Passagen ungeahnte Gefahren lauerten.
In den letzten Tagen hatte der Regen den Schneematsch fortgespült, und auf den Straßen war ein kaltes Glitzern zurückgeblieben. Werktags zu dieser späten Stunde, und dann auch noch bei nasskaltem Wetter, herrschte nicht viel Betrieb. Nur einzelne Passanten durchquerten die Lichthöfe der Straßenlaternen. Nirgends war ein Taxi zu sehen, in das Hupke hätte springen können. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu Fuß zu gehen, um zu seinem Unterschlupf zu gelangen. Und dazu musste er früher oder später die breite Straße überqueren.
Hupke zögerte. Es war ein Risiko, denn er würde unvermittelt auf dem Präsentierteller stehen. Er wusste nicht, wo seine Häscher steckten. Sie konnten überall auf ihn lauern, das war in der Dunkelheit nicht einzuschätzen. Das Häusergewirr auf der gegenüberliegenden Seite versprach Schutz. Dort konnte er in die Nebengassen eintauchen und querfeldein laufen.
Noch während Hupke versuchte, sein letztes bisschen Mut zusammenzunehmen, schwang rechts von ihm die Tür zur Kindl-Schänke auf. Lachende Menschen traten aus dem Wirtshaus mit den großen Fensterfronten. Es waren zwei G.I.s mit ihren Mädchen und ein weiteres Paar. Blitzschnell verwarf Hupke seinen ursprünglichen Plan und suchte den Schutz der Gruppe. Mit hochgeschlagenem Mantelkragen folgte er den Kneipenbesuchern. Die jungen Leute scherzten miteinander, eine Frau lachte. Hupke befand sich nur wenige Zentimeter hinter ihnen, und doch fühlte es sich so an, als würden ihn Welten von den unbeschwerten Nachtschwärmern trennen.
Aus dem Augenwinkel sah er vereinzelte Passanten. Spazierten sie zufällig die Straße entlang, oder folgten sie seiner Spur? Was befand sich in ihren ausgebeulten Manteltaschen, Feuerwaffen oder doch nur kalte Fäuste? Während Hupke mechanisch hinter den G.I.s herlief, überlegte er fieberhaft, wie er unbemerkt über die breite Straße kommen sollte.
Im Windschatten der lustigen Zecher näherte er sich der Kreuzung zur Albrechtstraße. Wenige Meter vor dem Rathaus sprang Hupke kurz entschlossen in einen Hauseingang. Er starrte den Weg entlang, den er soeben zurückgelegt hatte.
Und dann sah er sie.
Seine Vorahnung hatte ihn nicht getäuscht. Trotz des wilden Zickzacks über Trümmergrundstücke war es Hupke nicht gelungen, die Verfolger abzuschütteln. Sie waren ihm dicht auf den Fersen. Unter den eingeschalteten Straßenlaternen beschleunigten sie die Schritte, um schnell wieder aus dem Lichtkegel herauszukommen und in die Finsternis einzutauchen, ihr eigentliches Element.
Im Scheinwerferlicht eines Fahrzeugs konnte Hupke für wenige kostbare Sekunden deutlich erkennen, wie seine Verfolger die Umgebung inspizierten. Die Mörder machten keine Anstalten, ihre Absichten zu verheimlichen. Die Pistolen hatten sie nicht weggesteckt, sondern hielten sie locker in den Händen. Sie hatten begriffen, dass der von ihnen Verfolgte früher oder später die Straße überqueren musste. Jedoch wussten sie nicht, an welcher Stelle.
Erst als die zwei Bewaffneten hinter sich ein tiefes Donnern vernahmen, steckten sie hastig die Waffen weg. Der schwere Motor gehörte zu einem Greyhound-Spähpanzer mit aufgebautem Maschinengewehr. Wie üblich befanden sich Gendarmen der US Army Constabulary auf einer Patrouillenfahrt durch den Ortsteil Steglitz.
Diese Ablenkung war eine günstige Gelegenheit. Jetzt oder nie, sagte sich Hupke. Während seine Verfolger noch versuchten, im Scheinwerferlicht der Militärpolizei harmlose Passanten zu mimen, machte er einen Satz nach vorn und rannte über die Kreuzung. Gegen den erneuten Schmerz biss Hupke die Zähne zusammen, presste den Arm noch etwas fester gegen seinen Körper und hastete weiter.
Schräg gegenüber befanden sich die Albrechtshof-Lichtspiele. Die Abendvorstellung war gerade zu Ende gegangen. Rege diskutierend traten die Kinobesucher auf den Gehweg und strebten zur S-Bahn. Hupke tauchte in der Menge unter und erreichte die Bahnunterführung. Als die Passanten seitlich zum Bahnsteig hochstiegen, beschleunigte Hupke seine Schritte und lief geradeaus in das Wohngebiet auf der anderen Seite der Schienenstränge.
Das Viertel war in völlige Dunkelheit getaucht, doch Hupke benötigte keine funktionierenden Straßenlaternen, um sich hier zu orientieren. Immer noch rennend, bog er nach rechts ab. Er wollte nur weg von der Hauptstraße und den Bahngleisen und hinein in das Labyrinth der altvertrauten Gassen.
Eine Viertelstunde später erreichte Hupke mit trockenem Mund und schmerzendem Arm sein Ziel. Es war ein ganz normaler Wohnblock, und wie bei den meisten anderen Häusern wurde der Komfort zunehmend schlechter, je weiter man die Etagen nach oben stieg. Vor fünf Jahren hatte hier eine Brandbombe eingeschlagen. Das hastig errichtete Notdach war seitdem zum Dauerprovisorium geworden, im darunterliegenden Stockwerk pfiff aus allen Ritzen ein steter Wind. Der Hauswart hatte Hupke im obersten Stockwerk ein Zimmer angeboten, das im Gegensatz zu den umliegenden Räumen wenigstens trocken war. Das Bestechungsgeld war saftig, doch Hupke zahlte gern, wenn er dafür ein sicheres Versteck für das gelegentliche Aufbewahren von Diebesgut bekam. Jetzt waren diese vier Wände seine letzte Zuflucht. Oder zumindest würden sie es so lange sein, bis die Kripo dieses Geschmeiß, das hinter ihm her war, ins Kittchen brachte.
Hupke war erleichtert, es hierher geschafft zu haben. Er machte eine unbedachte Bewegung. Prompt schmerzte sein Arm wieder höllisch. Scharf sog er die klare Winterluft ein. Hupke erkannte, dass er unmöglich mehrere Tage hier untertauchen konnte, bis Gras über die Sache gewachsen war. Die Kugel musste innerhalb der nächsten Stunden aus seinem Arm entfernt werden. Vielleicht war es am besten, gleich am Morgen zum Präsidium in der Friesenstraße zu fahren. Im Gewimmel des alltäglichen Berufsverkehrs würde er seinen Verfolgern kaum auffallen. Und wenn Hupke erst einmal dort eingetroffen war, gab es sicher eine Möglichkeit, ihn in einem Polizeikrankenhaus unterzubringen und fachgerecht zu versorgen. Die Aussicht, nach all diesen Scherereien ein paar Tage auf Staatskosten durchgefüttert zu werden, gefiel Hupke durchaus.
Er blieb an der Straßenecke stehen, bis der Schmerz in seinem Arm wieder etwas abgeklungen war. Die massive Mietskaserne gegenüber schien sogar in der Nacht noch Schatten zu werfen. Die Haustür befand sich seitlich in der Durchfahrt zum Hinterhof. Das Feuerzeug bereits in der Hand, hielt Hupke kurz vor dem Anzünden inne. Der Schein der winzigen Flamme würde sowieso nicht weit genug reichen, um den Eingang zu erkennen. Hupke steckte das Feuerzeug wieder in die Tasche und beschloss, lieber auf seinen Tastsinn zu vertrauen.
Auf der anderen Seite der Straße angekommen, schlich er an der Hausmauer entlang, bis seine Hand ins Leere griff. Das musste die Durchfahrt sein. So dicht vor der Haustür wurden Hupkes Schritte schneller. Er konnte es kaum erwarten, sie hinter sich zu schließen und sich in Sicherheit zu wissen.
Plötzlich ertönte ein leises Geräusch. In Hupkes Nacken bildete sich eine Gänsehaut.
Er war nicht allein hier. Wenige Meter vor ihm stand ein Mann, der geräuschvoll ausatmete. Fast glaubte Hupke, den Atemzug in seinem Gesicht zu spüren.
Er blieb abrupt stehen. Dabei ratschten seine Schuhsohlen laut über den Boden. Hupke fuhr zusammen und fluchte in sich hinein. Er hatte sich verraten.
Hupkes Sinne waren aufs Äußerste geschärft. Das hier musste eine Falle sein. Er konnte sich nur noch retten, indem er sich nicht mehr bewegte, sich im Dunklen verleugnete.
Wie als Antwort auf seine Gedanken drang aus der Finsternis ein leises Kichern. Dann hörte Hupke wieder das Atmen.
Instinktiv wich er zurück und prallte mit dem Rücken gegen einen weichen Gegenstand. Plötzlich umschlossen ihn von hinten stählerne Arme. Der Druck auf die Wunde ließ ihn aufschreien. Mit vor Schmerz verzerrtem Gesicht rang er nach Luft.
Ein Lichtblitz. Leise zischte der Schwefel eines Zündholzes. Die schmale Feuerzunge erhellte Hupkes Gegenüber. Ein junger Mann mit ebenmäßigen Gesichtszügen stand vor der Haustür. Bei Hupkes Anblick verzog er den Mund zu einem höhnischen Grinsen.
»Na, wen haben wir denn da?« Die Stimme des Fremden klang heiser. »Wenn das nicht der gute alte Hupke ist.« Spielerisch streckte der junge Mann den Arm aus und ließ die Flamme dicht vor dem Gesicht seines Gefangenen tanzen.
Hupke verstand, dass er sich die ganze Zeit über etwas vorgemacht hatte. Die zwei schießwütigen Halbstarken waren nicht seine einzigen Verfolger gewesen. Dieser Kerl wusste alles über ihn. Er kannte sogar Hupkes Lager. Er und seine Kumpane hatten nichts weiter tun müssen, als ihn hier abzupassen.
Verzweifelt versuchte Hupke, sich zu befreien, doch die Umklammerung wurde nur noch fester. Hupke jaulte ein letztes Mal auf und sank in sich zusammen.
Es war aussichtslos. Er hatte einen Punkt erreicht, an dem ihm die Realität glasklar ins Bewusstsein drang.
Er würde diese Nacht nicht überleben.
2
Donnerstag, 17. Februar 1949
Oppenheimer konnte sein Pech kaum fassen, denn für den nächtlichen Großeinsatz hatte man ihn ausgerechnet zusammen mit Wenzel eingeteilt. Der Hof der ehemaligen Kaserne, in der sich jetzt die Kripozentrale von Westberlin befand, war in dieser Nacht in schwaches Licht getaucht. Wegen der Stromrationierungen hatte der Hausmeister die Dieselgeneratoren angeworfen, um mehr schlecht als recht die von den Holzpfählen herabhängenden Flutlichter zu versorgen. Wenn schon Dutzende Kripoleute ausrücken mussten, dann sollten sie auf dem Weg zu den Einsatzfahrzeugen wenigstens etwas sehen können. Oppenheimer öffnete die Beifahrertür des ihnen zugeteilten Volkswagens, klappte die Sitzlehne nach vorn und zwängte sich misslaunig auf die Rückbank. Auf der anderen Seite setzte sich Kommissar Franck neben ihn.
Daraufhin rückte der grauhaarige Kollege Großkurth nach, klappte die Rückenlehne des Fahrersitzes wieder nach hinten und zwängte sich hinter das Lenkrad. Er war so groß, dass er den Sitz erst mal zurückschieben musste, um ungehindert die Pedale erreichen zu können.
Für Wenzel blieb der vordere Beifahrersitz übrig. Das war Oppenheimer durchaus recht, denn zu viel Nähe zu ihm konnte er gerade nicht vertragen. Seitdem Wenzel mit seiner Gattin in die Villa von Oppenheimers guter Freundin Hilde eingezogen war, herrschte eine gewisse Anspannung zwischen ihnen. Sie bewohnten dasselbe Stockwerk, nur leider war der sonst so umgängliche Kollege privat kein einfacher Wohnungsnachbar. Erschwerend kam hinzu, dass das Zusammenleben des Ehepaars Wenzel nicht gerade harmonisch verlief. Schon mehrmals hatten lautstarke Auseinandersetzungen Oppenheimer und seine Frau Lisa in der Nacht aus dem Schlaf gerissen.
Mittlerweile bereute Oppenheimer es fast, Wenzel die freie Einzimmerwohnung angeboten zu haben, doch es war die einzige Möglichkeit gewesen. Sein Kollege hätte damals als Angehöriger der West-Kripo unmöglich länger im Sowjetsektor wohnen können. Weil er seinen Beruf beim Klassenfeind ausübte, hatten ihn die dortigen Behörden des Ortsteils Weißensee als politisch unzuverlässig eingestuft. Das bedeutete, dass Wenzel nur Lebensmittelkarten der niedrigsten Stufe bekommen hatte, außerdem gab es im Ostsektor für Mitglieder der westlichen Polizeibehörden das reale Risiko, entführt und in eines der berüchtigten Speziallager für gefährliche Personengruppen gesteckt zu werden. Völlig zu Recht war es Wenzel im Sowjetsektor zu riskant geworden.
Vom Rücksitz aus konnte Oppenheimer erkennen, dass Wenzels Hand bereits auf dem Zigarettenpäckchen lag, das in der Brusttasche seines Anzugs steckte. Er wollte sich in dem voll besetzten Auto die unvermeidliche Zigarette anzünden.
Vor zwei Monaten hatte Wenzel erfolgreich die Prüfung zum Kommissar absolviert. Damit gingen für ihn einige Privilegien einher. Er konnte jetzt eigene Fälle bearbeiten, nicht zuletzt befand er sich in einer besseren Gehaltsklasse, die trotz allem noch jämmerlich war, wenn man den Zeitaufwand und die Mühen gegenrechnete. Wenzel schien gerade zu überlegen, ob der Nimbus eines Kommissars ihm erlauben mochte, jetzt eine Zigarette zu rauchen.
Franck wurde unruhig. Im Gegensatz zu Oppenheimer, der wie ein Sack Kartoffeln zusammengesunken auf der Rückbank kauerte, schaffte er es, trotz des beengten Raums einigermaßen Haltung zu bewahren. Zu seinem nach oben gedrehten schwarzen Schnurrbart hätte er nur noch ein Monokel benötigt, um den Eindruck eines schneidigen jungen preußischen Offiziers zu erwecken. Franck warf Wenzel von der Seite einen mahnenden Blick zu und grollte: »Das ist doch wohl nicht dein Ernst? Öffne wenigstens das Fenster.«
Und Wenzel verstand. Um Franck nicht unnötig zu verärgern, setzte er eine harmlose Miene auf und klopfte nur kurz auf die Brusttasche.
Draußen näherte sich im Schein der Flutlichter Kriminalrat Seeßlen und blickte schmunzelnd durch die geöffnete Beifahrertür. Obwohl dieser gesetzte Herr mit seiner Halbglatze und der Brille auf den ersten Blick keine so imposante Figur wie Franck abgab, trug er als Dienststellenleiter einen Großteil der Verantwortung für den nächtlichen Einsatz.
»Also, macht mir keine Schande«, sagte er mit einem aufmunternden Nicken und schloss von außen die Tür. Großkurth startete den Motor und fuhr durch das weit geöffnete Metalltor vom Hof.
»Wo soll ich euch Jungs denn absetzen?«
Wenzel antwortete für Oppenheimer: »Wir müssen in den französischen Sektor, nach Reinickendorf.«
»Ich komme mir vor wie auf einem Schulausflug«, sagte Großkurth gut gelaunt.
Obwohl ihr Großeinsatz kein Ausflug war, sondern eine ernste Angelegenheit, spürte auch Oppenheimer ein Kribbeln in der Magengegend. Seeßlen hatte vor einer Stunde alle Mitarbeiter der Dienststelle zusammengetrommelt, um ihnen die nötigen Informationen zu geben. Leider waren die Hinweise spärlich gewesen. Oppenheimer hatte nur so viel mitbekommen, dass in der Nacht in den westlichen Sektoren eine große Razzia bevorstand und man mit zahlreichen Verhaftungen rechnete.
Um Zeit zu sparen, wurde die Mannschaft vom Präsidium auf die Westberliner Polizeireviere aufgeteilt, um gleich vor Ort die Datenerfassung und Vernehmungen abwickeln zu können.
Oppenheimer wandte sich kurz um und sah durch das Rückfenster, wie weitere Einsatzwagen von dem Kasernenhof auf die Straße fuhren. An der nächsten Kreuzung bogen die ersten Wagen aus der Kolonne in die Seitenstraßen ab. Die roten Rücklichter entfernten sich und verschwanden zwischen den Häuserzeilen.
»Statt Schüler auf einem Ausflug machen jetzt lauter Kommissare die Stadt unsicher«, murmelte Oppenheimer gerade laut genug, dass Großkurth es mitbekam. Bei dessen Gelächter knarrte die Federung des Fahrersitzes gleich mit.
Einige Stunden später wurde Oppenheimer von einem klingelnden Telefon geweckt. Er brauchte eine Weile, um sich in der ungewohnten Umgebung zurechtzufinden. Er befand sich in einem Aufenthaltsraum, in dem ein Dutzend fremder Polizisten und Zivilfahnder versuchten, die Nacht mit Skatrunden hinter sich zu bringen.
Kein einziger böser Bube war in den Nachtstunden eingeliefert worden, ebenso wenig hatte es einen Befehl zum Ausschwärmen gegeben. Den Polizeistreifen war es lediglich gelungen, zwei stark angetrunkene Männer aufzugreifen, die sich vermutlich in der Ausnüchterungszelle befanden. Irgendwann hatte sich der gelangweilte Oppenheimer in eine Ecke des Aufenthaltsraums verzogen und es sich auf dem harten Stuhl halbwegs gemütlich gemacht, bis ihm die Augen zugefallen waren.
Niemand war seitdem auf die Idee gekommen, ihn wach zu rütteln. Doch jetzt war etwas geschehen. Durch eine geöffnete Tür konnte Oppenheimer erkennen, dass Wenzel telefonierte.
Noch etwas benommen richtete er sich auf und rieb sich kurz mit den Händen über das Gesicht. Dann angelte er seine Taschenuhr aus der Hose. Es war ein Weihnachtsgeschenk von seiner Frau Lisa. Oppenheimer war zuerst völlig verblüfft darüber gewesen, wie es ihr gelungen war, einen solch kostbaren Gegenstand aufzutreiben. Doch Lisa war findig und hatte ihre Beziehungen am Flughafen Gatow spielen lassen, wo sie für die britische Luftfahrtlinie British European Airways arbeitete. Neben Tempelhof und Tegel war es einer der drei Stützpunkte, über denen die Luftbrücke nach Westberlin abgewickelt wurde. Und neben der dringend benötigten Lebensmittelversorgung der Bevölkerung nahmen die Piloten und Hilfskräfte auch gern Gelegenheiten für private Nebengeschäfte wahr.
Oppenheimer musste die Augen ein wenig zusammenkneifen, bis die Position der Uhrzeiger einen Sinn ergab. Es war jetzt halb sechs. Wegen der Stromrationierung würden die Straßenbahnen erst in zweieinhalb Stunden damit beginnen, die Werktätigen zur Arbeit zu bringen.
Es dauerte nicht lange, bis Wenzel das Telefonat beendet hatte und sich zu Oppenheimer setzte. Er schien es nicht besonders eilig zu haben.
»Das war’s für heute«, bestätigte Wenzel Oppenheimers Vermutung, dass der Großeinsatz als Fehlschlag abgehakt werden konnte. »Das Präsidium hat angerufen. Wir können einpacken.«
Wenzel blies in seine Tasse und trank einen Schluck Ersatzkaffee. Oppenheimer reckte seine schmerzenden Glieder.
»Haben sie auch gesagt, wie wir zurückkommen sollen? Holt Großkurth uns wieder ab?«
Kopfschüttelnd antwortete Wenzel: »Wir müssen die S-Bahn nehmen.«
Das war zu dieser frühen Stunde ohnehin die einzige Möglichkeit, um nach Hause zu kommen. Die S-Bahn wurde im gesamten Stadtbereich von der Deutschen Reichsbahn betrieben, deren Sitz sich im Ostteil der Stadt befand. Damit waren die Züge als einziges öffentliches Verkehrsmittel in Westberlin von den Stromsperren verschont geblieben. Bei dem Gedanken, dass ihnen eine nervtötende Warterei auf einem zugigen Bahnsteig bevorstand, ließ Oppenheimer die Schultern hängen.
Wenigstens zeigte ein Polizist Erbarmen mit den Gästen von der Kripo und brachte sie mit einem Einsatzfahrzeug zum Bahnhof Wittenau. Weil die Strecke der Nordbahn in Richtung Oranienburg nur eingleisig befahren wurde, mussten sie fast zwanzig Minuten warten, bis ein Zug in Richtung Innenstadt auftauchte. Irgendwann sehnte sich Oppenheimer nur noch nach seinem Bett. Beim Umsteigen an der Station Gesundbrunnen betrat er einfach den erstbesten bereitstehenden Zug und ließ sich völlig erledigt auf den Sitz fallen.
Wenzel zögerte, sich neben ihn zu setzen. Irritiert blickte er sich um. »Sind wir auch richtig hier?«
Als Oppenheimer ihm einen fragenden Blick zuwarf, schlossen sich unter dem hydraulischen Zischen bereits die Türen, und der Zug fuhr los. Er beugte sich zum Fenster und schirmte mit der Hand die Augen ab, um draußen etwas erkennen zu können. Bei dem Anblick fuhr ihm der Schrecken in die Glieder. Das weiße Stationsschild bewegte sich in die falsche Richtung. Anstatt nach Schöneberg zu fahren, steuerte ihr Zug direkt auf die Sowjetzone zu.
Oppenheimer fluchte vor sich hin. Das hatte ihm noch gefehlt.
Die Ringbahn von Groß-Berlin durchquerte alle vier Stadtsektoren. Den zahlreichen Pendlern war dies während der Fahrt bisher kaum aufgefallen, doch seit die Blockade Westberlins am 18. Januar dieses Jahres auch noch mit einer Gegenblockade beantwortet worden war, hatte sich alles auf einen Schlag verändert. Jetzt gab es beim Überqueren der Grenze zum Ostsektor täglich Gepäckkontrollen – in Straßenbahnen, auf U-Bahn-Strecken und natürlich auch in der S-Bahn. Um die Taschenkontrollen zu ermöglichen, wäre es zu aufwendig gewesen, die Züge extra anzuhalten. Also stiegen im Ostsektor in den letzten Stationen Polizisten in die S-Bahn, um stichprobenartige Durchsuchungen vorzunehmen.
Oppenheimer rückte unruhig auf dem Sitz hin und her. Er hoffte, dass die Kontrolleure nicht auf die Idee kommen würden, seine Papiere zu inspizieren. Wenn herauskam, dass er und Wenzel zur westlichen Kripo gehörten, konnte es unter Umständen haarig werden. Offiziell hatten sie im Ostsektor keinerlei Befugnis zur Strafverfolgung. Wenn auch nur der geringste Verdacht aufkam, dass man im Dienst war, konnte eine Stippvisite in den Ostteil der Stadt schnell mit einer Verhaftung enden.
Der Zug nahm Fahrt auf. Wenige Sekunden später lag die Sektorengrenze bereits hinter ihnen. Oppenheimer lehnte sich wieder zurück. Die nächste Station Schönhauser Allee befand sich im sowjetischen Machtbereich. Eilig dort umzusteigen würde nur unnötig die Aufmerksamkeit der Bahnwache auf sie lenken. Es war besser, die nächsten acht Stationen mit angehaltenem Atem durchzufahren, bis sie auf der anderen Seite der Ringbahn wieder im amerikanischen Sektor eintrafen.
Auch Wenzel begriff das und nahm endlich Platz. Die Arme verschränkt, starrte er vor sich hin. Er klappte seinen Mund auf, als wollte er sich über Oppenheimers Unachtsamkeit beschweren, doch außer einem leisen Knurren brachte er nichts hervor.
Nach einigen weiteren Stopps näherten sie sich schließlich der Haltestelle Ostkreuz. Wenzel riss die Augen auf und flüsterte: »Ach, verdammt.« Dann sackte er auf seinem Sitz zusammen und zog die Hutkrempe in die Stirn.
Alarmiert erkannte auch Oppenheimer, dass zwei Volkspolizisten von der Ostpolizei ins Abteil gestiegen waren. Sie trugen lange Wintermäntel mit Schulterklappen und Kragenspiegel. Einer von ihnen lüftete kurz die Schirmmütze mit den hochgebundenen Ohrenklappen und wischte sich mit dem Ärmel über die feuchte Stirn.
Die nächste Station Treptower Park war die letzte im Ostsektor. Die Vopos hatten nicht viel Zeit, um Schmuggler zu fangen. Noch ehe sich der Zug wieder in Bewegung setzte, begannen sie, die Taschen der Reisenden zu inspizieren.
»Wir haben keine Waren dabei«, wisperte Oppenheimer Wenzel zu, ohne seinen Blick von den beiden Polizisten abzuwenden. »Die werden uns bestimmt nicht rausziehen.«
Die Kontrolleure spulten ihre Routine ab. Jeder von ihnen übernahm eine Seite des Wagens. Der Polizist vor Oppenheimer war jetzt nur noch drei Sitzreihen entfernt. Mit einem prüfenden Blick schlenderte er an den Passagieren vorbei. Noch während Oppenheimer versuchte, ein harmloses Gesicht aufzusetzen, wusste er bereits, dass er jämmerlich versagte.
Es kam jedoch nicht mehr zu der Kontrolle. Bei der Sitzreihe vor ihm blieb der Polizist abrupt stehen. Das Gesicht zuckte. Irgendetwas hatte sein Interesse geweckt.
»Zeigen Sie mir die Tasche.« Im elektrischen Licht der S-Bahn konnte Oppenheimer erkennen, wie eine schmale Hand mit Altersflecken eine Einkaufstasche überreichte. Der Polizist kramte darin herum und zog ein Päckchen Kaffee hervor. Triumphierend befahl er: »Kommen Sie mit!«
Er zerrte eine verschreckte alte Dame in den Mittelgang. Sie versuchte, sich zu rechtfertigen. »Das hab ich in Moabit gekauft, im Westen. Ich will doch nur nach Hause.«
»Das können Sie uns auf der Polizeiwache erklären«, schnarrte der Vopo und griff nach ihrem Arm. Sein Kollege trat von hinten heran und packte die Frau auf der anderen Seite. Im Klammergriff wurde sie zur Tür geschoben.
Eine fremde Passagierin stand von ihrem Sitz auf und rief empört: »Nu lasse Se doch die arme Frau in Ruh, die hat Ihnen nix jetan!«
Ein förmlich gekleideter Herr mit einer schwarzen Melone auf dem Kopf, der sich im Gang an einer Schlaufe festhielt, sagte: »Die können nichts, außer harmlose Leute zu drangsalieren. Bolschewistenpack!«
Dieser Kommentar rief unter den Passagieren zustimmendes Gemurmel hervor. Einige Jugendliche tuschelten miteinander und stellten sich vor den Ausgang. Sie schienen sich zum Aussteigen bereit zu machen, doch als dann die Türen zur Seite klappten, rührten sie sich nicht vom Fleck.
Die Polizisten mit der alten Dame drängten sich an sie heran. Die jungen Leute schenkten ihnen keine Aufmerksamkeit und versperrten die geöffnete Tür.
»Lassen Sie uns durch!«, bellte der erste Polizist.
Als die Ordnungshüter bemerkten, dass ihre Befehle auf taube Ohren stießen, machten sie kehrt und hetzten den Mittelgang entlang, um noch rechtzeitig vor der Weiterfahrt die zweite Tür zu erreichen.
Sie hatten nicht mit den Fahrgästen gerechnet, die nicht mehr herumkommandiert werden wollten. Sie waren der Willkür der Sowjetmacht überdrüssig. Sicher galt das auch für einige Bewohner im Ostsektor, aber besonders traf dies auf die Bevölkerung in den drei westlichen Sektoren zu, die vom restlichen Westdeutschland de facto abgeschnitten waren. Die Lebensmittel, die über die Luftbrücke der Westalliierten die Bevölkerung erreichten, konnten die Verbitterung nicht lindern. Im Gegenteil, die Sowjetische Militäradministration und deren Befehlsempfänger wurden in den westlichen Stadtteilen immer stärker als Feind wahrgenommen.
Und der seit Monaten, wenn nicht gar Jahren aufgestaute Frust entlud sich nun in diesem engen S-Bahn-Abteil. Ein Mann stand von seinem Platz auf und tat so, als würde er sich zum Aussteigen bereitmachen. Dann stand eine zweite Passagierin auf, dann deren Sitznachbarin. Auch Oppenheimer und Wenzel spürten, dass sich hier eine Revolte anbahnte, erhoben sich von ihrem Platz und drängten sich an die Polizisten heran. Innerhalb von Sekunden war der Mittelgang von einem guten Dutzend Passagiere blockiert. Hände griffen nach den Polizisten und hielten sie an den Mänteln fest.
Der zweite Vopo versuchte erfolglos, sich loszumachen.
»Was soll das?«, rief er beinahe flehentlich, während der erste Polizist mit hochrotem Kopf brüllte: »Loslassen! Ich befehle ihnen …«
Es war bereits zu spät. Die Türen klappten zu. Niemand auf dem Bahnsteig hatte die Randale in dem Abteil wahrgenommen. Unter dem Summen des Triebwerks setzte sich die Bahn in Bewegung. Die Polizisten mussten hilflos mit ansehen, wie der Bahnsteig vor den Fenstern verschwand. Während sie noch mit den Fahrgästen rangelten, fuhr der Zug unbeirrt auf seiner vorbestimmten Route am Treptower Park vorbei.
Wenige Minuten später befanden sie sich bereits im US-amerikanischen Sektor.
Immer noch im Gedränge stehend, lachte Oppenheimer auf. Weiter hinten im Abteil klatschte jemand kurz Beifall.
Unter den Passagieren war die Stimmung jäh in Erleichterung umgeschlagen. In den Gesichtern der Volkspolizisten spiegelte sich hingegen blanke Panik. Ohne Vorwarnung befanden sie sich jetzt im Feindesland.
An der Station Sonnenallee klappten die Türen wieder auf, und die beiden widerstrebenden Männer wurden von den Pendlern aus dem Wagen geschoben. Oppenheimer konnte sich vorstellen, was jetzt mit ihnen geschehen würde. Die westlichen Ordnungshüter würden nicht lange fackeln, die Personalien und Wohnadressen der Ostkollegen aufnehmen, um sie wenige Tage später in Westberliner Zeitungen wie dem Tagesspiegel in aller Öffentlichkeit abzudrucken, wo die Kontrolleure als sogenannte Banditenpolizisten gebrandmarkt wurden. Oppenheimer fand diese moderne Form des Prangers extrem heikel, nicht zuletzt deshalb, weil hier Persönlichkeitsrechte verletzt wurden. Doch angesichts der wiederholten Entführungen von Privatpersonen und Polizisten in den Sowjetsektor war die allgemeine Stimmung mittlerweile derart aufgeheizt, dass sich nicht einmal mehr die Behörden von solchen Bedenken beirren ließen.
In Hildes Villa eingetroffen, stiegen Oppenheimer und Wenzel in der Vorhalle die breite Treppe empor. Sie waren nach dem Nachteinsatz derart erschöpft, dass sie schnurstracks in ihren Zimmern verschwanden.
»In der Küche ist noch etwas Brot für dich«, wurde Oppenheimer von Lisa begrüßt. Sie war bereits fertig für einen weiteren Arbeitstag. In der marinefarbenen Uniform mit den Emblemen der BEA stand sie vor dem kleinen Spiegel und steckte sich gerade die dunklen Haare hoch.
Oppenheimer stellte sich hinter sie und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Dann fielen ihm Lisas Augenringe auf.
»Wieder eine unruhige Nacht?«, fragte er und nickte zum benachbarten Zimmer, in dem das Ehepaar Wenzel wohnte.
Als Antwort verdrehte Lisa die Augen. »Astrid hat fast die ganze Nacht durchgeweint. Es war laut genug, um mich wach zu halten.«
Oppenheimer verzog den Mund. Er ahnte, dass es wohl an Wenzels außerehelichen Eskapaden lag, dass bei ihm der Haussegen schief hing. In der Zeit ihrer Zusammenarbeit war Oppenheimer bereits aufgefallen, dass Gregor ein Schwerenöter war und nichts anbrennen ließ. In der alten Dienststelle im Sowjetsektor hatte er mit der Sekretärin Fräulein Böttcher angebandelt, und soweit Oppenheimer überhaupt noch mitkam, war Wenzels letzte Flamme Fräulein Murr von der Weiblichen Kriminalpolizei, die er bei den Ermittlungen zum Fall der Serienmörderin Ostendorf kennen- und schätzen gelernt hatte. Man konnte nicht behaupten, dass Wenzel sonderlich diskret vorging. Und dass Wenzels Frau Astrid mittlerweile ihre direkte Zimmernachbarin war, machte die Situation nur noch komplizierter.
Auch Lisa war über die amourösen Umtriebe von Oppenheimers Mitarbeiter im Bilde. »Vielleicht denkt Astrid, dass Gregor die Nacht bei einer anderen war.« Sie setzte sich den zur Uniform gehörenden Pillbox-Hut auf und schlüpfte zum Schluss in ihren Wintermantel. Lisa hatte die dunklen Schatten unter ihren Augen überschminkt und sah jetzt wie frisch aus dem Ei gepellt aus. Verglichen mit ihr kam sich Oppenheimer sichtlich ungepflegt vor. Er begann, die verschwitzte Kleidung auszuziehen, in der er die ganze Nacht zugebracht hatte, um sich noch ein paar Stunden ins Bett zu legen.
»Ich könnte Astrid ja bestätigen, dass Gregor die ganze Zeit mit mir zusammen war«, brummte Oppenheimer, während er mechanisch den Hosengürtel öffnete.
»Das wird nichts bringen. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass er sie bei jeder sich bietenden Möglichkeit betrügt.« Schulterzuckend fügte Lisa hinzu: »Im Prinzip scheint sie ja recht zu haben.«
Mit letzter Kraft zog Oppenheimer sein Hemd aus und ließ sich dann auf die quietschende Matratze fallen. »Was soll man sagen«, seufzte er. »Gregor denkt eben manchmal mit dem falschen Körperteil.«
Oppenheimer deckte sich zu und war auf der Stelle eingeschlafen.
Als er gegen Mittag in ihrer Dienststelle zur Spätschicht erschien, erwartete ihn bereits Kommissar Franck. Oppenheimer fühlte sich immer noch völlig ausgelaugt, also schnappte er sich in der Büroküche einen Becher und goss sich Ersatzkaffee ein. Franck wartete unterdessen mit verschränkten Armen im Türrahmen, bis sein Kollege ansprechbar war.
Nachdem Oppenheimer einen großen Schluck aus dem Becher genommen hatte, fragte Franck: »War gestern bei euch noch was los?«
»Das Schweigen im Walde. Und bei dir?«
»Absolut nichts. Wenigstens habe ich mit den Kreuzworträtseln meinen Wortschatz etwas aufgemöbelt. Übrigens, wir haben Besuch. Wir warten nur noch auf dich.«
»Jaja, ein alter Mann ist kein D-Zug.« Da er auf seinen fünfzigsten Geburtstag zusteuerte, fand Oppenheimer, dass er ruhig ab und zu mal jammern konnte.
Die Kommissare hatten sich allesamt in Großkurths Büro versammelt. Draußen war ein dunkelgrauer Tag, also brannte zu dieser frühen Stunde dort bereits das Licht. Dass der Dienststellenleiter Seeßlen nicht zugegen war, wertete Oppenheimer als Zeichen, dass es sich um keine offizielle Versammlung handelte. Er schlängelte sich mit der dampfenden Tasse in der Hand durch die Schar der Kollegen, bis er eine freie Schreibtischkante fand.
Großkurth nickte ihm zur Begrüßung zu. »Dann sind wir ja komplett.« Er wies auf einen fremden Herrn, der mitten im Zimmer stand. »Das hier ist Herr Lüdecke vom Raubdezernat. Er war für den gestrigen Einsatz verantwortlich.«
Lüdecke mochte in den Vierzigern sein, doch die Sorgenfalten auf der Stirn ließen ihn älter wirken. Das breite Gesicht unter den kurzen Haaren war eigenartig eingebeult. Mit der platt gedrückten Nase und dem vorstehenden Kinn erinnerte Lüdecke an einen Preisboxer, der schon lange keinen Sieg mehr feiern konnte. Und wie sich herausstellte, hatte der Kollege vom Raubdezernat tatsächlich eine herbe Niederlage eingesteckt.
»Dieser Einsatz war wohl ein ziemlicher Rohrkrepierer«, fasste Wenzel zusammen. »Oder gab es noch weitere Entwicklungen?« Er war vor Oppenheimer eingetroffen und hatte noch einen Stuhl erwischt. Jetzt paffte er seine unvermeidliche Zigarette. Mit dem Umzug in den amerikanischen Sektor hatte Wenzel auch die Zigarettenmarke gewechselt. Statt dem stinkenden Kraut aus der Sowjetzone rauchte er jetzt Lucky Strikes.
Unter den vorwurfsvollen Blicken der Männer ließ Lüdecke die Schultern hängen. »Leider hat sich nichts mehr getan«, sagte er. »Deswegen wollte ich mich auch persönlich bei Ihnen entschuldigen. Bedauerlicherweise ist mir der Informant abhandengekommen. Gestern Abend, kurz bevor er mir die letzten Anweisungen geben konnte. Der Einsatz war bereits eingeleitet, also hatte ich gehofft, dass ich rechtzeitig eine Meldung von ihm erhalte.« Lüdecke machte eine Pause und atmete tief durch. »Aber nichts da. Unser Kontakt ist abgerissen. Das sieht meinem Informanten nicht ähnlich. Etwas Gravierendes muss vorgefallen sein, ja, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen.«
Die Männer hörten jetzt aufmerksam zu. Auch Oppenheimer beugte sich gespannt nach vorn.
»Wir sind hinter einer Jugendbande her«, fuhr Lüdecke mit seiner Erklärung fort. »Das mag harmlos klingen, aber tatsächlich sind sie, ungeachtet ihrer jungen Jahre, hartgesottene Kriminelle. Unseren Erkenntnissen zufolge haben sich auch altgediente Verbrecher dieser Bande angeschlossen. Zuerst hätte ich so etwas nicht für möglich gehalten, aber nun ja, man lernt ständig dazu. Die Bande ist in den drei Westsektoren aktiv und mischt fast überall mit – Rauschgift, Prostitution, Schmuggel. Wir hatten die Hoffnung, diese Organisation mit unserem Großeinsatz empfindlich zu treffen.«
Dass der Kollege vom Raubdezernat wegen eines verpatzten Einsatzes persönlich vorstellig wurde, kam Oppenheimer merkwürdig vor. Er ahnte, dass Lüdecke noch etwas anderes auf dem Herzen hatte.
»Und wie können wir behilflich sein?«, fragte er in die Stille hinein.
Lüdeckes Mundwinkel zuckten nach oben. Auf eine solche Ermutigung hatte er gewartet.
»Zunächst geht es mir um den Informanten«, sagte er mit Nachdruck. »Wenn Sie in den nächsten Tagen eine Leiche finden sollten, die ihm ähnelt, bitte ich Sie darum, mich unverzüglich zu kontaktieren. Ich muss wissen, wo er abgeblieben ist. Seinen Namen möchte ich nicht nennen, immerhin besteht noch die Hoffnung, dass er nur untergetaucht ist und sich bald wieder meldet. Aber ich kann Ihnen gern eine Beschreibung von ihm geben.«
Oppenheimer blickte auf den Boden seines leer getrunkenen Bechers und drehte ihn in den Händen. »Dieser Informant, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass er noch lebt?«
Lüdecke lachte bitter auf. »Im Prinzip habe ich mich damit abgefunden, dass er tot ist.«
3
Freitag, 18. Februar 1949 – Samstag, 19. Februar 1949
Unter einem schiefergrauen Morgenhimmel bahnte sich eine Schattengestalt ihren Weg über zerborstenen Beton und Steinbrocken. Der Mann hatte eine Schaufel über die Schulter gelegt, sein Kopf war gesenkt. Die Februarsonne war nur ein kleiner heller Punkt hinter den Wolken. Vor einer Stunde war sie aufgegangen und noch so schwach, dass er auf die Stolperfallen im Boden achten musste.
Das Schuttvolumen in Berlin war zu groß, um es komplett mit Lastkähnen über die Spree zu entsorgen. Also wurde ein Teil in der Stadt gelagert. Auf das Südgelände von Schöneberg kam nur der letzte unbrauchbare Rest der im Krieg zerstörten Gebäude. Waggon für Waggon wurden die Trümmer von Miniaturloks hierhergekarrt und abgeladen. Die neu geschaffenen Hügel und Täler auf der Deponie bestanden bei näherer Betrachtung nur aus Splittern und Staub. Dieser ganze Unrat sollte das Fundament für ein Parkgelände abgeben. Das Ziel, auf den Ruinen des Dritten Reichs eine grüne Oase entstehen zu lassen, lag allerdings noch in weiter Ferne.
Der Schritt des Arbeiters war fest, doch unregelmäßig. In den zwei Jahren seiner Anstellung hatte er gelernt, vorsichtig zu sein. Er bewegte sich auf einem tückischen Untergrund. Bei der aufgeschütteten Rampe weiter hinten war das Geröll bereits so stark verdichtet, dass es stabil genug für die ansteigenden Schienen der Trümmerbahn war. Die eigentliche Arbeit fand jedoch auf dem großen Schuttberg statt, wo Tag für Tag neue Trümmer abgeladen wurden. Und hier geriet der Müll unter dem Gewicht der Männer leicht in Bewegung. Manchmal ließ sich nicht verhindern, dass die Seiten der meterhohen Trümmeraufschüttungen urplötzlich in die Tiefe rutschten.
Eine kastenförmige Diesellok schlich die Rampe zum Berg hoch. Es war die erste Fuhre an diesem Tag, und der Mann kam viel zu spät. Bei dem Gedanken, vom Vorarbeiter einen Anschiss zu riskieren, ging er schneller. Trotz seiner Routine machte er einen unbedachten Schritt. Mit einem lauten Knirschen gerieten die Steinmassen unter ihm in Bewegung. Der Arbeiter erstarrte. Wenn er die Nerven verlor und hastig davonlief, würde noch mehr Geröll abrutschen.
Kaltblütig blieb er stehen und wartete ab, bis sich der Untergrund wieder beruhigt hatte. Der Arbeiter warf einen Blick auf die kleine Mulde, die sich jetzt dicht neben ihm aufgetan hatte. Sie war vielleicht dreißig Zentimeter tief. Ein metallisches Blitzen zwischen den Steinbrocken weckte seine Neugierde. Mit etwas Glück handelte es sich um Altmetall, das sich zu Geld machen ließ. Der Mann blickte sich kurz um und registrierte mit Genugtuung, dass noch keiner seiner Kollegen davon Notiz genommen hatte.
In der Hoffnung auf einen guten Fang nahm er die Schaufel von der Schulter und stach ins Geröll. Dicht unter der Oberfläche traf die Spitze auf einen weichen Gegenstand.
Der Arbeiter stutzte. Dann ging er in die Hocke und räumte mit den Händen die größeren Stücke zur Seite.
Als er schließlich erkannte, worauf er gestoßen war, zog er scharf die Luft ein und sprang auf. Der blitzende Gegenstand war eine Armbanduhr mit zersprungenem Glas. Die Uhr war immer noch an einem Handgelenk befestigt. Von dem grauen Staub bedeckt wirkte der Arm wie das Überbleibsel einer Steinskulptur. Der verkrustete braune Fleck war getrocknetes Blut. Statuen bluteten nicht.
Der Arbeiter wich erschrocken zurück. Er stand genau auf den Überresten eines Toten.
Er wollte um Hilfe rufen, doch aus seiner trockenen Kehle kam nur ein Krächzen. Also begann er, wild mit den Armen zu winken, und stürmte auf die Lokomotive zu, um die sich bereits die ersten Kollegen versammelt hatten.
Vom Entsetzen gepackt war es ihm jetzt egal, wohin er trat.
Kriminalanwärter Kubelik fand, dass Oppenheimer hinter dem Steuer eines Autos wie ein Frührentner fuhr. Und auch an diesem Tag war das nicht anders. Unruhig saß der junge Mann auf dem Beifahrersitz des Einsatzwagens, doch er war so muskulös, dass er die gesamten Vordersitze in Beschlag zu nehmen schien. Tatkräftig, wie Kubelik nun mal war, wäre er wohl am liebsten mit Warnlicht quer durch die Stadt geprescht. Stattdessen bremste Oppenheimer am Ende der Arnulfstraße ab. Resigniert beobachtete sein Assistent von der Seite, wie er penibel den Winker setzte, erst nach rechts und dann nach links blickte, um schließlich unter den Brücken der S-Bahn hindurchzufahren.
Seit der Entdeckung der Leiche auf der riesigen Schutthalde waren fünf Stunden vergangen, und Oppenheimer fand, dass der Tote ruhig auf ihn warten konnte. Die Schöneberger Polizei hatte den Fundort bereits gesichert. Jetzt schien auch geklärt, dass es sich bei dem Leichnam um keinen der dort beschäftigten Arbeiter handelte. Ein tragischer Unfall konnte somit ausgeschlossen werden. Und als die lokalen Ordnungshüter dann auch noch auf Schusswunden gestoßen waren, wurde sofort die Mordkommission in der Friesenstraße verständigt.
Oppenheimers Zusammenarbeit mit Kubelik lief reibungslos, und er war froh, dass der Kriminalanwärter immer noch bei der Kripo angestellt war. Jemand im Dezernat hatte der Kripoleitung vor ein paar Monaten gemeldet, dass Kubelik Mitglied der SED war, woraufhin ihn sein Vorgesetzter Seeßlen erst einmal beurlaubt hatte. Es war eine delikate Sache gewesen, denn die Führungsriege in der Friesenstraße schien selbst nicht zu wissen, wie in solchen Fällen zu verfahren war.
Offiziell wollte man Fairness demonstrieren und davon Abstand nehmen, Kubelik zu feuern. Andererseits gehörten praktisch alle maßgeblichen Ostpolitiker der SED an. In jüngster Zeit wurde von ihnen immer häufiger ein stramm stalinistischer Kurs propagiert, der letztendlich auf den Umbau der SED zu einer zentralistischen Einheitspartei abzielte. Dem westlich-demokratischen Prinzip des Pluralismus widersprach das völlig. Gleichzeitig war die Atmosphäre zwischen Ost und West im Laufe der Blockade von Westberlin zunehmend vergiftet. Und so hatte es dann bei der westlichen Kripo hitzige Diskussionen darüber gegeben, ob ein SED-Mitglied wie Kubelik überhaupt noch als Ordnungshüter eingesetzt werden dürfe.
Einer drohenden Kündigung war Kubelik gerade noch zuvorgekommen, weil er kurzerhand aus der SED ausgetreten war. Der offizielle Grund war seine Enttäuschung über den zunehmend autokratischen Kurs der linken Partei. Ob dies auch stimmte oder eine Schutzbehauptung war, das ließ sich nicht beantworten. Und Oppenheimer war es auch völlig egal. Viel wichtiger war für ihn, dass er Kubelik als eifrigen Mitarbeiter schätzen gelernt hatte.
Hinter den Brücken umkurvte Oppenheimer ein weitläufiges freies Gelände. In der Mitte des Grundstücks erhob sich ein massiver Tafelberg aus Geröll. Es musste sich um die Schuttdeponie handeln. Beim Fahren machte er sich eine geistige Notiz, dass dieses Grundstück größtenteils von Schrebergärten umgeben war. Im Südosten befand sich ein Schwimmbad, schräg gegenüber im Nordwesten lagen das Auguste-Viktoria-Krankenhaus und Wohnhäuser. Von dem Fundort des Toten waren diese Gebäude mehrere Hundert Meter entfernt. Also konnte man kaum damit rechnen, dass jemand mitbekommen hatte, wie der Tote auf den Schuttberg gelangt war.
Auf der Höhe des Krankenhauses liefen die schulterbreiten Schienen einer Trümmerbahn auf die Halde zu. An dieser Stelle entdeckte Oppenheimer auch die Zufahrt zum Gelände, schlug das Lenkrad ein und fuhr über prasselnden Splitt zu den wartenden Polizeifahrzeugen. Beim Aussteigen erkannte er bereits, dass sich oben auf dem Berg mehrere Personen versammelt hatten. Der einzig erkennbare Zugang war über die breite Rampe der Trümmerbahn. Trotz der frischen Temperaturen begann Oppenheimer schon bald zu schwitzen, während der durchtrainierte Assistent Kubelik neben ihm ohne ein Anzeichen von Müdigkeit unbeirrt emporstieg. Dass ihnen auf halbem Weg ein paar Leute von der Spurensicherung entgegenkamen, nahm Oppenheimer als willkommenen Vorwand für eine kurze Verschnaufpause.
»Was gibt es dort oben?«, fragte er mit kratziger Stimme.
Der Fotograf blieb stehen. Sorgfältig hielt er seinen verpackten Apparat in der Armbeuge. »Sieht nach einem Mord aus. In jedem Fall scheint es sich hier um den Tatort zu handeln. Eine Patronenhülse haben wir gefunden, aber keine Waffe. Die Suche geht noch weiter. Aber bei dem Gerümpel da oben weiß man nicht, wo man anfangen soll.«
Auf dem Berg angekommen, konnte Oppenheimer nachvollziehen, dass die Beweisaufnahme noch nicht abgeschlossen war. Zwischen den Brocken aus zerborstenem Baumaterial gab es Zwischenräume und Spalten. Oppenheimer schätzte, dass die obere Schicht komplett abgetragen werden musste, damit keine Beweise verloren gingen.
Hinter dem Zaun des benachbarten Friedhofs ragte ein markanter Wasserturm empor. Oppenheimer fühlte einen Stich in der Brust, denn er konnte sich noch lebhaft an die verstümmelte Frauenleiche erinnern, die vor fast fünf Jahren am Fuße des Turms gelegen hatte. Es kam nicht allzu häufig vor, dass er an abgeschlossene Fälle dachte. Erst jetzt wurde ihm bewusst, wie sich in seiner Vorstellung die Karte von Berlin stetig mit neuen Orten füllte, an denen entsetzliche Dinge geschehen waren.
Einige Meter entfernt stand ein Mann auf dem Plateau. Er hatte ihnen den Rücken zugekehrt, sein Blick war nach unten gerichtet. Die Pose mit den angewinkelten Armen war unverkennbar, ebenso wie der dichte Haarkranz unter dem Hut. Es war der Kollege Hergesheimer von der Spurensicherung. Als er näher kommende Schritte vernahm, wandte er sich um und begrüßte Oppenheimer mit einem Kopfnicken.
»Ein Albtraum«, sagte Hergesheimer. »Ein wahrer Albtraum. Ich habe bereits Metalldetektoren kommen lassen, damit wir überhaupt die Chance haben, Spuren zu finden. Aber die schlagen dauernd aus, denn in dem Beton sind auch lauter Eisenstangen eingegossen.«
»Und hier wurde also ein Opfer gefunden?«, fragte Oppenheimer und zog den Gürtel seines Mantels etwas enger, weil der schneidende Wind an der Kleidung zerrte.
»Korrekt. Ein Opfer, männlich, Anfang fünfzig. Und er hat eine Besonderheit. An der linken Hand fehlt ihm eine Fingerkuppe.«
Oppenheimer stutzte. Das ähnelte der Personenbeschreibung, die sie von Lüdecke bekommen hatten. »Ich glaube, diesen Mann suchen wir gerade.«
»Na, dann schauen wir ihn doch mal an«, schlug Hergesheimer vor und schritt zu einer Plane, die auf dem Boden ausgebreitet war. »Wir haben nur auf dich gewartet.«
Mit diesem Kommentar schlug er die Plane zurück und enthüllte eine etwa fünfzig Zentimeter tiefe Grube. Um den Toten herum war das Geröll entfernt worden. Zu sehen gab es allerdings nicht viel. Ein Mann mit Hut und Mantel lag zusammengekrümmt auf der Seite. Oppenheimer stieg in das Loch und begutachtete den Toten.
»Er weist zwei Schusswunden auf«, soufflierte Hergesheimer. »Ich halte es für eine klassische Exekution. Eine Kugel erwischte den Arm, die andere traf seinen Hinterkopf und war tödlich. Der Gerichtsmediziner geht davon aus, dass die Armwunde ein paar Stunden älter ist. Die beiden Schusswunden stammen nicht von derselben Waffe. Das Gelände wird nach Feierabend nicht abgesperrt. Also stellt es auch kein Problem dar, unbefugt auf diesen Berg zu klettern. Es gibt hier eben nicht viel zu klauen.«
Interessiert verfolgte Kubelik Hergesheimers Ausführungen. »Dass bei dem Opfer auch eine Patronenhülse gefunden wurde, deutet darauf hin, dass der Mann hier getötet wurde«, fasste Kubelik zusammen. Dann fragte er: »Gibt es eine Möglichkeit, dass der Tote nachträglich an dieser Stelle platziert wurde? Vielleicht kam er ja in einer Lore der Trümmerbahn.«
Hergesheimer zog die Brauen hoch, sodass sie über die Brillenränder ragten. »Das können wir ausschließen. Es müssten schon extrem ordentliche Kriminelle sein, dass sie nicht nur die Leiche, sondern auch gleich die Patronenhülsen an derselben Stelle entsorgen. Und die Schienen enden zwanzig Meter von hier. Dort vorn werden die Trümmer abgeladen und dann verteilt. Mit der Trümmerbahn ist der Tote auf keinen Fall hier heraufgekommen.«
Als Oppenheimer glaubte, alles gesehen zu haben, richtete er sich wieder auf und stieg aus der Grube. »Kommissar Lüdecke muss sich den Toten ansehen. Ihr könnt ihn aber ruhig schon in den Sarg umbetten.«
Ein Funkwagen war nicht vor Ort, also schickte Oppenheimer Kubelik zurück zum Präsidium mit der Anweisung, Lüdecke möglichst schnell herbeizuschaffen. Dankbar nahm dieser die Gelegenheit wahr, um ins Auto zu springen und mit deutlich überhöhtem Tempo davonzubrausen.
Oppenheimer blickte Kubelik schmunzelnd hinterher. Er fand, dass sich der Junge gut machte. Wegen seiner durchtrainierten Statur wurde er gern für Kripoeinsätze hergenommen, bei denen tatkräftige Leute gefragt waren. Doch Kubelik war intelligenter, als ihm allgemein unterstellt wurde, und in den Monaten ihrer Zusammenarbeit hatte er eine große Lernbereitschaft an den Tag gelegt. Vor allem war er sich nicht zu schade, einfache Fragen zu stellen, selbst wenn sie auf den ersten Blick deplatziert wirkten. Erst nach jahrelanger Berufspraxis hatte Oppenheimer erkannt, dass man sich als Ermittler davor hüten sollte, mit vorgefassten Meinungen an einen Fall heranzugehen. Kubelik schien das bereits begriffen zu haben. Auch wenn sie täglich mit Morddelikten zu tun hatten, bedeutete das nach Oppenheimers Auffassung nicht, dass man sie als Routinesache begreifen durfte. Das waren die Lebenden den Toten schuldig.
Eine Stimme riss ihn aus den Gedanken. Hinter seinem Rücken rief Hergesheimer aufgeregt: »Leute, kommt mal alle her! Wir brauchen noch mal den Fotografen!«
Überrascht wandte sich Oppenheimer um. Das Gesicht des Kriminaltechnikers war jetzt aschfahl. So schockiert hatte er den Kollegen selten gesehen. Während die Mitarbeiter der Spurensicherung hektisch auf Hergesheimer zuliefen, starrte dieser bewegungslos in die Grube.
Mit dem Toten konnte es nichts zu tun haben. Dieser lag mittlerweile in einem Zinksarg. Mit einem flauen Gefühl trat Oppenheimer neben Hergesheimer und folgte dessen Blick. In den Schattierungen von Grau fiel es ihm schwer, in der Grube Konturen auszumachen.
»Mein Gott, erkennst du es denn nicht?«, fragte Hergesheimer ihn ungläubig. »Da drunter liegt noch jemand!«
Anderthalb Stunden später tauchte Kubelik wieder auf, neben ihm Lüdecke. Sein Boxergesicht war in Falten gelegt. Kubelik hatte ihn also bereits vorgewarnt. Der Mitarbeiter vom Raubdezernat war ganz in Schwarz gekleidet. Während er vorsichtig über die Trümmer stapfte, wirkte er wie eine melancholische Krähe. Passend für eine Beerdigung, fand Oppenheimer.
Er führte Lüdecke zu dem geöffneten Sarg. Ein rascher Blick genügte, dann bestätigte er, dass es sich um seinen Informanten handelte.
»Er hieß Hupke«, sagte Lüdecke mit rauer Stimme. »Erwin Hupke. Er war ein Scheißkerl, und trotzdem tut es mir leid um ihn.«
Gedankenversunken verweilte Lüdecke bei Hupkes sterblichen Überresten. Erst nach einer Weile bemerkte er den Trubel bei der nahe gelegenen Grabungsstelle. Hergesheimers Mitarbeiter waren damit beschäftigt, die Mulde, in der man das erste Opfer aufgefunden hatte, weiter von Trümmern zu räumen.
»Was geht hier vor sich?«, fragte Lüdecke irritiert.
Oppenheimer seufzte. »Es wurde eine zweite Leiche gefunden. Ein Stück unter dem getöteten Herrn Hupke. Und die Spurensicherung sucht noch weiter. Wenn wir Pech haben, stehen wir hier auf einem Massengrab.«
Lüdecke blickte sich auf dem weitläufigen Plateau um. Er galt unter den Kollegen als erfahrener Kriminalist, also ahnte Oppenheimer, welche Gedanken in seinem Kopf kreisten. In diesen Endlagern für Trümmer konnte man Tote für immer verschwinden lassen. Wenn sie erst einmal unter Tonnen von Geröll begraben waren, bestand kaum die Gefahr, dass sie jemals wieder auftauchten.
»Meine Güte, ist das gerissen!«, sagte Lüdecke. Oppenheimer spürte, dass eine gewisse Bewunderung in dessen Stimme mitschwang. »Sie müssen ihre Opfer nicht einmal tief begraben. Den Rest übernehmen die Arbeiter. Es ist der perfekte Ort.«
»Auch eine Form der Arbeitsteilung«, murmelte Kubelik misslaunig, rieb sich die Hände und vergrub sie schließlich in den Manteltaschen.
Lüdecke war immer noch fassungslos. Er kramte hektisch ein Päckchen Zigaretten hervor und steckte eine davon in den Mund. Noch ehe er sie entzündet hatte, erinnerte er sich an die guten Umgangsformen und bot seinen Kollegen ebenfalls welche an. Kubelik winkte lächelnd ab, während Oppenheimer dankbar eine Zigarette aus der Packung entnahm.
»Ich hätte das nicht für möglich gehalten.« Lüdecke reichte Oppenheimer sein Benzinfeuerzeug. »Ich meine, wir reden hier von jungen Leuten. Meinem Informanten Hupke zufolge sind die vielleicht gerade mal zwanzig. Und solche Milchbubis sollen Straftaten begehen, vor denen selbst altgediente Ganoven zurückschrecken? Das ist doch nicht normal.«
Oppenheimer steckte die Zigarette in seine geliebte Spitze aus Meerschaum, zündete sie an und blies dann genüsslich den Rauch in den Wind. Schulterzuckend fragte er: »Was ist heutzutage schon normal?«
Nach Oppenheimers Fazit hingen die drei Männer schweigend ihren düsteren Gedanken nach und nahmen nicht einmal wahr, dass sich ihnen Hergesheimer von der Fundstelle her näherte.
»Ich muss die Herren Kommissare leider vertrösten«, entschuldigte er sich. Als er sah, dass Oppenheimer und Lüdecke rauchten, zauberte Hergesheimer seine Pfeife und einen Tabakbeutel hervor und begann, sie zu stopfen. Diese kleine Auszeit hatte er sich nach der Aufregung redlich verdient. »Wir sind bald so weit, den zweiten Toten zu bergen. Und dann suchen wir weiter. Es wird ein paar Tage dauern, die Gesteinsmassen abzutragen. In jedem Fall ist die Deponie bis Montag erst mal geschlossen. Wer weiß, was in der Tiefe noch auf uns wartet.«
Oppenheimer kalkulierte, wie viel Ermittlungsarbeit das bedeutete, und kam zu dem Schluss, dass die Mitarbeit von Kubelik allein nicht ausreichen würde. Die Arbeiter der Schuttdeponie hatten es sich unterdessen gemütlich gemacht. Ein paar Meter vom Fundort entfernt saßen sie auf der Diesellok und den gefüllten Loren und machten eine frühe Mittagspause, während sie neugierig beobachteten, was die Fremden von der Kripo da anstellten. Oppenheimer nickte in ihre Richtung und sagte zu Kubelik: »Dann werden wir am besten mit der Befragung der Arbeiter beginnen, solange sie noch hier sind.« Er wollte zu ihnen hinübergehen, wandte sich jedoch noch einmal an Hergesheimer. »Was wissen wir bislang von dem zweiten Opfer?«
»Ebenfalls männlich, aber jünger. Ich schätze mal Mitte dreißig. Er liegt seit kurzer Zeit hier, die Verwesung ist noch nicht weit vorangeschritten. Vielleicht haben wir Glück im Unglück.«
Oppenheimer nickte, denn er verstand, was Hergesheimer damit andeuten wollte. »Vielleicht ist den Mördern erst vor einer Weile die zündende Idee gekommen, hier oben ihre Leichen zu verscharren.«
Am nächsten Morgen wachte Oppenheimer auf, noch ehe der Wecker klingelte. Ein Geräusch hatte ihn aus dem Schlaf gerissen, an das er sich aber nicht mehr erinnern konnte. Er starrte zur Zimmerdecke und legte sich einen Plan für den Tag zurecht. Offiziell war er diese Woche zur Spätschicht eingeteilt. Doch heute war Samstag, und um den Dienststellenleiter Seeßlen noch abzufangen, ehe dieser ins Wochenende verschwand, musste Oppenheimer möglichst früh bei ihm vorstellig werden.
Er sah keine Alternative, als Verstärkung anzufordern, und ahnte schon jetzt, dass Seeßlen ihm Wenzel zuteilen würde. Schließlich bearbeitete dieser aktuell keinen Fall, außerdem hatte der Dienststellenleiter eine gewisse Vorliebe für die reibungslose Kooperation von eingespielten Teams. Trotz dieses nachvollziehbaren Grundes konnte Oppenheimer nicht behaupten, dass er auf eine Zusammenarbeit mit Wenzel in der jetzigen Situation besonders erpicht war.
Lisa schlief noch, als er den dunkelgrauen Wintermantel überwarf und sich auf den Weg zum Bad machte.
Der eiskalte Korridor lag im Halbdunkeln. In der Villa war es still. Oppenheimer schien als Einziger auf den Beinen zu sein. Immer noch in Gedanken bei Wenzel, schlurfte er den gewohnten Weg entlang und öffnete nichts ahnend die Tür.
Zuerst nahm Oppenheimer einen Schreckenslaut wahr. Aufgrund der Stromsperren war das Bad nur von einer einzigen Kerze erhellt. In deren flackerndem Schein erkannte Oppenheimer nur so viel, dass jemand gerade in der Wanne stand. Es war Astrid Wenzel, die duschte. In dem Zwielicht wirkten ihre nassen dunkelblonden Haare schwarz, das Handtuch hielt sie krampfhaft fest, um ihre Blöße zu bedecken.
»Entschuldigung«, murmelte Oppenheimer, während er einen Schritt zurücktrat.
Wenzels Frau Astrid hatte Oppenheimer längst erkannt. Nach der Schrecksekunde wirkten ihre Gesichtszüge jetzt entspannt, sie blickte ihn unumwunden an. »Das ist schon in Ordnung«, sagte sie und ließ dann einfach das Handtuch sinken.
Der Anblick traf Oppenheimer wie ein Schlag mit der Faust. Astrid Wenzel war Mitte zwanzig und eine attraktive Frau. Jetzt musste Oppenheimer nicht mehr darüber spekulieren, wie es unter Astrids Kleidung aussehen mochte. Provozierend stand sie splitterfasernackt vor ihm. Oppenheimer konnte nicht verhindern, von ihren steifen Brustwarzen Notiz zu nehmen. Seine Augen folgten den hinabperlenden Wassertropfen. Im Bereich von Astrids Schoß enthüllten die feuchten Schamhaare mehr, als sie verbargen.
Plötzlich wurde sich Oppenheimer gewahr, welches Bild er hier abgab. Zwischen Tür und Angel begaffte er den Intimbereich einer Frau, die nicht seine Ehegattin war. Aufgebracht über seine eigene Reaktion, stolperte er zurück auf den Gang und ließ die Tür hinter sich zufallen.
Es schien nicht angebracht, hier zu warten, bis Astrid mit ihrer Dusche fertig war. Oppenheimer wollte es nicht darauf ankommen lassen, dass Wenzels Gattin eine weitere Gelegenheit bekam, um ihn zu provozieren. Das alles würde nur Missverständnisse heraufbeschwören, und auf weitere Komplikationen in seinem Leben konnte Oppenheimer gern verzichten.
Erst in der Sicherheit seines eigenen Zimmers wagte er aufzuatmen. Trotzdem ließ sich der Anblick im Bad nicht so leicht abschütteln. Oppenheimer stand immer noch an der Tür. »Das ist schon in Ordnung?«, wiederholte er ungläubig Astrids Worte. Dann lachte er auf. »So eine Frechheit!«
4
Samstag, 19. Februar 1949
Seine Pfeife schmauchend, trotzte Hergesheimer dem frostigen Wind. Er stand unbeirrt zwischen den ausgehobenen Trümmerstücken, als hätte er sich seit dem gestrigen Tag von dort nicht fortbewegt. Den Mantelkragen hochgeschlagen, gab er vor dem Himmelspanorama wie ein Kapitän auf rauer See Befehle an seine Mannschaft und überwachte die Arbeiten. Inmitten des geschäftigen Treibens strahlte er eine unerschütterliche Ruhe aus. Mittlerweile waren Suchtrupps mit Spürhunden erschienen und suchten das Bergplateau nach weiteren Leichen ab.