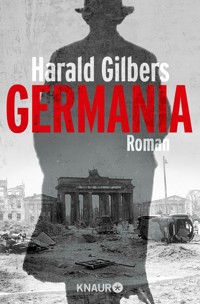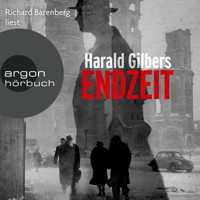9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kommissar Oppenheimer
- Sprache: Deutsch
Kommissar Oppenheimers vierter Fall: ein packender Krimi über eine Mordserie im zerbombten Berlin von Glauser-Preisträger Harald Gilbers. Berlin 1946. Nach Kriegsende nutzt Kommissar Oppenheimer seinen kriminalistischen Spürsinn, um Vermisste ausfindig zu machen. Routinemäßig besucht er dazu die Berliner Flüchtlingslager. Als der verunstaltete Leichnam eines vertriebenen "Volksdeutschen" aufgefunden wird, bekommt Oppenheimer von dem sowjetischen Oberst Aksakow den Befehl, sich mit der Sache zu beschäftigen. Weitere brutale Morde lassen nicht lange auf sich warten. Offenbar arbeitet der Täter eine Liste mit NS-Schergen ab, um späte Rache zu nehmen ... "Historisch sehr akkurat, atmosphärisch dicht und zudem noch ungemein spannend." Frankfurter Allgemeine Zeitung online
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Harald Gilbers
Totenliste
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kommissar Oppenheimers vierter Fall: ein packender Krimi über eine Mordserie im zerbombten Berlin von Glauser-Preisträger Harald Gilbers.
Berlin 1946. Nach Kriegsende nutzt Kommissar Oppenheimer seinen kriminalistischen Spürsinn, um Vermisste ausfindig zu machen. Routinemäßig besucht er dazu die Berliner Flüchtlingslager. Als der verunstaltete Leichnam eines vertriebenen »Volksdeutschen« aufgefunden wird, bekommt Oppenheimer von dem sowjetischen Oberst Aksakow den Befehl, sich mit der Sache zu beschäftigen. Weitere brutale Morde lassen nicht lange auf sich warten. Offenbar arbeitet der Täter eine Liste mit NS-Schergen ab, um späte Rache zu nehmen …
»Historisch sehr akkurat, atmosphärisch dicht und zudem noch ungemein spannend.« Frankfurter Allgemeine Zeitung online
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Epilog
Nachwort
Literaturhinweise
Prolog
Weydorf, Sowjetische BesatzungszoneMontag, 6. Mai 1946
Oswald Klinke erstarrte mitten in der Bewegung. Er glaubte, unmittelbar hinter sich etwas gehört zu haben. Ein Geräusch, das nicht hierhin gehörte.
Gehetzt blickte Klinke sich um. Es war nicht viel mehr zu sehen als die grünen Ähren der Wintergerste. Die Maisonne wurde von einem heraufziehenden Unwetter verdeckt. Ein plötzlicher Windstoß brachte den Geruch nach Regen mit sich. Raschelnd bewegten sich die Halme. Meereswellen unter einem tiefen Himmel. Wie zum Hohn stand in dem Feld eine menschenähnliche Gestalt. Unter dem Hut ein augenloses Gesicht, flatternde Kleiderfetzen über einem Gerippe aus Holzstöcken. Klinke wusste, dass die Vogelscheuche für das Geräusch nicht verantwortlich sein konnte. Leblose Dinge pflegten nicht hörbar auszuatmen.
War der Fremde ihm bereits auf den Fersen? Würde er die Gelegenheit nutzen, um zuzuschlagen? Klinke spürte, wie ihm bei diesen Gedanken die Hitze in den Kopf stieg. Er kam gerade von einer weiteren Beerdigung. Seit Ostern hatte die Totenglocke in ihrem Dorf bereits vier Mal geläutet. Und jetzt, allein auf dem Feldweg, ahnte er, dass die Glocke ein fünftes Mal läuten würde, wenn er nicht auf Draht war.
Es war ein Fehler gewesen, den direkten Weg zu seinem Haus zu nehmen, anstatt an der Hauptstraße entlangzulaufen. Unter den anderen Dorfbewohnern wäre er sicher gewesen. Aber hier, außerhalb des Dorfs, konnte er nicht auf Unterstützung hoffen.
Vielleicht war es besser, so zu tun, als hätte er den Verfolger nicht bemerkt. Jetzt, wo er gewarnt war, glaubte Klinke, das Überraschungsmoment auf seiner Seite zu haben. Demonstrativ gelassen schlenderte er zu einem Baum am Wegesrand und lehnte sich dort an, um die Schnürsenkel zu binden. Doch in Wirklichkeit betrachtete er die Umgebung.
Klinke unternahm einen vergeblichen Versuch, seinen Atem zu normalisieren. Leider war er nicht sonderlich kaltblütig – zumindest nicht, wenn er auf sich allein gestellt war. Wenn er sich auf niemanden verlassen konnte, wenn es nur an ihm selbst lag, ob er überleben würde oder nicht.
Wenigstens war er vorbereitet. In der Innentasche seines schwarzen Anzugs steckte eine geladene Wehrmachtspistole. In den chaotischen Tagen der Niederlage hatte er sie zusammen mit einer Uniform unweit des Dorfs in einem Straßengraben gefunden. Als Deutscher durfte man offiziell keine Waffen mehr besitzen. Wenn die russischen Besatzer jemanden verdächtigten, zu den letzten Getreuen Adolf Hitlers zu gehören, wurde der Pechvogel auf der Stelle verhaftet und verschwand dann auf Nimmerwiedersehen. Da sich nur selten ein russischer Soldat in ihr Dorf verirrte, hatte es Klinke jedoch für sicher gehalten, die Schusswaffe wieder aus ihrem Versteck zu holen und bei sich zu tragen. Schließlich musste er sich irgendwie verteidigen können.
Die wogenden Gerstenhalme im Blick, spannte Klinke sich an, machte sich bereit, die Waffe zu zücken, sobald sich ihm eine fremde Gestalt näherte.
Als einziger Arzt in dem Landkreis musste Klinke jeden Leichnam begutachten, die Todesursache einschätzen, Totenscheine ausstellen, die Polizei einschalten, wenn er faules Spiel vermutete. Er hatte die Zeichen gesehen und war doch zu dumm gewesen, die Zusammenhänge zu begreifen. Und jetzt, wo er alles verstand, war es womöglich bereits zu spät.
Gespannt wartete er darauf, dass sich sein Verfolger ihm offenbarte. Aber nichts geschah. Das nächste Geräusch war sich näherndes Hufgetrappel. Ein Pferd zog einen klappernden Karren den Feldweg entlang.
Klinke atmete bei dem Anblick auf. Das runde Gesicht des Mannes auf dem Kutschbock war ihm wohlvertraut. Es war der alte Herr Richter. Wie üblich lugten die nachlässig gestutzten Haare unter der Hutkrempe hervor. In seinem guten Anzug saß Richter auf dem Einspänner und ließ sich von seinem Klepper gemächlich nach Hause ziehen. Es gab keine Notwendigkeit zur Hast, nicht nach einer Beerdigung.
»Kann ich Sie mitnehmen, Herr Doktor?«, fragte Richter, als er den Karren zum Stehen gebracht hatte.
Dankbar nahm Klinke das Angebot an und bestieg den Kutschbock. Mit einem leichten Schlag des Zügels gab Richter seinem Pferd das Signal zum Weitertraben. Klinke hob den Hut, um seine hohe Stirn mit dem Taschentuch abzutupfen.
Das Unheil, das unvermutet über ihr Dorf hereingebrochen war, glich einem Albtraum. Klinke erkannte zwar noch seine altvertraute Umgebung, kannte die Menschen, die ihn täglich umgaben, doch etwas hatte sich unwiederbringlich verändert. Die bisherigen Gewissheiten galten nicht mehr.
Richter schienen ähnliche Gedanken zu beschäftigen. Nach einer Weile brummte er unzufrieden vor sich hin.
»Ich weiß«, murmelte Klinke als Antwort. »Das ist bereits der Vierte.«
»Der Vierte … von uns«, präzisierte Richter.
Klinke nickte wortlos.
Der erste Tote in Weydorf wurde in einem Pferdestall mit eingeschlagenem Schädel aufgefunden. Der Hufabdruck auf dem Kopf ließ noch einen tragischen Unfall vermuten. Bei einem Scheunenbrand nur fünf Tage später war ein zweites Todesopfer zu beklagen gewesen. Die Feuerwehr war unterbesetzt, denn auch in ihrem Dorf waren die meisten Männer im besten Alter an der Front geblieben. Wenn sie nicht für Hitler gefallen waren, galten sie als verschollen oder vegetierten in einem der unzähligen Kriegsgefangenenlager vor sich hin. Und so waren die übrig gebliebenen Dorfbewohner zu Hilfe geeilt, um das Feuer mit vereinten Kräften zu bekämpfen.
Nur einer hatte dabei gefehlt: der Besitzer der Scheune. Einige Stunden später wurde seine verbrannte Leiche in den verkohlten Überresten aufgefunden.
Schon am nächsten Tag kursierten in Weydorf Gerüchte, dass es bei den letzten Todesfällen nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Mit den nächsten beiden Toten wurde es endgültig zur Gewissheit. Dass das dritte Opfer in eine Sense gefallen war, könnte vielleicht auch an einen Unfall denken lassen, doch der heute beerdigte Dorfbewohner war mit durchgeschnittener Kehle aufgefunden worden. Klinke zweifelte nicht mehr daran, dass in ihrer Mitte ein Mörder sein Unwesen trieb.
Richter wusste, dass er dem Arzt gegenüber vollkommen offen sein konnte. Kaum etwas verband stärker als gemeinsame Heimlichkeiten.
»Dieser Scheißkerl versucht nicht mal mehr, seine Spuren zu verwischen«, sagte er gereizt. »Jetzt murkst er unsere Leute einfach so ab und schert sich nicht drum, ob es jemandem auffällt. Ich versteh das alles nicht. Haben Sie angeordnet, dass der Sarg in der Kirche geschlossen bleibt?«
Klinke nickte trübsinnig. »Was sollte ich anderes tun? Riskieren, dass das ganze Dorf in Aufruhr gerät?«
Es wäre kaum möglich gewesen, den regelrecht zerfetzten Hals des Toten unter dem Kragen des Sonntagshemds zu verbergen. Der Anblick der Schnittwunde hatte Klinke in den vergangenen Tagen verfolgt. Ein zweites Lippenpaar aus rohem Fleisch, das ihn bei der Leichenschau die ganze Zeit über höhnisch angegrinst hatte.
»Das will er doch gerade«, fügte Klinke ein wenig zusammenhangslos hinzu. »Der Mörder will, dass wir Angst vor ihm haben. Wozu sonst die Schnitzereien?«
Vehement schüttelte Richter den Kopf. »Das sind doch Kindereien. Das waren ein paar Lausebengels aus der Nachbarschaft.«
Bereits als Klinke der Familie des ersten Opfers seine Aufwartung gemacht hatte, um sie über ihren Verlust zu informieren, war ihm das Zeichen des Mörders aufgefallen, nicht mehr als eine Markierung, hineingeritzt in die Haustür. Weil die groben Umrisse auf den ersten Blick keinen Sinn ergaben, vergaß Klinke sie gleich wieder, kaum dass er sie gesehen hatte.
Das Entsetzen folgte später, als es bereits drei Tote gegeben hatte. Erst zu diesem Zeitpunkt war er aufmerksam geworden. Als Klinke mit wachsamem Blick durch sein Dorf gegangen war, hatte er schließlich registriert, dass an jedem Haus, in dem eines der Mordopfer lebte, zuvor eine dieser eingeritzten Figuren aufgetaucht war.
»An solche Zufälle glaube ich nicht«, beharrte Klinke. »Der Mörder weiß genau, was hier geschehen ist. Er hält uns für schuldig. Und nun dezimiert er uns, einen nach dem anderen.«
Klinke glaubte plötzlich, keine Luft mehr zu bekommen. Hastig lockerte er seine Krawatte und öffnete den oberen Hemdknopf.
Richter verzog den Mund. »Aber was sollen diese Schnitzereien? Warum soll sich der Schweinehund denn verraten? Damit wir zur Polizei laufen?«
»Er weiß ganz genau, dass wir nicht zur Polizei gehen können«, wandte Klinke ein.
Für einen Moment hielt Richter inne. Dann nickte er.
Damit war ihr Gespräch beendet.
Auf den letzten paar Hundert Metern wandte sich Klinke immer wieder um. Doch sosehr er auch in die Umgebung starrte, nirgends gab es ein Anzeichen dafür, dass sie verfolgt wurden.
Richter setzte seinen Fahrgast vor dessen Haus ab. Klinke sprang vom Kutschbock und schritt quer durch den Gemüsegarten. Hinter ihm fuhr der Einspänner unter Kettengeklirr und Hufgetrappel weiter.
Fast gleichzeitig riss die Wolkendecke auf. In der grellen Mittagssonne begann es vor Klinkes Augen zu flirren. Routiniert griff er zum Schlüsselbund. Als sich Klinkes Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, erstarrte er. Zunächst nahm er auf seiner Haustür nur feine Linien wahr. Bei genauem Hinsehen stellten sie sich als Kratzer heraus. Sie wirkten fast zufällig, doch als Klinke in die Hocke ging, erkannte er die gleiche Figur, die er auch an den anderen Häusern gesehen hatte.
Es war die Schnitzerei einer Menschengestalt. Wo sich die Schultern befinden sollten, formten sich an beiden Seiten weitere Kratzer zu halbrunden Gebilden. Aber diesmal war der Unbekannte bei seiner Schnitzarbeit geradezu liebevoll zu Werke gegangen. Und deshalb erkannte Klinke, dass es Flügel sein sollten.
Bei diesem Anblick begann er zu frösteln. Der Mörder hatte das Zeichen auch in seine Tür geritzt. Er war ihm ganz dicht auf den Fersen. Klinkes Zeit war abgelaufen. Er hatte sich zu lange etwas vorgemacht. Plötzlich erschien es Klinke aussichtslos, sich selbst zu schützen.
Er rannte los. Mehr stolpernd als laufend hastete Klinke dem Einspänner hinterher. Er wedelte mit den Armen, brüllte sich die Seele aus dem Leib, um Richter zum Anhalten zu bewegen.
Irritiert wandte sich dieser um und brachte seinen Klepper zum Stehen.
Schwer atmend stützte sich Klinke an dem Holzkarren ab.
»Wir müssen die Dorfbewohner einweihen, sofort«, keuchte er. »Ich bin der Nächste! Wir müssen fort von hier. Auf der Stelle!«
1
BerlinMontag, 9. Dezember 1946
Hier sind weitere Namen mit dem Anfangsbuchstaben L!«
Mit dieser Ankündigung knallte Frau Scholz einen Stapel Pappkarten auf Oppenheimers Tisch. Ihre dunkelbraunen Haare hatte sie wie üblich zu einem Dutt frisiert, der so hoch aufragte, dass Oppenheimer stets befürchtete, die Frisur könnte irgendwann einmal aus dem Gleichgewicht geraten. Fröhlich blinzelte sie Oppenheimer durch ihre Brille an, als erwartete sie eine Belohnung dafür, dass sie ihm zusätzliche Arbeit aufhalste.
»Ähm, ja, vielen Dank«, murmelte Oppenheimer und beobachtete zerstreut, wie sich Frau Scholz zwischen den Tischreihen hindurch wieder entfernte. Dann taxierte er die neuen Suchaufträge. Anhand der Stapeldicke konnte er relativ genau einschätzen, wie lange er zum Einsortieren brauchen würde. Oppenheimer rechnete mit etwa drei Stunden. Bei dem Gedanken sog er die Luft ein. Obwohl der Krieg mittlerweile seit anderthalb Jahren vorbei war, roch es in ihrem Großraumbüro unverändert nach Beton und Steinstaub.
Die Flut der Anfragen schien niemals aufzuhören, was nicht verwunderlich war, denn es wurde geschätzt, dass fast jeder vierte Deutsche einen Angehörigen vermisste oder selbst gesucht wurde. Unzählige Stadtmenschen waren vor dem Bombenhagel in die umliegenden Dörfer geflohen und fanden bei der Rückkehr nur noch zerstörte Häuser und Wohnungen vor. Mehr als zehn Millionen Wehrmachtssoldaten und Angehörige der SS befanden sich bei Kriegsende in Kriegsgefangenschaft. Bereits Mitte Mai 1945 waren die Ersten wieder entlassen worden, doch ein großer Teil war immer noch in den Internierungslagern eingesperrt oder galt als verschollen.
Und dann gab es nicht zuletzt die etwa vierzehn Millionen heimatlosen Menschen, die aus den einstmaligen deutschen Ostgebieten in Richtung Westen geflohen oder zwangsweise umgesiedelt worden waren. In der Zeit des Nationalsozialismus hatte man die deutschsprachige Bevölkerung außerhalb des Reichsgebiets noch Volksdeutsche genannt, um sie fein säuberlich von den Reichsdeutschen zu unterscheiden. Jetzt wurden die Flüchtlinge aus dem Osten im offiziellen Sprachgebrauch meistens nur Umsiedler genannt.
Bereits auf der ersten Alliierten-Konferenz, die im November 1943 in Teheran stattgefunden hatte, waren Roosevelt, Churchill und Stalin zu der Übereinstimmung gelangt, dass die sowjetisch-polnische Ostgrenze nach dem absehbaren Kriegsende längs der Curzon-Linie verlaufen sollte, während dem polnischen Staat im Gegenzug als Entschädigung für die an Russland abgetretenen Gebiete eine Verschiebung seiner Westgrenze versprochen wurde. Zumindest auf dem Papier schien dies eine simple Lösung zu sein, doch die Probleme sollten damit erst beginnen, denn die Bevölkerung in den von der Maßnahme betroffenen Westgebieten war ethnisch stark gemischt und mehrheitlich nichtpolnisch. Gleichzeitig musste für die polnischstämmigen Familien aus den Ostgebieten Platz geschaffen werden, die im westlichen Teil neu angesiedelt werden sollten.
Und so war mit einem Federstrich eine Völkerwanderung ungeahnten Ausmaßes ausgelöst worden, eine technokratische Lösung, bei der sich kaum jemand darum gekümmert hatte, ob sie überhaupt zu bewältigen war. Auf der Potsdamer Konferenz war zwar beschlossen worden, dass die Überführung in ordnungsgemäßer und humaner Weise erfolgen sollte, doch Oppenheimer hatte in den letzten Monaten wiederholt mitbekommen, dass sich die realen Vorgänge nicht an diesen hochtrabenden Plänen messen ließen. Die Deportationen verliefen chaotisch, allzu häufig wurde dabei mit rücksichtsloser Gewalt durchgegriffen.
Und all diese Schicksale bekam nun Oppenheimer auf seinen Schreibtisch, denn er arbeitete seit etwa einem halben Jahr beim Deutschen Suchdienst im US-amerikanischen Sektor Berlins, dessen Dienststelle sich im Stadtteil Dahlem befand.
Nach der kurzen Unterbrechung durch Frau Scholz aus der Poststelle wandte sich Oppenheimer wieder den Karten mit den Suchanfragen zu und rieb seine klammen Hände. Wenigstens hatte Lisa irgendwoher fingerlose Handschuhe aufgetrieben, mit denen er beim Kartensortieren nicht ständig abrutschte.
Dass Oppenheimer und seine Kollegen bei ihrer Arbeit die Wintermäntel anbehielten und Handschuhe trugen, lag daran, dass es in den letzten Tagen in Berlin wieder deutlich kühler geworden war. Der kurze Wintereinbruch im November war erträglich gewesen, zumal es danach wieder freundliche Tage gegeben hatte. Und trotzdem hielt sich seitdem hartnäckig die Kälte in den Winkeln des Großraumbüros, in dem Oppenheimer tagtäglich hockte. Mit seinen sechs Metern Höhe war der Raum praktisch nicht beheizbar. Zumindest nicht, solange es in Berlin an allen Ecken und Enden an Brennmaterial mangelte.
Nachdem Oppenheimer seine Hände geknetet hatte, fuhr er mit der Sortierung der Karten fort. An manchen Tagen kam er sich vor wie eine Arbeitsbiene, aber das störte ihn nicht. Einer von rund fünfzig weiteren Angestellten zu sein, die an langen Holztischen im Auftrag des Roten Kreuzes, der Caritas und Berlins Innerer Mission Menschenschicksale katalogisierten, um Vermisste aufzufinden und Familien zusammenzuführen, vereinfachte die Dinge. Oppenheimer stach nicht mehr aus der Masse hervor. Über den Tisch gebeugt, verrichtete er seine Arbeit, beschäftigte sich mit Routinekram, und das acht Stunden am Tag.
Statt als Kommissar tagtäglich zu riskieren, bei den Alliierten anzuecken, die sich allzu selten auf einen gemeinsamen Nenner einigen konnten, hielt er sich viel lieber an die Buchstaben. Namen waren eindeutig. Unpolitisch.
Lang, Lange, Längefeld, Langenbach, Lagemack, Langenberg. Oppenheimer musste seine Augen anstrengen, um die Beschriftung auf den Karten entziffern zu können. Der trübe Winterhimmel lieferte trotz der raumhohen Fenster zu beiden Seiten ihres Büros einfach nicht genügend Licht. Und die in drei Reihen angeordneten Hängelampen über ihren Köpfen waren nur noch eine reine Dekoration, seitdem die Stadtverwaltung Anfang November dazu gezwungen worden war, Stromsperren zu verhängen. Oppenheimer befürchtete, dass sich in diesem Jahr genau dasselbe Versorgungsdebakel anbahnte wie schon im ersten Nachkriegswinter. Auch damals hatte man den Strom strikt rationiert, da die Kraftwerke nur unzureichend mit Kohle beliefert wurden.
Das Problem wurde noch verschärft, weil sich die sowjetische Militäradministration außerstande erklärt hatte, die Versorgung der kompletten Großstadt aus dem Berliner Umland zu gewährleisten. Deswegen musste jede Besatzungsmacht in ihrem Sektor selbst für den Nachschub an Nahrung und Rohstoff sorgen. Und so wurden die Sektoren der Briten, Franzosen und Amerikaner momentan nur durch einen einzigen Schienenstrang vom Westsektor aus beliefert. Trotzdem versuchte Oppenheimer, es positiv zu sehen. Wenn der Winter tatsächlich über sie hereinbrechen sollte, dann besaß er jetzt wenigstens ein Paar warme Handschuhe.
Oppenheimer ergriff ein Dutzend Karten und sortierte sie. Dann beugte er sich vor, um sie alphabetisch in die Holzfächer einzuordnen, die unter einer verschiebbaren Abdeckplatte in seinem Tischgestell eingelassen waren. Er war so in seine Aufgabe versunken, dass ihm die raschen Schritte hinter seinem Rücken nicht auffielen. Erst als sich jemand über seine Schulter beugte, bemerkte er, dass etwas geschehen war.
»Also, Herr Oppenheimer, da ist Besuch für Sie«, raunte jemand.
Es war Herr Furmannek, der stets auf tadellose Umgangsformen und penible Kleidung achtete, damit er mit seiner schwarzen Augenklappe nicht wie ein Freibeuter wirkte. Unter dem zugeknöpften Wintermantel war nicht viel zu sehen, doch Oppenheimer zweifelte nicht daran, dass sein Kollege wie gewöhnlich ein Hemd mit steifem Kragen und eine ordentlich gebundene Krawatte trug.
»Was ist denn?«, fragte Oppenheimer. »Ich kann nicht so einfach weg. Mittagspause ist doch erst in einer Stunde.«
Und da bemerkte er Herrn Furmanneks Kurzatmigkeit. »Es scheint dringend zu sein. Da ist etwas vorgefallen. Mit einer Frau namens Hilde. Sagt Ihnen der Name etwas?«
Oppenheimer richtete sich auf. Jetzt hatte sich die Nervosität auch auf ihn übertragen.
»Ja, was ist denn?«
Herr Furmannek schüttelte nur den Kopf und zeigte zur Poststelle. Eilig legte Oppenheimer die Karten zur Seite und schlängelte sich zwischen den Tischreihen hindurch.
In der Poststelle herrschte eine Stimmung wie bei einem Kaffeekränzchen. Ein halbes Dutzend Frauen saß vor einem Berg aus Karten − neue Suchanfragen, die von den Damen unter geselligem Geplauder sortiert wurden. Daneben stand eine graue Gestalt mit einem Schnurrbart und hielt verlegen ihren Hut in den Händen.
Es war Otto Seibold. Gerade rückte er die Brille zurecht. Der Schnurrbart zuckte nervös, und das Gesicht war hochrot. Seit Oppenheimer gemeinsam mit ihm und Franz Schmude dafür gekämpft hatte, ihre gute Freundin und erbitterte Nazi-Gegnerin Hilde vor dem Volksgerichtshof zu entlasten, konnte er sich nicht erinnern, Seibold jemals in einem derart aufgelösten Zustand gesehen zu haben.
Bei Oppenheimers Anblick atmete Seibold auf.
»Richard, ein Glück!«, platzte es laut aus ihm heraus, sodass auch die Damen hinter dem Papierberg auf ihn aufmerksam wurden. Oppenheimer spürte die neugierigen Blicke und zog Seibold in den leeren Flur.
»Was hast du denn, Otto?«, fragte Oppenheimer. »Was ist mit Hilde?«
Seibold öffnete den Mund, fand jedoch nicht gleich die richtigen Worte. »Ich weiß es nicht«, antwortete er schließlich mit einem Stoßseufzer. »Hilde wird festgehalten. In Schöneberg, beim Sozialamt. Sie hat jemanden vorbeigeschickt, um mich zu unterrichten. Sie wollen sie nicht mehr gehen lassen. Hilde meint, dass nur du sie da wieder herausholen kannst.«
Seibold hatte diese Nachricht derart schnell heruntergerattert, dass es Oppenheimer schwerfiel, ihm zu folgen.
»Was, Sozialamt?«, wiederholte er verwundert. »Was hat sie denn ausgefressen? Und warum hält man sie fest? Hat sie vielleicht jemanden beleidigt?«
Entschuldigend hob Seibold die Hände. »Mehr weiß ich auch nicht. Am besten, du machst dich unverzüglich auf den Weg.«
Wenn sogar eine patente Person wie Hilde nicht mehr weiterwusste, musste die Situation tatsächlich ernst sein. Voller Sorge wollte Oppenheimer auf die Straße stürzen. Er hatte die Hand bereits auf den Türgriff gelegt, als ihn etwas zurückhielt. So überstürzt den Arbeitsplatz zu verlassen, das gefiel ihm nicht.
»Das geht nicht so einfach«, murmelte Oppenheimer. »Ich muss mich erst abmelden.« Wenn er einfach so von der Bildfläche verschwand, konnte das falsch aufgefasst werden. Während der Sommermonate hatten etliche Kollegen gefehlt. Vor allem am Freitag und Samstag zogen sie es vor, in vollgestopften Zügen die strapaziöse Fahrt mit dem sogenannten Kalorien-Express aufs Land zu unternehmen, um dort Lebensmittel einzutauschen. Natürlich waren die Hamsterfahrten illegal, wenn man keinen Bezugsschein vorweisen konnte. Doch nachdem sich herumgesprochen hatte, dass die Polizei bei ihren Razzien zunehmend ein Auge zudrückte, waren die Bahnsteige immer voller geworden.
Ernährungsfachleute hatten errechnet, dass ein arbeitender Erwachsener einen Bedarf von täglich zweitausendzweihundert Kalorien hatte. Doch die auf Karte ausgegebenen Lebensmittel waren von der Stadtverwaltung aufgrund der desolaten Versorgungslage zuletzt immer weiter reduziert worden, sodass die Menschen in Berlin zeitweilig nur die Hälfte der nötigen Kalorienmenge bekamen. In den Läden gab es meistens nur Brot und Kartoffeln. Im russischen Sektor wurden statt der Fleischration häufig auch mal Heringe oder weißer Käse ausgegeben. Frisches Gemüse bekam man eigentlich nie, ebenso wenig wie die zugesicherte Fettration.
Und mit der Nahrungsnot wurde so mancher vor eine schwere Entscheidung gestellt. Sollte man am Arbeitsplatz erscheinen, um Anspruch auf eine Lebensmittelkarte zu haben, in der ungewissen Hoffnung, in den Läden überhaupt etwas kaufen zu können? Oder erschien es nicht sinnvoller, zwei Tage seiner Zeit für eine Hamsterfahrt zu investieren?
Aber jetzt, wo die ersten winterlichen Temperaturen eingesetzt hatten und bei den Bauern nicht mehr viel zu holen war, waren die Ausfallquoten zurückgegangen, und Oppenheimer rechnete sich gute Chancen aus, für ein paar Stunden vom Bürodienst freigestellt zu werden. Immerhin konnte er wahrheitsgemäß damit argumentieren, dass es sich um eine Amtsangelegenheit handelte.
Oppenheimer machte kehrt und lief zurück ins Büro.
»Komm mit, Otto«, erklärte er hastig. »Und jetzt erzählst du Herrn Suhr dasselbe wie mir.«
»Wer ist denn dieser Herr Suhr?«, fragte Seibold.
»Mein Vorgesetzter.«
Warum hatte er sich darauf eingelassen? Warum war er nur hierhergekommen? Georg Hüttner starrte auf die verblichenen Tapeten. Wie immer war er nervös, wenn er sich im US-Sektor befand. Obwohl ihn nur wenige Kilometer von der sowjetischen Zone trennten, ermahnte er sich, auf der Hut zu sein. Im Territorium der westlichen Imperialisten konnte ein Fehltritt desaströse Konsequenzen haben. Normalerweise suchte er die Begleitung eines anderen Genossen, wenn er sich dorthin wagte. Das war besser so, damit man nicht in Verdacht geriet, mit dem kapitalistischen Ausland zu kooperieren.
Doch Hüttner bewahrte Geheimnisse, die nicht ans Tageslicht kommen sollten. Und so hatte er keine andere Wahl, als sich an diesem Morgen ohne Begleitung in die Höhle des Löwen zu wagen.
Schon jetzt bereute er diesen Entschluss.
»Möchtest du einen Tee?«
Die harmlose Frage seines Bruders Josef riss Hüttner aus den dunklen Gedanken. Als Antwort verzog er den Mund zu einem Lächeln und nickte. Doch ein fader Geschmack blieb, denn den Tee, der ihm so großmütig angeboten wurde, hatte er selbst besorgen müssen. Neben Fleischkonserven, Zucker und Kartoffeln hatte Hüttner auch noch Zündhölzer und ein wenig Brennholz mitgebracht.
Er wäre am liebsten auf der Stelle wieder verschwunden, es erschien jedoch nicht ratsam, auf Konfrontation zu gehen. Er war sich schmerzlich bewusst, dass Josef ihn vollkommen in der Hand hatte. Hüttner machte widerwillig gute Miene zum bösen Spiel, das sich auf einen Nenner bringen ließ: Erpressung. Es war wohl besser, so zu tun, als sei er wegen eines Familienbesuchs hierhergekommen, und noch ein paar Minuten zu verweilen, um Josef so etwas wie Normalität vorzugaukeln. Also versuchte Hüttner, es sich in dem abgeschabten Ohrensessel bequem zu machen, was gar nicht so einfach war, da er jede einzelne Sprungfeder spürte.
Josef begab sich zur Kochnische. Die Küche war ebenso ärmlich eingerichtet wie fast alles hier. Ein gekachelter Herd mit einem langen Ofenrohr, das auch Wärme abgab, daneben ein mit zwei Schrauben an der Wand befestigtes Metallwaschbecken, bei dem an einigen Stellen die Emaillierung abgeplatzt war. Ein riesiger Waschzuber stand mitten im Zimmer, der allerdings dazu diente, das von der Zimmerdecke herabtropfende Wasser aufzufangen.
Immerhin war die Dachgeschosswohnung verhältnismäßig groß und verfügte sogar über eine separate Diele und ein eigenes Wasserklosett. Vermutlich ging das schon als Luxus durch.
Hüttner warf seinem Bruder einen prüfenden Blick zu. Es war albern, und doch konnte er nicht anders, als nach einem weibischen Zug in Josefs Verhalten zu suchen, nach einer auffälligen Artikulation, an die er sich nicht erinnerte, nach einem deplatzierten Hüftschwung.
Hüttner beobachtete Josefs schlaksige Gestalt vor dem Herd, als ihm von den Fenstern her ein eisiger Windhauch in den Nacken blies. Es war kälter hier oben, als er gedacht hatte. Er beschloss, dass es ein Fehler gewesen war, seinen Wintermantel auszuziehen, und ging zur Diele, wo er ihn an einen Wandhaken gehängt hatte.
Unmittelbar vor der Tür verharrte er. Hüttner glaubte, dahinter ein Geräusch zu hören. Vielleicht war jemand dort. Womöglich belauschte jemand sie.
Hüttner riss die Tür auf und trat in die Diele. Doch da war nichts. Die einzige Kontur war der graue Mantel an dem Wandhaken.
Erleichtert schnaubte Hüttner. Wahrscheinlich hatten ihm seine Sinne einen Streich gespielt. Er sah Gespenster. Anders konnte es nicht sein. Er wickelte sich in den wärmenden Mantel und kehrte zum Sessel zurück.
»Es war nichts«, sagte er kopfschüttelnd, als er Josefs fragenden Blick auffing. Dann ließ er sich betont gelassen in den Sessel sinken und musterte trübsinnig den einfachen Holztisch, auf dem das aufgerissene Paket mit den in Wachspapier eingewickelten Lebensmitteln lag.
Obwohl Hüttner kaum etwas damit zu tun hatte, wusste er von den Nöten der Berliner Bevölkerung. Der allgegenwärtige Hunger, bei dem sogar die umfangreichen Getreideimporte aus dem Ausland letztendlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein waren, der Mangel an Brennmaterial, der die Berliner dazu trieb, die Bäume und Büsche in den Parks abzuholzen und Kohletransporte zu bestehlen.
In Berlin war alles anders als in Hüttners Erinnerung. Aber vielleicht hatte er in den langen Jahren des Exils die Vergangenheit durch eine rosa Brille gesehen. Er führte jetzt wieder seinen alten Vornamen, und doch hatte er sich immer noch nicht daran gewöhnt, dass die Leute ihn nicht mehr mit seinem russischen Spitznamen Jurka anredeten.
Hüttner kam sich in seiner Heimatstadt fremd vor. Damit hatte er nicht gerechnet, als er wenige Monate nach dem Kriegsende mit einer Handvoll anderer Exildeutscher in einem unruhigen Flug von Moskau direkt nach Berlin verfrachtet worden war. Aus der Ferne betrachtet, war ihm die Lage in der Stadt nicht so schwierig erschienen. In Russland war Hüttner tagtäglich seiner Aufgabe nachgegangen, für den deutschsprachigen Radiosender Freies Deutschland Texte zu verfassen, um die Stimme gegen die Nazipropaganda zu erheben, die Macht der Worte gegen die Tyrannei zu setzen. Doch auf die ungeahnt komplexe Situation nach seiner Rückkehr hatte ihn keine der politischen Schulungen vorbereitet.
Stalin kooperierte mit den Westalliierten, obwohl sie, abgesehen von dem gemeinsamen Feind des Faschismus, kaum eine ideologische Übereinstimmung besaßen. Und der Anblick des Trümmerhaufens, zu dem Berlin geworden war, hatte in Hüttner Bestürzung ausgelöst. Noch größer war die Erschütterung, als er schließlich von den Verbrechen der Rotarmisten hörte. Zuerst war er überzeugt gewesen, dass die Leute die Unwahrheit sagten. Hüttners Genossen verfielen auf die einfache Erklärung, dass die Berichte von den Vergewaltigungen und Plünderungen Propaganda sein mussten, die von ausgebildeten Faschisten gestreut wurde, um ihre Aufbauarbeit zu torpedieren. Die russischen Truppen hatten schließlich für die gerechte Sache gekämpft, und in dieses Bild wollten diese Berichte nicht hineinpassen.
Je mehr Hüttner in den folgenden Monaten hörte, umso unsicherer wurde er, was wirklich der Realität entsprach. Aber der Weg zur Erlösung war selten ein Spaziergang. Womöglich war es ja Hüttners Aufgabe, diesen schrecklichen Geschehnissen dadurch einen Sinn zu geben, indem er für eine bessere Zukunft sorgte.
Es dauerte eine ganze Weile, ehe der Tee aufgebrüht war. Zumindest kam es Hüttner wie eine Ewigkeit vor, bis Josef einen Becher mit der dampfenden Flüssigkeit vor ihm abstellte. Dann setzte er sich gegenüber auf das Bett, der einzigen weiteren Sitzgelegenheit in dieser Wohnung.
»Ich wollte es nicht tun«, versuchte Josef schließlich, sich zu rechtfertigen. Er schlang den viel zu großen Wintermantel um sich. »Aber ich muss irgendwie leben. Das wirst du doch verstehen.«
»Jetzt ist es auch egal«, brummte Hüttner. Er spürte keinen Durst, dennoch nippte er an dem Tee. Wenigstens konnte er seine Hände an dem Becher wärmen. Hüttner klappte den Mantelkragen hoch. Er hasste die Kälte. Nach den Jahren im Exil wusste er, dass er diese Abneigung mit den meisten Russen teilte. Zuerst hatte er tatsächlich gedacht, dass ihnen arktische Temperaturen nichts anhaben würden. Ganz so, als loderte in ihnen ein Feuer, das sie stets warm halten würde. Hüttner konnte kaum glauben, wie naiv er gewesen war.
»Die Sachen«, setzte Josef an. »Schreib auf, was du mir alles bringst. Irgendwann werde ich es zurückzahlen.«
Hüttner lachte in sich hinein. Er glaubte nicht daran, dass sein Bruder die Schulden jemals begleichen würde.
»Ich kann dir nicht regelmäßig etwas bringen«, gab Hüttner zu bedenken. »Wenn wir uns hier in der Wohnung treffen, dann bedeutet das für mich ein gewisses Risiko.«
»Du kannst mir auch einen Ort im Russensektor vorschlagen.«
Hüttner dachte über dieses Angebot nach. Sicher, das würde die Sache vereinfachen, doch gleichzeitig erhöhte es für ihn die Gefahr, von seinen Genossen beobachtet zu werden. Selbst wenn sie nur zufällig von der Sache Wind bekamen, würde es Komplikationen geben.
In Gedanken formulierte Hüttner eine ausweichende Antwort. Er kam nicht mehr dazu, sie auszusprechen, denn unvermittelt brach draußen ein lautstarkes Durcheinander aus.
Zuerst waren in der Ferne Sirenen zu hören. Dann gesellte sich das Heulen von Automotoren hinzu. Schließlich drangen aufgeregte Stimmen in die Wohnung.
Hüttner riss die Augen auf. Seine schlimmsten Befürchtungen drohten wahr zu werden. Er sprang aus dem Sessel auf und war mit zwei schnellen Schritten beim Fenster. Eine der zersprungenen Scheiben war durch einen Pappkarton ersetzt worden, doch wenn man den Hals reckte, ließ sich durch das Glasstück daneben ein Teil der Straße unten überblicken.
Zwei Polizeiwagen kamen ins Blickfeld und bremsten direkt vor dem Haus ab.
Hüttner fühlte sich ertappt. Plötzlich erschien das heimliche Treffen mit Josef in einem neuen Licht. War es nur ein Vorwand gewesen, um ihn in den US-Sektor zu locken? Sein Bruder wollte ihn gar nicht erpressen, nein, sein Motiv war Vergeltung. Einen anderen Reim konnte sich Hüttner auf diese Situation nicht machen.
»Du falscher Hund«, zischte er. Dann packte er seinen Hut.
»Nicht ins Treppenhaus!«, rief Josef ihm nach, doch Hüttner nahm die warnenden Worte nicht mehr wahr.
Einen Augenblick später befand er sich bereits im dunklen Flur und schaute gehetzt über das Treppengeländer.
Dort unten hämmerte jemand an die Haustür.
Er befand sich im obersten Stockwerk. Nur wenn es ihm gelang, die Treppe ganz nach unten zu laufen, bestand die minimale Chance, in den Hinterhof zu entwischen.
Fast wie von selbst flogen seine Füße die Stufen hinunter. Im Erdgeschoss rempelte Hüttner eine alte Frau an, die im Begriff war, die Vordertür aufzusperren.
»Na, sajen Se mal, könn Se nich’ uffpassn?«, rief sie ihm gereizt nach.
Wieder pochte jemand gegen die Vordertür.
Hüttner lief einen engen Korridor entlang in den hinteren Gebäudeteil. Nur noch wenige Schritte, dann war die Hintertür in Reichweite.
Er streckte seinen Arm aus und drückte auf die Klinke. Er wollte bereits aus dem Gebäude hinausrennen, als er mitten in der Bewegung innehielt. Schließlich wusste er nicht, was ihn auf der anderen Seite erwartete. Wenn er Pech hatte, dann befand sich die Polizei bereits im Hinterhof.
Hüttner öffnete vorsichtig die Tür, bis ein kleiner Spalt offen stand, durch den er hinausspähen konnte. Rauch schlug ihm entgegen. In der Nachbarschaft schien etwas verbrannt zu werden.
Trotzdem konnte er vor den Trümmern des rückwärtigen Nachbarhauses nichts weiter erkennen als ein Durcheinander aus Abfalltonnen und Wäscheleinen. Also zog Hüttner die Tür auf und schlüpfte nach draußen.
Den Hut in die Stirn gezogen, löste sich Hüttner von der Hauswand. Er versuchte, nicht aufzufallen, doch es ließ sich kaum verhindern, dass seine Schritte immer schneller wurden. Wenn er es bis zur gegenüberliegenden Ruine schaffte, würde er entkommen können.
Keuchend eilte er über den Innenhof. Hinter seinem Rücken brüllte plötzlich jemand: »Stehen bleiben! Polizei!«
Hüttner drehte sich nicht um, denn er hatte die dunklen Fensterhöhlen der Ruine fast schon erreicht. Nur noch ein paar Schritte, und er konnte in dem zerstörten Gebäude verschwinden.
Den Blick starr nach vorn gerichtet, achtete Hüttner nicht mehr darauf, wohin er seine Schritte setzte.
Doch er hatte nicht damit gerechnet, dass sich noch etwas anderes im Hinterhof befand. Ein Fremdkörper, der hier ebenso wenig etwas zu suchen hatte wie Hüttner selbst.
Zuerst bemerkte er nur einen Widerstand. Etwas zerrte an seinem rechten Fuß, daraufhin verlor Hüttner das Gleichgewicht und fiel mit ungebremster Wucht zu Boden. In seinen Kniegelenken zuckte ein stechender Schmerz. Auf dem mit Steinsplittern und Scherben übersäten Boden riss er sich die Hände auf.
Augenblicklich näherten sich Schritte, Hände packten seine Oberarme und zogen ihn gewaltsam hoch. Hüttner trat mit den Beinen um sich, bis er wieder festen Boden unter den Füßen spürte.
Seine zwei Ergreifer trugen die Tschakos der Berliner Polizeikräfte. Einer von ihnen drückte einen Holzknüppel in Hüttners Nacken.
Doch jetzt, wo sie ihn in Gewahrsam hatten, kümmerten sie sich nicht mehr um Hüttner. Etwas anderes hatte ihre Aufmerksamkeit geweckt.
»So ’ne Scheiße«, entfuhr es einem der Polizisten.
Die Ordnungshüter starrten auf das Hindernis, über das Hüttner gestolpert war. Allerdings konnte er den Sinneseindruck zunächst nicht einordnen. Zu ungewöhnlich war der Anblick, zu rätselhaft.
Auf dem grauen Boden lugte zwischen den Kehrichttonnen ein Arm hervor. Schriftzeichen befanden sich auf der entblößten Haut. Hüttner war allerdings zu weit entfernt, um sie entziffern zu können. Der tote Körper lag in einer verrenkten Position hinter den Abfalleimern. Auf dem Kopf befanden sich graue Haare. Der weit aufgerissene Mund war kohlschwarz verfärbt. Statt eines Schreis entstieg dem Rachen der letzte Qualm eines ersterbenden Feuers.
Hüttner hatte bereits geahnt, dass die Situation für ihn gefährlich war, doch nun war sie geradezu lebensbedrohlich geworden. Die Polizei hatte ihn in unmittelbarer Nähe einer nackten Männerleiche aufgegriffen. Und das ausgerechnet im US-Sektor. Hüttner konnte nicht erklären, was er hier suchte.
Allmählich drang die unweigerliche Tatsache in sein Bewusstsein vor, dass er sich nicht herausreden konnte. Es würde ihm nicht einmal gelingen, Entlastungszeugen zu benennen. Bei diesem Gedanken musste Hüttner hart schlucken.
2
Montag, 9. Dezember 1946
Oppenheimer kniff die Augenlider zusammen. Immer wieder landeten Regentropfen in seinem Gesicht. Er hatte es eilig, zu Hilde zu kommen. Hastig trat er in die Pedale, die bei jedem Tritt ein durchdringendes Quietschen von sich gaben. Ein Fahrrad war vorläufig immer noch das beste Mittel, um sich in der Stadt vorwärtszubewegen. Er hatte den Drahtesel, dessen kaputtes Gestell er kurz nach der Eroberung Berlins irgendwo am Wegrand aufgelesen hatte, in der Zwischenzeit schon so häufig geflickt, dass er kaum noch sagen konnte, ob die ursprünglichen Originalbauteile überhaupt noch vorhanden waren.
Am Straßenrand kam ihm eine Gruppe Kinder entgegen. Ausgelassen lachend rollten sie schwere Gummireifen vor sich her. Oppenheimer fragte sich, woher sie die kostbaren Autoteile haben mochten, bis er nach einigen Hundert Metern ein auf Ziegelsteine aufgebocktes Fahrzeug sah. Offenbar hatten Passanten die günstige Gelegenheit wahrgenommen und das unbewachte Auto auseinandergebaut, um Ersatzteile zu erhalten. Es ärgerte Oppenheimer, dass solcher Vandalismus immer stärker um sich griff. Die ersten Anzeichen für den Sittenverfall waren ihm bereits in den letzten Kriegsjahren aufgefallen. Wenn man gewisse Dinge brauchte, die auf legalem Weg nicht zu bekommen waren, dann scheuten sich die Leute nicht, sie einfach zu stehlen. Mittlerweile gab es in Berlin kaum eine Gaststätte, in der die Gäste nicht die Birnen aus den Lampenfassungen geschraubt hatten.
Manchmal schien es Oppenheimer so, als seien sie alle in einer Zwischenwelt gestrandet, in der es keine Regeln mehr gab. Abgesehen von spielenden Kindern, radelte man heutzutage immer häufiger an Gestalten vorbei, die mit eingezogenem Kopf durch die Trümmerlandschaft schlichen. Ruinenmenschen, wie sie sich selbst gelegentlich nannten. Die unfreiwilligen Höhlenbewohner der Neuzeit trugen eine unsichtbare Last auf ihren Schultern. Zum ersten Mal seit dem Kriegsende hatte sich unter ihnen eine allgemeine Mutlosigkeit breitgemacht. Streng genommen war Deutschland jetzt kein Staat mehr. Die ehemalige Nation war in Sektoren aufgeteilt. Es gab keine Flagge, nicht mal eine offizielle Nationalhymne. Wenn die Industriebetriebe nicht demontiert worden waren, fehlten häufig die ehemaligen Zulieferfirmen, und so wurde bislang kaum etwas produziert. Wenigstens besaß Berlin wieder einen von der Stadtbevölkerung demokratisch gewählten Magistrat, der vor vier Tagen seine Arbeit aufgenommen hatte. Die eigentlichen Geschicke wurden bis auf Weiteres freilich von den vier Alliierten getroffen.
Es war für Oppenheimer immer noch ein Rätsel, warum beim Kriegsende der große Jubel der deutschen Bevölkerung ausgeblieben war. Selbst bei den Menschen, die in den langen Jahren der Unterdrückung die Befreiung vom Nationalsozialismus herbeigesehnt hatten, war von neuem Optimismus nicht viel zu spüren. Womöglich nahm ein Teil von ihnen die militärische Niederlage trotz allem als Schmach wahr.
Der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki, der Oppenheimer damals zutiefst verstört hatte, war in der Öffentlichkeit nach der ersten Aufregung schnell wieder in Vergessenheit geraten. Die von den Alliierten kontrollierte Presse hatte sehr zurückhaltend darüber berichtet. Die ungeheure Zerstörungskraft des neuen Bombentyps wurde gebührend hervorgehoben, fasziniert wurde darüber berichtet, dass die neue Bombe auf denselben Kräften basierte, aus denen die Sonne ihre Energie bezog. Und vor allem hatte man sogar zu lesen bekommen, dass die Atombombe ursprünglich nicht dazu entwickelt worden war, um den Krieg im Pazifik zu beenden, sondern um gegen Deutschland eingesetzt zu werden. Dementsprechend überwog beim Großteil der Bevölkerung die Erleichterung, noch mal davongekommen zu sein. Die rechtzeitige Zerschlagung von Hitlers Armeen hatte Deutschland vor einer Katastrophe ungeahnten Ausmaßes bewahrt. Dafür war nun Japan der Leidtragende.
Aber in Berlin kümmerten sich nur wenige Leute darum, was in anderen Ländern geschah. Meist interessierten sie sich nicht einmal mehr dafür, was im benachbarten Stadtteil vor sich ging, und wandten sich eher Dingen zu, die mit ihrem unmittelbaren Alltagsleben zusammenhingen. Hier hieß das vor allem, darüber zu spekulieren, inwieweit Ost und West überhaupt miteinander auskamen.
Die oberste Berliner Behörde nannte sich bezeichnenderweise Allied Kommandantura. Bereits der aus englischen und russischen Wörtern zusammengesetzte Begriff schien zu verdeutlichen, wie wenig die Bündnispartner zusammenpassten. Und tatsächlich verlief die Zusammenarbeit alles andere als reibungslos. So weigerte sich die Sowjetische Militäradministration hartnäckig, die Berliner Universität in ihrem Sektor unter eine gemeinsame Kontrolle zu stellen, sie war nicht einmal bereit, das von ihr im Krieg eroberte Haus des Rundfunks, das ironischerweise mittlerweile im britischen Sektor lag, von der Allied Kommandantura beaufsichtigen zu lassen. Daraufhin hatten Briten und Amerikaner kurzerhand eigene deutschsprachige Sender in Betrieb genommen, um den Berlinern einen Gegenpol zum sowjetisch dominierten Radioprogramm zu bieten.
In Oppenheimers Blickfeld kam nun ein Krämerladen, vor dem eine lange Menschenschlange stand. Nur noch der Überrest einer Fassade ragte in die Höhe, auf der jemand mit weißer Farbe den bitteren Kommentar Das brachte uns der Krieg gepinselt hatte. Das zerstörte Gebäude thronte auf einer Gerölllawine, und doch hatte ein findiger Ladeninhaber die Erdgeschosswohnung so weit instand gesetzt, dass er dort seine Waren feilbieten konnte.
»Ein schöner Mist!«, beklagte sich eine ältere Frau mit Kopftuch. Um die Wartezeit angenehmer zu gestalten, saß sie auf einer ausrangierten Kloschüssel, die sie vermutlich irgendwo in den Ruinen entdeckt hatte.
Der Ladenbesitzer ließ sich kurz blicken, als er einer Kundin die Tür öffnete. Auch sein adretter Kittel konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er zu wenig Waren auf Lager hatte, um die Bedürfnisse seiner Kundschaft zu befriedigen. In den Schaufenstern wurde entweder minderwertiger Billigkram ausgestellt oder sündhaft teure Luxusartikel, die sich ohnehin niemand leisten konnte. Die wirklich wichtigen Bedarfsgegenstände des alltäglichen Lebens wurden unter den Ladentheken verhökert.
Die adrette Dame, die aus dem Geschäft getreten war, trug teure Nylonstrümpfe. Als sie mit vollen Einkaufstüten an der Warteschlange vorbeistöckelte, zog sie neidische Blicke auf sich.
Die Frau mit dem Kopftuch war immer noch erbost und rief der Dame nach: »Und so was nennt sich Demokratie?«
Die neue offizielle Staatsform war in Windeseile zum geflügelten Schimpfwort geworden. Und in jedem Sektor vertraten die Anwohner natürlich die Meinung, dass ihre lokale Besatzungsmacht die schlimmste von allen sei. So klagten die Leute hier in Schöneberg über die Amerikaner, während die Anwohner von Charlottenburg und Wilmersdorf sich das Maul über die Briten zerrissen, und ganz im Norden in Wedding und Reinickendorf wurde über die Franzosen gestöhnt. Dass man sich in den östlichen Stadtbezirken wie Lichtenberg und Friedrichshain über die Russen beklagte, verstand sich fast schon von selbst.
Absurderweise glaubten vor allem die überführten Nazi-Mitläufer, dass sie zu Hitlers eigentlichen Opfern zählten, weil sie keine hohen Ämter mehr bekleiden durften und zwangsverpflichtet wurden, um bei der Enttrümmerung der Stadt zu helfen. Dass sie als Schwerarbeiter auch einen Anspruch auf bessere Lebensmittelrationen hatten, als wenn sie ihrem ursprünglichen Beruf nachgegangen wären, ignorierten sie geflissentlich.
Allzu viele seiner Landsleute hatten sich in dieser neuen Opferrolle mit einer Selbstgerechtigkeit eingerichtet, die Oppenheimer zutiefst verärgerte.
Als die Potsdamer Straße zur Hauptstraße wurde, war es bis zu Oppenheimers Ziel nicht mehr weit. In der Ferne geriet bereits der runde Turm der Paul-Gerhardt-Kirche in sein Blickfeld, der eher an einen Wasserturm erinnerte. Und tatsächlich sah Oppenheimer bald vor einer Filiale der Dresdner Bank ein vom Wind geblähtes Transparent, auf dem in weißen Buchstaben Rathaus Schöneberg stand. Weil das bisherige Rathaus schwer zerstört war, befand sich hier das provisorische Notquartier der Stadtverwaltung.
Oppenheimer bremste und stieg ab. Mit dem Drahtesel an seiner Seite lief er drinnen den Hauptgang entlang und studierte die Türschilder, in der Hoffnung, auf das Büro des Sozialamts zu stoßen. Als er in einen Seitengang spähte, entdeckte er schließlich Hilde, die mit einem guten Dutzend anderer Menschen vor einer Tür ausharrte.
Inmitten der grauen Gestalten fiel sie sofort ins Auge. Hilde trug einen altmodischen Hut und ein Regencape, das ebenfalls bessere Tage gesehen hatte. Mit den Kleidern wirkte sie ein wenig wie eine Matrone, wären da nicht ihre dauergewellten Locken gewesen, die unter der Hutkrempe hervorlugten. Bei Oppenheimers Anblick zog sie die Stirn kraus.
»Na, da bist du ja endlich!« Es klang wie ein Vorwurf. »Verdammt und zugenäht, ich stehe mir hier schon seit Stunden die Füße platt!«
Oppenheimer war immer noch ein wenig atemlos. »Aber was ist denn geschehen?«, erkundigte er sich besorgt.
Statt einer Antwort drückte Hilde ihm Papiere in die Hand. »Da! Ich mach das nicht mehr mit! Du beantragst endlich deine OdF-Karte. Und keine Widerrede!«
Für einen Moment stand Oppenheimer mit offenem Mund da und wusste nicht, wie ihm geschah. Dann dämmerte ihm allmählich, dass er einer Finte aufgesessen war.
»Hast du deswegen etwa Otto aufgescheucht?«, fragte er ungehalten. »Nur damit ich diese dämliche Karte beantrage?«
»Das ist keine dämliche Karte«, wiegelte Hilde ab. »Jetzt spiel nicht den großen Helden, du hast ein Anrecht darauf. Wäre doch blöd, das sausen zu lassen!«
Oppenheimer atmete geräuschvoll aus. »Auf die Lebensmittelkarte kriegt man ja sowieso kaum was«, murmelte er.
»Ist doch egal«, wies Hilde ihn zurecht. »Auf jeden Fall hast du mit der OdF-Karte ein Anrecht auf höhere Zuteilungen.«
Die Ausschüsse für die Opfer des Faschismus hatte man kurz nach dem Krieg in allen vier Besatzungszonen gegründet. Diese Fürsorgeorganisation sollte sich für alle Personen einsetzen, die während des Nationalsozialismus wegen ihrer politischen Einstellung verfolgt worden waren. Neben besseren Lebensmittelzuteilungen winkten noch weitere milde Gaben wie zum Beispiel ärztliche Versorgung und Sonderzuteilungen von Kleidung und Schuhen. Gelegentlich beschaffte der OdF-Ausschuss für Hitlers Opfer sogar Wohnunterkünfte.
Allerdings war es ein offenes Geheimnis, dass auch immer häufiger Personen eine OdF-Karte beantragten, die beim besten Willen nicht als Opfer oder gar Nazi-Gegner klassifiziert werden konnten. Und so wurde mittlerweile jeder Bewerber auf Herz und Nieren geprüft und in unterschiedliche Kategorien und Untergruppen eingeteilt. Außer den damit beauftragten Beamten wusste niemand so recht, wie diese Klassifizierungen genau definiert waren.
»Du marschierst da jetzt rein, ich habe schon alles für dich ausgefüllt«, fuhr Hilde fort. »Es dauert sowieso lang genug, bis der Antrag bearbeitet ist.«
Trotz Hildes Zureden blieb Oppenheimer wie angewurzelt neben seinem Fahrrad stehen. Die Menschen vor dem Büro des OdF-Ausschusses warfen ihm befremdliche Blicke zu. Unter den Wartenden befand sich auch ein Herr, der in einer gestreiften KZ-Sträflingskluft aufgetaucht war, um seine Berechtigung auf die OdF-Karte zu demonstrieren.
Bei diesem Anblick wurde Oppenheimer die Kehle eng. Obwohl er mit der Einführung des Arierparagraphen aus dem Polizeidienst entlassen worden war und mehrere Jahre in einem Judenhaus dahinvegetierte, kam er sich gegenüber dem KZ-Überlebenden wie ein Scharlatan vor. Durch die sogenannte Mischehe mit Lisa war Oppenheimer zunächst einigermaßen geschützt gewesen. Aber wenn er nach dem Fall Lutzow nicht untergetaucht wäre, hätte die finale Verhaftungswelle wohl auch ihn erfasst, und Oppenheimer wäre zusammen mit den letzten überlebenden Juden in eines der Vernichtungslager transportiert worden.
Das alles wäre vermutlich geschehen, wenn Oppenheimer nicht seine Unterstützer gehabt hätte, und darunter vor allem Hilde. Zum Glück war diese schlimme Zeit nun vorbei. Oppenheimer wollte endlich einen Schlussstrich darunter ziehen. Ja, er hatte eine Vergangenheit, aber noch mehr war er davon überzeugt, dass er eine Zukunft hatte, wie immer diese auch aussehen mochte.
»Ich bin doch noch davongekommen«, protestierte Oppenheimer schwach.
Hilde ließ sich nicht einmal dazu herab, diesen Einwand mit einer Antwort zu würdigen. Stattdessen nahm sie Oppenheimer den Fahrradlenker aus der Hand und zeigte resolut auf die Bürotür.
Oppenheimer verzog das Gesicht und fügte sich schließlich seinem Schicksal. Natürlich wollte Hilde nur sein Bestes. Und wie immer, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war Widerstand zwecklos.
Oppenheimer klopfte kurz an und trat dann in das Büro.
Als er zwei Stunden später in seine Dienststelle zurückkehrte, zeigte sich, dass der Tag für Oppenheimer noch weitere Überraschungen parat hielt. Er hatte so ein schlechtes Gewissen wegen seiner Abwesenheit, dass er quer durch die Poststelle zurück an seinen Arbeitsplatz hastete und kaum etwas um sich herum wahrnahm.
Erst als Oppenheimer im Großraumbüro seinen Vorgesetzten erspähte, wurde er stutzig. Herr Suhr blieb üblicherweise in seinem eigenen Zimmer, doch jetzt saß er zwischen den Schreibtischen auf einem Stuhl und blickte prüfend zum Eingang. Er war ein kleiner Mann, trug stets eine Fliege und war ansonsten sehr reserviert. Und heute wirkten seine Sorgenfalten besonders tief.
Bei Oppenheimers Anblick sprang er auf und näherte sich mit ernstem Blick. »Wenn Sie bitte mitkommen möchten«, murmelte er.
Oppenheimer fiel auf, wie einige Kollegen hinter vorgehaltener Hand tuschelten.
Unbeholfen führte Suhr ihn aus dem Büro und blieb schließlich vor der Toilette stehen. Fast schon verschwörerisch beugte er sich vor. »Also, Herr Oppenheimer, da ist jemand für Sie. Er wartet schon seit fast einer Stunde auf Sie.«
»Entschuldigung, Herr Suhr, aber von wem sprechen Sie denn?«
Aus Suhr platzte es heraus: »Na, dieser Russe! In Uniform und allem. Ich glaube, das muss ein Offizier sein.«
Oppenheimer überlegte. Wenn aus heiterem Himmel im US-Sektor ein sowjetischer Offizier auftauchte, war praktisch garantiert, dass dies beträchtliches Aufsehen erregte. Auch Oppenheimer war zunächst besorgt. Wollten sie ihn etwa verhaften? Oder ihn kurzerhand in die Sowjetunion transportieren? Der Gedanke war naheliegend, denn einen Tag nach der niederschmetternden Wahlniederlage der Sozialistischen Einheitspartei SED bei den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung am 20. Oktober 1946 hatte die sowjetische Besatzungsmacht damit begonnen, aus der sowjetischen Zone und dem eigenen Berliner Sektor deutsche Facharbeiter, Spezialisten und Wissenschaftler wie bei einer Razzia aufzugreifen und mit unbekanntem Ziel in Richtung Osten zu verfrachten.
Schließlich beruhigte sich Oppenheimer jedoch mit dem Gedanken, dass ein ehemaliger Mordkommissar nicht gerade ein Facharbeiter in einer wichtigen Schlüsselindustrie war.
»Kennen Sie vielleicht den Namen dieses Herrn?«, fragte er Herrn Suhr. »Oder hat er gesagt, was er von mir will?«
»Leider konnte ich ihn nicht verstehen«, antwortete Suhr. »Tatsächlich glaube ich, dieser Herr spricht kein einziges Wort Deutsch. Und dann hat er es sich in meinem Büro bequem gemacht. Hat es konfisziert, einfach so! Und er besitzt auch noch die unglaubliche Frechheit, die Füße trotz seiner dreckigen Stiefel auf meinen Tisch zu legen!« Suhr ballte bei diesem Gedanken die Fäuste.
Oppenheimer begriff, dass bei solchen Geschehnissen sogar ein preußischer Beamter zur Furie werden konnte. Wortlos nickte er seinem Vorgesetzten zu, doch ihm fiel nichts ein, womit er die Wogen hätte glätten können.
Sowie Oppenheimer in Suhrs Büro getreten war, schlug ihm der unverwechselbare Gestank des russischen Machorka-Tabaks entgegen. Jemand bewegte sich hinter den Rauchschwaden. Über dem steifen Kragen einer Uniform reckte sich Oppenheimer ein Kopf mit kurz geschorenen Haaren entgegen.
»Мoj drug Oppenheimer!«, sagte der Offizier und lächelte ihn mit blitzenden Stahlkronen an.
Es war Oberst Aksakow. Dessen freudige Reaktion und die Tatsache, dass er Oppenheimer mit dem russischen Wort für Freund begrüßt hatte, ließen ihn aufatmen. Seit ihrer letzten Begegnung war schon mehr als ein Jahr vergangen, und Aksakow schien es in Berlin dermaßen gut zu gehen, dass sein Gesicht sogar noch runder geworden war.
Der Oberst trat an Oppenheimer heran und drückte ihn an sich. Obwohl sie damals gemeinsam den russischen Deserteur Grigorjew und dessen Bande zur Strecke gebracht hatten, konnte er sich nicht daran erinnern, von Aksakow jemals derart herzlich begrüßt worden zu sein. Das konnte nur bedeuten, dass er etwas von ihm wollte. Und tatsächlich packte Aksakow ihn ohne weitere Erklärungen am Arm und zog ihn nach draußen.
Oppenheimer kam nicht einmal mehr dazu, sich bei Herrn Suhr abzumelden. Aber der war sicherlich heilfroh darüber, dass der sowjetische Offizier aus seinem Zimmer verschwunden war.
3
Montag, 9. Dezember 1946
Oppenheimer glaubte zuerst, zornige Hummeln zu hören. Doch es waren nur die Propeller eines landenden Flugzeugs, das im Sinkflug über die Hausdächer glitt. Sie mussten sich in unmittelbarer Nähe des Flughafens Tempelhof befinden.
Er saß auf dem Rücksitz einer schweren Limousine und sah im Rückspiegel die asiatischen Züge von Aksakows Fahrer Serjoscha. Der Oberst hatte nicht verraten, wohin er Oppenheimer entführen wollte, und in dem allgegenwärtigen Durcheinander aus zerbombten Häusern und Bauschutt konnte man leicht die Orientierung verlieren.
Findige Leute hatten ausgerechnet, dass in Berlin fünfundfünfzig Millionen Kubikmeter Erde und Steinbrocken lagen, elf Millionen Kubikmeter Holz und 1,3 Millionen Tonnen Stahl. Die gesamte Trümmermenge wurde auf circa hundert Millionen Tonnen geschätzt, was wiederum einem Raumgehalt von fünfundsiebzig Millionen Kubikmetern entsprach. Mit anderen Worten: Es könnte bis 1970 dauern, bis sämtliche Überreste der Bombardierungen beseitigt waren. Anderen Schätzungen zufolge hätte man mit dem Berliner Schutt einen dreißig Meter breiten und fünf Meter hohen Steinwall bis nach Köln bauen können.
Soweit Oppenheimer erkennen konnte, waren sie in Richtung Osten gefahren. Erst als Serjoscha in den Kreisverkehr des Belle-Alliance-Platzes eingebogen war, den man mittlerweile nach einem der Begründer der KPD in Franz-Mehring-Platz umbenannt hatte, wusste er wieder, wo sie sich befanden.
Aksakows Fahrer drosselte das Tempo ihres Wagens. Ihr Ziel war also der Hermannstraßenkiez in Neukölln. Dieses Viertel galt als eher bürgerlich, doch auch hier wirkten die Straßenzüge grau, die Hauswände wiesen immer noch Einschusslöcher auf. Oppenheimer war eigentlich davon ausgegangen, dass er Aksakow in die Sowjetzone begleiten sollte, was der Oberst allerdings mit ihm in der US-Zone zu suchen hatte, überstieg seine Vorstellungskraft.
Serjoscha blieb, mit laufendem Motor, am Straßenrand stehen und musterte argwöhnisch die Umgebung. Aksakow kannte keine derartigen Skrupel und zwängte sich wortlos durch die Beifahrertür nach draußen.
Der Oberst näherte sich einem arg ramponierten Wohnhaus. Zielstrebig schritt Aksakow durch einen schmalen Seitengang in den Hinterhof. Obwohl Oppenheimer recht gut zu Fuß war, hatte er doch Mühe, bei diesem Tempo mitzuhalten.
Im Hinterhof angelangt, postierte sich Aksakow breitbeinig vor einer Gruppe von drei wartenden Männern. Als Oppenheimer kurz hinter dem Oberst auftauchte, warfen ihm die Anwesenden verwirrt Blicke zu.
»Also, was gibt es?«, erkundigte sich einer der Männer. »Können wir weitermachen?«
Oppenheimer zog seine Brauen zusammen. Der Mann nahm den Hut ab, um seine kahle Stirn mit einem Taschentuch abzutupfen. Die Prozedur geriet recht umständlich, denn ihm fehlte der linke Unterarm.
»Billhardt?«, fragte Oppenheimer.
Der Mann mit dem Taschentuch stutzte. Oppenheimer zugewandt, murmelte er: »Na, ich fress ’nen Besen.«
Billhardt setzte hastig den Hut wieder auf.
»Oppenheimer? Bist du das?«
Damals, als sie noch Kollegen bei der Mordkommission gewesen waren, hatte es sich so eingespielt, dass sie sich duzten, aber beim Nachnamen nannten.
»Tja, wie du siehst, bin auch ich übrig geblieben«, antwortete Oppenheimer. »Bist du wieder im Polizeidienst?« Mit dieser Frage nickte Oppenheimer in die Richtung der Kehrichttonnen. Trotz seiner Überraschung, hier auf einen alten Kollegen zu treffen, war ihm die halb verdeckte Leiche sofort aufgefallen.
»Aber ja, sie haben mich übernommen«, antwortete Billhardt. Er schien unsicher zu sein, ob eine herzliche Begrüßung angebracht war. Letztendlich reichte er Oppenheimer mit einem gequälten Lächeln die Hand. Billhardts Zögern war leicht zu erklären. Vor mehr als zwei Jahren hatte der ehemalige Kollege in einem schwachen Moment gebeichtet, dass er während des Krieges an der Ostfront Zivilisten exekutieren musste. Billhardt war diesem Strudel der Gewalt nur entkommen, weil ihm eine Granate den Arm abgerissen hatte.
Oppenheimer hatte bereits gehört, dass die Polizei darauf achtete, ehemalige Mitarbeiter nur dann wieder einzustellen, wenn sie unbelastet waren. Und so spürte er eine gewisse Neugierde, wie es Billhardt gelungen war, seine Vergangenheit zu vertuschen. Vielleicht hatte es bereits genügt, diesen Makel zu verschweigen, in der Hoffnung, dass die Polizeibehörde viel zu beschäftigt war, um alle Angestellten lückenlos zu überprüfen. Sicher war sich Billhardt bewusst, dass Oppenheimer ein Mitwisser war, der ihm sogar gefährlich werden konnte, wenn er auf die Idee käme, die Beteiligung des Ex-Kollegen an Kriegsverbrechen auszuplaudern.
Um die Situation zu entspannen, versuchte Oppenheimer, einen unverbindlichen Plauderton anzuschlagen. Die harmloseste Frage schien ihm zu sein, sich nach Billhardts Gattin zu erkundigen.
»Und was macht Dorothee so?«
»Ach, der geht es recht gut. Zum Glück war sie nicht in Berlin, als die Russen …« Billhardt verstummte und warf Aksakow einen Seitenblick zu. Er hielt es für sicherer, in dessen Anwesenheit nicht über die Vergewaltigungen zu reden. »Na, du weißt schon. Jedenfalls wurde Dorothee nicht verschlissen. Sie kam erst vom Land zurück, als Berlin schon erobert war. Und was ist mit Lisa?«
Für einen Augenblick spürte Oppenheimer eine gewisse Kurzatmigkeit. Er war noch längst nicht darüber hinweg, dass seine Frau weniger Glück gehabt hatte. Obwohl es ihm gelungen war, ihren Vergewaltiger zu fassen, konnte die Tat nicht ungeschehen gemacht werden. Oppenheimer sagte nur: »Ach, Lisa arbeitet jetzt in Charlottenburg bei den Briten. Als Übersetzerin. Du weißt ja, sie war Englischlehrerin.«
Billhardt nickte bedächtig. »Du bist nicht bei der Polizei? Ich meine, ich hätte das ja sicher mitbekommen. An sich suchen die genau solche Leute wie dich. Mehrjährige Berufspraxis, nachweislich unbescholten.«
»Momentan bin ich versorgt«, antwortete Oppenheimer bewusst zweideutig.
Wie es in den versteckten Berliner Hinterhöfen so üblich war, hatte man auch hier den Eindruck, sich in einem hermetisch abgeschlossenen Raum zu befinden, obwohl wenige Meter über ihren Köpfen das Rechteck des Himmels erkennbar war. In einer Ecke befand sich ein Fahrradschuppen, über dem Eisenstege zum Hausdach führten. In den Wänden gab es nur wenige Fenster, die größte Fläche wurde von dem abblätternden Putz in Beschlag genommen. Die hintere Seite des Innenhofs bestand aus einer Ruine. Wenn Oppenheimer seinen Kopf bewegte, konnte er zwischen den Trümmern hindurch die dahinter liegende Straße erspähen.
»Und was ist mit dem Toten?«, fragte Oppenheimer.
Billhardt wurde sich bei dieser Bemerkung bewusst, wo sie sich befanden.
»Eine merkwürdige Sache«, sagte er kopfschüttelnd. »Und noch merkwürdiger ist, dass wir die Leiche nicht wegschaffen dürfen, bis irgend so ein Spezialist auftaucht. Keine Ahnung, wer das sein soll. Die Spurensicherung war schon da, alles ist fertig. Doch wir müssen hier warten und Däumchen drehen. Aber darüber kann ich nur lächeln. Wir werden ja überall behindert. Witzigerweise ist die Kripozentrale im Ostsektor angesiedelt, aber das Untersuchungsgefängnis Moabit und die Vernehmungsrichter sitzen alle im britischen Sektor. Du kannst dir ja vorstellen, was für einen Kladderadatsch das gibt. Für jeden Häftlingstransport müssen die Russen eine Genehmigung erteilen – aber die machen immer Schwierigkeiten.«
Billhardts Hinweis, dass er mit den anderen auf einen Fachmann wartete, weckte in Oppenheimer einen gewissen Verdacht. »Vielleicht weiß Oberst Aksakow ja mehr über diesen Spezialisten?«, schlug er vor.
Für einen Moment schwieg Billhardt, dann gesellte er sich zu den übrigen Männern. Es waren zwei graue Personen mit ebenso grauen Hüten und verhärmten Einheitsgesichtern, wie man sie überall in der Stadt sah. Nach einem kurzen Gemurmel wandte sich einer von ihnen an Aksakow und unterhielt sich mit ihm in bruchstückhaftem Russisch.
»Das ist Wenzel«, erklärte Billhardt anstatt einer formellen Vorstellung.
Als Billhardts Mitarbeiter mit gesenkter Stimme Aksakows Antwort übersetzte, brach dieser plötzlich in schallendes Gelächter aus.
»Ja, natürlich«, japste er und zeigte dann mit dem Finger auf Oppenheimer. »Du bist dieser Spezialist. Du hattest keine Ahnung?«
»Mir sagt ja niemand was«, erwiderte Oppenheimer.
Als er Aksakow einen fragenden Blick zuwarf, nickte dieser nur bestätigend und zeigte dann auf die Leiche.
»Dawai! Dawai!«, befahl er Oppenheimer und schlenderte zufrieden zurück zu seinem wartenden Fahrzeug.
Sobald Aksakow verschwunden war, entspannten sich die Männer. Jetzt waren sie wieder unter sich. Kein Außenstehender mischte sich mehr in ihre Angelegenheiten ein.
»Der Oberst will morgen noch einmal mit Ihnen sprechen«, sagte Wenzel. »Sie sollen ihm dann ein Bild der Lage geben.«
»Der Genosse Oberst scheint ja große Stücke auf dich zu halten«, sagte Billhardt augenzwinkernd. »Wie kommt das?«
»Ach, ich habe mal für ihn ermittelt«, erklärte Oppenheimer bescheiden.
Billhardt nickte mit einem breiten Grinsen. »Ich sehe schon, die Katze lässt das Mausen nicht. Na, dann schau dir mal unseren Kunden an. Heute früh haben wir um Viertel vor neun den Anruf einer Anwohnerin erhalten. Eine Polizeistreife wurde vorbeigeschickt, und sie fanden diese Leiche vor.«
Oppenheimer hatte in seiner Karriere als Mordkommissar schon so manchen Toten zu Gesicht bekommen, doch diesmal waren die Begleitumstände derart merkwürdig, dass er sich an keinen ähnlichen Fall erinnern konnte. Der Verstorbene lag in einer verrenkten Position hinter den Abfalleimern. Weiße Haut strahlte Oppenheimer entgegen, denn unerklärlicherweise war der leblose Körper splitterfasernackt. Oppenheimer schätzte den Mann auf Anfang siebzig. Seine Arme waren weit ausgestreckt, der starre Blick zum Himmel gerichtet. Fast erinnerte er Oppenheimer an Ikarus, der der Sonne zu nahe gekommen war, sodass ihm das Wachs unter den Federn schmolz und er abstürzte.
Die Arme und Beine des Toten waren mit Schriftzeichen versehen, und in der unteren Gesichtshälfte klaffte ein schwarzer Schlund. Oppenheimer kniete sich neben der Leiche nieder, um den geöffneten Mund genauer zu betrachten. Hinter den lückenhaften Zahnreihen entdeckte er verkohltes Papier.
»Was soll denn das?«, fragte Oppenheimer.
Billhardt trat an ihn heran, seinen Blick auf den Toten geheftet. »Wahrscheinlich hat jemand ihm Papier in den Mund gestopft und es dann angezündet. Als die Nachbarin ihn entdeckte, brannte es noch. Sie hat einen schönen Schreck bekommen. Abgesehen von ein paar Kratzern, gibt es äußerlich keine Anzeichen von Gewaltanwendung. In der Umgebung befand sich auch keine Tatwaffe. Wir können also noch nicht ausschließen, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Aber mit Sicherheit wird sich dieser Herr nicht selbst hier nackt auf den Boden gelegt haben. Und das brennende Papier im Mund – vielleicht wollte jemand den Toten ja verbrennen.«
Oppenheimer schüttelte den Kopf. »Mit ein Paar Fetzen Papier eine Leiche in Brand setzen – also nein, ich glaube nicht, dass so was funktioniert. Dazu brauchte man schon einen Brandbeschleuniger.«
»Petroleum oder Sprit war dem Täter vielleicht zu kostbar«, wandte Billhardt ein.
Oppenheimer richtete seinen Blick auf die unregelmäßigen Muster auf den Armen und Beinen.
»Was ist das? Tätowierungen? War der Tote vielleicht ein Seemann?«
»Das ist keine Tätowierung«, sagte Billhardt. »Die Schriftzeichen hat ihm jemand mit schwarzer Tinte auf die Haut geschrieben. Soweit wir erkennen können, sind es irgendwelche Namen.«
Die Schrift auf der Haut war schwer zu entziffern. Oppenheimer musste seine Fantasie gehörig anstrengen, ehe er aus den krakeligen Buchstaben einzelne Namen bilden konnte. Max Erdmann, Andreij Kuprijanow, Sigmar Baer, Günter Altmann. Auf Anhieb sagten ihm die Namen nichts.
»Das gefällt mir nicht.« Mit dieser Bemerkung richtete sich Oppenheimer auf.
»Stimmt«, pflichtete Billhardt bei. »Sieht ganz so aus, als wollte da jemand einen Spaß mit uns treiben.«
»Besonders lustig ist das aber nicht«, brummte Oppenheimer.
»Wir wissen mittlerweile, dass der Tote Orminski hieß. Jakob Orminski.«
Oppenheimer stutzte. »Ein ostpreußischer Name?«
Billhardt nickte. »Genau, klingt ganz nach einem Volksdeutschen. Er wohnte hier in dem Haus, war offiziell aber nicht angemeldet. Außer dem Namen haben wir momentan noch nichts.«
Oppenheimer bewegte sich in einem Halbkreis um den Toten herum. Er hatte damit gerechnet, bei dem Leichnam die üblichen Anzeichen der Mangelernährung zu sehen, einen aufgeblähten Bauch, eiternde Geschwüre. Doch nichts dergleichen war zu erkennen. Der alte Herr schien gut genährt zu sein, und das in Zeiten allgemeiner Nahrungsknappheit.
Schließlich glaubte Oppenheimer, genug gesehen zu haben, und nickte Billhardt zu. »Dann lasst ihn mal ins Leichenschauhaus bringen. Wart ihr schon in seiner Wohnung?«