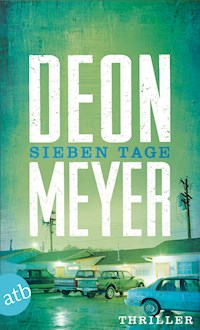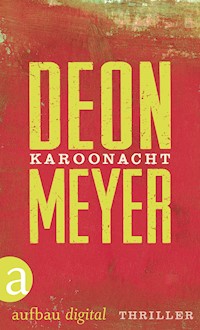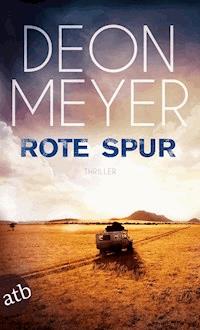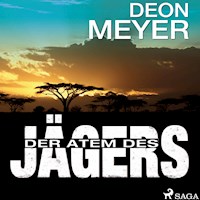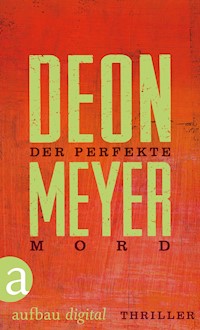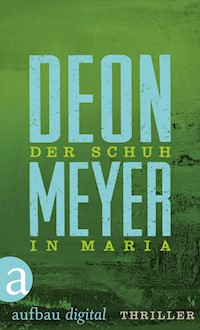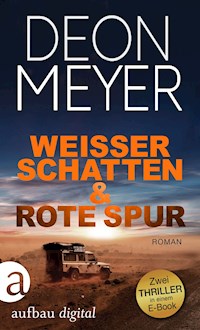Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Benny Griessel Romane
- Sprache: Deutsch
Wer hoch fliegt.
Kapstadt im Dezember. Bennie Griessel wird zu einem Tatort gerufen, der ihn aus der Fassung bringt. Ein Kollege hat seine Frau, seine zwei Töchter und dann sich selbst erschossen. Bennie will nur noch weg – von Alexa, seiner Freundin, von seinen Kindern. Er landet in einer Bar und betrinkt sich. Ein herber Rückfall für den trockenen Alkoholiker. An einem Strand experimentiert ein Kameramann mit einer Drohne und entdeckt eine Leiche. Ein Mann ist offenkundig erdrosselt worden. Als die Polizei die Identität des Mannes herausgefunden hat, sind alle in heller Aufregung. Ernst Richter galt seit Wochen als vermisst. Prominent wurde er durch seine Interplattform Alibi. Allen, die eine Affäre haben wollten, versprach er den sorgenfreien Seitensprung. Als man Bennie zu Hilfe rufen will, sitzt der nach einer Prügelei im Gefängnis. Und noch einen treibt der Tod von Ernst Richter um: den Weinbauer Francois du Toit aus Stellenbosch, der sich auf zwielichtige Geschäfte eingelassen hat ...
Ein fulminanter Roman, in dem das paradiesische und dunkle Südafrika eng nebeneinanderliegen. Das Meisterwerk eines der besten Thrillerautoren weltweit.
»Im Thrillergewand breitet Deon Meyer die Probleme, aber auch die Fortschritte der südafrikanischen Gesellschaft aus ... All das steckt in seinen ziemlich spannenden Geschichten.« Die Welt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Informationen zum Buch
Wer hoch fliegt …
Bennie Griessel war ein trockner Alkoholiker – bis zu dem Tag vor Weihnachten, als ein Freund seine Familie und sich selbst erschießt. Er beginnt wieder zu trinken, und als seine Kollegen ihn suchen, sitzt er im Gefängnis. Dabei hat Bennie einen neuen, spektakulären Fall. Ein Mann wird stranguliert an einem Strand aufgefunden. Ernst Richter hatte ein besonderes Geschäftsmodell. Allen, die fremdgehen wollten, versprach er, für ein todsicheres Alibi zu sorgen.
Ein fulminanter Roman, in dem das paradiesische und dunkle Südafrika eng nebeneinanderliegen. Das Meisterwerk eines der besten Thrillerautoren weltweit.
Kapstadt im Dezember. Bennie Griessel wird zu einem Tatort gerufen, der ihn aus der Fassung bringt. Ein Kollege hat seine Frau, seine zwei Töchter und dann sich selbst erschossen. Bennie will nur noch weg – von Alexa, seiner Freundin, von seinen Kindern. Er landet in einer Bar und betrinkt sich. Ein herber Rückfall für den trockenen Alkoholiker.
An einem Strand experimentiert ein Kameramann mit einer Drohne und entdeckt eine Leiche. Ein Mann ist offenkundig erdrosselt worden. Als die Polizei die Identität des Mannes herausgefunden hat, sind alle in heller Aufregung. Ernst Richter galt seit Wochen als vermisst. Prominent wurde er durch seine Interplattform Alibi. Allen, die eine Affäre haben wollten, versprach er den sorgenfreien Seitensprung.
Als man Bennie zu Hilfe rufen will, sitzt der nach einer Prügelei im Gefängnis. Und noch einen treibt der Tod von Ernst Richter um: den Weinbauer Francois du Toit aus Stellenbosch, der sich auf zwielichtige Geschäfte eingelassen hat.
»Im Thrillergewand breitet Deon Meyer die Probleme, aber auch die Fortschritte der südafrikanischen Gesellschaft aus … All das steckt in seinen ziemlich spannenden Geschichten.« Die Welt
Deon Meyer
Icarus
Thriller
Aus dem Afrikaans von Stefanie Schäfer
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Epilog
Danksagung
Quellen
Glossar mit Erklärungen der afrikaanssprachigen Wörter und anderer Begriffe
Über Deon Meyer
Impressum
Les ennemis du vin sont ceux qui ne le conaissent pas.
(»Nur die hassen den Wein, die ihn nicht kennen.«)
Das Zitat wird zwei Personen zugeschrieben: Professor Dr. Sellier, Journal de Médecine, in: Boland, Wynland (Vlok Delport, Nasionale Boekhandel, 1955), sowie »Professor Portmann« vermutlich Professor Michel Portmann, Arzt aus Bordeaux.
In clinical settings, some depressed people demonstrate a high proneness to survivor guilt, that is, guilt over surviving the death of abeloved one, or guilt about being better off than others.
»In klinischer Umgebung weisen manche Patienten mit Depressionen eine hohe Anfälligkeit für das Überlebenden-Syndrom auf, das heißt, sie leiden unter Schuldgefühlen, weil sie den Tod eines geliebten Menschen überlebt haben oder weil es ihnen besser geht als anderen.«
»Guilt, fear, submission, and empathy in depression«.
Lynn E. O’Connor, Jack W. Bery, Joseph Weiss, Paul Gilbert,
Journal of Affective Disorders.
1
Es war ein Komplott zwischen Himmel und Erde, das die Leiche Ernst Richters dem Boden entriss – als hätten sich die Elemente verschworen, um der Gerechtigkeit auf die Sprünge zu helfen.
Zuerst der Sturm am siebzehnten Dezember, der morgens um kurz nach acht Uhr ausbrach. Ein seltenes Phänomen, aber durchaus erklärlich, entstanden durch die Ausläufer eines thermischen Tiefdruckgebietes: ein blauschwarzes, brodelndes Ungeheuer, das aus dem Norden kurz hinter Robben Eiland über den Atlantik herangerast kam.
Die Wolkenmasse schleuderte theatralische gezackte Zungen meer- und erdwärts und zog eine dichte Regengardine hinter sich her, die in weniger als einer halben Stunde einundsiebzig Millimeter Niederschlag über Bloubergstrand, Parklands, Killarney Gardens und Zeezicht ergoss.
Es kam zu Überflutungen und Verkehrschaos. In den Mainstream-Medien und den sozialen Netzwerken wurde atemlos das K-Wort zitiert. Klimakollaps.
Doch beim Herausspülen der Leiche war der Beitrag des Klimas eher bescheiden; nur die Beschaffenheit der Landschaft jenseits von Blouberg trug dazu bei, wo der Südostwind wie ein blinder Bildhauer die Dünen derart geformt hatte, dass die Sturzflut zufällig kanalisiert wurde. Sie legte die Füße Ernst Richters frei, einer in tragischer Nacktheit, der andere noch mit schwarzer Socke bekleidet. Auf Halbmast. Ein bizarres Bild.
Das letzte Glied in der Kausalkette war das Schicksal, das den neunundzwanzigjährigen Kameramann Craig Bannister gegen 11:17 Uhr dort in der Nähe anhalten ließ, am Rand der Otto du Plessis-Laan, der Küstenstraße zwischen Blouberg und Melkbosstrand. Er stieg aus seinem Fahrzeug und prüfte das Wetter. Der Wind hatte sich größtenteils gelegt, und die Wolken rissen allmählich auf. Bannister wollte seine neue ferngesteuerte Flugmaschine, die DJI Phantom 2 Vision+ mit stabilisierter, hochauflösender Videokamera, ausprobieren. Die Phantom, ein sogenannter Quadrokopter, war ein technisches Wunderwerk im Kleinen, ausgerüstet mit GPS und WLAN. Dies ermöglichte es Bannister, sein iPhone mit der Kamera zu koppeln und die Videoaufnahmen auf dem Display seines Smartphones zu verfolgen, nur Millisekunden, nachdem die Phantom sie oben aus der Luft aufgezeichnet hatte.
Um kurz nach 11:31 Uhr runzelte Bannister die Stirn bei dem merkwürdigen Bild auf dem Handy und steuerte die Phantom tiefer und näher zu der betreffenden Stelle. Einen Meter über der Szene ließ er sie in der Luft schweben, bis er sich ganz sicher war.
Sand, schwarze Plastikplane – und Füße. Unverkennbar.
Er blickte von seinem iPhone auf, suchte nach der schwebenden Phantom und machte sich eilig auf den Weg. Es war, als sei das Videobild ein fiktives Machwerk, wie in einem Fernsehkrimi. Bannister folgte einem gewundenen Pfad über die bewachsenen Dünen, hinauf und hinunter durch die sandigen Hügel. Erst als er den letzten Abhang erreichte, sah er es mit eigenen Augen. Er ging näher und hinterließ eine einsame Reihe von Spuren im regenglatten Sand.
Die Füße ragten unter einer dicken schwarzen Plastikplane hervor, in die offenbar eine unter dem Sand begrabene Leiche eingewickelt war.
»Shit!«, fluchte Craig Bannister.
Er griff nach seinem Smartphone, das mit der Fernsteuerung verbunden war, und wurde sich jetzt erst bewusst, dass die Phantom noch immer einen Meter über dem Boden schwebte und weiterhin alles auf Video aufzeichnete.
Bannister ließ den Quadrokopter landen und schaltete alle Geräte ab. Dann wählte er den Notruf.
Um 13:14 Uhr klingelte im Ocean Basket in der Kloofstraat das Handy von Kripo-Kaptein Bennie Griessel. Ein Blick auf das Display sagte ihm, dass es Major Mbali Kaleni war, seine neue Vorgesetzte bei der Mordkommission im Direktorat für Kapitalverbrechen, auch bekannt als die Valke. Da ihm der Anruf eine potentielle Fluchtmöglichkeit bot, meldete er sich hastig und hoffnungsvoll.
»Hallo, Bennie, tut mir leid, dass ich Sie beim Mittagessen stören muss …«
»Kein Problem«, sagte er.
»Ich brauche Sie in Edgemead. Farmersfield Road. Vaughn ist schon unterwegs.«
»Ich bin in zwanzig Minuten da.«
»Bitte richten Sie Ihrer Familie meine Entschuldigung aus«, sagte Kaleni, die von dem »besonderen Essen« wusste, das Alexa Barnard, die Liebe in Griessels Leben, arrangiert hatte.
»Mach ich.«
Er beendete den Anruf. Alexa, Carla und der van Eck-Fuzzi hatten das Gespräch mitgehört. Er sah sie an. Sein Sohn Fritz klebte noch immer mit der Nase am Smartphone.
»Ach, Papa«, seufzte Carla, verständnisvoll und enttäuscht zugleich.
Alexa nahm seine Hand und drückte sie mitfühlend.
»Tut mir leid«, sagte Bennie und stand auf. Noch immer spürte er diffuse Schmerzen in Bauch und Arm, aber nicht mehr so schlimm wie am Morgen. »Ich muss raus nach Edgemead.«
»Große Mordsache?«, fragte der van Eck-Fuzzi, Carlas neuer Freund. Der reinste Jesus-Verschnitt mit seinem schulterlangen Haar und dem dünnen Bart.
Griessel ignorierte ihn. Er zückte sein Portemonnaie und gab Alexa seine Kreditkarte, die sie zu seiner Erleichterung mit einem Nicken annahm. »Nur noch schnell einen Abschiedskuss«, bat sie. »Mein Top-Ermittler.«
Im Dünengebiet östlich der Otto du Plessis-Laan legten die Kriminaltechniker die Leiche von Ernst Richter vorsichtig frei. Anfangs wurden sie noch von starken Windböen gebeutelt, die sich jedoch nach kurzer Zeit legten. Anschließend kam die Sonne hinter den dicken Wolken hervor, und sofort wurde es heiß und gleißend hell durch die Reflexion der Strahlen auf dem weißen Sand und dem noch stürmischen Atlantik.
Die Video-Einheit der SAPD hatte gegen 13:32 Aufnahmen gemacht, und die Spurensicherung war dabei, den Sand rund um die Leiche vorsichtig abzutragen und in gekennzeichnete Plastikbeutel zu füllen.
Kripo-Adjudant Jamie Keyter von der Dienststelle Table View leitete die Untersuchungen. Er hatte die Stelle in einem Umkreis von zehn Metern rund um die Leiche mit gelbem Tatort-Flatterband absperren lassen und zwei Uniformierte damit beauftragt, den Verkehr auf der Otto du Plessis-Laan zu regeln und Schaulustige fernzuhalten. Mit der misstrauischen, vage beschuldigenden Stimme, die er für solche Gelegenheiten bereithielt, hatte er Craig Bannister auf den Zahn gefühlt.
»Warum haben Sie ausgerechnet hier angehalten, um Ihr kleines Spielzeug auszuprobieren?«
»Das ist schließlich nicht verboten, oder?«
»Ich habe Sie etwas gefragt!«
»Hören Sie, ich habe mir dieses ›Spielzeug‹ gerade neu angeschafft. Ich bin ein professioneller DOP, und das ist ein …«
»Was ist das – ein DOP?«
»Director of Photography. Ich arbeite für Film- und Fernsehproduktionen. Bei diesem mit einer Kamera ausgerüsteten Quadrokopter handelt es sich um die neueste Entwicklung auf dem Gebiet der Flugmaschinen für Luftaufnahmen – es ist quasi eine Drohne mit HD-Kamera. Wenn ich die im Job nutzen möchte, muss ich auch damit üben. Und zwar ohne dauernd Hunderten von Modellfliegern ausweichen zu müssen.«
»Haben Sie eine Lizenz dafür?«
»Eine Lizenz? Man braucht keine Lizenz für einen Quadrokopter.«
»Sie haben also einfach so hier angehalten?«
»Genau.«
»Na so ein Zufall!« Jamie Keyter trug die Ironie ganz dick auf.
»Was wollen Sie mir unterstellen?«
»Ich unterstelle Ihnen gar nichts, ich frage nur.«
»Hören Sie, ich bin einfach so lange gefahren, bis ich ein Plätzchen mit einer netten Aussicht gefunden hatte«, erwiderte Craig Bannister geduldig. »Die Straße, das Meer, der Berg, sehen Sie sich doch einfach mal um! Ziemlich spektakulär, oder? Ich muss das Fliegen mit dem Quadrokopter üben und wollte zugleich die Kamera ausprobieren. Und zwar so, dass es sich lohnt. Zum Beispiel in dieser Umgebung.«
Jamie Keyter nahm die Ferrari-Sonnenbrille ab, um Bannister mit seinem Ich-habe-dich-durchschaut-Blick zu durchbohren.
Abwartend stand der Mann vor ihm. Die Situation war ihm sichtlich unangenehm.
»Sie haben also alles auf Video?«, fragte Keyter schließlich.
»Ja.«
»Zeigen Sie es mir.«
Zusammen sahen sie sich die Aufnahmen auf dem Display des Smartphones an. Zwei Mal. »Okay«, sagte Keyter, dann befahl er Bannister, bei seinem Wagen zu warten, und setzte die Ferrari-Sonnenbrille wieder auf.
In seinem schwarzen Polohemd, dessen Ärmel sich um seinen Bizeps spannten, in den schwarzen Edgars-Chinos mit dem schwarzem Ledergürtel, die Hände auf die Hüften gestemmt, betrachtete er die beiden Füße, die unter der Plastikplane hervorragten.
Er war stolz auf sich. Die Füße waren trotz der Totenflecken deutlich als die eines Weißen zu erkennen. Das bedeutete Medienrummel.
Jamie Keyter liebte Medienrummel.
Bennie Griessel, sechsundvierzig Jahre alt, ehemaliger Alkoholiker, seit sechshundertundzwei Tagen trocken, starrte durch die Windschutzscheibe seines Autos, während er sich durch den dichten Verkehr auf der Buitengracht quälte.
Normalerweise hasste er den Dezember.
Normalerweise hätte er mit einem gegrummelten Jissis! diese irren Urlauber verwünscht, vor allem die Scheißtypen aus Gauteng, die mit ihren dicken Portemonnaies im nagelneuen BMW so schnell wie möglich hinunter ans Kap jagten, um dort ihr Weihnachtsgeld zu verbraten. So nach dem Motto: Jetzt lassen wir es in dem verschlafenen Nest mal ordentlich krachen! Zu ihnen gesellte sich die komplette Bevölkerung der nördlichen Vorstädte Kapstadts, die all ihre Hemmungen zu Hause gelassen hatte und an die Strände strömte, zusammen mit den vor der Kälte flüchtenden Touristen aus Europa.
Normalerweise hätte er im Geiste missmutig die Folgen dieser feindlichen Übernahme aufgezählt: Nirgendwo Parkplätze, alles wurde teurer, und die Verbrechensrate stieg um mindestens zwölf Prozent, denn die Urlauber soffen, was das Zeug hielt, und dann knallten bei ihnen die Sicherungen durch.
Normalerweise. Aber nicht in diesem Jahr. Denn die Beklemmung war in ihm, über ihm, um ihn; sie umgab ihn wie eine schwarze Wolke. Bereits wieder. Noch immer.
Die Erleichterung über seine Flucht aus dem Restaurant war verflogen. Bereits auf dem Weg zum Auto hatte er sich Gedanken darüber gemacht, warum Mbalis Stimme so schwermütig geklungen hatte. So gedämpft, voller Entsetzen, umso auffälliger, je mehr sie versucht hatte, es zu überspielen. Ein krasser Gegensatz zu der positiven Stimmung, die sie sich in den letzten zwei Monaten als Dezernatsleiterin bemüht hatte auszustrahlen.
Ich brauche dich in Edgemead, Farmersfield Road. Vaughn ist schon unterwegs.
Dort wartete also Unheil. Unheil, gegen das er momentan kaum gewappnet war.
Deswegen betrachtete er den dichten Verkehr im Dezemberrummel heute nicht als Fluch, sondern als Segen.
Die Spurensicherung hatte Ernst Richters Leiche vollständig freigelegt.
Adjudant Jamie Keyter winkte das Videoteam wieder heran, damit sie den Anblick festhielten: Die dicke schwarze Plastikplane, die den Toten umhüllte, war ein klein wenig zu kurz, um auch die Füße zu bedecken. Dazu das blutrote Seil, mit dem sie fest verschnürt war – um den Hals, in der Mitte und um die Fußknöchel.
Keyter hatte den Zeitungsfotografen erspäht, der mit dem Teleobjektiv von der Straße aus versuchte, Fotos zu schießen. Daraufhin hatte er breitbeinig Position bezogen, die Hände auf die Hüften gestemmt: der Inbegriff des kompetenten Ermittlers am Tatort. Er beaufsichtigte das Videoteam, bis er sicher sein konnte, dass die Aufnahmen jeden erdenklichen Winkel abdeckten.
»Okay«, sagte er. »Ihr seid vorerst fertig.« Dann befahl er der Spurensicherung mit einer gebieterischen Geste: »Aufschneiden.«
Die beiden Kriminaltechniker wählten die passenden Instrumente aus ihren Ausrüstungskoffern, hoben das Flatterband an und knieten sich neben das Opfer. Einer schnitt vorsichtig das rote Seil auf, der andere nahm es und legte es zur Beweissicherung in eine Plastiktüte.
Jamie Keyter bückte sich ebenfalls unter dem gelben Band hindurch und näherte sich der Leiche. »Wickeln wir ihn aus.«
Es dauerte fast zehn Minuten, denn sie mussten vorsichtig zu Werke gehen, und die schwarze Plastikfolie war endlos lang. Die Kriminaltechniker falteten alle zwei Meter die Folie vorsichtig wieder zusammen, um eine Kontaminierung des Beweismaterials zu verhindern.
Die Uniformierten, die Videoeinheit, die beiden Konstabel von der Kripo und die Mannschaft des Krankenwagens rückten neugierig näher.
Und dann war die Leiche entblößt.
»Liegt noch nicht lange da«, stellte einer der Kriminaltechniker fest, denn es gab relativ wenige Anzeichen von Verwesung, nur eine allgemeine Verfärbung der Haut. An den Füßen und tief im Nacken war das blauviolette Netz der Leichenflecke zu erkennen, und am ganzen Körper klebte Sand.
Es handelte sich um einen schlanken Mann, mittelgroß, mit dichtem, dunkelbraunem Haar, gekleidet in eine blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit dem Spruch Ich würde mich ja geistig mit dir duellieren, aber ich sehe, du bist unbewaffnet in großen weißen Buchstaben darauf.
»Etwa eine Woche oder so«, meinte der andere Kriminaltechniker, dem das Gesicht des Opfers irgendwie bekannt vorkam, obwohl er es in diesem Augenblick nicht einordnen konnte. Aber das verschwieg er lieber.
Diese leise Ahnung war alles, was irgendjemandem am Tatort zu Ernst Richter einfiel.
»Erwürgt«, sagte der andere Kriminaltechniker und deutete auf die dunklen Male, die sich wie ein Ring um die Kehle legten.
»Ganz offensichtlich«, bestätigte Jamie Keyter.
2
Die Farmersfieldstraat lag an jenem Mittwochnachmittag verlassen da. Eine Mittelklassewohngegend, Reihen weißer und cremefarbener Einfamilienhäuser mit Ziegeldächern und ordentlich geschnittenem Vorgartenrasen. Der morgendliche Sturm hatte eine Spur von Ästen und Blättern auf der Straße hinterlassen.
Griessel brauchte nicht nach der Adresse zu suchen. Die Nachbarn hatten sich in kleinen Gruppen auf der anderen Straßenseite zusammengefunden, und vor dem Haus standen mehrere Polizeifahrzeuge. Griessel parkte in fünfzig Metern Entfernung auf dem Bürgersteig. Er blieb zunächst sitzen, die Hände auf dem Lenkrad, die Augen niedergeschlagen.
Er hatte keine Lust auszusteigen.
Irgendetwas war geschehen, was die Normalität des vorstädtischen Edgemead zerstört hatte. Und er wusste genau, dass das Geschehene den Zustand der Beklemmung, den er schon seit Monaten spürte, verschlimmern würde. Der Kleinbus der PCSI, der Eliteeinheit der Spurensicherung, stand auch vor dem Haus. Was hatten die hier zu suchen? Und warum waren Vaughn und er von den Valke herbeigerufen worden?
Griessel holte tief Luft, löste die Hände vom Lenkrad, stieg langsam aus und machte sich auf den Weg.
Eine weiße Mauer versperrte die Sicht, so dass er weiter gehen musste bis zur Einfahrt, wo ein Konstabel den Zugang bewachte.
Das Haus glich den meisten anderen in der Straße. Weitere Polizisten scharten sich um die Tür, im Kreis, die Köpfe gesenkt.
Der Konstabel hielt Griessel mit gebieterisch vorgehaltener Hand auf. Griessel zeigte seinen Ausweis.
Der Konstabel riss die Augen auf: »Ah, Kaptein Griessel. Kaptein Cupido bittet Sie, hier auf ihn zu warten. Ich lasse ihn schnell rufen …«
»Warum?«, fragte Bennie und drängte sich an dem Mann vorbei.
»Nein, Kaptein, bitte!« Der Mann klang ängstlich. »Es ist ein Befehl. Ich soll ihn rufen lassen.«
»Dann rufen Sie ihn.« Griessel hatte keine Geduld für Vaughns Mätzchen.
Der Konstabel bat die Uniformierten vor der Tür vernehmlich, den »Valke-Kaptein« zu holen. Einer von ihnen eilte ins Haus.
Griessel wartete genervt.
Cupido kam heraus, eilig, demonstrativ rebellisch gekleidet – Jeans, T-Shirt, blaues Sakko und dazu als schrillen Kontrast die gelb-orangefarbenen Laufschuhe, von denen er ihm gestern vorgeschwärmt hatte: »Nike Air Pegasus Plus, Pappie, kosten normalerweise fast tausend Mäuse, aber bei Tekkie Town gab’s die im Sale. Cooler Komfort in Technicolor, man geht wie auf Wolken. Macht die Fußarbeit zum Kinderspiel, ganz easy. Aber das Beste daran ist, dass diese Sneakers Major Mbali mächtig auf den Keks gehen werden.«
In den letzten paar Wochen hatte sich Vaughn fortwährend gegen die Anweisung von Major Mbali (deren neuen Rang er jedes Mal ironisch betonte) aufgelehnt, sich im Dienst ordentlich zu kleiden. Kaleni hatte am letzten Montagmorgen während der Dienstbesprechung feierlich verkündet: »Wer professionell sein will, muss professionell aussehen. Wir tragen Verantwortung gegenüber dem DPMO und der Öffentlichkeit.« Anschließend hatte sie gebeten, in Zukunft mit Krawatte, Jackett und »angemessenem Schuhwerk« zu erscheinen, oder wenigstens in Hemd mit Sakko. Das brachte das Fass zum Überlaufen für Cupido, der schon bei ihrer Ernennung zur Dezernatsleiterin schwer geschluckt hatte: »Hältst du das etwa für Zufall nach den Ergebnissen der letzten Wahlen? Ich nicht. Das liegt nur daran, dass sie eine Zulu ist, das ist ethnische positive Diskriminierung, das ist Zuma von vorne bis hinten. Du und ich, wir haben mehr Erfahrung, mehr Dienstjahre, mehr Knowhow, aber sie wird befördert!«
Griessel wusste, dass Cupido sich hauptsächlich deswegen so aufregte, weil die neue Leiterin seine Extravaganzen nicht dulden würde. Mbali war zielstrebig und konservativ, ganz im Gegensatz zu Vaughn. Griessel erwiderte, sie sei unter den gegebenen Umständen die richtige Person für den Posten.
Doch das hatte auch nichts geändert.
Cupido eilte herbei, und sein Gesichtsausdruck stand im krassen Gegensatz zu der fröhlich bunten Kleidung.
»Hi, Benna. Es ist nicht nötig, dass du reingehst. Wir sind hier fertig.«
Griessel hörte den Unterton in der Stimme seines Kollegen heraus, eine aufgesetzte Sachlichkeit, unter der er seine Erschütterung verbarg.
»Ich bin doch nicht den ganzen Weg hier rausgekommen, um … Was ist los, Vaughn? Was ist hier passiert?«
»Vertrau mir, Benna, bitte. Ist ein ganz klarer Fall, komm, lass uns gehen.« Cupido legte Griessel die Hand auf die Schulter.
Bennie wurde allmählich sauer. Was war denn los mit Cupido? Er zog seine Schulter weg. »Willst du mir jetzt sagen, was hier los ist, oder soll ich reingehen und selbst nachsehen?«
»Benna, vertrau mir, nur dieses eine Mal«, erwiderte Cupido mit einer Verzweiflung, die Griessels Misstrauen nur noch weiter anfachte.
»Jissis!«, sagte er und machte sich auf den Weg zur Haustür.
»Es ist Vollie«, sagte Cupido.
Abrupt blieb Griessel stehen. »Vollie?«
»Ja. Unser Vollie. Vollie Vis. Und seine Familie.«
Adjudant Tertius van Vollenhoven, der mit ihnen beiden zusammengearbeitet hatte, damals, als es die Provinzielle Sonderermittlungseinheit noch gegeben hatte. Vollie, der sparsam und trocken seine Westküstensprüche in seinem Namaqualand-Dialekt gebracht hatte, wenn die Nacht zu lang und die Moral zu sehr am Boden war. Vollie Vis, der aus Lambertsbaai stammte, jedes Wochenende dort hinausfuhr und montags für das ganze Team Fisch und Meeresfrüchte mitgebracht hatte, begleitet von genauen Instruktionen für die Zubereitung, denn »einen Hummer zu versauen ist ein Sakrileg, Kollege«. Der Mann, der in einem Zeitraum von vier Jahren zwei Serienmörder auf der Kaapse Vlakte dingfest gemacht hatte, dank seiner unendlichen Geduld und Hartnäckigkeit. Anschließend hatte er sich zur Dienststelle in Bothasig versetzen lassen. Er meinte, er habe seinen Beitrag geleistet und wünsche sich jetzt ein ruhigeres Leben – er wolle seine Ehe retten und seine Kinder aufwachsen sehen. Doch alle wussten, dass es das Trauma der Untersuchungen war, bei denen er Monat für Monat immer wieder vor einer verstümmelten Leiche gestanden hatte, in dem Wissen, dass er nur mit ein wenig Glück die Ungeheuer würde aufhalten können, selbst wenn er noch so sehr arbeitete.
Die alte Wut über diese Ungerechtigkeit des Schicksals flammte in Griessel auf, der Zorn auf diejenigen, die dafür verantwortlich waren.
»Raubüberfall?«
»Nein, Bennie …«
»Was ist passiert, Vaughn?«
Cupidos Stimme war fast unhörbar, und er konnte Griessel nicht in die Augen sehen. »Vollie hat sie erschossen, letzte Nacht, und zum Schluss sich selbst.«
»Vollie?«
»Ja, Benna.«
Bennie dachte an die beiden süßen Töchter, inzwischen junge Teenager, und Vollies Frau, mutig, stark, unterstützend. Mecia oder Tersia … Er wehrte sich gegen die Bilder, wollte sie nicht in seinen Kopf lassen – Vollie mit seiner Dienstpistole am Bett eines Kindes.
»O Gott, Vaughn«, sagte er und spürte, wie die Beklemmung zurückkehrte und drohte, ihn zu überwältigen.
»Ja, ich weiß.«
Griessel konnte nicht aufhören zu reden, er musste Druck ablassen. »Aber warum? Was ist passiert?«
Cupido zeigte auf die Uniformierten vor der Tür. »Die Kollegen von der Dienststelle Bothasig haben gestern ein Mädchen gefunden, im Gebüsch unterhalb von Richwood. Schon das zweite. Derselbe Modus Operandi wie bei einem anderen Mord vor einem Monat. Ein Serienmörder. Üble Sache, Benna, ein total kranker Scheißkerl. Vollie war da.«
Griessel setzte das Puzzle zusammen, die Hand am Hinterkopf. Er versuchte zu verstehen, was geschehen war. All die Dämonen, die zurückgekehrt waren und Vollie von innen aufgefressen hatten.
»Komm, Benna. Komm, lass uns gehen.«
Griessel stand da wie versteinert.
Cupido sah, dass sein Kollege wachsbleich war. »Benna, es ist wirklich besser, wenn wir jetzt …«
»Warte …« Griessel sah Cupido scharf an. »Warum hat Mbali uns hergeschickt?«
»Der Leiter der Dienststelle hat darum gebeten, dass wir uns das ansehen. Er sagte, er wolle nur sichergehen, dass sie nichts übersehen, denn die Medien …«
»Aha.« Und dann: »Warum willst du mich da raushalten, Vaughn?«
Cupido sah ihm in die Augen und tippte mit dem Zeigefinger gegen seine Schläfe. »Weil du noch nicht dazu bereit bist, Benna. Ich weiß das.«
Jamie Keyter und die beiden Kriminaltechniker hatten die Jeanstaschen des Opfers sorgfältig durchsucht, aber nichts gefunden.
Behutsam hatten sie die Leiche in den großen schwarzen Sack gelegt, den Reißverschluss zugezogen und die Bahre geholt. Die Leiche wurde zum Krankenwagen getragen. Die Kriminaltechniker hatten die schwarze Plastikplane und das rote Seil sorgfältig gekennzeichnet und verpackt. Einer der Techniker hatte den Metalldetektor geholt und war jetzt damit beschäftigt, in konzentrischen Kreisen den Tatort abzuschreiten, die Kopfhörer auf den Ohren.
Der andere stand neben Jamie Keyter. Kein anderer war in Hörweite. »Ich schwöre, dass er mir bekannt vorkommt«, sagte der Techniker.
»Natürlich. Er arbeitet mit dir zusammen«, erwiderte Keyter und runzelte hinter der Sonnenbrille die Stirn.
»Nein, nicht er, das Opfer.«
»Soll das heißen, Sie kennen ihn?«
»Nein, kennen ist zu viel gesagt. Ich habe ihn nur irgendwo schon mal gesehen.«
»Ist er ein Promi oder was?«
»Ich weiß nicht, ich habe ihn nur schon mal gesehen.«
»Das hilft uns kein Stück, wenn Sie nicht wissen wo. Glauben Sie, er ist ein Polizist?«
Dem Techniker tat es inzwischen leid, dass er überhaupt etwas gesagt hatte. »Nein, ich … Vielleicht irre ich mich. Vielleicht sieht er nur jemandem ähnlich, den ich …«
Der Mann mit dem Metallsuchgerät blieb stehen. »Hier ist etwas«, sagte er. Die Stelle lag etwa drei Meter vom Fundort der Leiche entfernt.
Sein Kollege nahm eine kleine Schaufel und kroch unter dem Absperrband hindurch. Mit den Händen lockerte er den Sand unter dem Sensor des Metallsuchgeräts und räumte ihn vorsichtig beiseite. Zunächst fand er nichts.
»Bist du sicher?«, fragte er seinen Kollegen.
»Ja, da ist definitiv etwas.«
Fünfzig Zentimeter unter der Oberfläche stieß der Techniker auf einen metallischen Gegenstand und grub so lange mit beiden Händen, bis er ihn greifen und aus dem Sand ziehen konnte. Dann lag er an der Oberfläche.
»Jissis, ein Handy!«
Er stand auf, holte einen Pinsel aus seinem Koffer und fegte den Sand weg, während Jamie Keyter erneut das Kamerateam hinzuholte.
»Ein iPhone 5, glaube ich«, sagte der Mann von der Spurensicherung. Er drückte eine Taste auf dem Handy, aber nichts geschah. »Mausetot.«
3
Transkription Gesprächsmitschnitt: RA Susan Peires mit Meneer Francois du Toit
Mittwoch, 24.Dezember. Hugenote Kamers 1604,
Koningin Victoriastraat 40, Kapstadt
Audiodatei I
RA Susan Peires (SP): … Natürlich können Sie ablehnen. Dann mache ich mir nur Notizen. Aber die Aufnahme bietet eine genaue Wiedergabe unseres Gesprächs und wird mit derselben Diskretion behandelt. Ich werde sie transkribieren lassen, was dann auf jeden Fall als Notiz dient. Der Datenschutz gilt so oder so.
Francois du Toit (FdT): Auch wenn Sie meinen Fall nicht übernehmen?
SP: Richtig.
FdT: Wer wird das Gespräch transkribieren?
SP: Meine Sekretärin, die ebenfalls an das Berufsgeheimnis gebunden ist.
FdT: Na schön, dann zeichnen Sie es auf.
SP: Vielen Dank, Meneer du Toit. Würden Sie mir bitte Ihren vollen Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihren Beruf nennen?
FdT: Mein Name ist Francois du Toit, geboren am zwanzigsten April 1987. Ich bin Winzer auf dem Gut Klein Zegen bei Stellenbosch … Draußen am Blaauwklippenweg.
SP: Sie sind jetzt also … siebenundzwanzig?
FdT: Richtig.
SP: Verheiratet?
FdT: Ja. Mit San… Susanne. Wir haben einen sechs Wochen alten Sohn. Guillaume.
SP: Vielen Dank. Wenn ich Ihren Anwalt richtig verstanden habe, erwartet Sie in diesem Augenblick die Polizei auf der Farm?
FdT: Ja.
SP: Worum geht es bei den Ermittlungen der Polizei?
FdT: Gustav … Mein Anwalt … Hat er es Ihnen nicht erzählt?
SP: Ich habe nur so viel verstanden, dass es eine ernste Sache ist, aber ich habe Meneer Kemp gebeten, mir keine Details zu nennen. Ich ziehe es vor, diese von meinem Mandanten persönlich zu erfahren.
FdT: Es … es hat mit dem Mord an Ernst Richter zu tun.
SP: Dem Vermissten? Dem Mann von Alibi?
FdT: Richtig.
SP: Und Sie sind darin verwickelt?
FdT: Die Polizei würde bestimmt nicht … Es tut mir leid. Es … Es ist eine lange Geschichte … Ich muss Ihnen die ganze Sache … Bitte.
SP: Ich verstehe … Meneer du Toit, bevor wir weitermachen, halte ich Ihnen die kleine Ansprache, die alle meine Mandanten von mir zu hören bekommen. Ich bin jetzt seit achtundzwanzig Jahren als Strafverteidigerin tätig und habe in dieser Zeit über zweihundert Personen vor Gericht vertreten. Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Betrug und so weiter. Mein Rat ist immer derselbe, und die Erfahrung hat wieder und wieder gezeigt, dass es ein guter Rat ist: Sie brauchen mir gegenüber nicht ehrlich zu sein, aber es macht letzten Endes meine Aufgabe wesentlich einfacher. Ich verurteile …
FdT: Ich habe durchaus vor, ehrlich zu sein.
SP: Lassen Sie mich bitte erst ausreden. Ich bin nicht hier, um Sie zu verurteilen, sondern um sicherzustellen, dass Sie den bestmöglichen Rechtsbeistand erhalten. Ich glaube felsenfest an ein Rechtssystem, bei dem ein mutmaßlicher Straftäter so lange unschuldig ist, bis das Gegenteil ohne jeden Zweifel vom Staat bewiesen wurde. Eine meiner größten Verantwortlichkeiten besteht darin, den Maßstab für sachlichen Zweifel so hoch wie möglich anzusetzen. Ich habe bereits Fälle angenommen, bei denen der Mandant mir von vornherein seine Schuld eingestanden hat, und dennoch habe ich genauso hart für ihn gekämpft wie für diejenigen, die ihre Unschuld behaupten. Denn das System funktioniert nur dann, wenn wir alle vor dem Gesetz gleich sind. Und ich glaube an das Gesetz. Daher ist es mir egal, ob Sie schuldig sind …
FdT: (unverständlich)
SP: Bitte, Meneer du Toit.
FdT: Nennen Sie mich doch Francois …
SP: Nein, ich bleibe lieber bei Meneer du Toit. Wir sind keine Freunde, sondern Rechtsanwältin und Mandant. Es handelt sich um ein amtliches, professionelles Verhältnis, für das Sie sehr viel Geld bezahlen werden und bei dem ich meine Distanz und Objektivität wahren muss. Was ich sagen wollte: Es spielt für mich keine Rolle, ob Sie unschuldig sind. Es ändert nichts an meinem Engagement oder an der Qualität meiner Arbeit. Ich gebe stets mein Bestes, denn dafür bezahlen Sie. Ich kann Sie nicht dazu zwingen, ehrlich zu mir zu sein, aber ich möchte Ihnen gerne die möglichen Folgen ausmalen, falls Sie es nicht sind. Verheimlichte Informationen neigen dazu, von selbst an die Oberfläche zu kommen. Nicht immer, aber oft. Und wenn sie zu einem unpassenden Zeitpunkt auftauchen, kann dies Ihrer Verteidigung ziemlich schaden. Ich kann den Fall und Ihre Vereidigung nur auf den Fakten aufbauen, die Sie mir liefern. Wenn Sie es vorziehen, mir eine Lügengeschichte aufzutischen, habe ich keine Wahl, ich muss damit arbeiten. Meiner Meinung und Erfahrung nach hat so etwas so gut wie nie einen positiven Einfluss. Kurzum, Meneer du Toit, je ehrlicher Sie zu mir sind, desto größer ist unsere Chance, dass Sie nicht ins Gefängnis wandern. Verstehen Sie das?
FdT: Ja.
SP: Möchten Sie es sich erst noch einmal überlegen?
FdT: Nein. Aber ich möchte, dass Sie alles erfahren. Die ganze Geschichte.
SP: Na schön. Wo wollen Sie anfangen?
4
Um 17:48 Uhr betrat Bennie Griessel das Fireman’s Arms, der Legende nach die zweitälteste Kneipe am Kap neben der Perserverance Tavern an der Buitenkantstraat.
Im Fireman’s bediente man Alkoholiker und andere zünftige Trinker schon seit 1864, was an jenem Mittwoch, dem siebzehnten Dezember, also insgesamt an die hundertfünfzig Jahre ausmachte. Griessel konnte die Kapstädter Saufgeschichte jedoch gestohlen bleiben. Der freie Parkplatz in der Mechaustraat war der einzige Grund, warum er hier angehalten hatte. Zielstrebig steuerte er zwischen den dunklen Holztischen und Sitzbänken hindurch auf die lange Theke zu, setzte sich und wartete darauf, bedient zu werden. Er atmete die Kneipengerüche ein. Sie lösten tausend Erinnerungen aus. Alle angenehm.
Er hatte die Arme auf die Theke gelegt und sah das kaum merkliche Zittern seiner Hände. Er faltete sie, damit der Wirt nichts bemerkte.
»Einen doppelten Jack«, bestellte er.
»Eis?«
»Nein, danke.«
Der Wirt nickte und schenkte ein. Kehrte mit dem klobigen Glas zurück, zwei Fingerbreit bernsteinfarbene Flüssigkeit darin, servierte mechanisch und geübt, ohne einen Schimmer von dem Ernst des Augenblicks zu haben.
Griessel zögerte nicht. Er dachte nicht an die sechshundertundzwei Tage ohne Alkohol, die hinter ihm lagen. Er trank das Glas in tiefen Zügen leer.
Der Geschmack war ein lange vermisster Freund, das Wiedertreffen eine Freude.
Doch es berührte ihn noch nicht im Innersten.
Er wusste, dass der Trost nicht im ersten Schluck lag. Dieser sowie die Betäubung, die Ruhe, der Sinn, die Heilung, die Linderung, das Gleichgewicht, die Ordnung und jenes Einswerden mit dem Universum kamen erst später, etwa am Ende des zweiten göttlichen Glases.
Das Institut für Kriminaltechnik der südafrikanischen Polizei befand sich seit 2011 in der Silverboomlaan in Plattekloof – eine über 17000 m² große, beeindruckende Stahl- und Glaskonstruktion. Das Rückgrat des Gebäudes bildete ein C, vier Stockwerke hoch, von dem sich fünf wuchtige Arme erstreckten, je einer für die Abteilungen Ballistik, DNS-Analyse, wissenschaftliche Analyse, Dokumentenanalyse und chemische Analyse.
Es war in der Küche der Abteilung für wissenschaftliche Analyse, als dem Kriminaltechniker beim Eingießen einer Tasse Kaffee plötzlich einfiel, an wen ihn das mit Sandkristallen bedeckte Gesicht der Leiche aus den Dünen hinter dem Bloubergstrand erinnerte.
War das möglich?
Ohne ein Wort zu seinem Kollegen ging er zu seiner Workstation, stellte die Kaffeetasse neben der Tastatur ab und googelte einen Namen.
Er klickte einen Link an und betrachtete das Foto, das hochgeladen wurde. Da wusste er, dass er richtig lag. Er suchte in seinen Notizen des Tages nach der Handynummer von Adjudant Keyter und wählte sie.
»Jamie«, meldete sich der Ermittler, so abweisend, als wolle er lieber nicht gestört werden. Er sprach seinen Namen »Jaa-mie« aus, nicht wie das englische »Jamie«. Der Kriminaltechniker fand das ein wenig aufgesetzt und nervig, ebenso wie Jamie Keyter an sich.
Er nannte seinen Namen und sagte: »Ich glaube … Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich bei dem Opfer um Ernst Richter handelt.«
»Wer ist Ernst Richter?«, wollte Jamie Keyter wissen.
»Der Typ von Alibi, der vermisst wird.«
Keyter schwieg einen Moment lang und antwortete dann höchst gereizt: »Ich habe keine Ahnung, von wem Sie reden, Mann.«
»Dann rufen Sie mal besser in der Dienststelle Stellenbosch an.«
Griessel hatte beide Hände um sein zweites Glas gelegt.
Das ist mein Urlaub, dachte er. Etwas anderes brauche ich nicht mehr. Jetzt kann Mbali ihren Unsinn sein lassen.
Am Montag hatte sie mit seiner Personalakte vor sich auf dem Tisch besorgt festgestellt: »Sie hatten schon seit drei Jahren keinen Urlaub mehr, Bennie.«
»Ich war über drei Monate lang krankgeschrieben nach …« Sie wussten beide, dass er auf den Angriff verwies, bei dem Mbalis Vorgänger getötet und Griessel angeschossen worden war.
»Das zählt nicht. Ich möchte, dass Sie sich zwischen Weihnachten und Neujahr freinehmen. Sie brauchen richtigen Urlaub.«
»Richtigen« Urlaub? Alles, wofür er Geld hatte, war Urlaub auf Balkonien, und das Herumhocken zu Hause würde ihn schon nach einem Tag in den Wahnsinn treiben.
»Damit Sie Zeit mit Ihren Lieben verbringen können.«
Das war Kalenis Trumpfkarte.
Seine Lieben.
Bevor ihn Mbali heute Mittag angerufen hatte, hatte er zwanzig Minuten lang dort im Ocean Basket mit seinen Lieben zusammengesessen. Seine Tochter Carla und seine Freundin und Geliebte Alexa hatten ununterbrochen über Kunstkram geredet, von dem er nichts verstand. Sein Sohn Fritz hatte an seinem Smartphone geklebt, war mit den Fingern über das Display gefahren und hatte hin und wieder ein geheimnisvolles kleines Lachen ausgestoßen, wenn eine neue SMS, WhatsApp, Facebook-Nachricht, Twitter-Meldung, BBM oder sonst was mit einem Klingelton reinkam. Als hätte sein Vater gar nicht existiert. Als hätten sie nicht bei einem ganz besonderen Essen gesessen, das Alexa mit großer Mühe organisiert hatte. Fritz, für den er ein Vermögen bezahlen musste, damit er nächstes Jahr auf die Filmakademie gehen konnte. Ein Vermögen nicht im übertragenen, sondern im konkreten Sinne, denn die AFDA verlangte 5950 Rand allein für die Registrierung. Dazu kamen 10000 Rand Immatrikulationsgebühr und 55995 Rand Studiengeld. Für ein einziges Jahr. Griessel kannte die Beträge auswendig, konnte sie im Schlaf herbeten, denn er hatte sie seinem Bankberater vorlegen müssen. Anschließend hatte ihn die Bank einen Monat lang Zeit zappeln lassen, bevor sie ihm den Kredit gewährte.
Fritz wusste das überhaupt nicht zu schätzen, sondern beschäftigte sich während des gemeinsamen Essens unaufhörlich mit seinem Handy, und Griessel wusste nicht, wie er reagieren sollte.
Seine beiden Kinder hatten ein besseres Verhältnis zu seiner Exfrau Anna. Manchmal hörte er, wie sie mit ihr am Telefon redeten. Gespräche geprägt von Gelächter, geteilten Erfahrungen und Insider-Informationen.
Und er? Was sollte er tun? Sein Leben bestand aus seiner Arbeit, und darüber konnte er nicht reden, genauso wenig wie über die Diagnose der Seelenklempnerin, dass Altruismus und Depressionen ihn in den Suff getrieben hätten.
Und dann dieser van Eck-Fuzzi. Carlas neuer Freund, der mit ihr zusammen Theaterwissenschaften in Stellenbosch studierte (für 29145 Rand pro Jahr, die er mit großer Mühe und Sparsamkeit bisher ohne einen Kredit aufbrachte). Griessel konnte van Eck nicht ausstehen. Er hatte sich sogar schon gefragt, ob der vorherige Freund seiner Tochter, der Rugbyspieler Etzebeth, keine bessere Partie gewesen war. Denn der hatte wenigstens gewusst, wann er die Schnauze halten musste.
Van Eck dagegen steckte voller Sprüche, Meinungen und Fragen, die Griessel keine Lust hatte zu beantworten. »Was war bisher dein interessantester Fall? Was hältst du von dem Urteil im Pistorius-Fall? Warum ist unsere Kriminalitätsrate so hoch?«
Er sprach Griessel nicht mit dem höflichen oom an, sondern duzte ihn einfach, was zu seinen langen Haaren und dem dreisten Blick passte. Alexa fand jedoch, er sei ein hübscher Junge, richtig süß, und Griessel wollte kein Spielverderber sein, denn schließlich war er Carlas Freund. Doch er wurde den Verdacht nicht los, dass van Eck ein verzogenes Bürschchen war.
Vincent van Eck. Er konnte Vaughn Cupidos Reaktion darauf förmlich hören: Was ist denn das für ein bekloppter Name? Wer bitteschön nennt sein Kind Vincent? Bei so einem Nachnamen?
Um 16:28 Uhr saß Adjudant Jamie Keyter dem Leiter der Polizeidienststelle Table View an dessen überladenem Schreibtisch gegenüber und erzählte ihm, dass die Leiche, die sie heute Nachmittag so sorgfältig aus dem Sand hinter Blouberg ausgegraben hätten, möglicherweise ein Mann namens Ernst Richter sei.
»Der Ernst Richter?«, fragte der Oberst besorgt.
Keyter fragte sich, warum alle außer ihm schon von diesem Mann gehört hatten – vielleicht sollte er die Zeitungen auch dann lesen, wenn nichts über ihn und seine Fälle darin stand.
Er bestätigte und erklärte, dass Richter vor über drei Wochen in Stellenbosch als vermisst gemeldet worden sei. Haarfarbe und Gesichtszüge des Opfers wiesen eine sehr starke Ähnlichkeit mit den beiden Porträts auf, die die Dienststelle Stellenbosch vor zehn Minuten per E-Mail geschickt hatte. Außerdem trug die Leiche dieselben Kleider, die Richter kurz vor seinem Verschwinden angehabt hatte.
»Gute Arbeit«, sagte der Dienststellenleiter in Gedanken.
»Danke, Oberst. Aber Stellenbosch meint jetzt, es sei ihr Fall. Ich finde aber, es ist unser Fall, und damit basta. Stimmt’s?«
»Ist er denn schon zweifelsfrei identifiziert worden?«
»Ich rufe gleich seine Mutter an und frage, ob sie ihn identifizieren kann, Oberst. Aber wir haben ihn auf unserem Gebiet gefunden. Stellenbosch braucht also lediglich einen 92 auszufüllen, um die Akte zu vervollständigen …« Keyters hoffnungsvoller Verweis bezog sich auf das SAPD-Formblatt Nummer 92, das ausgefüllt werden musste, nachdem eine vermisste Person gefunden worden war.
Der Dienststellenleiter kratzte sich im Nacken und dachte nach. Er kannte Jamie Keyters Stärken und Schwächen genau. Er wusste, dass der Adjudant vielleicht nicht das hellste Licht im Ermittler-Kronleuchter von Table View war, aber er war engagiert, methodisch und verlässlich und hatte bereits einige erfolgreiche Ermittlungen in unkomplizierten Mordfällen vorzuweisen.
Die große Frage war: Wenn es wirklich der Ernst Richter war, konnte er den Fall Keyter anvertrauen?
Dessen Schwäche war nämlich sein Ehrgeiz. Nachdem es einige lobende Meldungen in den Medien gegeben hatte, weil er vor ungefähr drei Jahren ein Autodiebstahlssyndikat zerschlagen hatte, überschätzte Jamie häufig sein eigenes Vermögen. In der Dienststelle Table View sorgte seine Vorliebe für das Licht der Öffentlichkeit häufig für Klatsch (ebenso wie seine Angewohnheit, vor dem Spiegel zu stehen).
Das andere Problem war die Arbeitsbelastung. Table View war eines der am schnellsten wachsenden Stadtgebiete auf der Halbinsel, und die meisten Zuzügler kamen aus der unteren Mittelschicht. Unter ihnen befanden sich nicht zuletzt Tausende Immigranten aus Nigeria, Somalia, Malawi und Zimbabwe, die sich im Gebiet von Parklands ansiedelten, wo derzeit sechzig Prozent aller Straftaten begangen wurden, um die sich die Dienststelle kümmern musste. Falls es definitiv der Ernst Richter war, würde er eine Menge Personenstunden investieren müssen, denn der Druck des Provinzkommissars würde sehr groß sein, wenn die Medien sich einmal auf den Fall stürzten.
Diese Kapazitäten besaßen sie nicht, und Keyter war überdies der Einzige, der nach der Aufmerksamkeit der Medien lechzte.
»Gut, Jamie, ich will mal in Stellenbosch anrufen und sehen, was ich tun kann«, log er.
Am Ende des dritten Glases ebbte Griessels physischer Schmerz ab. Die Schmerzen in seinem Arm und seinem Bauch – das dumpfe Pochen der sechs Monate alten Schusswunde. Damals hatten sie Oberst Zola Nyathi ermordet, und er, Bennie, hatte überlebt.
Durch das Gewitter heute Morgen waren die Schmerzen wieder zu einer pochenden Erinnerung an damals aufgeflammt.
Und jetzt saß er hier und nippte an seinem vierten doppelten Whisky.
Er hatte gewusst, dass der Alkohol auf ihn lauerte. Doc Barkhuizen, seit Jahren seine Vertrauensperson bei den Anonymen Alkoholikern, hatte es ebenfalls kommen sehen. »Ich kenne diese glasigen Augen, Bennie. Stelle dich der Gier. Wann warst du zuletzt bei einem AA-Treffen? Geh wieder zur Therapeutin. Schaffe Ordnung in deinem Kopf.«
Doch Griessel wollte nicht zurück zur Therapeutin, denn erstens hatte man ihn gezwungen, nach der Schießerei in Therapie zu gehen, und zweitens hatte er die Behandlung zu Ende geführt, obwohl er es im Grunde nicht einsah. Und drittens hatten Seelenklempner keine Ahnung, denn sie saßen nur in ihren kleinen Sprechzimmern, lächerlich eingerichtet, um auf neurotische, instabile Menschen heimelig und beruhigend zu wirken. Eine Schachtel mit Taschentüchern immer griffbereit, wie eine Beleidigung, und der Teddybär am Fenster.
Ein Teddybär. Bei einer Therapeutin, die Polizisten behandeln sollte.
Und dann steckten sie voller großer Worte und Bücherwissen, aber hatten sie schon mal neben einer verstümmelten Leiche gestanden? Oder dagelegen und zugesehen, wie das Blut aus einem spritzte, tropfte und floss, und man wusste, dass man verrecken würde, zusammen mit seinem Kollegen? Und es nichts gab, nichts, was man tun konnte, um ihn zu retten?
Seine Therapeutin war eine attraktive Frau gewesen. Mitte vierzig, genau wie er selbst. Erst hat er gedacht, das würde schon in Ordnung gehen, trotz der Taschentücher und des Teddys, aber dann begann sie mit dieser verdammten einschmeichelnden Stimme zu reden, als sei er ein Besessener, den man beruhigen musste. Sie stellte ihm Fragen über sein ganzes Leben, seine Karriere als Ermittler. Sie hörte aufmerksam zu, vollkommen konzentriert, und sie reagierte auf alles so liebenswürdig und behauptete, sie würde ihn verstehen. Nach vier Wochen diagnostizierte sie bei ihm posttraumatischen Stress. Und das Überlebenden-Syndrom. Und sie kam zu der Erkenntnis, dass sein Altruismus und seine Depressionen ihn in den Alkoholismus getrieben hätten.
Bennie war sich nicht einmal ganz sicher, was Altruismus bedeutete.
»Die Tatsache, dass einem etwas an anderen Menschen liegt«, hatte sie erklärt. »Und zwar in einem solchen Maß, dass man bereit ist, Opfer für sie zu bringen, ohne dass Belohnung oder Vorteile zu erwarten wären.«
»Und deswegen saufe ich?«
»Es ist nur ein Teil des Ganzen, Kaptein. Früher hieß es allgemein, dass Menschen, die Depressionen entwickelten, keine Zukunftsperspektiven erkennen könnten – das ist natürlich nur die Kurzfassung. Doch diese Art der Depression speist sich aus mangelndem Selbstwertgefühl und Sorge um den Status. Modernere Forschungen beweisen, dass es auch noch eine andere Art von Depression gibt – eine, bei der die Betroffenen unter schweren Schuldgefühlen leiden und ein sehr hohes Maß an Empathie für das Schicksal anderer aufbringen. Ihr Altruismus ist so ausgeprägt, dass sie unter Wahrnehmungsstörungen leiden, in dem Maße, dass sie sich selbst als Gefahr für die Menschen in ihrer Umgebung betrachten. Ich vermute, darauf sollten wir uns konzentrieren.«
Griessel passte das nicht. Depressive waren Leute, die wie Zombies mit hängenden Köpfen herumliefen und schwere, düstere Gedanken wälzten, etwa daran, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Und an so etwas hatte er noch nie gedacht. In dem Moment verwarf er das, was die Therapeutin sagte, als Unsinn, doch aus Höflichkeit schüttelte er nur leicht mit dem Kopf.
Daraufhin fuhr sie mit dieser beruhigenden Stimme fort: »Alles, was Sie mir bisher erzählt haben, deutet darauf hin. Nicht nur der Vorfall, bei dem der Oberst erschossen wurde. Jedes Mal, wenn Sie an einen Tatort kommen, beschleicht Sie ein Gefühl der Verantwortung, als hätten Sie die Tat verhindern müssen. Das ist nicht außergewöhnlich in Ihrem Beruf. Der wichtigste Faktor ist jedoch die Tatsache, dass Sie sich nach und nach verantwortlich für all jene fühlen, die Ihnen nahestehen, und einen unnatürlichen Drang entwickeln, sie gegen das Böse zu beschützen, dem sie täglich begegnen. Auf einer bestimmten Ebene wissen Sie, dass das unmöglich ist. Wir werden erforschen, ob das nicht die Depressionen und den Alkoholmissbrauch verursacht.«
Wir werden erforschen. Blödes Zeug. Als sei er ein Dschungel.
Er saß an der Theke und erinnerte sich. Und er trank, in der Hoffnung, zu vergessen. Denn die Dämonen von Vollie Vis waren in Edgemead in seinen Kopf gefahren.
5
Die Kanzlei von Rechtsanwältin Susan Peires in Hugenote Kamers bot eine wunderbare Aussicht über die Grünflächen des Kompanjiestuin. An diesem stickig heißen Tag vor Weihnachten wimmelte der Park von Besuchern.
Manchmal, wenn sie über einen Fall nachdenken musste, zog Susan Peires die Jalousien beiseite und schaute hinaus. Es half ihr, ihre Gedanken zu ordnen. Doch jetzt hatte sie ihre volle Konzentration auf den jungen Winzer Francois du Toit gerichtet.
Sie saß ihm gegenüber am Konferenztisch und lauschte jedem Wort, das er sagte. Im Geiste notierte sie sich Tonfall, Sprachgewohnheiten und -rhythmen. Es kostete ihn große Mühe, richtig in Gang zu kommen, aber das hatte sie erwartet. Manchmal verglich sie ihre Arbeit mit der eines Arztes in der Unfallchirurgie: Die Leute, die hier hereinkamen, waren von vornherein traumatisiert.
Sie schätzte die Körpersprache ihres potentiellen Mandanten ein, den Gesichtsausdruck, die Augen, die einmal sie, dann wieder die Wand anstarrten.
Sie wusste, dass sie mit ihren Interpretationen vorsichtig sein musste.
Denn Peires hatte als junge Anwältin eine wertvolle berufliche Lektion gelernt. Sie war als Pflichtverteidigerin berufen worden, in den letzten, unruhigen Jahren der Apartheid. Ein weißer Werkzeugmacher, Angestellter bei der Stadt, hatte vor Gericht gestanden, weil er des Mordes an seiner Frau angeklagt war. Die Indizien sprachen gegen ihn – einen Tag vor dem Mord hatte ihm ein Bekannter von der Untreue seiner Gattin erzählt, und Nachbarn hatten in der Enge der dicht beieinander stehenden kleinen Häuser in Goodwood den Ehekrach gehört, als er sie damit konfrontiert hatte. Er hatte Kratzspuren von ihr auf der Wange und ein Vorstrafenregister wegen eines sexuellen Übergriffs vor sieben Jahren. Schon als Peires ihn im Vernehmungszimmer der Dienststelle zum ersten Mal sah, war sie von seiner Schuld überzeugt. Denn das Gesicht des Mannes war grob und primitiv, und unter den dicken Brauen konnte er ihr nicht in die Augen sehen. Er war groß und stark mit Händen wie Vorschlaghämmer. Er war unzugänglich und wortkarg. Peires und die Ermittler waren davon ausgegangen, dass sein Alibi – er hatte steif und fest behauptet, in der Mordnacht bei seiner Mutter zu Hause in Parow gewesen zu sein – auf einer Absprache zwischen Mutter und Sohn beruhte.
Peires hatte die Mutter befragt, eine nervöse Kettenraucherin, die keinen guten Eindruck auf das Gericht machen würde. Erst als Peires der Frau eröffnete, dass ihr Sohn vermutlich lebenslänglich ins Gefängnis wandern würde, hatte sie weinend und ängstlich gestanden, nicht allein mit ihm zu Hause gewesen zu sein. Ihr Geliebter, ein Offizier der südafrikanischen Streitkräfte aus dem Kapstädter Farbigencorps, könne das Alibi bestätigen.
Und das hatte er getan, ein würdevoller, wortgewandter farbiger Mann mit sanfter, fester Stimme.
Erst als die Anklage gegen den Werkzeugmacher zurückgezogen worden war und sich die Aufmerksamkeit der Polizei gegen den verheirateten Geliebten des Opfers gerichtet hatte, hatte Peires ihren Mandanten gefragt, ob er sich so sehr wegen der Hautfarbe des Geliebten seiner Mutter geschämt hätte, dass er sogar bereit gewesen wäre, dafür ins Gefängnis zu wandern.
»Nein«, hatte er geantwortet.
»Wollten Sie Ihre Mutter schützen? Hatten Sie Angst, dass die Leute reden würden?«
Er hatte den Kopf geschüttelt.
»Warum haben Sie es mir nicht gesagt?«
»Weil Sie so ein böses Gesicht haben.«
Susan Peires hatte betroffen reagiert. Dass sie, die sich selbst als professionell, aber mitfühlend betrachtete, als »böse Frau« wahrgenommen werden konnte. Dass dieser offensichtlich harte, große Mann wegen ihres Aussehens Angst vor ihr haben konnte. Dass das äußere Erscheinungsbild wechselseitig ihre Charaktereinschätzungen auf diese Art und Weise hatte verzerren können.
Sie hatte lange darüber nachgedacht, zu viel Zeit vor dem Spiegel verbracht und nach und nach gelernt, ihre wenig ansprechenden Gesichtszüge zu akzeptieren – die wohl in Verbindung mit ihrem Beruf auch der Grund dafür waren, warum sie bisher beim männlichen Geschlecht noch nicht auf ernstzunehmendes Interesse gestoßen war. In der Folge hatte sie sich bemüht, ihr Erscheinungsbild mit Hilfe von Make-up und einem dezenteren Auftreten etwas einnehmender zu gestalten.
Sie hatte über die Neigung des Menschen zur Kategorisierung und Etikettierung aufgrund des Aussehens philosophiert, über den Einfluss der Gesichtszüge auf die Formung der Persönlichkeit gerätselt und spekuliert, doch vor allem hatte sie sich vorgenommen, niemals mehr denselben Fehler zu begehen.
Deswegen ließ sie sich nicht davon beeindrucken, dass Francois du Toit ein gut aussehender, braun gebrannter, kultivierter Mann war. Sie hörte zu und beobachtete.
Ein Urteil darüber, ob er ehrlich war oder nicht, wollte sie sich zu dem Zeitpunkt noch nicht erlauben.
6
Mittwoch, 17.Dezember, acht Tage vor Weihnachten.
Um 17:03 Uhr rief der SAPD-Dienststellenleiter von Table View beim Direktorat für Gewaltverbrechen in Bellville an und verlangte, den Kommandeur zu sprechen.
»Brigadier Manie ist gerade nicht im Büro, Kolonel«, antwortete die Sekretärin.
Der Dienststellenleiter seufzte, denn das war typisch für diese Zeit des Jahres. Weihnachtsfeiern, Weihnachtseinkäufe, Weihnachtsessen für das Personal … »Wer ist sein Stellvertreter?«
»Major Mbali Kaleni, Kolonel.«
Von ihr hatte er schon viel gehört. Er unterdrückte einen erneuten Seufzer. »Kann ich sie sprechen?«
»Einen Augenblick bitte.«
Bennie Griessel befand sich in einem Kokon. Er bemerkte weder die Leute hinter seinem Rücken, noch nahm er wahr, wie sich die Kneipe immer mehr füllte, je weiter der Nachmittag fortschritt. Er sah nicht die Fußballspiele auf den großen Flachbildschirmen und hörte nicht das Stimmengewirr der Mittrinker, die in Gruppen zusammenstanden, redeten und lachten.
Es gab nur ihn und den sechsten doppelten Jack und die Angstfreiheit und Weisheit seines alkoholisierten Zustands.
Er ließ den Kopf hängen und versuchte, seine tanzenden Gedanken zu ordnen.
Als er vorhin dort in Edgemead zusammen mit Vaughn Cupido vor dem Haus gestanden hatte, war die Erkenntnis in ihn gefahren wie ein Messer mitten ins Herz: Die Therapeutin hatte recht.
Adjudant Tertius van Vollenhoven hatte die schrecklichste, undenkbarste, erschütterndste Tat von allen begangen, weil er seine Lieben vor dem Werwolf des Bösen beschützen wollte, der mit sabberndem Maul und blutunterlaufenen Augen die Welt durchstreifte. Niemand konnte diesen Werwolf aufhalten; seine Gier wuchs und wuchs.
Ja, die Therapeutin hatte recht – er, Bennie Griessel, soff, weil das den Wolf von seiner Tür und von seinen Lieben fernhielt. Der Alkohol war sein Schutz, die Mauer, die verhinderte, dass er so wie Vollie …
Doch er war noch nicht betrunken genug, um diese Gedanken zuzulassen.
Aber er würde es noch tun.
Noch heute Abend.
Zwei Anzugträger um die dreißig drängten sich neben Griessel an die lange Theke des Fireman’s Arms. Sie musterten ihn, wie er über sein Glas gebeugt dasaß, und grinsten verächtlich.
Das gefiel ihm nicht.
Sein Handy klingelte, bevor er sie ansprechen konnte. Mbali Kaleni.
Scheiß drauf. Er gönnte sich gerade einen richtigen Urlaub. Mit seinem Freund Jack.
Griessel leerte sein Glas und winkte dem Wirt.
Major Mbali Kaleni versuchte vom Büro aus, Bennie Griessel auf dem Handy zu erreichen.
Cupido stand vor ihrem Schreibtisch, atmete angewidert den Blumenkohlmief ein und dachte: Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sie ist jetzt Leiterin der Mordkommission, und bei ihr im Büro stinkt’s nach Kohl?
Ursache war ihre Diät. Angeblich hatte sie damit schon elf Kilo abgenommen, was ihr Cupido jedoch nicht ansah. Auf ihn wirkte sie unverändert klein und dick.
Bis vor zwei Wochen hatte er noch nichts von Mbalis Diät gewusst. Dann traf er sie jedoch eines Tages auf dem Flur, während er gerade genüsslich geleegefüllte Schokoeier aus der Tüte naschte. Da ermahnte sie ihn mit ihrer nervtötend besserwisserischen Art: »Professor Noakes sagt, Zucker ist Gift, merken Sie sich das.«
Cupido hatte wohlweislich nichts darauf erwidert, denn jede Diskussion mit Kaleni glich einem Kampf mit einem Sumoringer – nie bekam man sie richtig zu packen, und am Ende war man total verschwitzt und unzufrieden. Als er tags darauf am Schreibtisch einen Joghurt aß, hieß es: »Professor Noakes sagt, fettreduzierte Lebensmittel sind nichts als Betrug.« Auch das hatte er noch durchgehen lassen. Doch als er am nächsten Morgen die Morgenbesprechung mit einer Tüte Salz-und-Essig-Chips verließ und Mbali bemerkte: »Professor Noakes sagt, Kohlenhydrate sind die wahren Dickmacher«, war es mit seiner Beherrschung vorbei. Unvorsichtigerweise fragte er gereizt zurück: »Wer ist denn dieser Professor Noakes?«
Da war sie ganz in ihrem Element und klärte ihn auf, und zwar von A bis Z: Über den tollen Professor Timothy Noakes, der erst alle Welt Nudeln fressen ließ und dann plötzlich das Gegenteil behauptete, nämlich, dass die bösen Kohlenhydrate die Leute reihenweise fett machten. Plötzlich schworen alle auf seine tolle Steinzeitdiät, und er verkaufte sein neuestes Kochbuch wie blöd. Und jetzt war er auch Mbalis großer Held. Es erfordere menschliche Größe, zuzugeben, dass man sich geirrt habe, meinte sie, sie habe schon so viel abgenommen und zugleich viel mehr Energie und es sei gar nicht so schwer, sie vermisse die Kohlenhydrate überhaupt nicht, sie esse jetzt Blumenkohlreis, Blumenkohlpüree und Leinsamenbrot.
Leinsamenbrot, pfui Teufel!
Mit der Leidenschaft der frisch Bekehrten versuchte Mbali, ihn zu missionieren, als sei auch er dick und müsse abnehmen.
Jeden Mittag kaufte sie zwei Köpfe Blumenkohl, die in ihrem Büro lagen und vor sich hin mieften, und fast vermisste Cupido den Gestank nach Fast Food, der früher bei ihr geherrscht hatte.
Nach einer Ewigkeit sagte Kaleni: »Bennie meldet sich nicht.«
Cupido musste sich beherrschen, denn er wusste, dass Bennie stets ans Handy ging. Wenn Major Mbali sich etwas weniger Gedanken über ihre Diät machen und sich dafür mehr auf ihre Leute konzentrieren würde, hätte sie sich jetzt nicht solche Sorgen um Bennie zu machen brauchen. Heute Nachmittag in Edgemead hatte Cupido den Schock und das Entsetzen in Bennies Gesicht gelesen und die Probleme schon kommen sehen, als er gefahren war.
Major Mbali hätte Bennie niemals dorthin schicken dürfen.
»Ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen«, sagte sie. »Würden Sie sich bitte schon mal auf den Weg machen? Sobald er sich meldet, sage ich ihm, dass er sich mit Ihnen treffen soll.«
»Ja, Major«, antwortete Cupido. Seit ihrer Beförderung war sie plötzlich furchtbar nett zu ihm, obwohl sie ihn früher nicht hatte ausstehen können. Was sollte das? Wie auch immer. Er wandte sich zum Gehen.
»Captain, ich habe das Gefühl, dass man uns diesen Fall anhängen will«, sagte Mbali, bevor er die Tür erreicht hatte. »Sobald Sie sicher sind, dass es sich bei dem Toten tatsächlich um den Alibi-Mann handelt, schalten Sie bitte Captain Cloete ein.«
John Cloete war Pressesprecher der Valke.
»Okay«, sagte Cupido.
»Ich möchte, dass Sie die Leitung der Sonderkommission übernehmen.«
Das traf ihn vollkommen unvorbereitet; nie hätte er gedacht, dass Mbali ihn an die Spitze einer Ermittlungsgruppe setzen würde. »Okay«, wiederholte er und fragte sich, ob er nur deshalb die Leitung erhielt, weil Griessel nicht ans Handy gegangen war.
Der eine Anzugträger, der direkt neben Griessel stand, erzählte dem anderen eine lange Geschichte, so laut, dass Bennie alles mithören konnte. Er lauschte, denn es lenkte ihn von seinen eigenen düsteren Gedanken ab.
»Noleen hat mir neulich was erzählt; sie hat gesagt, es wäre der Freundin einer Freundin passiert. Nettes Mädchen, gut aussehend …«
»Wenn eine Frau sagt, eine andere wäre hübsch, stimmt das meistens nicht.«
»Na ja, du weißt schon. Verrückte Sache. Jedenfalls hat Noleen erzählt, dieses hübsche Mädchen hätte sich vor sechs Monaten von ihrem Freund getrennt. Sie arbeitet in einem kleinen Betrieb, trifft nicht viele Typen, deshalb hat sie also beschlossen, es mit Internet-Dating zu probieren …«
»Blöde Idee.«
»Ach, du weißt schon. Jedenfalls hat sie also ein paar professionelle Fotos machen lassen, sich auf den Datingsites umgesehen und sich für eine entschieden. Sie hat ein Profil mit den neuen schönen Fotos angelegt, ihre Vorlieben und Abneigungen aufgelistet, ist online gegangen, und schon haben die Kerle sie angebaggert. Sie hat die ganze Nummer durchgezogen, die Spreu vom Weizen getrennt und nach ein paar Wochen mit einem attraktiven Typen einen Chat angefangen. Und je länger sie gechattet haben, desto cooler fand sie ihn. Irgendwann hat sie einem Treffen mit ihm zugestimmt. Sie ist auf Nummer sicher gegangen, hat ihr eigenes Auto genommen und ihn in einem Restaurant getroffen. Der Typ kommt an, ist super charmant und intelligent, sie haben sich ewig unterhalten, gut gegessen, Wein getrunken, und sie hat sich ein bisschen in ihn verliebt. Um es kurz zu machen: Der Typ hat sie also zum Auto begleitet, sie hat ihm die richtigen Signale gegeben, und er hat sie geküsst. Nicht aufdringlich, sondern eben romantisch, nach dem Motto: Ich respektiere deine Grenzen beim ersten Date. Und sie dachte sich: Wer hat behauptet, dass Internet-Dating nichts bringt? Aber zwei Tage später hat sie solche komischen kleinen weißen Bläschen auf den Lippen bekommen …«
»Scheiße, Mann.«
»Du weißt schon. Jedenfalls, sie geht also zum Arzt. Sagt der Arzt: Sie müssen jetzt ganz ehrlich zu mir sein. Haben Sie Kontakt zu Toten? Sie wissen schon, Leichen.«
»Scheiße!«
»Wenn ich es dir doch sage. Das Mädchen: Nein, natürlich nicht. Dann hat er sie gefragt, welche Kontakte sie in letzter Zeit hatte. Nach kurzer Überlegung hat sie ihm dann von dem attraktiven Typen erzählt. Sagt er: Die einzige Art, wie man sich diesen Ausschlag zuziehen und andere anstecken kann, ist, wenn man direkten Kontakt mit Leichen hat. Das heißt, wenn man Tote geküsst hat …«
»Igitt, ist das ekelhaft!«
»Du weißt schon. Der Arzt sagt also, dass er die Polizei rufen muss. Sie ist einverstanden. Die Polizei kommt, befragt sie und bittet sie, noch einmal ein Treffen mit dem Typen auszumachen, damit sie ihn abfangen können. Sie tut es und lässt sich diesmal von dem Typen mit nach Hause nehmen. Die Polizei beschattet sie. Als sie ins Haus gehen, wimmelt es überall von SEK. Die durchsuchen die Hütte und finden drei Leichen, Mann, noch mit den Zetteln am großen Zeh.«
»Wahnsinn!«
»Der Typ hat im Leichenschauhaus gearbeitet.«
»Ist doch Kacke«, sagte Bennie Griessel, und in seinem benebelten Zustand kam es lauter heraus, als er beabsichtigt hatte.
»Wie bitte?«, fragte der Geschichtenerzähler.
»Ist doch totaler Scheiß«, sagte Griessel und lallte ein wenig beim »Sch-«.
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Ich bin Polizist«, brachte er mit Mühe hervor.
»Sie sind doch sternhagelvoll«, sagte der andere Anzugtyp.
»Noch nicht voll genug. Aber die Geschichte ist totale Scheiße.«
Bennies Handy klingelte. Er sah auf das Display. Vaughn Cupido. Er steckte das Handy wieder weg.
»Und warum soll das eine Scheißgeschichte sein?«, fragte der Erzähler.
»Artikel 45 des Straf…gesetz… Strafgesetz…« Er hatte Mühe, das Wort herauszubringen und sagte dann gemessen und feierlich: »Straf-gesetz-buchs. Wir würden niemals einen Zivi… Zivilisss… Zivilisten…«
»Mann, Sie sind ja völlig zugedröhnt.«
»Wo ist denn Ihr Ausweis?«
Griessel fuhr mit einer Hand in die Tasche und holte sein Portemonnaie heraus. Es dauerte eine Weile. Die beiden Anzugtypen starten ihn voller Abscheu an. Er kramte in seinem Portemonnaie herum, zerrte seinen Polizeiausweis hervor und knallte ihn auf die Theke.
Die Männer sahen erst den Ausweis an und dann ihn.
»Kein Wunder, dass unsere Kriminalitätsrate die höchste auf der ganzen beschissenen Welt ist«, sagte der Erzähler.
»Fok jou«, sagte Bennie Griessel, »ist gar nicht wahr.«
»Fok jou, alter Säufer. Wenn du kein Polizist wärst, würde ich dir eine reinhauen.«
»Du kannst ja nicht mal ’ne Delle in ein Stück Scheiße hauen«, sagte Griessel und stand wacklig auf. Er schwankte, sehr unsicher auf den Beinen, gegen einen der Anzugträger.
Der Mann verpasste ihm einen Faustschlag auf die Wange. Griessel stürzte.
Der Erzähler sagte zu seinem Freund: »Du bist mein Zeuge – er hat mich als Erster gestoßen.«
7
Transkription Gesprächsmitschnitt: RA Susan Peires mit Meneer Francois du Toit
Mittwoch, 24.Dezember. Hugenote Kamers 1604,
Koningin Victoriastraat 40, Kapstadt
FdT: Ich habe Richter … Vielleicht sollte ich … Verdammt, ich habe es nicht kommen sehen. Bis vor zwei Jahren habe ich noch im Ausland gearbeitet, ich hätte nie gedacht … Kaum zu glauben, auf welchen Unsinn man sich manchmal einlässt, weil man glaubt, man hätte keine andere Wahl. Der Stress macht einen fertig … Und die Angst. Ich glaube, es war eher die Angst, aber wenn man erst mal bis zum Hals drinsteckt, wenn man nicht weiterweiß, und dann kommt so ein Kerl …