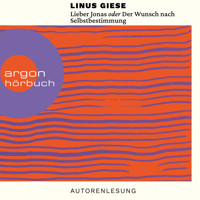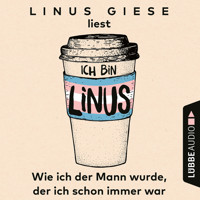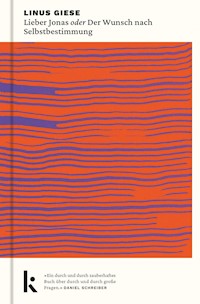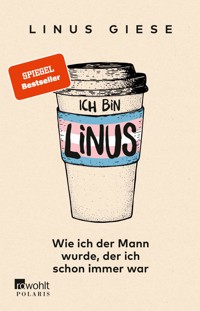
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein Satz, der wie eine Selbstverständlichkeit klingt – «Ich bin Linus» –, doch er teilt sein Leben in ein Davor und Danach. Auf beeindruckende Weise erzählt Linus Giese, warum er einunddreißig Jahre alt werden musste, um laut auszusprechen, dass er ein Mann und trans ist und warum sein Leben heute vielleicht nicht einfacher, aber sehr viel glücklicher ist. «Wer verstehen will, welche verschlungenen Wege es manchmal sein können, auf denen sich die eigene Identität entdecken lässt, wer verstehen will, wie sich eine Person immer wieder neu finden kann, wer verstehen will, was es heißt, trans zu sein, dass das nicht nur im Singular, sondern im Plural existiert, dass es ein ganzes Spektrum gibt, wie sich als trans Person leben, denken und lieben lässt – all denen sei dieses Buch ans Herz gelegt.» (Carolin Emcke) Eigentlich ahnt er es seit seinem sechsten Lebensjahr. Doch aus Sorge darüber, wie sein Umfeld reagieren könnte und weil ihm Begriffe wie trans, queer, nicht-binär fehlen, verschweigt Linus lange, wer er wirklich ist. Mit dem Satz «Ich bin Linus» beginnt im Sommer 2017 sein neues Leben, das endlich nicht mehr von Scham, sondern Befreiung geprägt ist. Offen erzählt Linus Giese von seiner zweiten Pubertät, euphorischen Gefühlen in der Herrenabteilung, beklemmenden Arztbesuchen, bürokratischen Hürden, Selbstzweifeln, Freundschaft und Solidarität, von der Macht der Sprache und digitaler Gewalt. Seit seinem Coming-Out engagiert sich Linus für die Rechte von trans Menschen. Vor allem im Netz, aber nicht nur dort, begegnet ihm seither immer wieder Hass. Doch Schweigen ist für ihn keine Option. «Linus Giese erzählt seine Geschichte so offen, mutig und spannend, dass man das Buch kaum aus der Hand legen kann. Ich sage das nicht oft, aber: Hören Sie diesem Mann zu.» (Margarete Stokowski)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Linus Giese
Ich bin Linus
Wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war
Über dieses Buch
Eigentlich ahnt er es seit seinem sechsten Lebensjahr. Doch aus Sorge darüber, wie sein Umfeld reagieren könnte, und weil ihm Begriffe wie trans, queer, nicht-binär fehlen, verschweigt Linus lange, wer er wirklich ist. Mit dem Satz «Ich bin Linus» beginnt im Sommer 2017 sein neues Leben, das endlich nicht mehr von Scham, sondern von Befreiung geprägt ist. Offen erzählt Linus Giese von seiner zweiten Pubertät, euphorischen Gefühlen in der Herrenabteilung, beklemmenden Arztbesuchen, bürokratischen Hürden, Selbstzweifeln, Freundschaft und Solidarität, von der Macht der Sprache und digitaler Gewalt. Seit seinem Coming-out engagiert sich Linus für die Rechte von trans Menschen. Vor allem im Netz, aber nicht nur dort, begegnet ihm seither immer wieder Hass. Doch Schweigen ist für ihn keine Option.
Vita
Linus Giese ist studierter Germanist und arbeitet seit November 2017 als Blogger, Journalist und Buchhändler in Berlin. Auf buzzaldrins.de schreibt er über Bücher und auf ichbinslinus.de über seine Transition, zudem hat er mehrere Texte für den Tagesspiegel, die taz und das Onlinemagazin VICE veröffentlicht. Twitter: 10.800 Follower*innen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-00664-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für alle trans Menschen, die dieses Buch lesen:
Ihr seid gut, so wie ihr seid!
«Ich halte es für unerlässlich,
dass es Menschen gibt,
die sich in die Mitte des Raumes stellen
und darauf bestehen, gesehen zu werden.»
Jaqueline Scheiber
«[…] es ist bequem, über Geschlecht als Kategorie herzuziehen und anderen vorzuwerfen, sie machten daraus eine Ideologie, wenn das eigene Geschlecht nicht in Zweifel gezogen oder benachteiligt wird, es ist einfach, Sexualität für etwas Intimes und Privates zu halten und irritiert zu reagieren, dass andere darüber sprechen, wenn der eigenen Sexualität zugestanden wird, etwas ganz Normales und Persönliches zu sein.»
Carolin Emcke
Starbucks
Es war Mittwoch, der 4. Oktober 2017, als ich das erste Mal den Namen sagte, den ich mir schon so lange für mich überlegt hatte: Linus.
«Linus» war meine Antwort auf die Frage eines Baristas nach meinem Namen, den er auf den Kaffeebecher schreiben wollte. Ich stand in einem Café am Frankfurter Hauptbahnhof, als ich zum ersten Mal das Gefühl hatte: Das hier ist der richtige Moment und der richtige Ort, um zu sagen, dass ich Linus heiße.
Und dass ich ein Mann bin.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie der Barista aussah. Ich habe mir sogar gemerkt, was ich damals bestellte: einen Pumpkin Spice Latte mit Sahne und einem extra Schuss Kaffee. In den folgenden Monaten war ich noch viele weitere Male dort, weil ich den Wunsch hatte, diesen einen Moment zu wiederholen. Es war jedoch immer so leer, dass ich nie wieder nach meinem Namen gefragt wurde.
Manchmal wird mir bei diesem Gedanken ganz flau im Magen, weil mir dann bewusst wird, wie sehr unser Leben von Zufällen abhängt. Wie wäre mein Leben weitergegangen, wäre ich damals nicht nach meinem Namen gefragt worden? Hätte ich dann einfach an einem anderen Tag und in einem anderen Moment den Mut aufgebracht?
Manchmal frage ich mich auch, warum ich meinen Namen beim ersten Mal einer fremden Person offenbaren musste: Sagt man so etwas nicht eher der besten Freundin oder der eigenen Mutter? Ich glaubte aus irgendeinem Grund, es einem Fremden erzählen zu müssen. Vielleicht, weil ich wusste, dass ich von einem Menschen, der mich nicht kennt, nicht in Frage gestellt werden würde? An diesem Ort und in diesem Moment war ich Linus, und das wurde ohne Nachfragen oder Skepsis hingenommen.
Bist du dir denn sicher? Aber du bist doch eine Frau! Das kommt für uns alle sehr überraschend! Du bist doch viel zu alt für so etwas! Wir glauben dir nicht! Du irrst dich! Du darfst das nicht sein! Das bist du nicht! Tu uns das nicht an! Das waren einige der Antworten, vor denen ich mich fürchtete.
Ich kann mich noch sehr genau an die Tage und Wochen erinnern, die diesem Moment im Starbucks vorausgegangen waren. Zwei Monate zuvor hatte ich mit Stefan auf einer Parkbank mitten in Frankfurt gesessen. Er war der Erste, mit dem ich darüber sprach, dass ich glaubte, ein Junge zu sein. Ich war damals schon einunddreißig Jahre alt, doch ich sagte immer: «Ich glaube, dass ich ein Junge bin» – es kam mir nie in den Sinn, dass ich eigentlich schon längst ein erwachsener Mann sein müsste. Ich denke, das liegt daran, dass mir meine Kindheit entgangen ist. Sie wurde mir vorenthalten. Ich wollte noch einmal ein Junge sein, um all das nachholen zu dürfen, was ich verpasst hatte und nicht erleben durfte.
Vielleicht steckte damals noch ein kleiner Peter Pan in mir, der alles Mögliche wollte, nur niemals erwachsen werden. Heute weiß ich, dass ich diese verpasste Kindheit nicht nachholen kann – doch ich kann mir Dinge, die ich verpasst habe, Stück für Stück zurückholen.
«Ich halte dich für einen Jungen, und ich freue mich auf den Tag, an dem ich ‹er› sagen und deinen Namen kennenlernen darf», schrieb mir Stefan in einer Nachricht kurz vor meinem Coming-out. Auch heute halte ich mich noch oft für einen Jungen, von dem ich hoffe, dass er irgendwann zu einem Mann heranwachsen wird – damals war das für mich alles noch kaum vorstellbar.
Wenn ich die Geschichten von anderen trans Menschen lese, bin ich oft fasziniert davon, wie sicher manche bereits als Kinder und Jugendliche bei der Antwort auf die Frage waren, wer sie sind und was sie sich wünschen. Als ich aufwuchs, fehlten mir Begriffe wie trans, genderqueer oder nichtbinär. Identität war für mich nichts Wandelbares, sondern – ganz im Gegenteil – etwas, das für immer und unverrückbar feststand. Felsenfest. In Stein gemeißelt.
Der Tag, an dem ich zum ersten Mal Linus sagte, war der Tag, an dem sich mein Leben in ein Davor und ein Danach teilte. Auch wenn das wie ein Klischee klingt, es ist wahr. Zurück ließ ich ein Leben, das eng wie ein Korsett gewesen ist – und trat in eines, in dem ich mir zum ersten Mal erlaubte, über meine Identität, meine Sexualität und mich selbst nachzudenken.
Was wünsche ich mir? Was brauche ich? Was gefällt mir? Was tut mir gut? Was würde ich gerne ausprobieren? Wer bin ich eigentlich?
Als ich den Becher, auf dem mein Name stand, ausgetrunken hatte, fuhr ich damit zurück in das Zimmer nach Mühlheim, in dem ich damals zur Untermiete lebte, machte ein Foto und lud es auf meinem Facebook-Profil hoch. Dazu schrieb ich den Satz: «Tolles Gefühl: bei Starbucks zum ersten Mal den Namen laut aussprechen, den ich mir schon so lange für mich wünsche.» Danach machte ich das Handy aus, klappte meinen Laptop zu und legte mich auf den Fußboden meines kleines Badezimmers, weil ich vor lauter Angst kaum noch Luft bekam. All das, was mich der Barista nicht gefragt hatte, fragten mich jetzt vielleicht meine Freund*innen. Vielleicht würden sie sich auch von mir abwenden, mich beschimpfen, mir die Freundschaft kündigen? Und was würde passieren, wenn mein Chef davon erfuhr? Oder meine Kolleg*innen? Würde ich vielleicht entlassen? Gemobbt? Abgelehnt? Verstoßen? Oder auch einfach nur seltsam beäugt?
Mit meinem Coming-out verlor ich das Privileg, zu den «Normalen» zu gehören – ich war plötzlich anders und davon abhängig, ob ich von anderen immer noch akzeptiert oder gemocht wurde.
Es dauerte lange, bis ich mich zum ersten Mal wieder online traute – und einen Großteil der Kommentare unter meinem Foto las ich erst Wochen und Monate später. Natürlich gab es Fragen, natürlich gab es Irritationen – manche übergingen die Neuigkeiten auch einfach schweigend. In den Wochen und Monaten nach meinem Coming-out kam es zu Konflikten und Zerwürfnissen, Freundschaften zerbrachen. Vieles von dem, was ich mir ausgemalt hatte, trat in ganz unterschiedlichen Varianten und Abstufungen ein. Doch nichts davon war so gravierend, wie ich es befürchtet hatte.
Meine größte Angst war, dass jemand sagen könnte: Das, was du dir wünscht, ist falsch – du bist ekelhaft, und ich deshalb alles wieder rückgängig machen müsste. Und tatsächlich gibt es immer wieder Menschen, die mir genau das sagen oder auch schreiben – doch mittlerweile verunsichert mich das nicht mehr. Ich sage dann: So bin ich eben – ich bleibe hier, ich bleibe sichtbar, ich möchte mich für dich nicht ändern. Was willst du dagegen machen?
Ich sage oft, dass dieser Mittwoch im Oktober der Tag meines Coming-outs war. Doch eigentlich stimmt das so nicht. Bei Wikipedia steht, dass man unter einem Coming-out ein «absichtliches, bewusstes Öffentlichmachen» versteht. Mich irritiert an dem Begriff, dass er etwas Einmaliges suggeriert: Aber trans Menschen haben oft nicht nur ein singuläres Coming-out, sondern müssen sich immer und immer wieder outen. Ich zeigte meinen Becher meinen Freund*innen auf Facebook, doch nicht alle meine Freund*innen sind auf Facebook. In einem Artikel las ich, ein Coming-out sei wie Duschen: Du musst es fast täglich tun. Wie sage ich es alten Freund*innen? Wie sage ich es neuen Freund*innen? Wie sage ich es Verwandten? Wie sage ich es dem Arbeitgeber, den Kolleg*innen? Und wann sage ich es meinem Date? Ich oute mich beim Arztbesuch, bei Behördenterminen, im Gespräch mit der Krankenkasse – und eine lange Zeit habe ich mich auch jedes Mal geoutet, wenn ich ein Paket bei der Post abholen musste, das an meinen alten Namen adressiert war.
Mein Leben ist ein andauerndes Coming-out – ich muss mich immer wieder erklären. Ich tue das seit drei Jahren. Wenn ich sage, dass ich ein trans Mann bin, gibt es darauf ganz unterschiedliche Reaktionen: Am angenehmsten ist mir das unaufgeregte Verständnis. Doch es gibt auch peinlich berührtes Schweigen, Unsicherheit, Überforderung, Neugier oder übergriffige Nachfragen. Hattest du schon die OP? Wie ist dein Zeitplan für die Umwandlung? Bist du dir sicher, dass du nicht einfach nur eine burschikose Frau mit kurzen Haaren bist? Und die häufigste Frage: Seit wann weißt du denn, dass du trans bist?
In vielen Lebensgeschichten von trans Menschen fällt irgendwann ein Satz wie Ich wusste schon als Kind, dass ich trans bin oder Ich wusste schon immer, dass ich ein Mann bin. Ich sage das auch manchmal, weil es tatsächlich vieles einfacher macht – vor allem im Gespräch mit anderen Menschen. Doch ich bin mir nicht immer sicher, ob es wirklich stimmt. Ich wusste schon als Kind, dass ich gerne Badeshorts trug, kurze Haare mochte und lieber mit einer Turtles-Figur spielen wollte als mit einer Barbie. Ich wusste auch als Kind schon, dass ich einen Penis haben wollte und – genauso wie mein Vater und mein Bruder – gerne im Stehen gepinkelt hätte. Doch wusste ich als Kind bereits, dass ich ein Junge bin? War mir als Kind bereits klar, dass ich kein Mädchen bin? Ich weiß es nicht. Als Jugendlicher wusste ich dann, dass ich mich oft seltsam fremd mit mir selbst fühlte, dass ich unsicher und ängstlich war. Als ich durch Zufall anfing, das Online-Tagebuch eines trans Manns zu lesen, dachte ich oft: Das bin doch ich, das möchte ich auch, das würde mich endlich glücklich machen. Doch es dauerte dann noch weitere sechzehn Jahre, bis ich mein erstes Coming-out hatte.
Blicke ich zurück, kommt mir mein Leben oft wie ein großes und verschlungenes Durcheinander vor. Es war ein langer Weg, bis ich endlich zu mir selbst gefunden habe. Ich glaubte, eine lesbische Frau zu sein. Ich glaubte, eine Butch zu sein. Jetzt bin ich ein queerer trans Mann. Vielleicht bin ich das schon immer gewesen. Doch vielleicht war es auch ein Prozess, bis ich dahin gekommen bin, wo ich mich heute verorte.
Als ich achtzehn Jahre alt war, glaubte ich, niemals ein trans Mann sein zu dürfen. Als ich vierundzwanzig Jahre alt war, glaubte ich, schon längst zu alt zu sein, um noch ein trans Mann sein zu können. Als ich mich mit einunddreißig Jahren endlich outete, hatte ich das Gefühl, zum ersten Mal richtig atmen zu können. Ich verspürte zum ersten Mal so etwas wie sexuelle Lust. Als ich mit zweiunddreißig Jahren damit begann, Hormone zu nehmen, veränderte sich mein Leben zum ersten Mal in eine positive Richtung. Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Es gibt so wenig Repräsentation von trans Menschen, und es werden so wenig diverse unterschiedliche Lebensgeschichten erzählt, dass mir an dieser Stelle wichtig ist, zu betonen: Trans Menschen müssen nicht als Kind wissen, wer sie sind. Sie müssen auch nicht als Jugendliche wissen, wer sie sind. Niemand muss sich immer sicher sein. Zweifel und Unsicherheiten sind erlaubt. Experimentieren ist erlaubt. Auch Fehler sind erlaubt. Es gibt nicht nur einen einzigen möglichen Lebenslauf für trans Menschen. Wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen uns irren. Wir dürfen uns umentscheiden. Wir dürfen auch bereuen. Wir dürfen all das, was alle anderen Menschen auch dürfen.
Es gibt keinen universellen Lebenslauf für trans Menschen. Die Geschichte, die ich in diesem Buch erzähle, steht nicht repräsentativ für alle anderen trans Menschen. Ich spreche nicht für andere trans Menschen und möchte das auch gar nicht. Das hier ist meine Geschichte, mit all meinen Umwegen, Irrwegen und Sackgassen. Als ich in meinem Leben das erste Mal einen trans Mann traf, war meine erste Frage: Bin ich zu alt? Ist es zu spät? Als ich kürzlich für jemanden der erste trans Mann war, den mein Gegenüber traf, lautete dessen erste Frage: Kann ich überhaupt trans sein, wenn ich schon einundzwanzig Jahre alt bin und mir noch immer nicht sicher bin, was ich mir eigentlich wünsche?
Ja, kannst du. Du kannst und darfst alles sein – und ich wünsche allen, die dieses Buch lesen, dass sie nicht so lange brauchen werden wie ich, bis sie das verstanden haben. Identität und Sexualität sollten etwas Fließendes sein – und nichts, das uns festlegt und beschränkt. Es gibt keine Grenzen und Vorschriften: Du darfst alles ausprobieren, dir alles erlauben, alles tragen, was dir gefällt, und alles tun, woran du Freude hast. Gender ist eine Spielwiese – probiere dich aus und habe Spaß dabei.
Vor drei Jahren dachte ich, dass ich der männlichste Mann sein müsste, den die Welt jemals gesehen hat. Heute denke ich: Wenn mir die Jacke in der Frauenabteilung gefällt, kaufe ich sie mir. Ich versuche – ganz losgelöst von allen gesellschaftlichen Erwartungen – herauszufinden, wer ich überhaupt bin: Gefallen mir eigentlich Männer oder Frauen? Mag ich lackierte Fingernägel? Gefallen mir Blumenmuster und Glitzerschuhe? Bin ich vielleicht doch nicht so binär, wie ich immer dachte? Und wie kann ich versuchen herauszufinden, woran ich Freude habe und was ich mir wünsche?
Es ist ein andauerndes Experimentieren, und ich wünschte, alle Menschen – ob trans oder cis – würden sich ebenfalls die Freiheit nehmen, über stereotype Vorstellungen hinaus zu denken. Vielleicht kann ich mit meiner Geschichte, die in einem Starbucks im Frankfurter Hauptbahnhof begann, einen Teil dazu beitragen.
Tine & Daniel
Zu der Zeit, als ich mich auf den Weg nach Frankfurt machte, lebte ich erst seit ein paar Tagen bei Tine und Daniel in Mühlheim – das ist mit der S-Bahn zwanzig Minuten entfernt vom Frankfurter Hauptbahnhof. Drei Monate zuvor hatte ich angefangen, in einer Buchhandlung in Hanau zu arbeiten. Drei Monate zuvor lebte ich noch mit meiner Partnerin und unserem Hund in Würzburg. Ich pendelte fast jeden Tag mit dem Zug nach Hanau, um dort zum ersten Mal in meinem Leben hauptberuflich Bücher zu verkaufen.
Mein Studium hatte ich bereits 2011 abgeschlossen, aber in den Jahren danach war es mir schwergefallen, im Berufsleben Fuß zu fassen. Ich schrieb endlos viele Bewerbungen und reiste zu Vorstellungsgesprächen durch die halbe Bundesrepublik. Ich war in Berlin, in Köln, in Hamburg und fuhr sogar bis nach Weinheim, doch am Ende sammelte ich eine Absage nach der anderen. Ich konnte in keinem der Gespräche überzeugen. Im Nachhinein glaube ich, dass man mir einfach angemerkt haben muss, dass etwas mit mir nicht stimmte – nicht ganz richtig war.
In dieser Zeit war ich jahrelang arbeitslos, blieb zu Hause und kümmerte mich um den gemeinsamen Haushalt und den Hund, ich traute mir irgendwann einfach nichts mehr zu. Kürzlich sprach ich mit einer Freundin über die Zeit vor meinem Coming-out, und sie sagte: «Wir haben alle gemerkt, dass irgendetwas mit dir nicht stimmte. Es passte einfach nicht.» Wer sollte mir einen Job geben, wenn ich mir selbst nicht einmal zutraute, irgendwo arbeiten zu können? Ich war schüchtern, verschlossen, unglücklich. Da war kein Selbstvertrauen, kein Selbstbewusstsein, keine Selbstsicherheit.
Als ich im Buchladen in Hanau anfing, veränderte sich meine Lebenssituation plötzlich. Ich merkte zum ersten Mal, dass ich in etwas gut war, was ich tat. Ich hatte Spaß daran, Bücher zu empfehlen, aber auch am Kontakt mit den Kund*innen. Ich freute mich über die vielen unterschiedlichen Begegnungen und die Gespräche, die ich führte. Bevor ich in Hanau anfing, hatte ich oft Angst vor alltäglichen Dingen – es kostete mich zum Beispiel unglaublich viel Überwindung zu telefonieren. Jedes Telefonat war ein großes Drama, das ich oft tagelang vor mir herschob. Doch plötzlich hatte ich keine Wahl mehr – wenn das Telefon klingelte, musste ich abnehmen.
Wenn mich Menschen fragen, ob ich gebürtig aus Berlin komme, dann gerate ich immer ein wenig ins Stocken: Nein, gebürtig komme ich aus Bremen. Zuletzt gewohnt habe ich in Mühlheim, davor in Würzburg, davor in Göttingen, dazwischen für ein Jahr in Hamburg, und studiert habe ich übrigens in Dresden und Bayreuth. Ich habe das Gegenteil von einem geraden Lebensweg, erst als ich in Berlin ankam, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, nach Hause zu kommen.
Als ich im Herbst 2017 darüber nachdachte, etwas an meinem Leben zu ändern, wurde mir schnell klar, dass ich dafür mit meinem alten Leben brechen musste. Ein Freund erstellte für mich eine Wohnungsanzeige: Zimmer, WG oder kleine Wohnung in Frankfurt oder Hanau gesucht – am besten mit Hund und ab sofort. Darunter ein Foto von mir auf einem roten Roller – ich fuhr keinen Roller, ich habe nicht einmal einen Führerschein, aber der Roller hatte dieselbe Farbe wie meine Jacke, und ich dachte, dass das auf einem Foto gut aussehen könnte.
Ein paar Tage später meldete sich Tine bei mir und erzählte, dass bei ihr in Mühlheim eine Wohnung leer stehen würde, in der zuvor ihre verstorbene Mutter gelebt hatte. Die Wohnung hätte sogar einen freien Stellplatz für meinen Roller. Ich musste lachen. Mühlheim ist nur zwanzig Minuten von Hanau entfernt, ich fuhr hin und lernte Tine, Daniel und ihren Hund Mogli kennen, eine seltsame Mischung aus einem Dackel und einem Schäferhund. Beide hatten eigentlich nicht vorgehabt, die Wohnung zu vermieten. Es war Zufall, dass sie meine Anzeige sahen. Und es war eine spontane Entscheidung, mir die Wohnung anzubieten. Sagte ich nicht schon, dass es manchmal erschreckend ist, wie sehr unser Leben von Zufällen abhängt? Obwohl es in diesem Fall natürlich ein schöner Zufall war.
Zwei Jahre später sprach ich mit Tine und Daniel darüber, wie wir uns bei der Besichtigung zum ersten Mal getroffen haben. Ich machte auf beide einen sehr zurückhaltenden und unsicheren Eindruck. So fühlte ich mich damals auch – ich wusste einfach nicht, wohin mit mir.
Ich zog nicht sofort ein, aber es war beruhigend zu wissen, dass ich eine Option auf eine finanzierbare Unterkunft in der Nähe meiner Arbeit hatte.
Wenn ich an diese Zeit im Herbst 2017 denke, dann verschwimmt alles vor meinen Augen. Ich befand mich in einem Ausnahmezustand, weil ich das Gefühl hatte, mein Leben würde auseinanderbrechen: die Trennung von meiner Partnerin, der immer stärker werdende Wunsch nach einem Coming-out, der neue Job im Buchladen, die Frage danach, wo ich wohnen sollte – all das wurde für mich zu einer immer stärker werdenden Belastung.
Damals besuchte ich Stefan in Berlin, und ich erinnere mich noch, wie ich mit ihm bei einer Hausärztin saß, um mich aufgrund dieser Situation erst einmal krankschreiben zu lassen. Die Hausärztin überwies mich sofort weiter in die Psychiatrie. Dort musste ich mich und meinen psychischen Zustand begutachten lassen. Ich wurde zum Glück wieder nach Hause geschickt.
Zwei Tage später zog ich nach Mühlheim. Als ich Tine anrief, stand ich weinend auf einem Bahnsteig, weil ich nicht mehr wusste, wohin ich als Nächstes gehen könnte. Sie holte mich vom Bahnhof in Mühlheim ab, und ich zog in die leerstehende Wohnung ein – ich hatte nicht mehr dabei als einen Rucksack und eine Umhängetasche.
Tine und Daniel erzählten mir später, dass sie sich damals viele Gedanken um mich gemacht haben. Sie wussten nicht, ob ich mich verlassen fühlte oder noch mehr Ruhe für mich selbst brauchte. Ich lebte sehr zurückgezogen, verbrachte viele Stunden damit, auf meinem Bett zu liegen und an die Decke zu starren. Manchmal lauschten sie an der Wand, ob ich mich noch bewegte, weil sie Angst davor hatten, dass ich mir etwas antun könnte.
Weil ich krankgeschrieben war, hatte ich viel Zeit. Ab und an fuhr ich zusammen mit Daniel und Mogli mit dem Fahrrad raus ins Grüne, um spazieren zu gehen. Ich suchte nach einer Therapeutin und fand relativ schnell einen Platz, mitten in der Frankfurter Innenstadt. Nach den Sitzungen wanderte ich durch die Fußgängerzone. Ich ging in Modegeschäfte und schaute mich dort in der Herrenabteilung um. Ich ging Kaffee trinken. Ich fuhr mehrmals die fünfundfünfzig Stockwerke den Main Tower hinauf, stand ganz oben, schaute über Frankfurt hinweg und hörte «Never Let Me Down Again» von Depeche Mode: We’re flying high / We’re watching the world pass us by.
Der 4. Oktober war ein dunkler Tag, an dem es nie so richtig hell wurde. Ich setzte mich wieder mal in die S-Bahn, um nach Frankfurt zu fahren. Am Hauptbahnhof stieg ich aus und ging in den kleinen Starbucks in der Nähe des Eingangs. Ich stellte mich in die Schlange, und als ich drankam und gefragt wurde, wie ich heiße, sagte ich Linus.
Ich werde oft gefragt, ob ich das geplant hatte, aber das hatte ich nicht. Es war eine spontane Entscheidung. Danach stand ich dort mit meinem Becher, auf dem plötzlich dieser Name stand.
Wenn ich heute erklären muss, warum ich Linus heiße, dann sage ich oft: Wegen den Peanuts, kennst du etwa nicht Linus mit der Schnuffeldecke? Linus’ Charakter hat dafür gesorgt, dass mir meine Kuscheldecke beim Älterwerden nicht mehr peinlich war. Ich glaube, gerade für Jungen – aber auch für Männer – ist es nicht immer einfach, warm, weich und verletzlich zu sein. Linus war für mich ein Vorbild dafür, dass sanft zu sein überhaupt nicht peinlich sein muss.
Als ich damit begann, dieses Buch zu schreiben, erzählte mir eine befreundete Autorin, dass die Schnuffeldecke von Linus das Lieblingsbeispiel ihrer Therapeutin für ein Übergangsobjekt sei – so etwas haben Kinder, wenn sie für eine kurze Zeit ohne ihre Eltern sind. Ich finde das eine ganz schöne Namensassoziation.
Als ich mit dem Becher zurück in die Wohnung fuhr, postete ich das Foto zwar auf Facebook, aber ich konnte Tine und Daniel nichts davon erzählen. Im Nachhinein muss ich darüber lachen, weil ich eigentlich keinen besseren Ort für dieses Coming-out hätte haben können – Daniel hörte damals einen Podcast von einem trans Mann und trug bei meiner Wohnungsbesichtigung ein Kleid. Doch ich war so in mir selbst gefangen, dass ich gar nicht sehen konnte, dass dort zwei potenzielle Verbündete waren – deshalb blieb ich lieber für mich.
Als Tine und Daniel das Foto auf Facebook sahen, klickten beide Gefällt mir, um mir zu signalisieren: Das irritiert uns nicht, alles gut. Daniel nahm am nächsten Tag das Schild mit meinem Namen vom Briefkasten und klebte ein Schild mit meinem neuen Namen dorthin.
Bevor ich ein paar Tage später den Mietvertrag unterschrieb, googelte Tine lange im Internet, um herauszufinden, ob ich diesen Vertrag schon als Linus unterschreiben dürfte. Ich bekam das damals alles gar nicht wirklich mit, heute rührt es mich, wie aufgeschlossen und zugewandt die beiden gewesen sind. Es gibt viele Menschen, die nach einem solchen Coming-out überfordert oder ablehnend reagieren – Tine und Daniel haben alles richtig gemacht.
Und trotzdem hatte ich Angst davor, mit den beiden darüber zu sprechen. Trotzdem hatte ich Angst davor, dass mir nicht geglaubt werden könnte. Meine größte Angst war, dass mir niemand abnehmen würde, dass ich ein trans Mann war. Meine größte Angst war, dass ich nicht trans genug wäre, dass Menschen mich ansehen und sagen könnten: Du siehst aber nicht aus wie ein Mann. Ich hatte einunddreißig Jahre lang als Frau gelebt, ich brauchte einunddreißig Jahre, bevor ich herausfand, dass ich eigentlich ein Mann bin. Wie sollte man mir glauben? Wie sollte man mich nicht für einen furchtbaren Betrüger halten?
Wann wurde ich eigentlich trans?
Die Frage, wie ich mich selbst sehe und wie ich von anderen gesehen werde, beschäftigt mich als trans Mann vielleicht noch einmal stärker als viele andere Menschen. Wer trans ist, läuft oft Gefahr, sich gezwungenermaßen ausgiebig mit sich selbst zu beschäftigen. Einmal besuchte ich mit einem Freund eine schwule Gala – «Ich bin mein eigener Planet, ich kreise um mich selbst» wurde auf der Bühne gesungen. Manchmal scherze ich über meine eigene Selbstbezogenheit, doch im Grunde ist es genau das: Ich musste mich so sehr mit mir selbst beschäftigen, um überhaupt herausfinden zu können, wer ich bin und wer ich sein darf.
Oft werde ich gefragt, seit wann ich überhaupt weiß, dass ich trans bin. Ich finde, dass das eine sehr schwer zu beantwortende Frage ist – seit wann weißt du denn, dass du cis bist? Oder heterosexuell?
Wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich oft an den Song «Wrong» von Depeche Mode. Dave Gahan singt darin: I was born with the wrong sign / In the wrong house / with the wrong ascendancy. Und später dann: There’s something wrong with me chemically / Something wrong with me inherently / The wrong mix in the wrong genes / I reached the wrong ends by the wrong means. Immer wenn ich das Lied höre, singe ich laut mit. Weil mir das Grundgefühl des Liedes so erschreckend bekannt vorkommt.
Wenn ich mit dem Wissen, das ich heute habe, auf meine Kindheit blicke, erkenne ich, dass ich wohl schon immer ein wenig anders war als die meisten Mädchen um mich herum: Ich verhielt mich anders, machte andere Dinge, mochte andere Dinge. Ich wollte schon immer lieber wie mein älterer Bruder sein: genauso kurze Haare haben wie er, mit den Jungs Fußball spielen, im Bett Boxershorts tragen (in die ich mir gerne ein Sockenpaar schob, damit es aussah, als hätte ich dort eine leichte Beule) und im Sommer mit nacktem Oberkörper herumlaufen.
Wenn ich als erwachsener Mann auf dieses Kind, das ich war, zurückblicke, erkenne ich natürlich in vielen Kleinigkeiten erste Anzeichen für mein heutiges Leben – doch als Kind selbst habe ich lange nicht gemerkt, dass ich vielleicht anders sein könnte, als die meisten Mädchen. Ich durfte die ersten Jahre meines Lebens all das tun, was ich gerne tun wollte: Ich ging mit der Badehose meines Bruders ins Schwimmbad und lief in unserem Garten ohne T-Shirt umher. Doch je älter ich wurde und je sichtbarer sich mein Körper veränderte, desto stärker spürte ich, dass ich mich unpassend verhielt. Im Sommer, als ich zwölf wurde, bekam ich meinen ersten Badeanzug – ich hasste ihn. Ich hasste die Form, die er hatte, und ich hasste, dass er meine Formen so sehr betonte. Ich fühlte mich darin fast nackt und schutzlos, er zwickte im Schritt, und die Träger schnitten in meine Schultern. Ich erinnere mich noch gut an die entsetzten Blicke anderer Eltern, als ich an einem heißen Ferientag doch wieder heimlich in einer Badehose schwimmen ging. Ich fühlte mich in meinem Leben noch nie so beschämt wie in diesem Moment. Ich war alleine ins Schwimmbad gegangen, als ich nach Hause kam, erzählte ich nichts von meinem Erlebnis.
Je älter ich wurde, desto stärker wurde das Gefühl, nirgendwo mehr dazuzugehören. Ich erinnere mich noch gut an eine Klassenfahrt, auf der sich alle Mädchen für die abendliche Kinder-Disco schminkten. Auch ich wurde damals geschminkt, die Erinnerung daran kann ich noch heute fast körperlich spüren – ich wusste nicht, was ein Mascara-Stift ist, und hatte große Angst davor, dass mir mein Auge ausgestochen werden könnte. Es fühlte sich an, als wäre mir ein Kostüm übergezogen worden, das ich nicht tragen wollte. Das mit dem Schminken begriff ich auch viele Jahre später noch nicht – ich habe einfach nie verstanden, warum an Mädchen oft diese unausgesprochene Erwartung gestellt wird, sich zu schminken, doch an Jungs nicht.
Doch während das Schminken etwas war, für das ich mich entscheiden konnte, waren die Veränderungen meines Körpers etwas, das ich nicht aufhalten oder beeinflussen konnte. Der Moment, in dem meine Brüste wuchsen, war für mich einer der schlimmsten meines Lebens. Die Pubertät traf mich hart, und ich hatte keine Chance, mich zu wehren – auch wenn ich es ab und an versuchte und auf meine Brüste einschlug oder eine Schere nahm, um mich damit zu schneiden. Doch nichts konnte ihr unaufhörliches Wachstum stoppen. Es gab nichts, das ich tun konnte, um diese Veränderungen aufzuhalten. Die Zeit meiner ersten Pubertät war ein furchtbarer und gewaltvoller Lebensabschnitt, in dem ich fast täglich damit konfrontiert war, dass mein Leben nicht mehr so frei und unbeschwert war, wie es mir lange Zeit erschienen war.
Mir fällt übrigens selbst auf, wie oft ich Ich erinnere mich schreibe – fast schon wie eine mantrahafte Beschwörungsformel. Ich glaube, ich tue das, um mir selbst zu versichern, dass diese Erinnerungen tatsächlich wahr sind. Eigentlich erinnere ich mich nämlich an nicht sehr viel zwischen meinem vierten und zwölften Lebensjahr. In der großartigen Serie Euphoria sagt Rue, eine der Hauptfiguren: «Die Welt drehte sich schnell, mein Gehirn war langsam.» Als Kind drehte sich meine Welt zu schnell für mein Gehirn. Als ich drei Jahre alt war, zogen meine Eltern mit mir für ein paar Jahre nach Marokko, doch ich erinnere mich an nichts mehr aus dieser Zeit. Meine einzige Erinnerung ist ein immer wiederkehrender Albtraum, der mich in meiner Kindheit nächtelang aufgesucht hatte. In dem Traum wusste ich nie, ob ich wach war oder schlief – ich lag in meinem Bett und wusste, dass sich mir eine schwarzgekleidete und bedrohliche Gestalt näherte. Nacht für Nacht fürchtete ich mich davor, dass sie näher kam. Ich wünschte mir immer, endlich aufzuwachen, doch im Traum war ich die ganze Zeit wach.
Aus Erzählungen von anderen weiß ich, dass ich im Kindergarten nicht sprach – nicht ein einziges Wort. Die Erzieher*innen ließen mich gewähren, in der Hoffnung, ich würde schon irgendwann meinen Mund aufmachen und anfangen zu sprechen. In meinem ersten Schulzeugnis stand, dass ich «kontaktbereit, aber zurückhaltend» gewesen sei.
In der öffentlichen Diskussion wird oft besorgt angemerkt, dass Kinder, die früher einfach Kinder sein durften, heute zu trans Kindern gemacht werden würden. Ich glaube nicht, dass Eltern Kinder trans machen können. Ich glaube jedoch daran, dass es gut ist, wenn Eltern heutzutage achtsamer, hellhöriger und offener sind. Mir selbst wäre so viel Leid erspart geblieben, hätte ich schon mit elf Jahren verstanden, was mit mir los ist. Oder mit sechzehn. Oder mit einundzwanzig. Und nicht erst mit einunddreißig Jahren. Das sind einfach viel zu viele Jahre, in denen ich überleben musste, ohne wirklich Luft zu bekommen.
In welche Schublade passe ich?
Auch wenn ich damals nicht genau wusste, wer ich eigentlich war, wusste ich ziemlich genau, wer ich nicht sein wollte. Ich wollte mit Mädchen zusammen sein, doch ich selbst wollte kein Mädchen sein, ich wollte diesen Körper nicht, und ich wollte auch nicht die Erwartungen erfüllen, die anscheinend an Mädchen gestellt wurden.
Antworten auf die Frage, wer ich sein möchte und wie ich leben und lieben kann, habe ich seit jeher in Büchern gesucht. Für mich ist Literatur ein Ausweg – nicht aus dem Leben heraus, sondern ins Leben hinein. Bücher sind eine Möglichkeit, einen Blick in andere Leben zu werfen und dabei Orientierung und Anleitung zu erhalten. Doch in den Büchern, die ich las, als ich zu einem Teenager heranwuchs, gab es keine Figuren, die mir ähnelten. Ich fand keine Vorbilder für das, was ich fühlte. Ich las Bücher über Jungs, die andere Jungen liebten, und manchmal entdeckte ich auch Bücher, die von Mädchen erzählten, die andere Mädchen liebten. Doch die nahezu komplette Abwesenheit von Menschen, mit denen ich mich hätte identifizieren können, führte dazu, dass ich mich in meiner Pubertät oft seltsam und fremd fühlte.
Irgendwann bekam ich zunehmend das Gefühl, dass etwas an mir ekelhaft oder beschämend sein müsste. Alle meine Wünsche und Bedürfnisse verschoben sich in einen Bereich von Heimlichkeit und Scham. Manchmal klaute ich meinem Vater ein Hemd aus dem Schrank – oder ein Jackett. Ab und an zog ich mir auch besonders enge Oberteile an, um mir damit die Brüste abzubinden.
Schon damals waren glückliche Tage Tage, an denen ich für einen Jungen gehalten wurde – was aufgrund meiner kurzen Haare nicht selten vorkam. Bei alldem verspürte ich jedoch ständig Angst davor, gerade etwas Verbotenes, Falsches oder Schambehaftetes zu tun.