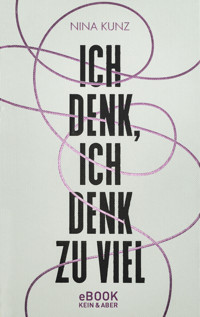
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was sollen diese ewigen Gedankenschlaufen? Was haben schlaflose Nächte auf Instagram zu bedeuten? Und wie kann Jean-Paul Sartre bei Panikattacken helfen? Persönlich und präzise schreibt Nina Kunz – Schweizer Kolumnistin des Jahres 2020 – über das Unbehagen der Gegenwart und geht der Frage nach, warum sich ihr Leben, trotz aller Privilegien, oft so beklemmend anfühlt. Ein Buch über Leistungsdruck, Workism, Weltschmerz, Tattoos, glühende Smartphones, schmelzende Polkappen und das Patriarchat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Nina Kunz wurde 1993 geboren, studierte Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Zürich und arbeitet seit 2017 als Kolumnistin und Journalistin für Das Magazin des Tagesanzeigers. Ihre Texte erschienen bereits in der Neuen Zürcher Zeitung, der ZEIT und dem ZEITmagazin. 2018 und 2020 wurde sie zur »Kolumnistin des Jahres« gewählt.
ÜBER DAS BUCH
Leistungsdruck, Workism, Weltschmerz, Tattoos, glühende Smartphones, schmelzende Polkappen & das Patriarchat.
30 Texte zur Gegenwart.
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
SINNKRISEN
Observer’s Paradox (feat. William Labov)
Workism (feat. Derek Thompson)
Wer ist mein Vater? (feat. Julia Kristeva)
Wursteln (feat. Jean-François Lyotard)
Schwindelgefühl (feat. Jean-Paul Sartre)
Summa cum gaudi (feat. Eric Hobsbawm)
Weltschmerz (feat. Johann Paul Friedrich Richter)
Normalität (feat. Michel Foucault)
Ich hasse dieses Internet (feat. Donna Haraway)
SELBSTZWEIFEL
Arrival Fallacy (feat. Tal Ben-Shahar)
Kontrollsimulation (feat. René Bridler)
Babytattoo (feat. Laurie Penny)
Happychonder (feat. Eva Illouz)
Dabdabhada (feat. Karl Marx)
Drei Tage offline (feat. Jia Tolentino)
Vom Scheitern (feat. Elizabeth Day)
Cat Person (feat. Kristen Roupenian)
Bravo Girl (feat. Chimamanda Ngozi Adichie)
Bias blind spot (feat. Emily Pronin)
Seitentriebe (feat. Reni Eddo-Lodge)
SEHNSÜCHTE
Comfort Food (feat. Will Self)
Geduld (feat. Moma)
Donut-Ökonomie (feat. Kate Raworth)
Und ich liebe sie doch (feat. Falco)
Rumination (feat. Tobias Teismann)
Newstalgia (feat. Kaitlyn Tiffany)
Larger than Life (feat. Benjamin von Stuckrad-Barre)
Chhhht (feat. Marcel Proust)
Herbst (feat. Haddaway)
Genüge ich dir? (feat. Leslie Jamison)
Dank
Literatur
Quellen
»Wer keine Angst hat, hat keine Phantasie.«
erich kästner
VORWORT
Dieses Buch ist in den letzten beiden Jahren entstanden, ohne dass ich je daran gedacht hätte, ein Buch zu schreiben.
Alles begann damit, dass ich anfing, über meine Alltagsängste nachzudenken. Und jedes Mal, wenn mich ein bedrohliches Gefühl beschlich, so lange an Texten herumwerkelte, bis ich glaubte zu verstehen, warum ich mich fühle, wie ich mich fühle. Warum da diese Enge in meiner Brust ist und der Stress-Tinnitus in den Ohren pfeift, obwohl ich doch all diese Privilegien hab.
Ich schrieb über die Angst, das Leben online zu vergeuden, über die absurde Überidentifizierung mit meinem Job, Identitätsfragen, die Suche nach meinem Vater, den ich nicht kenne, den Weltschmerz, Kylie Jenner und das verfluchte Patriarchat.
Herausgekommen ist nun dieses Buch, das zur einen Hälfte ein Tagebuch ist und zur anderen ein Theoriesammelsurium. Denn ich las viel, Jia Tolentino, Jean-Paul Sartre, Roxane Gay, um herauszufinden, wie ich meine Ängste deuten könnte, die so diffus waren, dass ich sie manchmal kaum zu fassen kriegte.
Was mich beim Schreiben beschäftigte, war, inwiefern ich behaupten kann, dass mein Unbehagen irgendwie »für etwas steht«, für eine nihilistische Gegenwart, für eine ausgebrannte Generation, für einen postmodernen Zeitgeist. Aber, wenn ich ehrlich bin, will ich gar nichts davon behaupten, es wäre unpräzise und verkürzt.
Dieses Buch ist eine Einladung in meine Gedankenwelt. Eine Einladung, sich vielleicht in einem der Texte wiederzufinden, oder natürlich auch mir kopfschüttelnd zu widersprechen. Dieses Buch ist ein kleines Puzzleteil in der Debatte um Leistungsdruck und Mental Health. Es sind Notizen aus dem Jetzt, ehrlich aufgeschrieben. In der Hoffnung, dass sie weitere Gedanken anstoßen.
Zürich, Oktober 2020
SINNKRISEN
OBSERVER’S PARADOX
Es kommt häufig vor, dass ich todmüde bin, aber just in dem Moment, in dem ich den Kopf auf das Kissen lege, wieder hellwach werde.
In der Regel frage ich mich dann Dinge wie: Schaffe ich die Deadline? Habe ich den Müll runtergebracht? Sind Nicolas Sarkozy und Carla Bruni eigentlich noch ein Paar? Gestern lag ich auch wieder hellwach im Dunkeln, aber diesmal war etwas anders. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, kam ein Bild aus meiner Vergangenheit hoch. Ich sah den Spielplatz im Erismannhof, wo ich mir als Kind ständig die Knie aufschürfte, den Idaplatz-Kiosk, wo ich mein erstes Bravo-Heft kaufte, die Küche meiner alten WG, in der es nie Milch, aber immer Rotwein gab.
Mein Herz pochte. Mit jeder Erinnerung fand ich es unglaublicher, dass das alles in meinem Leben passiert sein soll. Zudem fragte ich mich, wie all diese Bilder in meinem Kopf Platz haben. Der ist doch schon vollgestopft mit Informationen. Ich überlegte, dass ich zum Beispiel die Texte aller Britney-Spears-Songs kenne, die Eckdaten der Punischen Kriege (264–146 v. Chr.), die Bedeutung des Wortes »postmodern«, das Werk von Erich Kästner, das Rezept für Apfelkuchen. Als es dämmerte, lag ich immer noch wach, schwitzte und dachte: Wie kommt das Hirn nur mit dieser Masse an Gedanken klar? Dreht man da nicht irgendwann durch?
Vor Schreck setzte ich mich auf, und da musste ich plötzlich an das »Observer’s Paradox« denken. Das ist ein Phänomen, das ich an der Uni kennengelernt hatte, bei dem Forscher*innen zu verzerrten Resultaten kommen, weil sie ein Experiment durch ihr bloßes Beisein beeinflussen.
Der Begriff wurde in den Siebzigern vom Linguisten William Labov geprägt, der erforschen wollte, wie New Yorker in ihrem Alltag sprechen. Sein Dilemma war aber, dass er die Leute aus ethischen Gründen nicht einfach belauschen durfte, sondern sie interviewen musste – was dazu führte, dass sie eben gerade nicht redeten wie am Küchentisch. Er merkte also, wie schwer es ist, die »wahre Natur« gewisser Dinge (wie etwa Sprache) zu ergründen, weil diese nur dann natürlich vonstattengehen, wenn sie nicht beobachtet werden, ein Paradox, das übrigens auch die Experimentalphysik kennt.
Als ich müde die Augen schloss, fühlte ich mich auf einmal erleichtert. Ich war nämlich überzeugt, dass ich in dieser Nacht nur dem »Observer’s Paradox« aufgesessen war. Ich hatte bestimmt nicht die »wahre Natur« meines Hirns entdeckt und musste mir auch keine Sorgen machen, dass es überhitzt. Ich hatte mir nur selbst beim Denken zugeschaut, und das ist immer unheimlich. Das eigentliche Problem war also – wie bei Labov – das Beobachten selbst. Denn hätte ich nicht so genau hingeschaut, wäre mir diese Masse an Gedanken auch nie bedrohlich vorgekommen. Grübeln, so dachte ich, löst leider nicht nur Probleme, sondern schafft auch welche. Kurz vor acht fiel ich jedenfalls in einen tiefen Schlaf.
WORKISM
Manchmal lerne ich ein neues Wort und denke: Wie habe ich je ohne dieses Wort leben können? Gerade ist das »Workism«.
Workism beschreibt nämlich etwas, das mir schon länger Sorgen macht: Es ist der Glaube, dass Arbeit nicht mehr eine Notwendigkeit darstellt, sondern den Kern der eigenen Identität. Geprägt wurde der Begriff vom Journalisten Derek Thompson, der letztes Jahr in der Zeitschrift The Atlantic darüber schrieb, dass immer mehr Leute ihre Erfüllung in der Arbeit suchen. Als ich den Text las, dachte ich nach jedem Satz: Oh, das mache ich auch. Denn genau wie Thompson es beschreibt, bin ich mit dem Ideal aufgewachsen, dass es ein zentrales Ziel im Leben sein soll, einen Job zu finden, der weniger Lohnarbeit ist als vielmehr Selbstverwirklichung. Darum wollte ich Journalistin werden, und darum habe ich heute keine Schreib-, sondern Lebenskrisen, wenn ich im Job versage.
Besonders faszinierend an diesem Artikel fand ich, dass die bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, wie etwa John Maynard Keynes, schon vor achtzig Jahren prophezeiten, dass das Zeitalter der Selbstverwirklichung kommen werde – nur eben ganz anders. Sie glaubten, dass die Automatisierung der Arbeit so viel Freizeit schaffen werde, dass die Menschen ihren Fokus auf Hobbys und Freund*innen verlegen könnten. Aber stattdessen ist bedeutsame Arbeit zum Fetisch geworden, weil einige Workaholics (vor allem im Silicon Valley) ihren Job zu einer »Berufung« hochstilisiert haben.
Laut Thompson wurde so ein Ideal geschaffen, das nun auf allen Ebenen der Gesellschaft zu Burn-outs und Ängsten führt. Denn: Die Gewinner des Systems (Architekt*innen, Startup-Gründer*innen …) arbeiten bis zum Umfallen, während alle anderen als »Verlierer*innen« dastehen, weil sie keinen dieser raren Selbstverwirklichungsjobs ergattern. Aber es gibt auch Gutes am Konzept von Workism. Oder zumindest war ich froh, endlich einen Begriff zu haben, der mir zeigt, bei was für einem Wahnsinn ich da eigentlich mitmache. Das Wort funktioniert wie ein Spiegel für das eigene Tun. Ich fühlte mich bei der Lektüre des Textes ja nur so ertappt, weil ich verstand, was hinter meinem Selbstverwirklichungsdrang steckt.
Also habe ich mir für dieses Jahr etwas vorgenommen. Ich möchte dem Modell von Workism etwas entgegenhalten und die Anteile meiner Identität mehr würdigen, die nichts mit dem Job zu tun haben. Vor allem, wenn ich das nächste Mal verzweifle, weil etwas mit einem Text nicht klappt, will ich mir in Erinnerung rufen, was ich noch bin – außer Journalistin. Und das ist einiges. Ich bin zum Beispiel die mit der besten Großmutter der Welt, ich bin die Grüblerin, die seit fünfzehn Jahren die gleichen Pulp-Platten hört, ich bin die Frau, deren Wohnung aussieht wie eine Altpapiersammlung, ich bin die Freundin, die immer ein bisschen zu fest liebt, und vor allem bin ich das ewige Kind, das vor Freude ausflippt, wenn es eine Katze sieht.
WER IST MEIN VATER?
Ich war eben bei der Polizei. Das Revier befindet sich in einem hässlichen Achtzigerjahre-Gebäude in Zürich. An der Wand hing ein Kalender, der ein verschneites Schweizer Dorf zeigte. Ich sagte: Guten Tag. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier am richtigen Ort bin, aber ich suche meinen Vater. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen und habe keine Ahnung, wie man da vorgeht. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen?
Ich habe meinen Vater nie vermisst. Für mich war dieses Vater-Ding immer etwas Abstraktes. Wie die Milchstraße. Oder ein Kubus. Ich kannte zwar den Begriff, aber für meinen Alltag hatte er keine Bedeutung. Überhaupt erst kapiert, dass bei mir etwas anders war als bei den anderen, habe ich am ersten Tag in der Grundschule. Da war ich sechs Jahre alt, und die anderen Kinder fragten: Wo ist dein Papa? Und als ich sagte, ich hätte keinen, wurden sie mitleidig. Dann schob ich zwei Wochen lang die Krise, weil ich plötzlich überall Papas sah, im König der Löwen-Film, in der Nutella-Werbung. Nur bei mir gab es keinen.
Bei uns zu Hause gab es bloß den jeweils aktuellen Freund meiner Mutter. Aber das waren Männer, keine Papas. Ich dachte gründlich darüber nach, dann hatte ich die Sache für mich zurechtgelegt. Ich erklärte meinen Klassenkamerad*innen: Schaut, mit Papas ist es wie mit Booten (ich glaube, ich meinte Jachten). Wenn du mit einem Boot aufwächst und es dir dann weggenommen wird, bist du traurig, weil etwas fehlt. Aber wenn du nie ein Boot hattest, dann kannst du auch nichts vermissen. Das leuchtete allen ein und die Sache hatte sich vorerst erledigt.
Nun, neunzehn Jahre später, will ich meinen Vater suchen. Warum, weiß ich nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Zeit reif ist. Nur: Wie findet man jemanden, der seit einem Vierteljahrhundert verschollen ist? Was sagt man, wenn man ihn findet? Und ist diese Person dann mein Vater oder ein Unbekannter, der zufällig die Hälfte meiner Gene gestiftet hat?
Ich habe Angst, der Polizist könnte mich für verrückt halten. Vermutlich kommt nicht jeden Tag eine junge Frau vorbei, die ihren Vater verloren hat. Der Beamte erklärt mir aber bloß, dass die Polizei nur nach Kindern und Kriminellen suchen dürfe. Als ich wieder nach draußen trete, beginnt es zu schneien. Ich denke: Das hatte ich mir irgendwie pathetischer vorgestellt.
Die Geschichte erzählt sich gut. Gezeugt wurde ich in einem Hilton-Hotel in Dresden, und eigentlich hätte es mich gar nicht geben sollen. In diesem Sommer nahm meine Mutter, damals zwanzig, die Pille, aber zum Glück hatte sie etwas Falsches gegessen und musste sich übergeben. Mein Vater war ein junger Fotograf, der offenbar ziemlich viel Ecstasy nahm und Haare hatte wie Jesus. Meine Mutter arbeitete in einem Plattenladen und sah aus wie Madonna. Rote Lippen, blonde Mähne, Lederjacke.
Die beiden lernten sich in einem Café kennen, sie hatten eine kurze Affäre, viel Spaß und blöderweise dann auch ein Kind. Also mich. Vor Kurzem erfuhr ich, dass ihr gemeinsamer Song Mysterious Ways war, vom U2-Album Achtung Baby. Als meine Mutter im zweiten Monat schwanger war, ließ sie meinen Vater jedoch sitzen, weil sie die Nase voll hatte von seinen cholerischen Anfällen. Am 3. April 1993 kam ich zur Welt. Als das Gericht meinen Vater aufforderte, Unterhalt zu zahlen, tauchte er unter.
31. Januar 2019: Wenn man »Privatdetektiv Zürich« googelt, erhält man fünfzig Treffer. Ich rufe den erstbesten an und erkläre ihm, dass ich meinen verschollenen Vater suche, aber fast nichts über ihn weiß. Er meint: Wir finden jeden.
Ich habe mir immer vorgestellt, dass mein Vater aussieht wie Damon Albarn, der Sänger der britischen Band Blur. Na ja, eigentlich habe ich mir vorgestellt, dass er mein biologischer Vater ist. Er hat genauso blaue Augen wie ich, diese aschblonden Haare, diese feingliedrigen Hände. Jahrelang hing ein Blur-Poster an unserem Kühlschrank. Nichts ergab in meinem Kopf so viel Sinn, wie dass Albarn mein Vater ist. Vermutlich wollte ich einfach einen berühmten Vater.
5. Februar: Der Detektiv trägt Glatze und Apple Watch, sein Büro ist steril wie eine Zahnarztpraxis. Ich überreiche ihm die Gerichtsakten von 1993 und erkläre ihm, dass ich wirklich nichts wisse, außer dass mein Vater ursprünglich aus einem englischsprachigen Land kam und in den Neunzigern in Europa gestrandet war. Er sagt, er werde nun mit »diversen Partnern im Ausland kooperieren«. Was das heißt, will er nicht verraten. Er werde sich aber mit einem Kostenvoranschlag melden. Zum Abschied überreicht er mir seine edle Visitenkarte.
Ich habe nur zwei Dinge von meinem Vater: ein Foto, das er von meiner Mutter schoss, als sie schwanger war, und eine Schatulle aus Leder, in der ich Akku-Ladekabel aufbewahre, von denen ich nicht mehr weiß, zu welchem Gerät sie gehören. Sonst habe ich nichts, was seine Existenz belegt. Er ist ein Phantom.
Fast immer wenn ich Leuten erzähle, dass ich meinen Vater noch nie in meinem Leben gesehen habe, führe ich anschließend die gleiche Unterhaltung.
Das Gegenüber fragt: »Also noch gar nie?«
Und ich sage: »Nein, ich weiß nicht einmal, wie er aussieht.«
»Was? Du hast nicht mal ein Foto gesehen?«
»Nein«, sage ich, »das möchte ich auch nicht. Ich wollte immer, dass mein Vater ein Abstraktum bleibt. Ich wollte nie eine Projektionsfläche für irgendwelche Ansprüche oder Wünsche.«
»Aber es interessiert dich doch sicher, wie er aussieht!«
»Na ja. Es gibt so etwas wie eine biologische Neugierde. Ich möchte wissen, wer mir seine Gene vererbt hat. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich nur meine Mutter. Wir reden gleich, wir lachen gleich. Aber ich bin viel zierlicher gebaut, und meine Haare haben diesen Rotstich. Woher?«
26. Februar: Der Detektiv hat mir sein Angebot geschickt. Er rechnet mit Kosten in Höhe von 9000 Franken. Ich sitze betrübt vor dem Laptop und denke: Vielleicht sollte ich doch meine eigene Recherche starten?
3. März: Das Mysteriöse ist: Im Internet findet man nichts über meinen Vater. Ich habe ihn in meinem Leben bestimmt schon dreihundert Mal gegoogelt. Es gibt nur einen Wissenschaftler und einen Unterwasser-Fotografen mit seinem Namen, doch die sind beide zu alt. Und das Problem mit den sozialen Medien ist, dass ich nicht weiß, wonach ich suche. Ich scrolle mich immer wieder durch Facebook-Seiten und grüble: Ist das meine Nase? Hat der meinen Teint? Sind das meine Halbgeschwister?
4. März: Seit ich angefangen habe zu recherchieren, bin ich besessen von Zahlen. Was ich weiß: Mein Vater kam Mitte der Sechzigerjahre auf die Welt. Wie Janet Jackson, Kiefer Sutherland und David Cameron. In den Gerichtsakten steht, er hätte mir bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr monatlich 690 Franken zahlen sollen, dann bis zum zwölften 750 und 820 bis zur Mündigkeit. Er hat sich also um 162720 Franken gedrückt. Das Geld könnte mir nicht egaler sein. Was mich beschäftigt, ist: Wie kann man ein Kind in die Welt setzen und dann nicht vor Neugierde platzen, was aus ihm geworden ist? Ich würde sterben vor Kummer.
Das frechste Vorurteil, dem ich immer wieder begegne, ist das mit dem »Vaterkomplex«. Wenn Leute erfahren, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, mutmaßen sie manchmal, dass ich dann wohl in allen Männern einen Ersatz-Papa suche. Das fand ich immer abstrus, denn der größte Knacks in dieser Hinsicht ist eher meine Verwunderung über Männerkörper. Da ich nur mit Frauen aufgewachsen bin, sind sie mir fremd. Ich finde sie nicht bedrohlich oder so. Nur ulkig. Als Vierjährige lief ich zum Beispiel einmal ins Bad, als der Freund meiner Mutter duschte, und schrie überrascht: »Männerpopos sind so kindisch!«
5. März: Ich sitze am Küchentisch und beobachte, wie die Spatzen im Innenhof auf den Mülltonnen herumhüpfen, als mir zum ersten Mal klar wird, dass das klappen könnte. Bis hierhin war diese Suche bloß eine Spielerei gewesen. Doch heute ist etwas passiert, was alles ändern könnte. Ich saß wie schon so oft in den letzten Wochen zu Hause und gab alle möglichen Wortkombinationen mit dem Namen meines Vaters in die Suchmaschine ein, als mit der Präzisierung einer größeren deutschen Stadt plötzlich ein Blog-Eintrag über eine Asylkonferenz erschien. Eine Person mit seinem Namen hatte die Fotos gemacht. Finde ich meinen verschollenen Vater tatsächlich durch einen Google-Zufall?
6. März: Auf eine Art fühlen sich die letzten Stunden bedeutsam an, wie etwas, woran ich mich immer erinnern werde, und gleichzeitig unbeschreiblich öde. Ich schrieb der Organisation, ob ich die Kontaktdaten des Fotografen haben könne. Sie fragten zurück, ob der Fotograf denn wisse, wer ich sei, und da ich nicht wusste, wie ich das sonst erklären sollte, sagte ich die Wahrheit: Vielleicht sei ich seine Tochter. Dann rief mich ein nervöser Herr an, der meinte, er dürfe die entsprechende Mailadresse aus »datenschutzrechtlichen Gründen« nicht herausgeben, er werde aber gern meine weiterleiten. Nun heißt es: warten.
Ich dachte oft, es sei etwas falsch mit mir, weil ich keine größere Trauer darüber empfand, keinen Vater zu haben. Immer wenn ich einer neuen Bekanntschaft davon erzählte, reagierte er oder sie so, als hätte ich gerade mein Darmkrebs-Leiden offenbart. Das erzeugte eine kognitive Dissonanz in meinem Kopf, weil zwei Töne aufeinanderprallten. Die gesellschaftliche Erwartung, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen, und mein tatsächliches Empfinden der Lage. Die Erwartung: Du bist ein armes Geschöpf. Mein Erleben: Ich dachte nicht mal groß über meinen Vater nach, da ich eine Großmutter hatte, die mir heimlich Barbies mit Glitzerflügeln kaufte und mir zeigte, wie man richtig guten Apfelkuchen backt.
7. März: Heute stand ich unter der Dusche, als mich zum ersten Mal die Angst packte: Was ist, wenn ich meinen Vater einfach einmal sehen möchte – und er eine Beziehung will? Was ist, wenn wir komplett andere Bedürfnisse haben? Und überhaupt: Bin ich ready dafür? Wenn ich an ihn denke, werde ich schon wehmütig, aber nicht nach ihm, sondern nach den Neunzigerjahren. Es ist ja so, dass ziemlich viele meiner Freund*innen an dieser Nineties-Nostalgie kranken, da die Gegenwart mit ihrem Detox-Kram so langweilig sein kann. Die Vorstellung, dass mein Vater damals ein verruchter Party-Schönling war, ist aufregend. Ich erzähle das manchmal, um mir eine Geschichte zu geben. Aber will ich diesen Menschen wirklich kennenlernen? Ist die Fantasie nicht immer besser?
8. März: Der heutige Tag war absurd, und zwar nicht auf eine zurückhaltende Art. Nach dem Aufwachen holte ich das iPhone von der Steckdose, und da leuchtete eine Mail meines Vaters. Der Name in Kleinbuchstaben, als wollte er sich nicht aufdrängen. Ich sagte zu meinem Freund: »Ich habe eine Mail von meinem Vater erhalten.« Er schreckte aus dem Halbschlaf hoch und starrte mich an. Wir wussten nicht, was sagen. Ich ließ mich lange umarmen. Dann gingen wir in die Küche und aßen Pumpernickel mit Peanutbutter. Da war sie also, die Mail, zwölf kurze Zeilen. Sie handeln von seiner Sprachlosigkeit und seiner Freude. Er meint, er habe 25 Jahre darauf gewartet, ein Bild von mir zu sehen. Die Message ist etwas vage, aber genau diese Ungeschliffenheit finde ich sympathisch.
9. März: Gestern blieb ich noch lange am Küchentisch sitzen und dachte: Schon krass. Und lachte innerlich, wie banal das ist, diese E-Mail. Diese Zeilen. Ich war glücklich, doch eine Sache machte mich stutzig. Warum hat er 25 Jahre gewartet? Meine Mailadresse steht doch überall im Netz. Es wäre ein Leichtes gewesen, mich zu finden. Kurz füllten sich meine Augen mit Tränen.
10. März: Mein Vater und ich schreiben uns nun E-Mails. Bisher geht es um seine Kindheit und seinen Drogenmissbrauch. Seine Offenheit überrumpelt mich etwas. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es der Inhalt der Nachrichten ist oder vielmehr die Tatsache, dass nun irgendwo auf der Welt der Mensch, der mich gezeugt hat, hinter seinem Rechner sitzt (wo, weiß ich immer noch nicht) und mir schreibt. Mein Hirn sträubt sich, diesen Gedanken anzunehmen, denn es ist paradox. Einerseits ist mir diese Person verflucht nah. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes mein Vater. Und gleichzeitig hat sie nichts mit mir zu tun.
11. März: Ich warte, dass ein überwältigendes Gefühl hochkommt. Ich habe mich ja immer damit gerühmt, wie wenig mir diese Vatergeschichte ausmacht, wie locker ich diese Anekdoten erzählen kann. Manchmal machte es mir sogar Spaß, Leute mit meiner Nonchalance zu schocken. Und nun habe ich Angst, dass sich das rächt. Ich schaue mir eine Folge der ARD-Serie Charité nach der anderen an, um mich abzulenken. Aber da kommt nichts. Kein verstecktes Trauma, keine Panik. Vielleicht muss ich mich damit abfinden, dass dieser Kontakt gar nicht so viel auslöst, wie ich immer gedacht hatte. Vielleicht habe ich einfach zu viele Hollywoodfilme geschaut und bin nun irritiert, dass es »in echt« auch andere Narrative gibt als Drama.





























