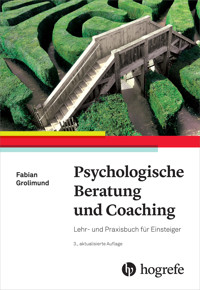Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Gefühle unserer Kinder verstehen, annehmen und liebevoll begleiten. Wir alle möchten, dass sich unsere Kinder in der Beziehung zu uns sicher, geborgen und geliebt fühlen: - So sicher, dass sie sich mit all ihren Gefühlen, Wut, Angst, Scham und Traurigkeit, zeigen können und wissen, dass sie mit ihren Problemen immer zu uns kommen dürfen. - So geborgen, dass sie sich auch mit ihren Schwächen von uns angenommen fühlen. - So geliebt, dass sie sich frei entfalten können und nicht am Erwartungsdruck von außen zerbrechen.Aber oft scheitern wir als Eltern an der Realität. Unsere Kinder können uns mit ihren emotionalen Ausbrüchen überfordern und uns mit ihrem Verhalten zur Weißglut treiben. Sie drücken unsere Knöpfe, wühlen in alten Wunden und schon fahren unsere Gefühle Achterbahn: Plötzlich reagiert man unverhältnismäßig stark, wird laut und patzig, droht und schmollt, ist auf einmal so tief verletzt, verzweifelt oder hilflos. Hinterher tut es einem leid, man schämt sich und versteht nicht, wie man wieder einmal so aus der Haut fahren konnte. Niemandem gelingt es immer, gelassen und einfühlsam zu reagieren. Aber wir können uns mit unseren Kindern auf den Weg machen: Gemeinsam können wir lernen, unsere Gefühle besser zu verstehen, sie anzunehmen und konstruktiv auszudrücken. An manchen Tagen gelingt uns das besser, an anderen schlechter. Wichtig ist, dass unsere Kinder merken, dass wir uns immer wieder darum bemühen. Dabei will dich dieses Buch begleiten: Mit vielen konkreten Alltagsbeispielen, Übungen und Impulsen für herausfordernde Situationen. Mit vielen liebevollen Illustrationen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fabian Grolimund | Stefanie Rietzler
Ich liebe dich, so wie du bist
Die Gefühle unserer Kinder verstehen, annehmen und liebevoll begleiten
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Markus Lefrançois, Kassel
Umschlagmotiv: © mauritius images / Maskot
Illustrationen: René Amthor, www.studio-vieleck.de
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN Print: 978-3-451-60211-5
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-83111-9
Inhalt
Liebe Mutter, lieber Vater,
Kinder bedingungslos lieben
Wenn Kinder in alten Wunden wühlen
Wut, Angst und Trauer haben keinen Ausschaltknopf
Eine Liebeserklärung an die Wut
Achtung: versteckte Wutverstärker!
Mein Kind tickt aus: Was kann ich tun?
»Du gehst jetzt raus, bis du dich wieder beruhigt hast!« – wie sinnvoll sind Auszeiten?
»Und wo bleiben Grenzen, Regeln und Respekt?«
Peinlich, peinlich: Wenn uns die Scham überrollt
Ängste: Was wirklich hilft
Du bist mehr als deine Leistung
»Ich mache mir doch nur Sorgen um dich!«
Umgang mit Stress und Sorgen: eine Frage des persönlichen Stils?
»Mein Kind ist anders – wie gehe ich damit um?«
Wie begleiten wir Kinder durch die Trauer?
Wenn Eltern sich trennen
Druck, Frust und schlechte Noten: Was dein Kind von dir braucht, wenn es in der Schule schwierig wird
Aus Fehlern wird man klug?
Von fehlerschnüffelnden Nasenbären, Motzkühen und Hibbelhunden
Herausfordernde Zeiten als Familie meistern
Auch deine Bedürfnisse zählen!
Was sich unsere Kinder von uns wünschen
Literatur
Über die Autoren
Der Illustrator
Liebe Mutter, lieber Vater,
eines der schönsten Geschenke, das wir unseren Kinder machen können, ist, sie so zu lieben, wie sie sind. Niemandem von uns gelingt das immer. Aber je öfter unsere Kinder diese Erfahrung machen dürfen, desto mehr können sie zu sich »ja« sagen und sich selbst annehmen.
Dürfen wir dich zu Beginn dieses Buches zu einer kurzen Übung einladen?
Denke an deine engsten Bezugspersonen aus deiner Kindheit: Eltern, Großeltern, Lehrkräfte – an Menschen, die dich geprägt haben.
Frage dich:
Welche Erwartungen habe ich von wem gespürt?
Welche davon konnte ich erfüllen, welche nicht?
Welchen versuche ich heute noch zu entsprechen?
Welche Gefühle durfte ich als Kind ausdrücken, welche nicht?
Wie musste ich sein und was musste ich tun, um Liebe und Anerkennung zu erhalten? Und wie beeinflusst mich das in der Gegenwart?
Es ist erstaunlich, wie oft es in Coachings, Beratungen und Therapien um diese Fragen geht. So viele Menschen können eigene Persönlichkeitsanteile nicht annehmen, haben Schwierigkeiten, das zu akzeptieren, was an ihnen zurückgewiesen wurde. Sie tragen die Überzeugung mit sich herum, nicht gut genug zu sein.
Zu deutlich haben sie gespürt, dass sie für ihre Eltern, Lehrkräfte, aber auch Gleichaltrige zu laut, zu schüchtern, zu anstrengend, zu empfindlich, zu faul, zu ehrgeizig, zu unsportlich, zu dick oder zu uncool waren. Einige haben erlebt, dass sie für ihre Eltern etwas Besonderes sein müssen: die beste Schülerin, ein Spitzensportler – und man die Aufmerksamkeit der Eltern vor allem dann bekommt, wenn man aus der Masse herausragt. Manche fühlten sich nicht angenommen, weil sie nicht das ersehnte Geschlecht hatten, dem gängigen Rollenbild eines »echten Jungen« oder eines »richtigen Mädchens« nicht entsprachen, den religiösen Überzeugungen der Eltern nicht folgen wollten oder vom Charakter her dem Expartner schmerzlich ähnelten, den die Mutter oder der Vater verteufelte. Einige hatten erlebt, dass ihre Eltern immer wieder davon sprachen, wie viel sie für die Kinder geopfert hatten, wie anstrengend die Vater- oder Mutterschaft für sie ist – und man dieses Opfer als Kind nur durch ganz viel Dankbarkeit und Bravsein aufwiegen kann.
Mit diesem Buch möchten wir es Eltern ein wenig erleichtern, sich selbst und ihre Kinder so anzunehmen, wie sie sind. Dieser Wunsch zieht sich durch fast alle unsere Artikel, die wir in den letzten Jahren für DasSchweizer ElternMagazin Fritz + Fränzi schreiben durften und die du in diesem Buch in gesammelter und erweiterter Form wiederfindest.
Fühl dich eingeladen, die folgenden Texte auf dich wirken zu lassen und einzelne Übungen auszuwählen, die dich ansprechen. Oft ist es hilfreicher, wenn man in einem Ratgeber nur eine einzige wirksame Übung findet und verinnerlicht, die gut zu einem passt, anstatt zu versuchen, ein ganzes Programm »abzuarbeiten«.
Du wirst im Laufe dieses Buches auf viele Fallbeispiele stoßen. Einige davon stammen aus Coachings und Beratungen, die wir durchgeführt haben. Sie wurden so weit zusammengefasst, anonymisiert und verfremdet, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Andere Familien haben uns nicht nur einen Einblick in ihren Alltag gegeben, sondern uns auch erlaubt, ihre Erfahrungen als schriftliches Interview, Podcast oder Video mit dir zu teilen. Davon findest du Ausschnitte im Buch und jeweils eine ausführliche Fassung auf unserer Seite: www.elternliebe.ch
Bist du bereit für unsere gemeinsame Reise? Dann los!
Herzlich,
Stefanie und Fabian
Kinder bedingungslos lieben
Die Überzeugung, dass wir unsere Kinder möglichst bedingungslos lieben und annehmen sollten, ist relativ neu und sorgt für hitzige Diskussionen.
Manche Eltern vertreten den Standpunkt, dass damit jegliche Führung verloren ginge und sich die Kinder zu unsäglichen Tyrannen entwickeln würden. Das klingt dann oft so: »Ja schön und gut – aber soll ich etwa alles gutheißen, was mein Kind tut, und ihm alles durchgehen lassen? Und was, wenn es stiehlt, andere mobbt oder auf der faulen Haut liegt?«
Für andere Mütter und Väter ist bedingungslose Liebe das Allheilmittel schlechthin, der Weg zu einer besseren und friedlicheren Menschheit. Sie sehen sie als Grundvoraussetzung, damit sich Kinder überhaupt positiv entwickeln können. Manchmal gipfelt dies in einer problematischen Ideologie: dann werden alle Probleme in anderen Familien auf die scheinbar mangelnde Liebe zurückgeführt. Oder man verurteilt und greift Eltern an, weil sie das Elternsein auch mal anstrengend finden, mit bestimmten Eigenschaften ihres Kindes hadern oder sich gewisser Erziehungspraktiken bedienen wie Konsequenzen, Belohnungen oder Lob.
Doch was ist bedingungslose Liebe?
Das Konzept geht auf den US-amerikanischen Psychotherapeuten Carl Rogers zurück. Dieser begründete in den 1960er-Jahren die Gesprächspsychotherapie und formulierte drei Bedingungen, die in Beziehungen gegeben sein sollten, damit sich Menschen entfalten können: Bedingungslose Wärme und Wertschätzung, Echtheit sowie Empathie.
Als Humanist ging er davon aus, dass wir alle autonom und frei sind, dass wir wachsen, uns weiterentwickeln und verwirklichen möchten. Damit uns dies gelingt, benötigen wir andere Menschen, die sich in uns einfühlen, die Welt ein Stück weit aus unserer Sicht wahrnehmen, uns mit Wärme und Verständnis begegnen und dabei authentisch bleiben. Von solchen Erwachsenen lernen Kinder, Zugang zu den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen zu finden und zu entdecken, wer sie sind und was ihnen wichtig ist. Bleiben die Bezugspersonen auch bei unangenehmen Empfindungen zugewandt, wird es den Kindern leichterfallen, sich selbst und ihre Gefühlswelt anzunehmen.
Das Gegenteil einer bedingungslosen Liebe wäre eine an Bedingungen geknüpfte Liebe: Ich liebe dich nur, wenn du so bist und dich so verhältst, wie ich das will. Dabei müssen wir uns die Zuneigung unseres Gegenübers verdienen, indem wir uns an seine Vorstellungen anpassen und zur Not bestimmte Anteile unserer Persönlichkeit verleugnen. Das kann in der Folge zur Empfindung führen, nicht richtig oder nicht gut genug zu sein und ständig an sich arbeiten zu müssen, um von anderen akzeptiert zu werden.
Ist es möglich, bedingungslos zu lieben?
Die meisten von uns möchten ihren Kindern bedingungslose Liebe schenken. Das ist in engen Beziehungen jedoch schwierig und wird uns nie vollständig gelingen – und das muss es auch nicht. Carl Rogers definierte sein Konzept für die Therapiebeziehung. Dort ist es einfacher, bedingungslos wertschätzend zu bleiben, weil die Bedürfnisse und das Verhalten der Hilfesuchenden das Leben der Beratenden nicht betreffen. Um es plastisch auszudrücken: Der Satz »Ich bin fremdgegangen« hat eine ganz andere Wirkung, je nachdem, ob ihn eine Klientin oder der eigene Partner äußert.
Als Eltern haben wir Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen an und für unsere Kinder. Wir alle freuen uns, wenn unser Kind sich anderen gegenüber hilfsbereit zeigt, dem kleinen Geschwister liebevoll begegnet, im Spiel versinkt und sich auch einmal alleine beschäftigen kann, gerne zur Schule geht und sich für vieles interessiert. Und für viele von uns wäre es schwierig, wenn sich das eigene Kind aggressiv und gemein verhält, andere auslacht, das kleine Geschwister vor lauter Eifersucht heimlich quält, desinteressiert und passiv wirkt und nichts mit sich anzufangen weiß.
Bedingungslose Liebe bedeutet nicht, dass wir sämtliche unangenehmen Gefühle in uns unterdrücken müssten, nie enttäuscht, verärgert oder beschämt über das Verhalten des Kindes sein dürfen. Es bedeutet auch nicht, alles zuzulassen. Vielmehr zeigt sich bedingungslose Liebe darin, dass wir auch in solchen Situationen interessiert und zugewandt bleiben und wissen möchten, weshalb sich unser Kind so fühlt und verhält.
Maggie erzählt:
Als unser Sohn geboren wurde, war die Ältere wie ausgewechselt. Alina war bis dahin so ein zufriedenes, fröhliches und hilfsbereites Kind! Aber sobald ich mit dem Kleinen nach Hause kam, ging das Drama los. Sie war so eifersüchtig und wollte ihren Bruder am liebsten »zurückgeben«. Ich konnte sie keine Minute mit dem Säugling alleine lassen: Ich hatte echt Angst, dass sie ihm etwas antut. Ein paar Mal habe ich sie erwischt, wie sie ihn richtig fest gezwickt oder gehauen hat, wenn sie dachte, ich merke es nicht. Ich musste ständig gegen meine Gefühle ankämpfen! Aber manchmal kam ich einfach an meine Grenzen. Ein paar Mal war ich so sauer, dass ich meinen Sohn demonstrativ auf den Arm genommen und die Größere ignoriert habe, sogar als sie geweint und um Aufmerksamkeit gebettelt hat.
Wie gelingt es uns, in solchen Momenten zugewandt zu bleiben?
Der Schlüssel zu bedingungsloser Liebe ist Empathie: sie ermöglicht es uns, uns wieder mit dem Kind zu verbinden. Nicht, weil man alles gutheißen würde, was geschieht, sondern weil wir wissen wollen, welche Bedürfnisse und Gefühle hinter diesem herausfordernden Verhalten stecken.
Beginne bei dir
Wenn es uns nicht gelingt, unser Kind anzunehmen, wenn wir es trotz guter Vorsätze ausgeschimpft, unter Druck gesetzt, abgewertet, bestraft oder ihm zumindest mit Konsequenzen gedroht haben, ist das schlechte Gewissen nicht weit.
In diesen Situationen können wir bei uns beginnen und lernen, uns selbst Empathie und unbedingte Wertschätzung entgegenzubringen.
Anstatt uns Vorwürfe zu machen und uns als schlechte Mutter oder unfähigen Vater zu verurteilen, können wir uns selbst mit mehr Verständnis begegnen:
»Wenn ich unter Zeitdruck und gestresst bin, dann ärgere ich mich sehr, wenn mein Kind so lange braucht, bis es angezogen ist. Manchmal lasse ich mich dann zu Äußerungen hinreißen, die ich hinterher bereue.«
»Ich habe es mir so schön und harmonisch vorgestellt, wenn das zweite Kind da ist, und darauf gehofft, dass sich Alina auf ihr Geschwisterchen freut. Aber jetzt ist sie so eifersüchtig! Ich bin richtig enttäuscht.«
»Ich war heute oft wütend und habe viel geschimpft. Ich fühle mich im Moment überfordert und alleine gelassen.«
»Ich hätte nicht gleich den Teufel an die Wand malen müssen, als Carlo mir diese schlechte Deutschnote gezeigt hat. Ich glaube, ich habe einfach Angst bekommen und mir so viele Sorgen um seine Zukunft gemacht. Deswegen habe ich so heftig reagiert.«
Mit der Zeit bemerken wir immer schneller, welche eigenen Gefühle, Sorgen, manchmal auch Verletzungen aus der Kindheit hinter unseren Reaktionen stecken. Wir registrieren öfter, wo wir überreagieren und wo es hilfreicher wäre, eigene Erwartungen zu hinterfragen, anstatt vom Kind einzufordern, dass es sich anpasst.
Damit uns die Forderung nach bedingungsloser Liebe nicht unter Druck setzt, dürfen wir sie als Geschenk sehen, das wir unseren Kindern immer wieder machen können. An manchen Tagen gelingt uns das besser, an anderen schlechter. Wichtig ist, dass unsere Kinder merken, dass wir uns immer wieder darum bemühen.
Übung: Nimm das Beste an!
Wir möchten dir an dieser Stelle eine kleine, aber wirksame Übung vorstellen. Sie hilft dir dabei, dich mit deinem Kind zu verbinden und auch in anspruchsvollen Situationen mit ihm in Beziehung zu bleiben. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass wir dann besonders wütend oder enttäuscht auf unsere Kinder reagieren, wenn wir ihnen negative oder böswillige Absichten unterstellen.
Unser Kind hat einen Wutanfall und wir denken – weil wir selbst gestresst sind –, dass es uns damit provozieren oder einen Machtkampf ausfechten will. Es trödelt morgens und wir unterstellen ihm, dass es sich »querstellt« und uns auf die Palme bringen möchte. Es mäkelt am Essen herum und wir denken: »Wie verwöhnt und undankbar! Ich stehe eine Stunde in der Küche und achte auf eine gesunde Ernährung und das ist nun der Dank?!«
Es ist ganz normal, dass sich solche Gedanken aufdrängen, wenn uns der Gefühlsstrudel der Kinder mitreißt.
Rückwirkend, wenn wir ruhiger und entspannter sind, kann es uns aber gelingen, solche Situationen anders zu betrachten. Dazu setzen wir eine andere Brille auf und gehen – versuchsweise – davon aus, dass unser Kind nicht böswillig handelt, sondern es einen guten Grund für sein Verhalten gibt. Vielleicht wurde ein wichtiges Grundbedürfnis des Kindes übergangen oder frustriert? Möglicherweise war es müde oder hungrig und deswegen so gereizt?
Alinas Mutter machte sich die folgenden Gedanken über die Eifersucht ihrer Tochter:
Ich bin ziemlich enttäuscht, dass Alina so eifersüchtig ist. Aber ehrlicherweise habe ich jetzt viel weniger Zeit für sie und sie muss oft warten. Wahrscheinlich hat sie wirklich Angst, dass ich sie nun nicht mehr so sehr liebe oder mir ihr kleiner Bruder wichtiger ist. Ich bin tatsächlich ungeduldiger mit ihr und schimpfe häufiger. Bestimmt sehnt sie sich zurück nach der Zeit, in der sie mich ganz für sich allein hatte.
Diese Übung kann uns auf drei verschiedene Arten dabei unterstützen, unseren Kindern näherzukommen:
Vielleicht sprechen wir im Nachhinein mit unserem Kind und teilen ihm unsere Überlegungen mit. Kindern tut es oft auch hinterher gut, wenn sie merken, dass ihre Eltern nun besser verstehen, wie sie sich in der entsprechenden Situation gefühlt haben. Häufig hegen Kinder einen unausgesprochenen Groll, wenn sie sich nicht verstanden fühlen und können diesen loslassen, wenn man als Elternteil darauf zurückkommt.
Situationen wiederholen sich. Alinas Mutter gelang es durch die Übung in der darauffolgenden Zeit besser, die Bedürfnisse ihrer Tochter im Blick zu behalten, wenn diese eifersüchtig war. Anstatt sich über sie zu ärgern und sie wegzuschicken oder mit ihr zu schimpfen, umarmte sie sie und zeigte ihr dadurch, dass sie ihr wichtig ist und es genug Liebe für beide Kinder gibt. Sie flüsterte ihr zu: »Das ist gerade nicht so einfach für dich.«
Kennen wir den Grund für das Verhalten unseres Kindes, können wir über Lösungen nachdenken. Alinas Mutter fiel auf, dass sich ihre Tochter oft verloren fühlte, wenn sie sich um das Baby kümmerte. Also ließ sie Alina beim Wickeln helfen, den Kinderwagen schieben und machte sie zur Kleiderchefin, die bestimmen darf, was das Baby am nächsten Tag anziehen soll. Sie sagte öfter: »Dein kleiner Bruder hat großes Glück, dass er so eine tolle Schwester hat« oder »Schau mal, wie er dich anlächelt. Er hat dich sehr lieb«. Alina fühlte sich von Tag zu Tag wohler in ihrer neuen Rolle als große Schwester – und ihre Mutter achtete darauf, dass auch die Große oft genug »klein sein« durfte.
Jetzt bist du dran!
Schreibe hier eine Situation auf, in der du deinem Kind gegenüber ablehnende Gefühle hattest:
Versuche dich nun in dein Kind einzufühlen und suche nach dem »guten Grund« für sein Handeln: Welche Grundbedürfnisse deines Kindes wurden in dieser Situation eventuell frustriert (mehr dazu erfährst du im nächsten Kapitel)? Wonach hat es sich in diesem Moment wohl gesehnt?
Falls du einen »guten Grund« gefunden hast: Wie möchtest du darauf eingehen? Willst du mit deinem Kind darüber sprechen? In einer zukünftigen Situation anders reagieren? Und was genau könntest du sagen und tun?
Wenn Kinder in alten Wunden wühlen
Freundlich sein, aber bestimmt. Zugewandte, liebevolle, einfühlsame Eltern sein. Nicht nörgeln. Nicht schimpfen. Nicht drohen. Nicht laut werden. Nie mehr die Nerven verlieren! Stattdessen mal ruhig bleiben. Ja, Gelassenheit ist das Zauberwort! Durchatmen, das liest man doch überall, das beruhigt. Aber egal, was ich mir von all dem vorgenommen habe: Manchmal kann ich nicht anders. Da drücken die Kinder meine Knöpfe, und »zack!«, wirft es mich mal wieder aus der Bahn. Dann reagiere ich über, werde grob, schreie herum, bin patzig, drohe, strafe, schmolle, bin plötzlich so verletzt, so verzweifelt und hilflos, könnte heulen. Später tut es mir dann leid und ich schäme mich, ich wollte es doch anders machen. Wieso kriege ich das nicht hin?
Findest du dich in diesen Aussagen wieder, die wir in unserer Arbeit immer wieder von Eltern hören? Ja? Dann lass uns gemeinsam erkunden, warum es manchmal so schwer sein kann, besonnen zu reagieren.
So viel vorweg: Natürlich sind wir alle nur Menschen. Der Tag war lang, die To-do-Liste auch, man ist müde, hat sich schon den ganzen Tag zusammengerissen und dann kommt der Moment – die zankenden Geschwister am Esstisch, die Weigerung, ins Bett zu gehen –, der das Fass zum Überlaufen bringt. »Ego depletion« oder »Ich-Erschöpfung« nennt der Sozialpsychologe Roy Baumeister (2000) dieses Phänomen, die Erschöpfung unserer Willenskraft nach vielen anstrengenden Aufgaben.
Darüber hinaus gibt es Situationen, in denen nicht nur die Alltagserschöpfung den Ausschlag gibt, sondern Wunden aus der eigenen Kindheit.
Warum verliert man die Nerven?
»Die emotionalen Zustände unserer Kindheit und Jugend sind wie schlafende Quälgeister, die bestimmte Reize oder Situationen wachrütteln und deren Treiben wir dann hilflos ausgeliefert sind«, schreibt die Psychotherapeutin Gitta Jacob in ihrem Buch Raus aus Schema F (2020).
Wie ist das bei dir? In welchen Momenten reagierst du übermäßig emotional, werden deine Knöpfe gedrückt? Was haben diese gemeinsam? Und welche Gedanken gehen dir dann durch den Kopf?
Andrea erzählt:
Mir ist bewusst geworden, dass ich immer dann die Nerven verliere, wenn ich den Eindruck habe, von meinen Kindern ignoriert zu werden. Beim letzten Mal saß ich mit unserer 14-jährigen Tochter im Wohnzimmer und wollte mich mit ihr unterhalten. Sie tippte aber ständig auf ihrem Handy herum und blickte kaum vom Bildschirm auf. Mein Mann kann gut darüber hinwegsehen, sagt, sie ist halt in der Pubertät und es ist normal, dass sie nicht mehr so viel erzählt, aber ich kann das nicht so sehen: Ich sitze dann da und komme mir so blöd vor, bin plötzlich verletzt, traurig und einsam, obwohl unsere anderen Kinder im selben Raum sind. Und dann rede ich den ganzen Tag kein Wort mehr mit meiner Tochter, vielleicht auch, um sie spüren zu lassen, wie das ist. Total unreif, ich weiß. Aber das erweckt bei mir einfach diesen Eindruck: Ich werde nicht gehört! Was du willst, zählt nicht! Du bist nicht wichtig! Du fällst zur Last!
Bei näherer Betrachtung wird klar, dass sich solche Glaubenssätze schon früh eingebrannt haben. Glaubenssätze sind tief in uns wurzelnde Überzeugungen über uns selbst, die Welt und unsere Beziehungen, die wir im Laufe unserer Kindheit aufbauen.
Sie speisen sich aus der Art und Weise, wie unsere wichtigsten Bezugspersonen mit uns und unseren Bedürfnissen umgegangen sind. Diese Prägungen wirken in uns fort – und beeinflussen wiederum, wie wir auf unsere eigenen Kinder zugehen. Je besser wir unsere Kindheitsprägungen verstehen und uns aktiv mit ihnen auseinandersetzen, desto freier und unbeschwerter werden wir – und desto eher können wir die Eltern sein, die wir gerne sein möchten (siehe dazu auch Stahl & Tomuschat, 2018).
Auf diesem Weg hilft uns zunächst ein Blick auf unsere psychischen Grundbedürfnisse, die als innerer Motor wirken – und die Frage, inwiefern unsere Eltern diesen Rechnung tragen konnten (in Anlehnung an Grawe, 2000).
Überlege dir:
Bindung:Inwiefern habe ich mich von meinen wichtigsten Bezugspersonen geliebt und bei ihnen geborgen gefühlt?
Wir alle möchten von Anfang an Nähe zu unseren Eltern herstellen. Babys schmiegen sich an, lächeln oder brabbeln, wenn man sich über sie beugt, oder strecken ihre Ärmchen aus. Später versuchen wir aktiv, gute Beziehungen zu Verwandten, dem Freundeskreis, zu Partnerinnen und Partnern und den eigenen Kindern herzustellen. Gelingt uns dies, empfinden wir Liebe, Zuneigung, Verbundenheit und Freude. Im Gegenzug kann die Vorstellung, dass wir einen geliebten Menschen verlieren könnten, Ängste und Sorgen auslösen. Spannungen und Streit in Beziehungen empfinden wir als belastend.
Kompetenz und Selbstwirksamkeit:Inwiefern durfte ich erleben, dass ich etwas kann, Ziele erreiche und durch meine Bemühungen etwas bewirken kann?
Neben verlässlichen Bindungen streben wir ein Gefühl von Selbstwirksamkeit an. Wir möchten erleben, dass unsere Handlungen etwas bewirken und wir unser Leben aktiv gestalten können. Wenn wir merken, dass uns wichtige Fähigkeiten fehlen oder wir kein Gehör finden, fühlen wir uns frustriert oder wütend und werden mit der Zeit ohnmächtig und deprimiert.
Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz:Inwiefern habe ich genügend Anerkennung und Wertschätzung erfahren? Wurde ich oft abgewertet und beschämt?
Wir alle möchten als Mensch mit unseren Stärken und Schwächen gesehen und geschätzt werden und leiden, wenn uns geliebte Personen abwerten, bloßstellen oder geringschätzen.
Autonomie:Inwiefern durfte ich im Familienalltag mitentscheiden und eigene Wege gehen? Wie stark wurde erwartet, dass man sich fügt?
Es ist in uns angelegt, unseren eigenen Kopf zu entwickeln. Schon Kleinkinder lernen, »Nein!« zu sagen, oder möchten sich »alleine!« anziehen. Je älter Kinder und Jugendliche werden, desto stärker wollen sie ihr Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten, und fordern, bei Entscheidungen mitreden zu dürfen. Fühlen wir uns in unserer Autonomie beschnitten, von anderen kontrolliert und eingeengt, bäumen wir uns auf: Manchmal mit stillem Widerwillen, manchmal in offener Aggression.
Lustgewinn:Inwiefern durfte ich eigenen Interessen nachgehen, unbeschwerte Momente, Freude, Genuss und Entspannung erleben? Wurden meine Interessen als Spinnereien abgetan und von mir erwartet, dass ich meine Zeit »sinnvoll« nutze? Standen vielleicht auch harte Arbeit, Entbehrung und Pflichterfüllung über allem?
Schließlich gibt es eine Reihe von Aktivitäten, die wir um ihrer selbst willen tun, einfach weil sie uns positive Gefühle verschaffen. Als Kinder versinken wir im Spiel, genießen unbeschwerte Momente mit Gleichaltrigen, suchen nach Spannung, indem wir einen packenden Roman lesen oder Ausflüge unternehmen, lauschen hingerissen unserer Lieblingsmusik, lassen uns von der Schönheit der Natur berühren oder kosten gutes Essen aus. Wir entwickeln eigene Interessen, denen wir nachgehen möchten.
Von Grundbedürfnissen zu Grundüberzeugungen
Die Art und Weise, wie die wichtigsten Bezugspersonen mit uns und unseren Bedürfnissen umgehen, prägt uns nachhaltig und beeinflusst, wie wir die Welt sehen (Jacob, 2020; Stahl, 2015):
Werden unsere Grundbedürfnisse in der Kindheit ausreichend berücksichtigt, bilden sich hilfreiche Grundüberzeugungen aus, wie:
»Ich bin liebenswert.«
»Ich bin willkommen.«
»Ich darf so sein, wie ich bin.«
»Ich kann etwas.«
»Ich kann mich auf andere verlassen.«
»Ich darf Fehler machen.«
»Meine Ansicht zählt.«
»Ich darf Hilfe in Anspruch nehmen.«
…
Manchen Eltern gelingt es nicht, auf wichtige psychische Grundbedürfnisse ausreichend einzugehen.
Werden Kinder vernachlässigt, oft mit sich und ihren Gefühlen alleine gelassen, kontrolliert oder andauernd abgewertet und bestraft, können sich negative Grundüberzeugungen herausbilden, wie:
»Ich bin nichts wert.«
»Ich bin eine Belastung.«
»Was ich möchte, zählt nicht.«
»Ich bin dumm.«
»Ich komme zu kurz.«
»Ich bin schuld.«
»Ich verdiene keine Liebe.«
…
Viele heute erwachsene Menschen haben in der Kindheit jedoch erfahren, dass ihre Bedürfnisse vorwiegend unter bestimmten Umständen erfüllt wurden. Daraus haben sie unbewusste Regeln oder Pläne abgeleitet. Diese sind vielfach als »Ich muss …«- oder »Ich darf nicht …«-Sätze in ihnen abgespeichert.
Beispiele dafür wären:
»Ich muss immer alle Erwartungen erfüllen.«
»Ich darf keine Fehler machen.«
»Ich muss perfekt sein.«
»Ich darf nicht widersprechen.«
»Ich muss stark sein.«
»Ich muss mich immer nützlich machen.«
»Ich muss immer für andere da sein.«
»Ich muss mich unterordnen.«
»Ich darf nichts für mich tun.«
…
Wenn wir solche »Ich muss«- und »Ich darf nicht«-Überzeugungen bei uns selbst identifizieren, ist es sehr hilfreich, sich zu fragen: »Was befürchte ich denn, wenn ich dem nicht nachkomme?«
Vielleicht merken wir, dass wir in unserer Kindheit gelernt haben: »Wenn ich widerspreche, dann tickt mein Vater aus«, »Nur wenn ich erfolgreich bin, werde ich geliebt« oder »Wenn ich etwas für mich tue, dann finden die anderen mich egoistisch und wenden sich von mir ab«.
Wie Kindheitserfahrungen den Umgang mit den eigenen Kindern prägen
Andrea, die Mutter im obigen Beispiel, erkannte, dass sie in ihrer eigenen Kindheit zwar einen recht guten Draht zu ihren Eltern hatte, diese aber beruflich enorm eingespannt waren. Im Alltag mit ihren vier Geschwistern wurde sie wenig gesehen und häufig übergangen. Nachts habe sie im großen Haus oft Angst gehabt und nach Mama und Papa gerufen, aber niemand sei gekommen. Und wenn sie heute als Erwachsene den Eindruck hat, nicht beachtet zu werden, sind all die alten Gefühle mit voller Wucht wieder da: die Einsamkeit, die Trauer, die Angst, die Scham. Das geht ihr nicht nur mit den Kindern so, sondern auch in Sitzungen im Beruf.
Matthias hingegen triggert die Unzufriedenheit seiner Kinder: »Da nehme ich mir am Wochenende extra Zeit, plane einen Ausflug und will, dass alle Spaß haben: und morgens kommen die Kinder nicht in die Gänge, ziehen im Auto eine Schnute, die Kleine nölt herum.« Dann packt ihn der Zorn. Er wird laut, wirft den Kinder vor, undankbar zu sein, und erwartet, dass sie sich zusammenreißen. Wenn die Kleinen nicht sofort einlenken, fühlt er sich ohnmächtig und würde sie am liebsten an Ort und Stelle stehen lassen.
Der Rückblick in seine Biografie offenbart, dass er als Kind immer den Eindruck hatte, zu kurz zu kommen. Die eigenen Eltern erlebte er als fordernd, streng und distanziert. Oft fühlte er sich gegenüber seinen Klassenkameraden minderwertig, weil sich die Familie nur wenig leisten konnte. Noch immer hallen die mahnenden Worte seiner Eltern nach: »Im Leben wird dir nichts geschenkt!« oder »Sei gefälligst dankbar für das, was du hast. Anderen geht es viel schlechter!«.
Nun bietet Matthias seinen Kindern so vieles, was er früher selbst vermissen musste, und trotzdem scheint er sie nicht »zufriedenstellen zu können«, damals wie heute »genügt er scheinbar nicht«.
Was uns die Spurensuche bringt
Oft tut es Menschen weh, wenn sie erkennen, wie sie »für die eigenen Eltern sein mussten«, um akzeptiert zu werden, welche eigenen Bedürfnisse verletzt oder missachtet wurden und welche Glaubenssätze sich eingebrannt haben. Dies kann uns aber auf einen produktiven Pfad führen: Wir können uns bewusst machen, dass wir häufig auf unsere bisherige Lebensgeschichte reagieren – und nicht auf das momentane Außen. Und wir können mehr Mitgefühl mit uns und Fürsorge für uns selbst entwickeln für die Momente, die uns tiefer treffen als andere.
Vielleicht hast du Lust, eine der folgenden Übungen auszuprobieren? Achte darauf, welche zu dir passen. Einige sprechen eher den Kopf an, andere die Gefühlsebene, führen aber alle zu einem ähnlichen Ergebnis.
Übung: Schenk dir Selbstmitgefühl
Im ersten Kapitel hast du erfahren, wie wertvoll es ist, wenn wir als Eltern bei uns beginnen und uns selbst mit Mitgefühl begegnen. Studien zeigen, dass Selbstmitgefühl nicht nur die Stressbelastung der Eltern reduziert, sondern auch zu einem liebevolleren Umgang mit den Kindern beiträgt (Neff & Faso, 2015; Gouveia, Carona, Canavarro und Moreira, 2016).
Aber wie können wir das umsetzen? Die Psychologin Kristin Neff forscht seit vielen Jahren zu diesem Thema und schlägt drei Schritte vor, die uns in herausfordernden Situationen helfen können. Sehen wir uns diese anhand von Andreas Beispiel an. Für sie war es ein Augenöffner, festzustellen, dass sie im Zusammenleben mit ihren Kindern häufig nicht auf die aktuelle Situation reagiert, sondern auf eine eigene Kindheitsprägung. Insbesondere Momente, die in ihr den Glaubenssatz »Du bist nicht wichtig!« aktivierten, brachten sie aus der Fassung. Da sie als Kind häufig erleben musste, dass sie in schwierigen Momenten alleine war, ist es für sie wertvoll, sich diese fehlende Zuwendung heute selbst zu schenken. Wenn sie spürt, dass sie wieder einmal von starken Gefühlen übermannt wird, nimmt sie sich einen Moment für sich und geht in Gedanken die folgenden Schritte durch:
Nimm wahr, was ist: »Jetzt fühlst du dich wieder so einsam und unzulänglich und redest dir ein: Du bist nicht wichtig! Niemand hört dich!«.
Verbinde dich mit der Welt: »Es gibt viele Menschen, die sich oft einsam und ungesehen fühlen. Du bist nicht alleine.«
Behandle dich wie eine gute Freundin: »Dass deine Tochter abgelenkt war, trifft gerade einen wunden Punkt bei dir. Das macht dir zu schaffen. Was würde dir jetzt guttun?«
Jeder Schritt für sich entlastet und bringt uns weiter.
Wenn wir unsere Gefühle achtsam wahrnehmen, zulassen und innerlich in Worte fassen, signalisieren wir: »Was du fühlst, ist in Ordnung und wichtig.« Gerade wenn man in der eigenen Kindheit erlebt hat, dass man »kein Theater machen soll«, »gar nicht wütend zu sein braucht« oder »nicht so eine Heulsuse sein soll«, ist es heilsam, wenn man sich heute selbst gestattet, auch unangenehmen Empfindungen Raum zu geben.
Wie bereits beschrieben, haben wir unsere negativen Glaubenssätze oft in Situationen erworben, in denen wir uns von geliebten Menschen abgelehnt, bloßgestellt oder ungeliebt fühlten. Ähnelt eine heutige Situation solchen Erfahrungen aus der Kindheit, fühlen wir uns oft alleingelassen, schwach und klein. Verbundenheit wirkt wie ein Gegenmittel. Sobald wir uns bewusst machen, dass das, was wir gerade erleben, eine zutiefst menschliche Erfahrung ist, empfinden wir uns wieder als Teil einer Gemeinschaft. Diese Verbundenheit kann sich nicht nur durch einen inneren Monolog einstellen, sondern auch im Gespräch mit vertrauten Menschen, in einer Selbsthilfegruppe, einem Coaching oder einer Psychotherapie.
Wird Andrea von ihrer Tochter vermeintlich ignoriert, geht sie innerlich hart mit sich ins Gericht. Sie sagt sich: »Du zählst nicht! Du fällst nur zur Last! Du bist nicht wichtig!« Niemals würde sie so etwas in diesem Ton zu anderen sagen! Sobald sie sich vorstellt, wie eine gute Freundin zu ihr sprechen würde, wird sie liebevoller, weicher, ermutigender.
Manchmal befürchtet man, dass ein mitfühlender Umgang mit sich selbst bedeutet, dass man eigene Fehler negiert, Ausflüchte sucht und Probleme nicht anpackt. Interessanterweise zeigt die Forschung das Gegenteil: Menschen, die sich selbst mit Mitgefühl begegnen, können Fehler besser zugeben, gehen Schwierigkeiten aktiver an und haben eher den Kopf frei, um Lösungen zu finden und sich auf andere einzulassen (Neff, 2022; 2012).
Übung: Ab und zu gründlich ausmisten
Glaubenssätze bilden sich überwiegend in den ersten Lebensjahren aus. Oft tragen wir sie für den Rest des Lebens mit uns herum. Die meisten Menschen haben einige spezifische Lebensthemen, die immer wieder zu Problemen führen: Wer glaubt, perfekt sein zu müssen, wird sich oft unzulänglich und wertlos fühlen – und sich früher oder später verausgaben. Wer einen Glaubenssatz wie »Ich darf nicht widersprechen« oder »Ich muss immer auf andere Rücksicht nehmen« verinnerlicht hat, wird sich in Beziehungen unterordnen und läuft Gefahr, dominante und egoistische Partnerinnen und Partner anzuziehen. Die Überzeugung, stets stark sein und alles alleine schaffen zu müssen, kann zu Entfremdung und Überforderung führen.
Es lohnt sich, im Erwachsenenalter eine Inventur des eigenen Innenlebens vorzunehmen und sich zu fragen: Welche Glaubenssätze wirken noch heute in mir? Welche davon bestärken mich? Und welche ziehen mich herunter?
Letzteren können wir mit einer wirksamen Strategie aus der kognitiven Verhaltenstherapie zu Leibe rücken: der »kognitiven Umstrukturierung«. Dabei setzen wir uns bewusst mit unseren Gedanken auseinander, hinterfragen sie und suchen aktiv nach neuen, gesünderen Ansichten.
Und so kannst du vorgehen:
Schreibe einen Glaubenssatz auf, der dich belastet.
Nun prüfst du diesen Satz auf Herz und Nieren:
Woher kommt diese Ansicht?
Hilft mir dieser Gedanke, mich so zu fühlen und so zu reagieren, wie ich das gerne möchte?
Stimmt dieser Satz (heute noch)? Gibt es Beweise dafür? Welche Gegenbeweise könnte ich ins Feld führen?
Ist diese Forderung überhaupt realistisch?
Was würden Menschen, die ich liebe und die mir wichtig sind, zu dieser Überzeugung sagen?
Wie sähe mein Alltag aus, wenn ich diesen Glaubenssatz loslassen könnte?
Wie könnte eine realistischere, hilfreichere Überzeugung lauten?
Sehen wir uns dazu ein Beispiel an:
Zweifachmama Katarina ist andauernd erschöpft. Die Angebote ihres Partners und Umfelds, sich auszuruhen, Verantwortung abzugeben oder ihr Engagement in diversen Vereinen etwas zurückzunehmen, schlägt sie aus. Sie empfindet solche Vorschläge beinahe als Angriff. In einem Coaching erkennt sie, dass sie ihr Selbstwertgefühl fast gänzlich aus der Erfahrung zieht, gebraucht zu werden und für andere nützlich zu sein.
Sie notiert für sich den belastenden Glaubenssatz:
»Ich muss immer für andere da sein!«
Auf die oben gestellten Fragen antwortet sie wie folgt:
Woher kommt diese Ansicht?
»Ich war die Älteste von fünf Kindern. Meine Mutter war gesundheitlich angeschlagen, sodass ich schon früh mit anpacken und meine Geschwister mitversorgen musste. Oft habe ich von Mutti gehört, dass sie es ohne mich nicht schaffen würde. Das waren eigentlich die einzigen Momente, in denen ich richtige Zuwendung bekommen habe. Irgendwie steckt dieser Glaube fest in mir, dass ich nur dann wertvoll bin, wenn ich mich für andere nützlich mache und immer für sie da bin.«
Hilft mir dieser Gedanke, mich so zu fühlen und so zu reagieren, wie ich das gerne möchte?
»Auch heute gibt es mir ein gutes Gefühl, wenn ich für andere da bin. Ich mag es, wenn bei mir alle Fäden zusammenlaufen. Wenn andere sagen, ›Wow! Was du alles schaffst!‹, schmeichelt mir das sehr. Aber in letzter Zeit bin ich zu oft müde und erschöpft. Und es gibt immer wieder Streit, bei dem mir mein Partner vorwirft, dass ich nicht nein sagen kann und mich um alles andere kümmere, nur nicht um mich und uns. Unseren älteren Sohn nervt es auch oft, wenn ich ihm eigentlich nur helfen will. Teilweise wird er richtig aggressiv und schnauzt mich an: ›Jetzt lass mich einfach mal in Ruhe! Du musst dich nicht überall einmischen! Das ist meine Sache! Ich bin kein Baby mehr.‹«
Stimmt dieser Satz (heute noch)? Gibt es Beweise dafür? Welche Gegenbeweise könnte ich ins Feld führen?
»Natürlich ist es mir wichtig, für meine Familie und Freunde da zu sein. Aber dieses ›Müssen‹ und das Gefühl, nur durch Hilfe für andere wertvoll zu sein, stimmt eigentlich nicht. Vor allem diejenigen, die mir am nächsten stehen, zeigen mir sehr deutlich, dass sie das nicht erwarten und auch nicht wollen. Und mich nervt es ja auch, wenn sich meine Schwiegermutter bei der Familienfeier bis zur Erschöpfung um alle kümmert, sich aber partout nicht helfen lässt, und sich dann darin sonnt, dass sie den Laden alleine schmeißt.«
Was würden Menschen, denen ich wichtig bin, zu dieser Überzeugung sagen?
»Wer dich wirklich liebhat, der möchte, dass es dir gut geht. Du bist schon lange dauernd erschöpft und gereizt. Das nützt auch niemandem … Wenn du ständig im Helfermodus bist und dich aufopferst, kannst du ja gar nie erleben, dass andere Menschen dich auch aus anderen Gründen mögen und schätzen.«
Wie sähe mein Alltag aus, wenn ich diesen Glaubenssatz loslassen könnte?
»Ich wäre immer noch ein Mensch, der sich gerne einbringt und für andere da ist. Aber wenn ich den Glaubenssatz loslassen könnte, dann müsste ich nicht immer reflexartig meine Hilfe aufdrängen, sondern dürfte selbst entscheiden, wann ich das will. Das würde mir Luft verschaffen, ich könnte mich erholen. Mir und unserer Familie würde das guttun.«
Wie könnte eine realistischere, hilfreichere Überzeugung lauten?