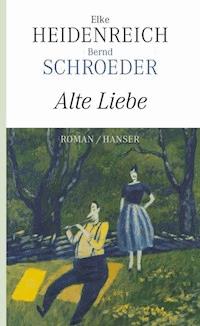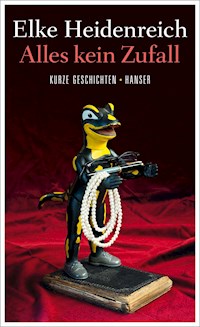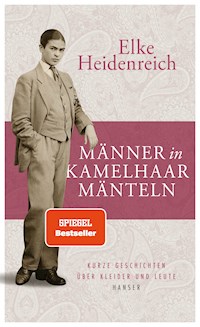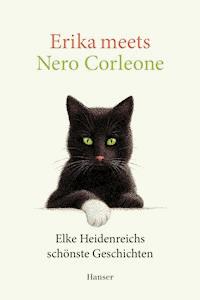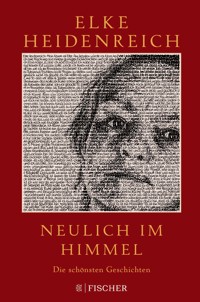Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Elke Heidenreichs neues Buch, diese kurzen Geschichten zu weiten Reisen sind „seitenweise Reiseglück“, so Katja Kraft im Merkur: „Ach Elke, sie schafft`s doch immer wieder uns zu kriegen“!
Elke Heidenreich ist in ihrem Leben sehr viel gereist: von Florenz nach China, von Berlin nach Amerika, und überall hat sie sich umgesehen. Nirgendwo jedoch ist sie ausgetretenen Pfaden gefolgt, nirgendwo hat sie nur das gefunden, was in den Reiseführern steht. Nein, sie hat sich ihre eigenen Wege gebahnt, hat Entdeckungen gemacht, die nur sie machen konnte, hat vor allem diejenigen Orte geliebt, die ihr etwas ganz Eigenes, Neues schenken konnten: eine besondere Straße, ein besonderes Essen, und einmal vermasselt ein Hund einfach eine Stadt wie Florenz. Und überall spürt sie die gleiche unstillbare Neugier auf die Menschen in den fremden Ländern und Städten. Eine wunderbare Entdeckungsreise!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Auf Reisen mit Elke Heidenreich — das neue Buch der »feinen, warmherzigen und sehr lustigen Erzählerin«. Felicitas von Lovenberg, F.A.Z.Elke Heidenreich ist in ihrem Leben sehr viel gereist: von Florenz nach China, von Berlin nach Amerika, und überall hat sie sich umgesehen. Nirgendwo jedoch ist sie ausgetretenen Pfaden gefolgt, nirgendwo hat sie nur das gefunden, was in den Reiseführern steht. Nein, sie hat sich ihre eigenen Wege gebahnt, hat Entdeckungen gemacht, die nur sie machen konnte, hat vor allem diejenigen Orte geliebt, die ihr etwas ganz Eigenes, Neues schenken konnten: eine besondere Straße, ein besonderes Essen, und einmal vermasselt ein Hund einfach eine Stadt wie Florenz. Und überall spürt sie die gleiche unstillbare Neugier auf die Menschen in den fremden Ländern und Städten. Eine wunderbare Entdeckungsreise!
Elke Heidenreich
Ihr glücklichen Augen
Kurze Geschichten zu weiten Reisen
Hanser
Ihr glücklichen Augen,
Was je ihr gesehn,
Es sei, wie es wolle,
Es war doch so schön!
J. W. von Goethe, Lied des Lynkeus, Faust, II. Teil
Für Tom
Reisegesicht
Die Wirklichkeit ist nur auf der Durchreise zu ertragen … Wer hat das gesagt? Ich glaube, mein Freund Hans Neuenfels. Er hatte mir von seinem Großvater erzählt, der ihm zum Thema Reisen geraten hatte: »Du musst immer ein Ziel vor Augen haben, aber du musst nicht da gewesen sein.«
Was ist mit der Heimat? Gibt es die noch? Ohne Kitsch ist Heimat nicht mehr zu haben, sagt Vilém Flusser, und ich glaube, der Verlust von Heimat macht auch frei, um neue Fäden zu spinnen. Wir waren doch mal Nomaden? Wir sind es noch. Reise ich wegen der Orte oder wegen der Menschen? Das zeigt sich immer erst, wenn ich wirklich vor Ort bin. Ich kann nicht acht Milliarden Menschen lieben, aber einzelne liebe ich schon, überall, ich liebe Menschen, aber die Leute gehen mir meist auf die Nerven, so ist das. Und Wurzellosigkeit gefällt mir, »A man is not a tree«, sagt Flusser (oder wer?). Also reise ich immer wieder los, einfach so, ohne große Erwartungen. Ins Unbekannte. Und was kommt mir meist entgegen? Das Bekannte. Und wenn das Unbekannte mich tatsächlich verblüfft, lasse ich es zu und versuche, mich vor Erklärungen und Deutungen zu hüten. Die heilige Teresa von Ávila soll gesagt haben (oder war es doch Jacques Lacan? Ich werfe ja immer alles durcheinander): »Es ist zu lehren, wie man nicht versteht.« Ist das nicht wunderbar? Und Heidegger, den ich überhaupt nicht leiden kann, hat doch einen schönen Satz beigesteuert zu diesem Thema des Wagnisses: »Wohin springen wir, wenn wir springen? Springen wir in einen Abgrund? Ja, wenn wir den Abgrund nur vorstellen. Nein, wenn wir springen.«
Ich bin immer wieder gesprungen.
Ich bin viel gereist.
Ich war auf allen fünf Kontinenten, in fast allen Metropolen, ich war in der Antarktis und in Afrika, in China und Amerika und auf Kuba, und jede Reise hat etwas mit mir gemacht. Und die wirklichen und die imaginären Reisen, die in Zug, Bahn und Flugzeug, die in Hotels und auf Wanderungen und die parallel dazu im Kopf — sie alle mischen sich, auf solchen Reisen bewohnt man echte und geträumte Orte und wird zum Pendler zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Was tun Reisende? Paul Theroux sagt: »Sie gehen hin und hoffen auf das Beste.« Solche Reisenden sind keine Touristen. Ich wollte nichts erleben, mich auch nicht von irgendwas erholen. Auf keinen Fall wollte ich irgendwas Berühmtes besichtigen: »Nichts ist mehr da, was man sich ansehen könnte, alles ist zu Tode geglotzt worden.« (D. H. Lawrence) Ich wollte nur woanders sein. Und woanders, das musste nicht unbedingt ein »schöner« Ort sein. »Travelling is a never ending source of inspiration.« Von wem? Keine Ahnung, unterwegs notiert.
Ist ein Reisender vielleicht auf der Flucht? Vor etwas? Vor sich selbst? Sven Regener singt: »Wir wissen nie, wohin es geht, wir sind schon froh, dass es noch Wege gibt.« Und der Vielreisende Cees Nooteboom sagt: »Es geht darum, zu verschwinden und gleichzeitig dazubleiben.« Denn man hat ja einen Hintergrund, hat Telefonnummern, wenn man die wählt, ist da jemand, der einen kennt, das Band besteht, und doch, sagt Nooteboom: Man hat sich gelöst, man ist jetzt ein anderer, und »die Illusion besteht darin, dass man an all diesen Orten, die man erstmals aufsucht oder zu denen man zurückkehrt, noch ein zweites Leben hat, das zeitgleich mit dem anderen verläuft«.
Reisen muss man auch lernen. Man bewegt sich in Welten, Häusern, Gegenden, die anderen gehören. Man kann Gefahr, Willkür, Ablehnung begegnen. Und weil alles immerfort überall möglich ist, wird man gelassen. Ich bin auf Reisen nie aufgeregt oder ängstlich, ich bin wie in einer Art Meditation — ich nehme an, was auf mich zukommt, und das sind keine touristisch geplanten Sehenswürdigkeiten. Das sind Menschen, Eindrücke, Gefühle, Landschaften. Und immer vermisse ich mein Zuhause, weiß doch aber, dass es da ist und auf mich wartet. Also kann ich mich auf das Fremde einlassen, mit Leib, Verstand und Seele. Ich will nichts erleben. Ich will nur dort sein, um später wieder hier sein zu können, aber anders. Denn ich war dort.
Sind meine Geschichten alle wahr? Ach, um die Wahrheit zu verändern, reicht doch schon ein Glas Cognac. Und wenn ich meine Reisen erzähle, dann in einer Sprache, die keine eigene Wahrheit hat. Sie markiert nur vorübergehende Wirklichkeiten. Und wer zu gründlich Buch führt, sieht auch zu sehr die Verluste, die er erleidet.
Es gibt ein Lied von Paolo Conte, es heißt »Genova per noi«, Genua für uns, und es erzählt von den Bauern, weitab im Hinterland, die von Genua, der Stadt am Meer, träumen. Und eines Tages fahren sie hin. Was für eine Enttäuschung — diese graue Stadt im Regen, dieses dunkle Meer, das sich immer bewegt, »Che si muove anche di notte / Non sta fermo mai«, das auch nachts niemals stillsteht. Und sie kehren zurück aufs Land zu ihren großen, stillen Schränken voller alter Leintücher und Lavendelduft und leben weiter wie immer, aber: mit anderen Gesichtern, denn … »quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così che abbiamo noi che abbiamo visto Genova« … wir haben jetzt die Gesichter und den Ausdruck von Leuten, die Genua gesehen haben.
Gottfried Benn fällt mir ein, der staunend schrieb:
»Nachts auf Reisen Wellen schlagen hören / und sich sagen, dass sie das immer tun …«
Manchmal stehe ich vorm Spiegel und suche in meinem Gesicht all die Orte, an denen ich war. Wie sähe ich wohl aus ohne sie?
Weit …
Ach, PARIS!
Mit siebzehn war ich in Paris und bin jung und dumm herumgestromert, ohne Ahnung von irgendetwas außer Gedichten: Rimbaud, Verlaine, Apollinaire, die kannte ich, und dass man hier Croissants isst, das wusste ich, und ach ja, der Eiffelturm, aber hohe Dinge interessierten mich nicht. Ich saß mit meinem bisschen Geld halbe Tage lang vor einem Croissant und einem kleinen Espresso und dachte: PARIS!, und las die Gedichte, die ich in ein Heft abgeschrieben mit mir herumtrug —
Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur?
Ach, Verlaine! Ach, siebzehn
Ich ging in ein Konzert mit Musik von Camille Saint-Saëns und kaufte ein Programmheft, in dem ein erschütternder Satz stand, den ich in all den Jahrzehnten nie mehr vergessen habe: »Ich bin die Zukunft gewesen«, schrieb der alte Saint-Saëns bitter an Romain Rolland …
Auf diesem Foto bin ich siebzehn und strahle, aber in meinen Tagebüchern stand: »Voir clair c’est voir noir«, das hat Paul Valéry gesagt.
Mit Mitte zwanzig war ich wieder dort und habe alle Museen abgeklappert, schlecht geschlafen in einem Dreckshotel, zerstochen von Wanzen, billig und schlecht gegessen, einsam, mit Stadtplan herumfuhrwerkend, lange Briefe schreibend an einen, den ich liebte und der nicht dabei war.
Dann war ich Mitte dreißig und fuhr mit einem anderen her und mit zwei Freunden: dem Regisseur Ulrich Heising und seiner Gefährtin, der großartigen und liebenswerten Schauspielerin Christa Berndl. Ich denke an sie als Menschen, mit denen man immerzu lachen konnte, wir haben nur gelacht auf dieser Reise, gelacht und französische Texte rezitiert …
Und wir waren jeden Abend irgendwo im Theater. Wir hatten alle Kinder des Olymp gesehen und uns alle in Jean-Louis Barrault verliebt, seinetwegen waren wir hier.
Er hatte 1974 ein neues Theater gegründet in der damals leerstehenden Gare d’Orsay, wo er auch selbst auf der Bühne stand. Wir lernten Ariane Mnouchkine kennen, die auch ein eigenes Theater hatte, das Théâtre du Soleil in einer riesigen alten Munitionsfabrik im Bois de Vincennes. Wir fuhren mit der Metro Nr. 4 bis zur Endstation, Porte de Clignancourt, und liefen den ganzen Tag über den riesigen Flohmarkt und landeten in einer Kneipe mit rot-weiß karierten Tischtüchern, fettigen Hähnchen, billigem Wein und einer Dreimannkapelle, Akkordeon, Gitarre, Bass. Irgendwann nahm erst Uli, dann ich das Akkordeon, wir spielten, sangen, waren sehr betrunken, es wurde getanzt, die Nacht nahm gar kein Ende, ich hatte auf dem Flohmarkt eine große Schaufensterpuppe gekauft und keine Ahnung, wie wir die transportieren sollten, ach, Paris!
Sie steht heute bei mir. Ich glaube, wir haben sie damals aufs Auto gebunden, mit Stricken. Christa und Uli sind tot, die kann ich nicht mehr fragen, und wo der Mann heute lebt, mit dem ich damals in Paris so glücklich war, das weiß ich nicht. Geblieben ist nur die Puppe.
Und dann war ich mit über siebzig noch mal mit meiner liebsten Reisefreundin Gisela in Paris, wir konnten uns ein Luxushotel leisten, 1a Weine, prächtiges Essen, Presseausweis für alle Museen, teure Plätze in beiden Opern, alles perfekt.
Und doch nie mehr so glücklich wie damals. Paris, Paris. Sehnsuchtsort.
Wir Mädels unter uns. ZÜRICH
Es gibt überall Schönes. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste: Der schönste Platz in Zürich ist die Frauenbadi. Und mein erstaunlichstes Erlebnis hatte ich auch dort.
Heute ist man etwas nackter!
Die Frauenbadi ist eine Badeanstalt nur für Frauen, 1837 eröffnet, als endlich das öffentliche Baden für Frauen erlaubt wurde — weniger aus sportlichen, vielmehr aus hygienischen Gründen: Die meisten Häuser hatten kein fließendes Wasser, und hier konnte man sich waschen. Der Zürcher Reformator Huldrych Zwingli hielt dereinst nichts vom Schwimmen: »Schwimmen habe ich Wenigen nützen sehen«, schreibt er, »wiewohl es zu Zeiten lustig ist, die Glieder wie ein Fisch im Wasser zu strecken und ein Fisch zu werden.« Aber er war es, der die mittelalterliche Badekultur ruckzuck erst mal beendete, und es dauerte drei Jahrhunderte, bis die Zürcher so viel Puritanismus nicht mehr wollten. Also: ein Badhaus für Frauenzimmer, dem viele andere öffentliche Bäder folgten.
Und nun schwimmen wir — direkt in der Limmat, damals wie heute. Gegen Blicke abgeschottet liegt das wunderbare Jugendstilgebäude der Frauenbadi (1888 ganz und gar renoviert), dieses hölzerne schöne Gebilde am linken Limmatufer, festgezurrt an der Mauer, aber es schwimmt und man schwimmt direkt im Fluss. Dreiunddreißig Meter ist das Außenbecken lang, sieben Meter breit, vier Meter die Tiefe des Flusses hier, Fische begleiten uns. Und von draußen sieht uns niemand, und damit das auch so bleibt, tuckert ab und zu ein Polizeiboot vorbei.
Hier sind wir Mädels unter uns. Hier schwimmen, lesen, schwatzen wir oder trinken eisgekühlte Sachen von der Bar. Und ob wir was anhaben oder nicht, unten, oben, nackt, angezogen, das ist hier ohne Männerblicke völlig wurscht, jede, wie sie will.
Da sitze ich mit meinen Zürcher Freundinnen, wenn ich im Sommer in der Stadt bin — ich versuche, dass es immer Sommer ist! —, und dann spendiert Marina die erste Flasche und Anne-Françoise die zweite und ich die dritte, und wir dösen und lachen und schwimmen den Rausch zwischendurch immer mal weg, und Marion weint, und Sarah tröstet, und Anuschka lacht, und Leonie passt auf, dass alle eingecremt sind. Und Claudia isst die ganze Schachtel Champagnertrüffel vom Sprüngli für vierundvierzig Franken auf einen Sitz leer, »das schmilzt doch sonst alles!«, und es gibt nichts Kostbareres als diese Frauenfreundschaften. Wir kennen einander, wir kennen unsere geglückten oder missglückten Liebes- und Lebensentwürfe, unsere Körper mit und ohne Narben und Falten, und ich bin in der Frauenbadi einfach nur von Kopf bis Fuß dankbar, für alles. Für alles, was ich erlebt, und für alles, was ich überlebt habe. Und für meine wunderbaren Freundinnen.
Und mein erstaunlichstes Erlebnis: Einmal ging ich zusammen mit einer verschleierten Muslima in die Frauenbadi. Als ich aus der Umkleide kam, kam sie auch: oben ohne, Bikinihöschen, aber der Kopf ordentlich verschleiert. Alles, alles geht.
Die Königin von MAILAND
Für Inge
Nach Mailand bin ich oft gefahren, entweder um in die Oper zu gehen oder um meine Freundin Inge Feltrinelli zu besuchen, die gleich nebenan in der Via Andegari wohnte, außen unauffällig, innen prächtig, ein echter Raffael über ihrem Bett — jetzt, wo sie tot ist, darf ich das sagen, oder? Meine lustige Inge, sie war ein Essener Mädchen, wie ich, hieß früher Inge Schönthal, und weil ihr Vater Jude war (und schon früh emigriert), musste Inge noch kurz vor Kriegsende im März 1945 das Gymnasium verlassen. Da war sie fünfzehn, und als sie neunzehn war, schnappte sie sich ein Fahrrad und radelte fast 300 Kilometer von Göttingen nach Hamburg, um Fotoreporterin zu werden. Wurde sie, weil Inge alles schaffte, was sie anpackte. 1953, da war ich zehn und Inge dreiundzwanzig und wir kannten uns noch nicht, schickte der Verleger Heinrich Maria Ledig-Rowohlt die quirlige Inge nach Kuba, um Hemingway zu fotografieren — das wurde ein Knaller und ihr Durchbruch. Sie hat danach in Kuba auch Fidel Castro fotografiert, in Paris die Beauvoir und Picasso, in Amerika John F. Kennedy, Audrey Hepburn und Gary Cooper, in Italien Anna Magnani, der sie als junge Frau ein wenig ähnlich sah.
Und dann lernte sie Giangiacomo Feltrinelli kennen, den Spross einer der reichsten Familien Italiens, reich durch Holzhandel, Textilien, Banken. Und der Sohn pfeift auf all das, wird ultralinker Aktivist, gründet aber mit dem Geld den Feltrinelli Verlag und verlegt als Erster Doktor Schiwago von Boris Pasternak. Und dann Che Guevara. Er hatte das richtige Händchen. Unter bis heute nicht geklärten Umständen kam er 1972 bei der Sprengung eines Strommastes ums Leben, da war er 46 Jahre alt und von Inge, die er 1960 geheiratet hatte, schon wieder geschieden. Nach seinem Tod — Sohn Carlo war noch klein — übernahm sie beherzt die Verlagsgeschäfte und leitete sie später äußerst erfolgreich zusammen mit Carlo.
Sie kannte alle, sie war jedes Jahr in Frankfurt der Paradiesvogel der Buchmesse, und sie hat nie mit Erfolgen oder Berühmtheiten rumgeprotzt. Als ich sie 1980 kennenlernte, war sie fünfzig, ich Mitte dreißig, und wir waren Freundinnen innerhalb von fünf Minuten und bis zu ihrem Tod 2018. Ich durfte oft ihr Gast sein und lernte immer neue interessante Menschen bei ihr kennen — zum Beispiel Celia, die (blonde!) Tochter von Che Guevara, dessen Bücher Feltrinelli verlegte. Im Flur hing ein Poster mit seinem lachenden Gesicht und dem Zitat: »Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza«, man muss hart sein, ohne je die Sanftheit zu verlieren. Ich stand davor und staunte, sie nahm es von der Wand und packte es mir ein — heute ist das Bild bei mir, und sein Lachen ermahnt mich: Mai perdere la tenerezza!
Inge fuhr auf einem roten Rennrad durch Mailand und ich auf einem Leihrad im Schlepptau, immer mörderisches Tempo, immer unterwegs zu einer Ausstellung, einem Konzert, einem Essen. Und immer guckte sie, die Extravagante, mich an und seufzte: »Du siehst wieder nach gar nichts aus, so mausig, so können wir doch nicht zu Zeffirelli!« Und dann nahm sie ihre goldenen Ohrclips raus und klemmte die auf meine flachen schwarzen Ballerinaschuhe und legte mir irgendeine feuerrote Seide um den Hals und sagte: »Na ja, so könnte es gehen.« Und dann saßen wir bei Franco Zeffirelli, der einen Arm in Gips hatte, und ich fragte blöde: »Wie ist denn das passiert?«, und er, der Zyniker und knurrige, schwierige Mensch, konterte: »Beim Eislaufen, was sonst«, da war er über achtzig und hatte natürlich keine Lust, über Unfälle und Krankheiten zu reden, und es waren lauter schöne, reiche, kluge, berühmte Menschen da, auch der angeschwärmte Giancarlo Giannini, der gerade einen James Bond abgedreht hatte, aber Inge war immer der Mittelpunkt, laut, strahlend, lebendig. Die Königin von Mailand, das war sie. Es war der Abend nach der legendären Premiere, wir waren auch in der Scala gewesen, wo der 83-jährige Zeffirelli eine umjubelte Aida inszeniert hatte, 2006, einundzwanzig Jahre lang hatte es Verdis Aida auf dieser Bühne nicht mehr gegeben, entsprechend wurde gefeiert.
Die Karten hatten bis zu zweitausend Euro gekostet, aber Inge hatte immer ihre Kanäle und Beziehungen, und die Mailänder genossen eine goldstrotzende, traditionelle Inszenierung. Zeffirelli hasste das moderne Regietheater, hier war die Liebe noch Liebe und das ganz große Drama noch das ganz große Drama und Prinzessin noch Prinzessin, und der Regisseur füllte die Bühne mit etwa dreihundert Leuten, der ganze Pharaonenhof versunkener Zeiten, von Dirigent Riccardo Chailly mit Mühe in Schach gehalten. Der Applaus dauerte minutenlang. Und nun wurde, von Jüngern umgeben, gefeiert, und ich hatte wenigstens goldene Clips auf den Schuhen und rote Seide um den Hals.
Inge versuchte immer, mich ein bisschen rauszuputzen, wenn wir in die Oper gingen oder wenn Besuch kam. Doris Lessing, Isabel Allende, Nadine Gordimer oder Antonio Tabucchi, alle kamen zu ihr, tranken was, aßen mit, saßen plötzlich im Salon — der Verlag war ja gleich nebenan. Inges Talent zur Freundschaft und Gastfreundschaft war legendär, sie kochte, sie lachte, sie wirbelte herum und brachte alle zusammen, und manchmal rief jemand an, und sie sagte: »Moment, hier ist die Elke, die kennt deine Bücher!«, und gab mir das Telefon, und es war Umberto Eco. Und einmal sagte sie mir am Telefon: »Der Grass ist gerade da, den kannst du doch nicht leiden, komm erst am Abend, dann ist der weg, wann bist du weg, Günter? Um sechs ist der weg!«
Er saß daneben und hörte das, bei Inge gab’s kein Geheimnis, und ich kam also erst am Abend, da war »der weg«. Als der Schriftsteller Richard Ford vorbeischaute, für dessen Bücher ich so schwärmte wie für seine blauen Augen, erzählte sie ihm das natürlich sofort, und er lachte, und ich wurde rot. Bei Inge lag immer alles offen auf dem Tisch, auch das Peinliche, aber ich war so glücklich, durch sie ein ganz anderes Mailand kennenzulernen, das der Künstler, der versteckten Villen mit Zitronenhainen, die ich sonst nie gesehen hätte. Inge polierte mein Italienisch und versorgte mich mit Büchern, räumte mir Rabatte in den Feltrinelli-Buchhandlungen ein, dafür musste ich ihr immer in Briefen Klatsch und Tratsch aus der deutschen Verlagsszene schreiben, den gab’s ja reichlich. Für eine Zeitschrift schrieb ich ein Porträt über sie mit der Überschrift: »Ich bin ein glücklicher Mensch«. Und das war sie wirklich, sie hatte das Talent zum Glücklichsein wie kaum jemand, den ich kenne. Ihre Wohnung voller Bilder, Blumen, Bücher, bunter Kissen, weicher Teppiche, auf denen Dackel Enzi aus Göttingen und zwei vergnügte kleine Enkel herumsprangen, spiegelte den inneren und äußeren Reichtum einer Frau, die von sich sagte: »Ich bin ein glücklicher Mensch.« Das kann nur jemand sagen, der auch klug genug ist, zu wissen, was Schmerz heißt und wie man damit fertig wird.
Sie ging schon auf die achtzig zu und trug immer noch Highheels, Knallfarben wie Orange, Pink, Giftgrün, riesige Ohrringe, und sie war frech und witzig. Bei Zeffirelli war ein rechtskonservativer Zeitungsverleger aus dem Berlusconi-Gefolge, sie reichte ihm matt das Händchen zum Kuss und raunte mir zu: »Den stell ich dir jetzt nicht vor, der ist zu blöd.« Und als eine steindumme, steinreiche Amerikanerin sie tatsächlich nicht kannte (in Mailand fast unmöglich) und sie fragte, wer sie denn sei, sagte sie: »Ich bin Primaballerina an der Scala und schon über siebzig, und ich muss noch jeden Abend tanzen.«
Inge Feltrinelli verschreckte gern Traditionalisten. Einmal hat sie in den Sommermonaten Bücher nach Gewicht verkaufen lassen. »Was kostet mehr? Ein Kilo Hummer oder ein Kilo Moravia? Ein Kilo Shakespeare oder ein Kilo Spargel?« Der Slogan schlug ein, die Leute kauften im flauen Juli in den Feltrinelli-Läden tatsächlich die Bücher kiloweise.
»Was ist wichtiger für eine Frau«, fragte ich sie 2001 bei unserm Interview, »Intelligenz, Schönheit oder Humor?« — »Humor«, kam ohne Zögern die Antwort. Aber, meinte sie, Intelligenz kann nicht schaden, und Schönheit ist ohnehin relativ. Nie würde sie sich liften lassen, aber nicht aus Stolz auf ihre Falten (»Meine Freundinnen sind alle geliftet und sehen viel besser aus!«), sondern weil sie keine Vollnarkose herausfordern wollte, ohne wirklich krank zu sein — eine für Inge Feltrinelli ganz typische, handfeste Position, die ich übernommen habe. Und Humor hatte sie wie niemand sonst, den ich kannte. Wir haben uns gekugelt vor Lachen, als in Italien Der Name der Rose rauskam, Il Nome della Rosa, und Umberto Eco auf die Frage eines Journalisten, warum er diesen seltsamen Titel gewählt hatte, sagte: »Pinocchio war schon vergeben.« Das hätte auch von ihr sein können!
Inge sprach schnell, und ins Deutsche mischten sich englische und italienische Wörter. Welchem Land oder Ort fühlte sie sich zugehörig, Deutschland, Italien, New York? »Ich bin Mailänderin«, sagte sie. Aber: »Ich nehme mich nicht so wichtig, das ist das Deutsche an mir.« Oh! Ich protestierte, gerade wir Deutschen nehmen uns doch so unendlich wichtig? Aber sie meinte das im Hinblick auf Statussymbole, auf gesellschaftlichen Glamour. Die italienische Frau sei sehr auf Wirkung aus, schon zum Einkaufen morgens Designerjeans, ein Tausend-Mark-Kaschmirpullöverchen und einen Zobel. Das gab es bei Inge nicht, schon gar keine echten Pelze. Es gab fröhlich bunte Eleganz von der Stange, und durch die teure Via Monte Napoleone fuhr sie zum Einkaufen auf dem Fahrrad, wie weiland Königin Juliana durch Den Haag.
Ja: Inge Feltrinelli war die Königin von Mailand, und wo sie auftauchte, knallten die Champagnerkorken. Es war immer ein Wind um sie, Bewegung, Lebenslust, Grandezza. Aber das täuschte darüber hinweg, wie hart sie für den Verlag arbeitete. Sie hatte zahlreiche Orden, Verdienstkreuze, war Ehrendoktorin, aber war vor allem Literaturvermittlerin, Freundin der Autoren, eine Persönlichkeit, wie es im Verlagsgeschäft heute nur noch wenige gibt. Wenige? Mir fällt gerade niemand ein. »Man muss wissen, was wichtig ist«, sagte sie. Und was wichtig ist, muss man genießen und sich bewahren: Freundschaften, Bücher und »diese eine große Liebe, von der man sich nie mehr erholen kann«. Das sagte sie mir zu einer Zeit, als Giangiacomo Feltrinelli schon seit dreißig Jahren tot war.
Meine wunderbare Inge
Ihr Sohn Carlo, der heute den Verlag leitet, kam damals herein, registrierte, dass seine Mutter interviewt wurde, und spottete: »Ach, mal wieder was fürs Ego?«, und sie lachte. Ja, das brauchte sie, dass man sie bemerkte und sich für sie interessierte, aber sie gab es auch so reich zurück.
Sie fehlt mir.
Eine Art Wunder. GENT
Sonntag, 7. März 2004. Er ruft an, früh, aufgeregt. Ob ich mit ihm nach Gent fahren würde, heute?
Ich würde jederzeit sofort überall mit ihm hinfahren.
Er ist meine große Liebe. Er weiß das, und es ist ihm egal, nein, er nutzt es aus. Meine Zeit, meine Arbeit, mein Auto, mein Geld, meine Kontakte — das kann er alles gut brauchen, nur meine Liebe nicht. Das wird ihm zu viel, mit zwei geschiedenen und einer aktuellen Frau, ein paar Geliebten, einem nicht zu stillenden Hunger. Er kann nicht lieben, ich weiß das, er kann nur begehren, und mich begehrt er nun mal nicht. Ich ihn übrigens auch nicht. Ich liebe einfach nur an ihn hin mit meinem ganzen Herzen — wie er über Musik spricht, wie er lacht, wie er mich ansieht beim Wein, wie er sich kleidet, wie er riecht — ich liebe alles an ihm, außer seinem Gang. Sein Gang ist lächerlich. Am Gang sieht man, dass er aufgeblasen und eitel und ein Wichtigtuer ist. Er ist kein guter, er ist nicht mal ein netter Mensch, keiner meiner Freunde mag ihn, aber mich hat es getroffen, was will man machen. Irgendwann hört so etwas zum Glück ja auch wieder auf, und man kann weiteratmen, aber am 7. März 2004 war ich noch nicht so weit.
Natürlich würde ich mit ihm nach Gent fahren, in meinem schönen neuen Auto mit dem unbegreiflichen neuen Navi.
Warum nach Gent?
Weil dort am Sonntag, dem 7. März 2004, in der Genter Oper, Vlaamse Opera, zum allerletzten Mal Leoš Janáčeks Káťa Kabanová gespielt wurde, eine Inszenierung von Robert Carsen aus Antwerpen. Er liebte nichts mehr als die Musik von Leoš Janáček, und auch dafür liebte ich ihn. Die Frauen erreichten ihn nicht, keine, oder sagen wir: keine länger als ein paar Wochen, aber die Musik war seine große Liebe, dieser Musik war er treu, seit seiner unglückseligen Kindheit in einem unglückseligen Land, heimlich am Radio.
Natürlich fuhren wir hin. Und lachten, weil wir das neue Navi nicht verstanden, Navi, das muss man lernen: »Fahren Sie links, dann bleiben Sie rechts« — ja, was denn nun? Das begreift man nicht auf Anhieb, aber man weiß, um nach Gent zu kommen, muss man irgendwie über Aachen und dann Richtung Brüssel oder Antwerpen, und irgendwann stand da Gent, und die Oper und die Tiefgarage findet man immer.
Er fuhr, ich saß glücklich daneben, denn ich wusste, mehr Nähe wird es nie geben.
Ich sollte mich irren.
Wir erfuhren: restlos ausverkauft. Es gab keine einzige Karte mehr, es war nichts zu machen. Er wurde fahl, er sackte zusammen, ich sah den Menschen, den ich liebte, vor Kummer schrumpfen und ich brach in Tränen aus. »Sie wissen nicht, um was es geht«, sagte ich zu der fassungslosen Dame am Kartenschalter. »Es geht um alles, es geht fast um Leben und Tod, wir kommen aus Köln, wir müssen diese Inszenierung sehen, ich kann es Ihnen nicht erklären, aber es hängt alles davon ab. Alles.«
Sie schaute ratlos und erschüttert auf den bleichen Mann, die weinende Frau, und schließlich sagte sie: »Ich kann vielleicht etwas machen. Eine Ausnahme. Ein Notfall, ja?« »Ja«, rief ich, »ein Notfall, bitte!« Und sie schrieb uns ein Kärtchen. »Kommen Sie kurz vor der Vorstellung«, sagte sie. »Ehe die Türen geschlossen werden. Gehen Sie zur vorderen Tür links. Ich werde dem Kollegen Bescheid sagen. Er wird Sie mit diesem Kärtchen hier einlassen, und dann stellt er zwei Stühle für Sie hin. Es ist einmalig. Es ist eine Ausnahme, ja?«
Ich zog mein Portemonnaie, ich hätte jeden Preis bezahlt, sie winkte ab. »Eine Ausnahme.«
Und so war es. Dieses Kärtchen öffnete uns die Tür zum ersehnten Paradies. Wir saßen nebeneinander auf Klappstühlen. Und wir hörten und sahen. Wir erlebten die Geschichte der leidenschaftlichen Katja, die Tichon geheiratet hat, der kalt ist, und die Boris liebt, der sie verlässt, und deren Schwiegermutter alles tut, um ihr Unglück noch größer zu machen, und die am Ende ins Wasser geht, in die Wolga. Die Bühne war die Wolga, es war atemberaubend, wie haben sie das gemacht? Die ganze Bühne: Wasser. Und die einsame Frau verschwindet — singend — im Wasser.
Und der Mann neben mir weinte, die Tränen liefen ihm übers Gesicht, und er hielt meine Hand, zum ersten und einzigen Mal, und es war das Größte und Schönste, was ich mit ihm erlebt habe, viel mehr, viel näher als das, was die anderen Frauen mit ihm erlebten.
Den Mann gibt es längst nicht mehr in meinem Leben, das Herz ist an der Stelle ein wenig vernarbt, ja, das schon, aber den kleinen Zettel habe ich immer aufbewahrt, mit dem uns die gütige Frau an der Kasse, die gespürt hatte, dass hier irgendwas loderte, diese zwei Stunden ermöglicht hatte. Es stand nichts anderes darauf als »Laissez — Passer«, lasst sie durch. Das, was mitunter in Kriegs- und Krisenzeiten auf Passierscheinen für verzweifelte Menschen steht, die im Nirgendwo gelandet sind und keine Reisedokumente haben.
Laissez — Passer.
Die Liebe ist passé, alles ist passé, die Erinnerung an den Abend bleibt, das kleine Kärtchen bleibt und zeigt: Alles ist möglich, jede Art von Wunder, jede Art von Liebe.
Das habe ich in Gent erlebt.
PEKING sehen und nicht sterben
W as habe ich immer gelästert über die doofen Deutschen, die mit einem Wohnwagen voll Sauerkraut und deutschem Bier nach Italien fahren und sich dort jeden Tag deutsches Essen kochen …
Und jetzt lerne ich in Peking einen Amerikaner kennen, der sagt, es gäbe in Peking ein Hofbräuhaus, ob ich da mit ihm hingehen wolle?
1aHofbräuhaus — wie in München, auch der Rausch, perfekt
Ein Hofbräuhaus! Ich hatte eine ganze Woche schon Hühnerfüße essen müssen, Schweineohren und andere widerliche Dinge. In China bestellt man nicht nett wie beim sogenannten Chinesen in Köln »Nr. 28, Hühnchenfleisch mit Mandeln und Bambussprossen« — da kommt das ganze Tier in Einzelteilen auf den Tisch, und es ist gruselig. Aber nun ein Hofbräuhaus! Mitten in Peking! Paulanerbier, Weißwurscht mit süßem Senf, Brezeln, die Bedienung im Dirndl, der chinesische Schankkellner in Lederhosen, aus dem Lautsprecher bayerische Volksmusik — es war der be-scheuerte Himmel auf Erden, für zwei, drei Stunden und einen ordentlichen Rausch.
Und dann wieder raus (auch ohne Corona damals fast nur mit Atemmaske) in dieses völlig unbegreifliche mausgraue Peking ohne Atemluft, Beijing, pei-ching, nördliche Hauptstadt. Der Amerikaner war sehr lustig. Mir zuliebe hat er auf der Großen Mauer, chang cheng — sie ist ein Wunder, 8850