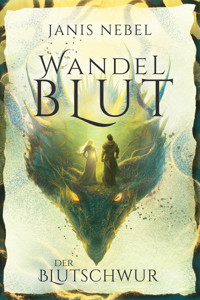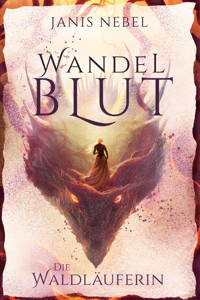6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Flucht vor dem Roten König hat Merle mit dem geheimnisvollen Kenai zusammengeführt – einem Begabten wie sie selbst. Seine Macht erschreckt sie ebenso wie sein Angebot, ihr bei der Kontrolle ihrer Gabe zu helfen. Denn seit der verhängnisvollen Nacht, in der ihre Kräfte außer Kontrolle gerieten und sie alles verlor, fürchtet Merle ihre eigenen Fähigkeiten beinahe genauso sehr wie den Roten König. Als Merle erfährt, dass auch ihre Familie in Gefahr schwebt, scheint Kenai ihre einzige Hoffnung zu sein. Doch wie soll sie einem Mann vertrauen, der ihre dunkelsten Ängste verkörpert? Je länger sie an seiner Seite bleibt, desto schwerer wird es für sie, den Zwiespalt aus wachsender Zuneigung und Misstrauen zu ertragen. »Im Bann des Roten Königs« ist der zweite Band der abgeschlossenen YA-Fantasy-Trilogie "Merles Fluch". YA-Fantasy trifft auf Slowburn-Romantasy, Coming-of-age und ein atmosphärisches Mittelalter-Setting. Für Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren. ---- DIE MERLES FLUCH TRILOGIE: Band 1: Die Gabe des Roten Königs , Band 2: Im Bann des Roten Königs , Band 3: Der Turm des Roten Königs
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Im Bann des Roten Königs
Über die Autorin
Janis Nebel wurde 1985 in Bayern geboren und studierte Archäologie und Geographie. Danach arbeitete sie als Archäologin in Rettungsgrabungen an verschiedenen Orten Süd- und Mitteldeutschlands. Nach einem kurzen Abstecher in die Welt der Wirtschaft und den Büroalltag zog sie 2017 nach Frankreich und erfüllte sich dort den lange gehegten Traum, einen Roman zu schreiben. Ihr Debüt „Die Gabe des Roten Königs“ erschien 2019.
Mehr zur Autorin: https://janisnebel.com
Bücher von Janis Nebel
Die Merles Fluch-Trilogie:
Band 1 | Die Gabe des Roten Königs
Band 2 | Im Bann des Roten Königs
Band 3 | Der Turm des Roten Königs
Wandelblut-Saga
Band 1 | Die Waldläuferin
Band 2 | Der Asrenkrieger
Band 3 | Der Blutschwur
Band 4 | Der Abschlussband erscheint 2025!
Trage dich in Janis Nebels Newsletter ein, um das Erscheinungsdatum zu erfahren, sobald es feststeht!
Jetzt anmelden!
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Der Turm des Roten Königs | Band 3 der Merles Fluch Trilogie
Mehr von Janis Nebel
Danksagung
Kapitel1
Auf ihrem Gesicht spürte Merle die Wärme von Sonnenstrahlen, und durch ihre geschlossenen Augenlider sah sie rote und gelbe Lichtschlieren tanzen. Es roch nach Moder und fauligem Schlamm. Leises Plätschern drang an ihre Ohren. Außerdem bewegte sich der Boden, auf dem sie lag. Das Moor, dachte sie, ich bin ins Moor gefallen!
Merle riss die Augen auf. Sonnenlicht blendete sie. War sie etwa im Moor eingeschlafen? Das Bild eines Hirsches zuckte in ihrem Gedächtnis auf. Ein Hirsch, der im Schlamm steckte und langsam versank, wie sehr er auch dagegen ankämpfte. Sie wollte nicht enden wie er. Am Grunde eines schwarzen Sees, für immer erstarrt.
Grauen packte sie, und sie hievte sich mit einer ungelenken Bewegung in eine sitzende Position. Der Boden schwankte nun bedenklich, und ihr Körper schrie geradezu vor Schmerz. Doch bevor sie den Mund öffnen konnte, legte sich eine Hand darauf. Ihr Schrei erstickte.
Der Arm, der zu der Hand gehörte, zog sie nach hinten und presste sie gegen einen warmen Körper. Ein zweiter Arm griff von der anderen Seite um ihren Leib und hielt sie in einem Schraubstockgriff gefangen, in dem sie nur hilflos mit Armen und Beinen zappeln konnte, wie ein auf den Rücken gefallener Käfer. Panisch versuchte sie die fremde Hand aufzubiegen, aber nur der Zeigefinger rutschte ein wenig nach oben, sodass sie durch die Nase atmen konnte. Ihre Gegenwehr erlahmte viel zu schnell, denn sie fühlte Schmerzen, als wären Nägel in ihre Knochen geschlagen worden.
Dann nahm sie eine Bewegung an der Grenze ihres Sichtfelds wahr. Sie sah auf, soweit die Arme es zuließen. Dicht beieinanderstehende Stämme und aus dem Wasser ragende Wurzeln umgaben sie wie ein löchriger Vorhang. Dazwischen dichtes Laub und das Funkeln der Sonnenstrahlen, die sich auf der stillen Wasserfläche brachen. Das Wasser war so klar, dass Merle die darunter liegende Welt aus Pflanzen und Algen sehen konnte. Kleine Fische schillerten dazwischen, und das Boot schien wie schwerelos über dem wehenden Grün zu schweben. Das war nicht das Moor, in dem der kleine Hof ihrer Eltern lag und das sie von Kindesbeinen an kannte. Stattdessen befand sie sich mitten in einem Wasserwald. Sie saß in einem Boot, das sich zwischen Ästen und Zweigen verfangen hatte.
Wieder bemerkte sie eine Bewegung. Dort drüben, zwischen den Blättern, glitten lautlos andere Boote vorüber. Männer standen darauf und spähten in alle Richtungen. Sie trugen dunkle Mäntel, und Schwerter hingen an ihren Gürteln. Einer hielt einen gespannten Bogen, mit bereits angelegtem Pfeil. Die Männer waren auf der Jagd. Und wer immer Merle festhielt, wollte offenbar nicht von ihnen gesehen werden. Sie spürte seine Anspannung in ihrem Rücken und seinen lautlosen Atem im Nacken. Ein Hauch von Gras und sonnenwarmen Steinen umwehte sie.
Es plätscherte leise, als ein Bewaffneter seinen langen Stab ins Wasser tauchte und sein Boot in ihre Richtung abstieß. Ein kaltes Kribbeln rieselte Merles Wirbelsäule hinunter. Sind wir etwa die Gejagten? Ihre Muskeln wollten sich spannen, aber der stechende Schmerz darin ließ sie gleich wieder nachgeben.
Der Bewaffnete glitt näher, und der Griff um Merles Rumpf wurde fester. Aber noch hatte der Mann im anderen Boot sie nicht zwischen den Stämmen ausgemacht. Wenn er jedoch noch näher kam …
Ein durchdringendes Pfeifen ertönte, wie von einem jungen Blässhuhn. Der Mann stoppte sein Boot und antwortete mit demselben Pfiff. Einen Moment stand er still und lauschte. Und auch Merle hielt die Luft an. Doch dann stieß er das Boot ab und trieb lautlos in eine andere Richtung davon.
Merle atmete aus und folgte ihm mit Blicken, bis er zwischen den Stämmen verschwunden war. Erst dann löste sich die Hand von ihrem Mund, und die Arme ließen sie los.
Merle drehte sich um. Ein Mann mit silbernen, weit auseinanderstehenden Habichtaugen blickte sie zwischen schwarzen Strähnen hindurch an. Kenai. Aber etwas an seinem Gesicht war anders. Sein linkes Augenlid war gerötet und knotig verdickt. Es hing tiefer als das rechte, sodass seine linke Gesichtshälfte wirkte, als würde ihm vor Müdigkeit das Auge zufallen, während sie die rechte hellwach und offen ansah.
„Kenai, was …“, begann Merle.
Aber er legte einen Finger auf ihre Lippen. Dann tauchte er lautlos ein Ruder ins Wasser und schob das kleine Boot noch tiefer ins Dickicht. Erst als es so dicht geworden war, dass die Äste und Blätter sich wie eine Zeltplane um sie wölbten, hielt er inne. Er zog das Ruder aus dem Wasser und legte es ins Boot, darauf bedacht, keine lauten Geräusche zu verursachen.
Merle kramte unterdessen in ihrem Gedächtnis und versuchte, das Letzte, woran sie sich erinnerte, mit ihrer jetzigen Situation in Einklang zu bringen. Kenais Auge. Ein schrecklicher Erinnerungsfetzen flackerte auf, in dem sie das Messer ihres Vaters in dieses Auge eindringen sah. Der Schmuggler. Er hatte Kenai und sie eingesperrt und an Ray und Greta ausliefern wollen. Und dann war da dieser Furcht einflößende Gabenpriester Feistar Bergan gewesen, mit dem funkelnden Glasanhänger an der Kette …
Die Gedanken und Bilder kreisten wild in Merles Kopf, und sie hatte Mühe, sie in eine zeitliche Ordnung zu bringen. Zu ihren schmerzenden Muskeln und Knochen gesellte sich nun ein pulsierender Kopfschmerz. Sie schloss die Augen und rieb sich die Schläfen.
„Wo sind wir?“, flüsterte sie.
„Auf einem Nebenarm des Dal“, antwortete Kenai mit seinem rollenden Akzent. „Eine halbe Tagesreise von Dalsburg flussabwärts.“
Merle schüttelte den Kopf und blickte ihn verwirrt an. „Was machen wir hier? Wie sind wir hierhergekommen? Und wer sind diese Männer?“ Sie wies in die Richtung, in die der Bewaffnete auf dem Boot verschwunden war. „Und dein Auge …“ Sie spürte, wie ihr langsam schwindlig wurde. Es war doch weg gewesen, das Auge. Wie konnte es so plötzlich heilen? Und das Feuer! Und Skip, wo war Skip?
Eine Welle der Panik durchspülte sie. Sie wollte aufspringen, Kenai am Kragen packen und ihn schütteln, damit er ihr endlich erklärte, was geschehen war. Doch als sie auf die Beine zu kommen versuchte, durchfuhr sie wieder Schmerz, und Übelkeit trieb ihr den Speichel in den Mund. Sie war außer Atem, als wäre sie einmal quer durch ganz Dalsburg gerannt. Was war nur mit ihr los? Warum fühlte sie sich so schwach? Und diese Schmerzen, war sie etwa verletzt? Sie tastete ihre Arme und Beine ab, fand aber nichts Ungewöhnliches. Irgendetwas Wichtiges musste ihr entgangen sein.
„Beruhige dich“, flüsterte Kenai. „Ganz ruhig.“
Er hatte einen festen Zug um den Mund. Er war nervös. Und das wiederum beunruhigte Merle noch mehr. Denn obwohl sie Kenai nicht gut kannte, wusste sie, dass er ein Mann war, den wenig aus der Ruhe bringen konnte. Sie setzte sich langsam auf, bemüht, keine Bewegung zu machen, die die Schmerzen erneut aufwallen ließ. Die Übelkeit ebbte ein wenig ab.
„Was ist passiert?“, fragte sie und bemühte sich, ihre Stimme ruhig und fest klingen zu lassen.
Kenai setzte sich ihr gegenüber auf die Holzlatte, die die einzige Sitzgelegenheit auf dem kleinen Boot darstellte. „Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst?“
Merle dachte angestrengt nach. „Wir waren in der Lagerhalle des Schmugglers. Er hat dich verletzt, und dein Auge … es war …“ Sie sah unsicher zu ihm hoch.
Doch Kenai verzog keine Miene. Das halb geschlossene Auge unter der wulstigen roten Narbe blickte genauso stechend auf sie hinunter wie das andere. „Es war nur das Lid“, sagte er schlicht, als würde er davon erzählen, dass er sich den Daumen blau gehämmert hatte. Dann wedelte er mit der Hand, um Merle dazu zu bringen, weiter zu erzählen.
Merle fuhr fort. „Ray und Greta waren da. Sie wollten die Gabe … meine und deine … in einem Anhänger an einer Kette fangen, einem Gabenkompass, so nannten sie es. Aber dann …“ Merle presste die Lippen zusammen, als die Erinnerung zurückkehrte. „Skip. Er hat uns gerettet. Er hat den Gabenkompass zerstört.“
Sie stockte. Alles, was danach passiert war, verschwand in einem Nebel. Sie sah nur unzusammenhängende Fetzen. Da war Ray, ein Messer schimmerte. Skips leblos herabhängende Hand in einem blutigen Verband. Ihre Augen brannten, und ihr Kopfschmerz hämmerte nun heftig gegen ihre Stirn. Wieder stieg Übelkeit in ihr auf, und sie schluckte dagegen an. „Was ist mit Skip passiert?“
Kenai blickte ernst auf sie herab. Er hatte die Ellenbogen auf die Knie gestützt und die Finger ineinander verschränkt. Für einen kurzen Augenblick glaubte sie ein Schimmern in seinen Augen zu sehen.
„Er ist tot“, sagte er schlicht. „Der Sohn der Hure hat ihn erstochen, kurz bevor du alles in Brand gesetzt hast.“
Kenais Gesicht verschwamm vor ihren Augen. Skip war tot? Alle Kraft wich aus ihrem Körper, und sie sank gegen die Bootswand zurück. Das Wasser schwappte dagegen, als der kleine Kahn dabei ins Schwanken geriet. Es kümmerte Merle nicht. Skip war tot. Von Ray erstochen. Vor ihren Augen. Eine dumpfe Taubheit vernebelte ihre Sinne. Als hätte jemand einen Gabenkompass aus der Kiste geholt, dachte sie noch, bevor die Übelkeit sie übermannte und sie sich über den Bootsrand hinweg ins Wasser übergab.
Als das Würgen nachließ, sank Merle zurück und schloss die Augen. Mit den Fingern tastete sie nach der Perle. Nach Skips Perle. So blau wie seine Augen. Sie lag warm auf ihrer Haut unter dem Hemd. Klimpernd stieß die schwarze Perle mit der silbernen Zickzacklinie dagegen. Kenais Perle. Merle hatte das Gefühl zu ersticken und gleichzeitig in eine bodenlose Tiefe zu stürzen. Die Perlen waren das Einzige, was sie noch halten konnte.
Atmen, dachte sie. Nur atmen. Der Wasserwald versank. Feuer und Wasser wechselten sich ab und ließen ihren Leib einmal verbrennen und dann wieder ertrinken. Skips blasses Gesicht tauchte hin und wieder aus den Nebeln auf. Er lächelte und winkte ihr mit seiner Hand im blutigen Verband zu. „Willst du noch eine Perle?“, fragte er dabei und hielt ihr seine noch heile Hand hin. Darin lag aber keine Perle, sondern ein gläserner Gabenkompass. Und er leuchtete so sehr, dass Merle alle Sinne davon vergingen.
* * *
Als sie das nächste Mal erwachte, war es dunkel, und es roch nach gegrilltem Fisch. Sie lag auf einer Decke, und darunter spürte sie kühle Erde. Sie drehte den Kopf und sah Kenai über ein winziges Feuer gebeugt, das er mit Steinen und Rindenstücken abgeschirmt hatte. Sein ernstes Gesicht war warm erleuchtet, und mit der Hand hielt er einen Stock in die Flammen. Als sie sich bewegte, blickte er hoch.
„Hast du Hunger?“, fragte er leise.
Merle setzte sich stöhnend auf. Ihr Körper war noch immer schwer wie Blei und so schwach wie der einer Hundertjährigen. Ihr Kopf protestierte sofort gegen die aufrechte Haltung.
„Warte“, sagte Kenai und kam herüber. „Ich helfe dir.“
Ehe Merle begriff, was er tat, schob er seine Arme unter ihren Nacken und ihre Knie und hob sie hoch. Dann trug er sie hinüber zum Feuer und setzte sie so ab, dass sie sich gegen einen umgestürzten Baumstamm lehnen konnte. Er tat es routiniert, als wäre es das Normalste der Welt.
Merle aber stockte der Atem. Sie fühlte sich hilflos wie ein Neugeborenes. Von der Bewegung war ihr wieder so schwindlig geworden, dass sie einen Augenblick brauchte, um klar zu sehen. Warum war sie nur so schwach? Kenai musste sie für eine wahre Memme halten!
Er benahm sich jedoch, als wäre er es gewöhnt, dass er sie so herumtrug. Und wahrscheinlich war er das auch, wurde Merle peinlich bewusst. Sie hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, seit sie Dalsburg verlassen hatten. Ein paar Stunden? Tage? Wochen?
Kenai war inzwischen zum Feuer gegangen und mit einem am Stock gebratenen Fisch zurückgekehrt. Er hielt ihn ihr hin.
Merle fühlte bohrenden Hunger und hob die Hand, um den Fisch entgegenzunehmen. Doch sofort fuhr ihr ein rasender Schmerz in Schulter und Wirbelsäule. Sie stieß zischend die Luft durch ihre zusammengebissenen Zähne und ließ den Arm wieder sinken.
Kenai setzte sich neben sie und seufzte. Er begann kleine Teile vom Fisch abzuzupfen und zu entgräten.
„Wasser konnte ich dir einflößen“, sagte er. „Aber feste Nahrung nicht. Du musst etwas essen.“
Damit hielt er ihr ein mundgerechtes Stück weißen Fischfleischs an die Lippen.
Merle presste den Mund zusammen. War er tatsächlich gerade dabei, sie zu füttern? Der Kopfschmerz pochte noch heftiger gegen die Rückseite ihrer Augäpfel, als Hitze in ihre Wangen stieg.
„Iss“, sagte er und hob dabei die Augenbrauen.
Merles Magen knurrte noch einmal vernehmlich. Sie versuchte erneut die Hand zu heben, um ihm das Fleisch abzunehmen. Aber sogleich schossen spitze Pfeile durch ihre Wirbelsäule. Mit einem unwilligen Grunzen öffnete sie schließlich den Mund, und Kenai schob den Happen zwischen ihre Lippen.
Sobald das Stück Fisch ihre Zunge berührte, überfiel sie ein solcher Heißhunger, dass sie keinen Gedanken mehr an ihre Würde verschwendete. Gierig schlang sie hinunter, was Kenai ihr in den Mund steckte. Jeder Bissen schmeckte wie Selmas bester Kuchen. Saftig, fettig und mit knuspriger Haut. Merle glaubte nie etwas Besseres gegessen zu haben, und sie nahm den Mund so voll, dass sie sich verschluckte und husten musste. Ihre Muskeln verkrampften sich dabei. Schmerzwellen rauschten durch ihren Körper, und sie hatte Mühe, wieder zu Atem zu kommen.
„Na, na“, mahnte Kenai. „Nicht so hastig.“ Dann murmelte er etwas in seiner Sprache, stand auf und brachte Merle einen kleinen, mit Wasser gefüllten Ledersack.
„Trink.“
Merle tat, was er sagte, und stürzte das Wasser in tiefen Zügen hinunter.
Gleich darauf fühlte sie sich elend und glaubte, wieder erbrechen zu müssen. Sie war sicher, dass sie weder besonders viel gegessen noch viel Wasser getrunken hatte, aber sie fühlte sich so voll, wie nach einem Festtagsessen. Und erschöpft war sie auch. Müde lehnte sie den Kopf an den Baumstamm und sah zu, wie Kenai sein Messer reinigte und das Feuer austrat. Der Himmel war wolkenlos, und der volle Mond schien so hell auf sie hinunter, dass die kleine Lichtung von den scharfen Schatten der umstehenden Bäume durchschnitten wurde. Merle gähnte. Am liebsten hätte sie sich gleich wieder hingelegt und geschlafen. Aber sie musste mit Kenai sprechen.
„Wo sind wir?“, fragte sie mit krächzender Stimme. „Wie sind wir hierhergekommen? Und … wie lange ist es her, dass ich … dass ich …“
Kenai wischte sein Messer an seiner Hose trocken und steckte es in die kleine Lederscheide an seinem Gürtel. Dann nahm er die Decke vom Boden auf, kam zu ihr herüber und legte sie ihr sanft über die Schultern. Er setzte sich neben sie und rieb sich müde die Augen.
„Wir sind in der Nähe von Karsk. Du warst fast zwei Tage bewusstlos. Heute Nachmittag bist du zum ersten Mal wach geworden. Und jetzt hast du wieder ein paar Stunden geschlafen.“
Kenai gähnte und legte den Kopf zurück gegen den Baumstamm, um die Sterne zu betrachten. Er war dünner geworden, fand Merle. Sein Gesicht schien härter, die Wangenknochen schärfer. Erschöpft sah er aus.
„Ich erinnere mich an Feuer“, sagte Merle leise.
Kenai blickte sie prüfend an. Sein Adamsapfel zuckte, bevor er sagte: „Du hast es entzündet. Erinnerst du dich nicht?“
Merle schüttelte den Kopf.
Er runzelte die Stirn. „Du hast den zweiten Gabenkompass zertrümmert. Und dann haben wir unsere Gaben vereint. Wir hätten sie fast fertiggemacht, wir beide.“ Ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen. Doch gleich verschwand es wieder. „Aber dann hast du die Verbindung gekappt und hast … irgendwie hast du alle Energie in Feuer umgewandelt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Nicht in diesem Ausmaß.“
Merle blickte ihn verwirrt an. „Und dann?“
„Dann habe ich das Chaos genutzt und mich davongemacht. Mit dir auf meinem Rücken.“
„Aber was … wie …?“
„Du warst nicht mehr bei Bewusstsein. Hast es übertrieben mit der Gabe. Das kommt vor, wenn man keine Erfahrung hat. Eine Zeit lang habe ich sogar gefürchtet, dass du es nicht schaffen würdest. Du warst so schwach, hast kaum noch geatmet.“ Er strich sich das Haar aus den Augen. Sein Ausdruck war sehr ernst. „Mach das nicht noch mal, hörst du? Das hätte schiefgehen können. Wenn du es zu sehr übertreibst, kann die Gabe dich umbringen. Das gilt für Nehmer und Geber gleichermaßen.“
Merle blickte in sein durch das verdickte Augenlid und die schiefe Nase seltsam unsymmetrisches Gesicht. Sie hätte die Narbe gern mit den Fingern berührt. Aber das konnte sie natürlich nicht. Verlegen wandte sie den Blick ab, und ein Stich fuhr dabei in ihre Halswirbelsäule.
„Kommen daher diese Schmerzen?“, fragte sie und versuchte die verkrampften Muskeln wieder zu lockern.
Kenai nickte. „Du hast dir zu viel abverlangt. Aber es vergeht wieder. In ein paar Tagen. Hoffe ich zumindest.“
Merle hob vorsichtig den Arm und rieb sich den wehen Nacken. Dabei streiften ihre Finger das Lederband, an dem die beiden Perlen hingen. Sie holte sie unter ihrem Hemd hervor und ließ sie durch ihre Finger gleiten. Skip war tot. Erstochen von Ray. Merles Bauch ballte sich zu einer schwarzen, eisigen Kugel zusammen. Ihre letzte Erinnerung an ihn war sein entsetztes Gesicht. Entsetzt, weil er sah, wie sie die Gabe benutzte. Die Gabe, die ihm so verhasst war, weil sie seinen Eltern das Leben genommen hatte. Sein knochiger Körper war noch magerer als gewöhnlich gewesen, und seine linke Hand hatte in einem blutigen Verband gesteckt. Man hatte ihn im Kerker des Roten Königs gefoltert.
Merles Gedankengang stoppte abrupt. Im Kerker, aus dem es kein Entkommen gab. Und doch… wie war er in die Lagerhalle des Schmugglers gelangt? Mühsam kramte sie in ihrem verwirrten Gedächtnis. Erinnerungsfetzen drangen an die Oberfläche. Greta und Ray, denen Skip vorwarf, sie hätten ihn belogen. Greta, die behauptete, Skip hätte nicht nur Merle, sondern auch ihre Mutter entkommen lassen. Ihre Mutter. Bel.
Merle sog die Luft so schnell ein, dass ein heißer Stich durch ihren Brustkorb fuhr. Skip war freigekommen, weil er Bel verraten hatte! Er hatte preisgegeben, dass sie eine Begabte war und wo sie lebte. Greta und Ray mussten sich direkt danach auf den Weg gemacht haben!
„Kenai“, flüsterte Merle. „Wir müssen sofort zum Bruch.“
Er blickte sie irritiert an. „Wohin?“
„Zum Bruch! Zum Hof meiner Eltern im Riedinger Hochmoor. Greta und Ray sind gewiss dorthin unterwegs, weil sie wissen, dass meine Mutter eine Begabte ist.“
Kenai starrte sie an, die Augen zu Schlitzen verengt. In seinem Kopf arbeitete es sichtlich, bevor er sagte: „Wie kann es sein, dass deine Mutter eine Begabte ist und dir all die Jahre nicht das Geringste darüber beigebracht hat?“
Merle wurde bewusst, dass Kenai gar nichts über ihre Familie wissen konnte. „Meine Mutter spricht nicht“, sagte sie langsam. „Sie ist ein wenig merkwürdig. Bis zu meinem Aufbruch nach Dalsburg wusste auch ich nicht, dass sie eine Begabte ist.“
Kenai schüttelte ungläubig den Kopf. „Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ich glaube, das Beste wäre, du schläfst noch ein wenig.“
„Es ist die Wahrheit!“, fuhr Merle auf, und ihre Wirbelsäule jagte dabei eine solche Schmerzwelle durch ihren Körper, dass sie die Zähne zusammenbeißen musste. Als der Krampf abebbte, fuhr sie leiser fort: „Wir müssen vor ihnen im Bruch sein und meine Eltern warnen.“
„Wer sind Greta und Ray?“, fragte er mit dem harten Ton eines Vernehmers.
„Rebellen“, sagte Merle. „Oder so was Ähnliches. Sie standen mit dem Schmuggler in Verbindung. Sie waren es auch, die Bergan in die Lagerhalle brachten.“
„Die Hure und ihr Sohn? Der, der deinen Freund …?“ Er sprach den Satz nicht weiter, offenbar um zu vermeiden, Merle noch einmal Skips Tod ins Gedächtnis zu rufen.
Sie war ihm dankbar, obwohl es nichts nützte. Sie dachte trotzdem daran, und es schmerzte wie die verdammte Hölle. Sie nickte, bemüht den Heulkrampf zurückzuhalten, der sich in ihrer Brust ballte.
„Ich glaube nicht, dass sie sich gleich auf den Weg gemacht haben“, sagte Kenai. „Möglicherweise hat dieser Ray nicht einmal überlebt. Er war es, den das Feuer zuerst erwischt hat.“
„Du meinst, sie könnten tot sein? Beide?“
Kenai zuckte mit den Schultern. „Ray möglicherweise. Seine Mutter sicher nicht. Als ich gegangen bin, waren sie nicht mehr im Raum. Aber das gilt für so ziemlich jeden, der noch imstande war zu gehen.“ Er hielt inne, als überlegte er, noch etwas hinzuzufügen, schloss dann aber den Mund.
Merle ließ diese Information einen Augenblick sacken. „Ich muss dennoch zum Bruch“, sagte sie dann. „So schnell wie möglich. Greta lebt. Und auch wenn Ray tot wäre und sie nicht sofort etwas unternommen hätte, könnte sie doch Leute losschicken. Ich muss meine Eltern warnen. Das ist die einzige Chance, die sie haben.“
„Du kannst nicht gehen. Zumindest nicht gleich. Du bist ja nicht mal fähig, dich auf den Beinen zu halten.“
Mühsam richtete sich Merle auf. „Verstehst du nicht, Kenai? Wenn ich es nicht tue, dann sterben sie! Und es ist meine Schuld, weil ich so blöde war, Hals über Kopf den Bruch zu verlassen, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das haben könnte!“ Merles Stimme war immer lauter geworden. Ungeduld, Trauer und Wut brodelten in ihr und formten ein explosives Gemisch.
Kenais graue Augen schimmerten. „Ich verstehe sehr gut. Besser, als du wahrscheinlich denkst. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass du dich kaum bewegen kannst. Und auch nicht daran, dass halb Dalsburg auf der Suche nach uns die Umgebung durchkämmt. Wir hatten verdammtes Glück, dass wir bisher noch nicht entdeckt worden sind. So lange, bis du wieder imstande bist zu laufen, bleiben wir hier!“
„Ich werde gehen!“, fauchte Merle. „Und wenn ich kriechen muss!“
Kenai starrte sie wütend an. „Was du vorhast, wäre blanker Selbstmord. Es wimmelt überall von Soldaten und Rebellen. Und jeder einzelne von ihnen sucht nach uns!“
Merle spürte seine Wut in der Luft vibrieren. Einen Moment fürchtete sie sich vor ihm. Sie wusste, er hatte recht. Aber sollte sie ihre Eltern einfach ihrem Schicksal überlassen?
„Bitte hilf mir“, sagte sie plötzlich. Die Worte und der flehende Ton überraschten sie selbst.
Kenai blinzelte, als hätte sie ihm eine unerwartete Ohrfeige versetzt. „Ich kann nicht“, entgegnete er. Es klang nicht mehr wütend, sondern eher hilflos.
„Aber… du hast mich bis hierher gebracht“, sagte Merle. „Alleine wärst du viel weiter gekommen. Du könntest längst in Sicherheit und auf dem Weg in den Süden sein. Zu deiner Familie. Warum?“
Im blassen Licht des Vollmonds sah Merle, wie Kenais Kiefer mahlten, während er die Hände ineinander krampfte und auf den Boden starrte.
„Ich sagte dir bereits, dass wir Begabte zusammenhalten müssen“, erklärte er, ohne sie anzusehen. „Dich in Dalsburg zurückzulassen, hätte entweder deinen Tod oder Schlimmeres bedeutet.“ Abrupt stand er auf und entfernte sich ein paar Schritte. Einen Augenblick stand er schweigend mit dem Rücken zu ihr und blickte zum sternenübersäten Himmel hinauf. „Ich bin müde, Merle. Ich habe seit zwei Tagen kaum geschlafen, und ich kann nicht mehr klar denken. Wenn deine Mutter wirklich eine Geberin ist, dann wäre es in der Tat schlimm, wenn sie den Rebellen oder dem Roten König in die Hände fällt. Aber wir können mit dem Boot nicht flussaufwärts fahren. Nicht wenn ich der einzige Ruderer bin und nicht mit so vielen Feinden, die auf dem Fluss nach uns suchen. Wir müssten zu Fuß gehen. Und wie ich das sehe, bist du noch zu schwach dafür.“ Er drehte sich zu ihr um. „Das kannst du doch nicht leugnen, oder?“
Als sie nicht antwortete, fuhr er fort: „Ich kann dich nicht bis in dein Hochmoor tragen. Wir haben keine Pferde, und selbst wenn, wären sie viel zu auffällig. Pferde machen Lärm, hinterlassen Spuren. Und wir sollten befestigte Wege meiden, uns an unbesiedelte Gegenden halten.“ Er kam näher und hockte sich vor sie hin, sodass sie gezwungen war, ihm ins Gesicht zu sehen. „Wir müssen warten, bis du wieder kräftig genug bist, um zu gehen. Siehst du das ein?“
Merle nickte langsam.
„Gut“, sagte er. „Dann lass uns eine Nacht schlafen. Wenn wir morgen ausgeruht und satt sind, können wir darüber nachdenken, wie wir das Ganze anstellen werden.“
Kapitel2
Der vertraute Geruch von Kräutern hing in der Luft. Einen Moment glaubte Merle sich in ihrer Dachkammer im Bruch. Aber es rauschte und roch nach Wasser. Ein sanfter Wind streichelte ihre Wange. Sie öffnete die Augen und sah, dass sie auf dem Boden lag, auf derselben Decke, die Kenai ihr in der Nacht um die Schultern gelegt hatte. Aber sie war nicht mehr auf der kleinen Lichtung, an die sie sich erinnerte. Sie lag unter einem aus Ästen und Blättern geflochtenen Dach, das sie vor der Sonne abschirmte. Der Boden bestand aus feinem hellem Sand und runden Kieseln. Kleine Wellen schwappten nur wenige Schritte von ihr entfernt an den kleinen Strand.
Vorsichtig stützte Merle sich mit den Armen ab und machte einen zaghaften Versuch, sich aufzusetzen. Zu ihrer Überraschung blieb der Schmerz aus. Sie spürte nur ein dumpfes Pochen, als würde jemand auf einen blauen Fleck drücken. Unangenehm, aber erträglich.
Sie richtete sich auf. Vor ihr im Sand stand ein aus Holz gedrechselter Becher mit einer braunen Flüssigkeit darin, und daneben lag ein gebratener Fisch, halb in ein großes grünes Blatt geschlagen. Und nicht weit davon entfernt befanden sich Kenais Stiefel, unter ihnen sein Mantel und sein Hemd, säuberlich zusammengefaltet.
Merle blickte um sich. Sie befand sich auf einem Flussstrand, den der Dal in einer Windung angespült hatte. Um die kleine Sandfläche herum wuchs dichter Wald und Schilf. Baumgerippe bleichten in der Sonne, und weit draußen auf dem Fluss sah sie Kenai in einem Holzboot stehen. Sein gebräunter Oberkörper war nackt, und er verharrte unbewegt, einen langen Speer wurfbereit in der Hand. Dann, plötzlich, so schnell, dass sie mit den Augen kaum folgen konnte, stieß er zu. Als er den Speer wieder aus dem Wasser zog, zappelte ein Fisch an der Spitze. Er tötete ihn mit einem gezielten Schlag gegen die Bootswand. Danach streckte er sich, blickte in die Ferne und sprang schließlich ins Wasser, so glatt und geschmeidig, wie der Fisch es getan hätte, den er soeben erschlagen hatte.
Merle stieß einen entsetzten Schrei aus. Sie konnte nicht schwimmen und fürchtete sich vor Gewässern. Besonders vor dem Moor, das schon viele ahnungslose Lebewesen verschlungen hatte. Vor nichts hatte sie größere Angst als vor scheinbar grundlosem Wasser. Und Kenai sprang einfach dort hinein. So weit draußen, dass der Fluss vermutlich mehrere Meter tief war. Und schlimmer noch: Er blieb verschwunden! Das Boot trieb nun herrenlos immer weiter flussabwärts!
Merle wuchtete sich ungelenk auf die Füße. Ihr schwindelte heftig, aber sie klammerte sich, die Schmerzen ignorierend, an dem Gestänge des improvisierten Laubdachs fest.
„Kenai!“, rief sie. Ihre Stimme zittrig und rau. Sie musste husten. „Kenai!“
Da tauchte sein Kopf einige Meter vom Boot entfernt aus den Wellen. Mit wenigen Zügen erreichte er es und glitt in einer fließenden Bewegung wieder hinein. Er blickte zu ihr herüber. Dann griff er hastig nach den Rudern und steuerte das kleine Boot in ihre Richtung.
Merle sank erleichtert zu Boden. Einen Moment hatte sie geglaubt, er wäre ertrunken. Der Schreck saß ihr noch in den Knochen, und ihr Körper zahlte ihr die hektischen Bewegungen mit dumpfen Schmerzwellen heim. Zittrig sah sie zu, wie Kenai näher kam, ins hüfthohe Wasser sprang und das Boot halb auf den Strand zog. Dann eilte er auf sie zu.
„Was ist?“, fragte er atemlos. „Hast du jemanden gesehen? Hat dich jemand entdeckt?“
Tropfnass und außer Atem kam er vor ihr zum Stehen. Wasser perlte aus seinen schulterlangen Haaren, und seine schwarze Hose klebte triefend an seinen Beinen.
Merle schüttelte den Kopf. „Nein, ich dachte nur, du wärst ertrunken.“
„Was?“ Kenais Stimme war ungläubig.
„Du bist ins Wasser gesprungen und warst plötzlich verschwunden!“
Er wischte sich die Tropfen aus den Augen. „Du hast niemanden gesehen?“, fragte er noch einmal.
Merle blickte zu ihm hoch. Seine breite Brust und die muskulösen Arme glänzten in der Sonne. Sie schüttelte noch einmal den Kopf.
Kenai schnaubte. Dann ließ er sich neben ihr im Sand nieder und drückte Wasser aus seinen Haaren. „Ich habe nur gefischt“, sagte er. „Kein Grund zur Panik. Ich bin ein sehr guter Schwimmer.“
Merle blickte ihn von der Seite an, wie er dasaß, mit angezogenen Beinen, die braunen Arme locker um die Knie geschlungen. Am liebsten hätte sie sich an ihn gelehnt.
Kenai bemerkte ihren Blick und richtete seine grauen Habichtaugen auf sie. „Iss was“, sagte er. „Du musst zu Kräften kommen.“ Er schob das Blatt mit dem Fisch näher an sie heran.
Zögernd griff sie zu.
„Du siehst schon besser aus“, meinte er mit einem kleinen Lächeln in den Mundwinkeln. „Und aufstehen kannst du anscheinend auch schon.“
Merle nickte. Der Heißhunger hatte sie von Neuem gepackt, und sie schlang den Fisch hinunter. Dann griff sie nach dem Becher und schnupperte daran. Es roch nach Kräutern und auch ein wenig wie das weiße Pulver, das sie ihrer Mutter gegeben hatten, damit sie schlief. Der Tee war noch lauwarm.
„Ich kenne diesen Geruch“, sagte sie misstrauisch.
Kenai grinste nun. „Schlaf tut dir gut. Um so mehr du schläfst, um so schneller wirst du heilen.“
„Dieses Zeug kann mich aber auch betäuben. Wie viel hast du in den Becher getan? Und wo hast du das Pulver überhaupt her?“
Er hob beschwichtigend die Hände. „Das ist Kareiva. Das Kraut wächst hier wild. In meiner Heimat ist es ein gängiges Heilmittel. Es hilft dir zu schlafen. Aber das Pulver, von dem du sprichst, ist eine Droge, die im Süden auf der Basis von Kareiva hergestellt wird. Du brauchst dir aber keine Sorgen zu machen. Das Kraut allein hat eine weniger starke Wirkung.“ Er blickte sie auffordernd an. „Trink, es wird dir guttun.“
Merle zögerte. Auf einmal hatte sie einen bitteren Geschmack im Mund. „Hast du mir das schon vorher eingeflöst? Habe ich deshalb so viel geschlafen?“
Kenais Augen wurden schmaler. „Warum so misstrauisch? Vertraust du mir etwa nicht?“ Offenbar las er die Antwort auf seine Frage in ihrem Gesicht, denn seine Züge wurden hart. „Um dich zu betäuben, bräuchte ich keine Kräuter. Die Gabe ist dafür weitaus besser geeignet.“
Merle spürte Wut in sich aufsteigen, und gleichzeitig rieselte ihr ein kalter Schauder den Rücken hinunter. Was wollte er damit sagen? Hatte er sie schon zuvor mit seiner Gabe betäubt, ohne dass sie es bemerkt hatte? War er zu so etwas fähig? Sie rückte ein wenig von ihm ab. Der Wunsch sich an ihn zu lehnen, war ihr gründlich vergangen. Am liebsten wäre sie nun vor ihm davongelaufen.
Kenai betrachtete sie ungeniert. „Du fürchtest dich vor mir“, stellte er fest.
Merle sah zu Boden. Ja, verdammt! Sie fürchtete sich! Im Grunde war Kenai ein Fremder. Ein Fremder, dem sie mit Haut und Haar ausgeliefert war. Er könnte wer weiß was mit ihr tun! Und sie hatte ihm nicht das Geringste entgegenzusetzen. Ob die Gabe der einzige Grund war, warum er sie hierher gebracht hatte?
„Merle?“ Er blickte sie von der Seite an, und die Härte war aus seinen Zügen gewichen. „Du musst keine Angst vor mir haben. Ich würde nie…“
„Hast du mich betäubt?“, fragte sie barsch.
Er antwortete nicht.
„Hast du mich entführt? Bin ich deine Gefangene?“, bohrte sie weiter. Ihre Wut war offenbar noch stärker als ihre Angst.
Kenai blinzelte. „Das glaubst du wirklich?“, fragte er ungläubig. Dann stand er unvermittelt auf. „Du denkst also, ich hätte dich verschleppt?“
Merle erwiderte seinen Blick stur.
Kenai schnaubte, drehte sich um und ging zurück zum Boot.
„Wo willst du hin?“, verlangte Merle zu wissen.
„Was geht’s dich an!“ Er stieß das Boot mit zorniger Wucht vom Strand ins Wasser und schwang sich hinein. „Weißt du, wofür Kareiva noch bekannt ist?“, rief er über die Schulter zurück. „Es stärkt die Gabe. Ich habe es dir gegeben, weil ich deine verdammte Gabe nicht mehr spüren kann!“ Wütend stieß er die Ruder ins Wasser und glitt rasch davon.
Merle öffnete den Mund, um ihm ebenso zornig etwas hinterherzurufen. Aber es blieb ihr im Halse stecken. Sie hatte die Gabe völlig vergessen. Es stimmte. Sie spürte nicht das geringste Ziehen. Und das, obwohl Kenai direkt neben ihr gesessen hatte.
Sie fühlte zaghaft in sich hinein und suchte nach einem Zupfen, einer Bewegung. Aber da war absolut nichts. Hatte sie die Gabe verloren?
Merle lehnte verwirrt den Kopf gegen das Gestänge ihres Sonnendaches und blickte Kenai nach. Er begann von Neuem zu fischen. Sein Boot trieb weit ab. Aber kurz bevor es völlig außer Sicht geriet, brachte er es jedes Mal wieder näher heran.
Zur Hölle mit der Gabe!, dachte sie schließlich und beförderte den Becher mit einem Fußtritt in den Fluss. Wenn sie wegblieb, war es doch nur ein Segen für sie.
* * *
Als Merle das nächste Mal erwachte, dämmerte es bereits. Die Sonne stand schon hinter den Bäumen und färbte den wolkenlosen Himmel rosa und orange. Kenai hockte am Flussufer und nahm die Fische aus, die er gefangen hatte. Dabei summte er leise vor sich hin.
Merle setzte sich auf. Es gelang ihr fast ohne Schmerzen, und sie fühlte auch keinen Schwindel mehr. Ihr Mund war trocken, und sie hätte ein ganzes Fass Wasser trinken können.
Kenai verstummte, als er ihre Bewegung bemerkte, und warf ihr einen Blick über die Schulter zu. Er sagte aber nichts, sondern fuhr damit fort, die Fische zuzubereiten.
Merle sah ihm eine Weile zu. Sie hatte ihn einen Entführer genannt und ihm vorgeworfen, er habe sie mit der Gabe betäubt. Immer noch war sie sich nicht ganz sicher, ob es stimmte oder nicht. Aber trotz allem war sie vermutlich nur dank ihm noch am Leben. Und in ihrer jetzigen Lage brauchte sie ihn.
Sie räusperte sich. „Es tut mir leid“, sagte sie leise.
Kenai murmelte etwas Unverständliches in seiner Sprache. Dann stand er auf und trat zu der kleinen Feuerstelle. Er legte die alte Glut frei und fachte sie mit Blasen und trockenem Reisig wieder an. Bald knisterte ein kleines Feuer. Dann steckte er die Fische auf Stöcke und stieß diese so in den Sand, dass sie über der Flamme brieten.
Die Sonne war mittlerweile verschwunden, und es wurde dunkel um sie her. Merle stand mühsam auf und schwankte hinüber zum Feuer. Ihre Schritte waren noch unsicher, ihre Muskeln schwach, aber sie konnte stehen und gehen. Sie ließ sich neben dem Feuer nieder und sah Kenai zu, wie er schweigend das Essen zubereitete. Er war immer noch wütend.
„Ich hätte nicht so misstrauisch sein sollen“, gab sie zu. „Ich kannte dieses Pulver von früher und dachte, du willst mich außer Gefecht setzten. Ich… ich hatte einfach Angst.“ Und ich habe sie noch immer, fügte sie in Gedanken hinzu, gab sich jedoch Mühe, es nicht zu zeigen. „Ich bin dir wirklich dankbar, dass du mich nicht zurückgelassen hast. Aber… an vieles kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich brauche etwas Zeit, verstehst du?“
Kenai setzte sich auf seine Fersen zurück und blickte sie an. Dann reichte er ihr den Wassersack. Merle nahm ihn und leerte ihn in großen Zügen.
„Wir müssen uns vertrauen“, erklärte er ernst. „Wir sind auf uns allein gestellt, Merle. Wenn wir beide uns nicht vertrauen, dann ist alles verloren.“
„Du hast ja recht“, sagte sie.
Kenai warf ihr einen Blick zu. Sie ertappte sich dabei, wie sie immer wieder sein verdicktes Augenlid anstarrte. Sie hatte sich noch nicht an sein verändertes Aussehen gewöhnt.
„Kannst du die Gabe noch fühlen? Irgendetwas?“
Merle schüttelte den Kopf. „Nicht das Geringste. Es ist, als wäre sie völlig verschwunden.“
Kenais Mundwinkel zogen sich noch weiter nach unten.
„Wird sie wiederkommen?“, fragte Merle. Alles in ihr hoffte, er würde mit dem Kopf schütteln.
„Ich weiß es nicht“, erwiderte er und spielte nervös mit seinem Messer herum. „Es ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Normalerweise kehrt die Gabe mit dem Bewusstsein zurück. Zumindest war es bei mir so.“ Dann wendete er die Fische über dem Feuer.
„Ich fühle mich schon viel besser“, sagte Merle. „Ich denke, morgen früh können wir aufbrechen.“
Kenai warf ihr einen kritischen Blick zu, und das knotige Lid beschattete sein Auge so sehr, dass es wirkte, als hätte er ein schwarzes Loch im Gesicht.
„Zurück zu deinem Moor? Bist du dir sicher? Wenn deine Gabe noch nicht wieder da ist, dann ist das kein gutes Zeichen. Wir sollten noch einen oder zwei Tage warten.“
„Ich fühle mich gut. Ob die Gabe nun wieder kommt oder nicht. Viel wichtiger ist doch, dass wir meine Eltern rechtzeitig erreichen…“
Merle brach ab, denn plötzlich nahm sie eine Gestalt wahr, die sich im Dunkeln hinter Kenai aufrichtete.
Kenai musste die Verwunderung in ihrem Gesicht erkannt haben, denn er fuhr mit dem Messer in der Hand herum. Doch der Schatten war schneller und hatte ihm schon einen Arm um den Hals gelegt. Daran zog er Kenai ruckartig nach hinten in die Dunkelheit.
Merle stieß entsetzt einen Schrei aus und sprang auf. Ihr Körper protestierte mit einer lähmenden Schmerzwelle dagegen. Noch bevor sie sich ganz aufrichten konnte, griff ein zweiter Schatten nach ihr und bog ihr die Arme auf den Rücken. Der brutale Griff zwang sie auf die Knie. Etwas Hartes knallte gegen ihren Hinterkopf und brachte ihre Ohren zum Summen. Als sie wieder klar sehen konnte, erkannte sie im spärlichen Licht des Feuers einen Haufen ineinander verknäulter Leiber. Mehrere Männer hatten sich auf Kenai gestürzt, der sich heftig zur Wehr setzte, und rangen darum, ihn unter Kontrolle zu bringen.
Dann schimmerte blasses Licht auf. Kenais Haut glomm zwischen den auf ihn einprügelnden Männern wie Sternenlicht. In der Dunkelheit verlieh es ihm etwas Anderweltliches. Bei diesem Anblick jagten Merle kalte Schauder den Rücken hinunter. Und auch die Männer wichen vor ihm zurück, als hätten sie sich verbrannt. Einige krümmten sich zusammen und verzogen die Gesichter. Ihre Schläge wurden langsamer und unkoordinierter. Kenai gelang es, sich freizukämpfen und wieder auf die Beine zu kommen. Seine Haare standen wild in alle Richtungen ab, und seine grauen Augen leuchteten ebenso wie sein Gesicht. Merle bekam eine Gänsehaut. Kenai war auf eigenartige Weise schön und schrecklich zugleich.
Pfeilschnell stieß er mit dem Dolch auf einen seiner Angreifer ein. Dann wirbelte er herum und zog einem anderen die Klinge über den Unterarm. Der Schwarzgekleidete zischte und zuckte zurück. Kenai kam frei und stand nun geduckt und mit gezücktem Messer zwischen den drei Männern, die versuchten, eine Lücke in seiner Verteidigung zu finden. Doch bei jedem Vorstoß schoss sein Messer nach vorn. Er drehte sich um sich selbst und wich gegen den umgestürzten Baum zurück, um sich den Rücken frei zu halten.
Ein heftiges Rucken an Merles Arm, machte ihr ihre eigene missliche Lage wieder bewusst und wuchtete sie zugleich auf die Füße.
„Lass deine Hexerei sofort bleiben, oder ich schneide deinem Liebchen die Kehle durch!“, brüllte eine raue Stimme hinter Merles Rücken. Eine Klinge drückte sich fest an ihre Kehle. Sie fühlte sich kalt und glatt an, wie ein Eiszapfen.
Sie hielt die Luft an und schielte zu Kenai hinüber. Er war mitten in der Bewegung erstarrt, doch sein Leuchten glomm um so stärker auf. Die drei Männer, die ihn umzingelten, hatten sichtlich Mühe, sich auf den Beinen zu halten.
Kenais Zähne blitzten im Dunkeln, als er atemlos entgegnete: „Du würdest ihr niemals die Kehle durchschneiden!“
„Bei der Großen Einheit, warum denn nicht?“, wollte ihr Peiniger mit einem rumpelnden Lachen wissen. „Von euch dreckigem Gabenpack gibt es ohnehin viel zu viele.“
„Aber ihr braucht sie“, sagte Kenai.
„Besser tot als in den falschen Händen.“ Der Mann drückte die Klinge noch etwas tiefer in Merles Haut. „Leg deinen Dolch jetzt weg und hör auf mit deinen feigen Tricks! Sonst wirst du gleich sehen, wie sehr ich diese kleine Schlange brauche.“
Kenai richtete sich auf. Der Mann links von ihm taumelte nach vorn und hieb wie ein Betrunkener nach Kenais Kopf. Aber dieser wich ihm mühelos aus und trat einen Schritt auf Merle und ihren Peiniger zu. Schweiß und Blut schimmerte auf seinem Gesicht.
„Bleib stehen!“, rief der Mann, der Merle hielt, und zog sie gleichzeitig mit sich rückwärts. „Komm keinen Schritt näher!“ Seine Stimme klang nun wesentlich weniger zuversichtlich.
Die drei Männer in Kenais Rücken kämpften gegen die Luft an, als wollten sie einen Schwarm Stechmücken vertreiben. Wäre die Situation nicht so brenzlig gewesen, hätte Merle über sie lachen müssen.
Da ruckte es so heftig an ihrem Kragen, dass es ihr die Luft nahm.
„Bleib stehen, hab ich gesagt!“, warnte der Mann noch einmal mit schrillerer Stimme.
Aber Kenai hielt nicht an. Sein Körper spannte sich, und die Adern an seinem Hals traten hervor. Da sackte Merles Peiniger mit einem Stöhnen über ihr zusammen, als wären ihm plötzlich die Beine weggezogen worden. Er wog so schwer, dass sie ihn nicht halten konnte und unter ihm einknickte. Sie strampelte panisch und versuchte ihre Arme frei zu bekommen. Gleichzeitig fühlte sie, wie der Körper über ihr unkontrolliert zu zucken begann. Sie wand sich mit aller Kraft und bemühte sich, ihn von sich wegzuschieben. Etwas Warmes tropfte dabei auf ihr Gesicht, und sie drehte angeekelt den Kopf weg. Erst als der Mann sich nicht mehr regte, gelang es ihr endlich, ihn von sich herunterzuwälzen. Keuchend lag sie einen Augenblick da.
Dann vernahm sie dumpfe Schläge und rasselnden Atem. Kenai rang neben dem Feuer mit einem der Angreifer. Der letzte, der noch nicht am Boden lag. Kenai stieß einen unterdrückten Schrei aus, warf sich herum und erwischte den Mann mit seinem Dolch am Hals. Ein Blutschwall ergoss sich über sein Gesicht. Der Schwarzgekleidete kippte röchelnd zur Seite. Kenai fiel mit ihm.
Trotz der rasenden Schmerzen stützte sich Merle hoch. Ihr Kopf dröhnte dabei, und in ihrer Wirbelsäule, den Armen und Beinen schienen Nägel zu stechen. Sie stolperte zu Kenai hinüber, der auf dem Rücken lag und die Hände auf sein Gesicht presste. Das Leuchten pulsierte noch auf seiner Haut. Gesicht und Hände waren schwarz beschmiert mit Blut. Merle wurde schlecht. Sie ging neben ihm in die Knie, wagte es jedoch nicht, ihn zu berühren.
„Sie sind alle tot“, flüsterte sie. „Ich glaube, du hast sie alle umgebracht.“ Sie erkannte den friedlichen Ort nicht wieder. Um sie herum hatte sich der kleine Flussstrand in ein Schlachtfeld verwandelt. Vier Männer lagen auf dem Sand, entweder schon tot oder in ihren letzten Zuckungen. Überall waren im Mondlicht schwarz schimmernde Flecken zu sehen, und es roch ekelerregend nach Blut und Exkrementen.
Kenai ließ die Hände sinken und blickte sie mit geweiteten Augen an. Sie schimmerten unnatürlich in seinem blutverschmierten Gesicht. Dann setzte er sich langsam auf, und ein Rumpeln ging durch seine Brust. Er spuckte Blut in den Sand und wischte sich über den Mund. „Bist du verletzt?“
Merle schüttelte den Kopf. Sie blickte von seinem blutbesudelten Gesicht auf ihre eigenen Hände. Sie waren ebenfalls feucht und klebrig. Ihr Magen rebellierte, und sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Ein eisenartiger Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus. Es konnte nicht ihr Blut sein. Die Übelkeit überwältigte sie, und sie übergab sich.
Als die Krämpfe nachließen, kroch sie zum Flussufer und wusch sich Gesicht, Hals und Arme.
Auch Kenai stand bis zu den Knien im Fluss und tauchte seinen Kopf ins Wasser, als könnte er nur so wieder zur Besinnung kommen. Als er sich schließlich aufrichtete, tropfte es dunkel aus seiner Nase.
„Was ist mit dir?“, fragte Merle unsicher.
Er tastete mit zwei Fingern vorsichtig seine Nase ab. „Nichts“, brummte er und wankte aus dem Wasser. Sein Schritt war schleppend. Irgendetwas stimmte nicht.
„Was ist denn los?“, hakte Merle nach und folgte ihm mit ihrem Blick.
„Wir gehen“, sagte Kenai knapp und stolperte zum Lagerfeuer, um die Decke und seinen Mantel einzusammeln.
„Was? Aber wohin?“ Merle stakte ihm hinterher und fiel über einen der Toten. Sie wollte sich schon wieder aufrappeln, als ihr der bleiche Arm des Mannes ins Auge fiel. Er streckte sich weit vom Körper weg, als wollte der Mann im Tod den Mond umarmen. Sein Ärmel war ein Stück nach oben gerutscht, und ein Teil des Unterarms war sichtbar. Auf der Innenseite des Handgelenks war der Ansatz einer Tätowierung zu erkennen.
Merle hielt inne. Dann beugte sie sich darüber und schob den Ärmel vorsichtig noch ein wenig weiter nach oben. Ein wütend flatternder Hahn aus bläulichen Linien schien sie anzuspringen. Die Klauen drohend ausgestreckt, die Federn im Sprung gesträubt.
Merle wich zurück.
„Trödel nicht herum“, sagte Kenai. „Vielleicht treiben sich noch mehr von diesen Typen in der Gegend herum. Wir müssen verschwinden. So schnell wie möglich.“
„Hast du das schon mal gesehen?“, fragte Merle.
Er kam näher. Sein Mantel verdeckte nun den größten Teil seiner schimmernden Haut. Doch das sanfte Leuchten, das von Gesicht und Händen ausging, konnte er damit nicht verbergen.
„Diesen Hahn hier?“ Merle deutete auf die Tätowierung. „Ich glaube, es ist das Zeichen von Simeon, dem Schmuggler. Alle seine Leute tragen es.“
Kenai beugte sich weiter herunter und betrachtete den Hahn. „Bist du dir sicher?“
Merle nickte. „Meinst du, diese Männer sind von ihm geschickt worden?“
Kenai schniefte vorsichtig und verzog das Gesicht. „Nach allem, was ich gesehen habe, ist der Schmuggler verbrannt. Ich glaube nicht, dass er überlebt hat.“
„Und Ray und Greta? Die Männer könnten sich ihnen angeschlossen haben. Immerhin haben sie mit Simeon zusammengearbeitet, damals, als wir … als wir …“ Die Erinnerung an Skips Tod ließ Merle verstummen. Sie tastete nach den Perlen um ihren Hals und drückte sie an ihre Haut, als könnten sie ihr Leid lindern.
Kenai seufzte. „Möglich.“ Er wandte sich ab. „Auf jeden Fall scheint jemand zu wissen, dass wir entkommen sind, und sucht nach uns. Wir müssen sofort ins Boot.“
„Ins Boot?“ Merle schluckte gegen die aufsteigende Panik an. Boot bedeutete Wasser. Tiefes Wasser. „Nein, vergiss es, ich setze da keinen Fuß hinein.“ Die Vorstellung, in diesem kleinen Kahn über einen unvorstellbar großen Fluss zu treiben, ließ ihr Herz sogleich hart gegen ihren Brustkorb hämmern.
„Aber du warst schon die ganze Zeit da drin“, erwiderte Kenai gereizt. „Und es hat dir nicht geschadet.“
„D-das ist etwas anderes.“ Merle stand, den Schmerz ignorierend, auf und wich ein paar Schritte in Richtung des Dickichts zurück. „Ich kann da unmöglich hinein, verstehst du? Ich kann einfach nicht.“
Kenai folgte ihr mit den Augen. „Du brauchst keine Angst haben. Wenn du über Bord gehen solltest, hole ich dich raus. Versprochen.“
Die Tiefen, der Schlamm, die Kälte und wer weiß was für schreckliches Getier … Merle schüttelte den Kopf. „Nein! So einfach ist das nicht.“
„Es gibt keine andere Möglichkeit, Merle. Wir müssen hier weg. Jetzt! Sonst gehen wir, verdammt noch mal, nirgendwo mehr hin!“ Seine Stimme war lauter und schärfer geworden. Merle hörte die mühsam unterdrückte Wut darin vibrieren.
Aber sie schüttelte starrsinnig den Kopf. Es war unmöglich. Sie würde nicht mit diesem Boot auf den Dal hinausfahren. Auf gar keinen Fall!
Kenai schloss die Augen und atmete langsam aus. Dann rieb er sich die Stirn und fuhr sich durch die nassen Haare. Mit hängendem Kopf kam er auf sie zu und sagte dabei: „Bei der Großen Einheit, Merle, du lässt mir wirklich keine andere Wahl.“
Merle erstarrte. Was meinte er damit?
Er hob den Kopf, und das Leuchten der Gabe pulsierte ein klein wenig stärker über sein Gesicht. Ungläubig wich sie vor ihm zurück. Das würde er nicht wagen!
Aber Kenai setzte ihr nach und packte sie am Handgelenk. Dann zog er sie zu sich heran und drückte ihr seine Handfläche auf die Stirn. Es fühlte sich an, als würde ihre Haut mit seiner zusammenwachsen. Sie konnte nichts mehr sehen. Und dann wurden ihre Glieder schwer. Plötzlich hatte sie große Mühe, sich auf den Beinen zu halten.
„Du … du …“ Sie wollte Kenai die schlimmsten Schimpfwörter an den Kopf werfen, die sie kannte. Aber sie fielen ihr nicht mehr ein. Sie war so müde. Und ihre Gedanken wurden langsamer und langsamer. Sie fühlte ihre Beine nachgeben. Kenai fing sie auf.
„Verzeih mir“, flüsterte er in ihr Ohr.
Dann wurde es dunkel.
Kapitel3
Ein leises Grollen weckte Merle, und sie wollte aufspringen, als hätte sie eine Wespe gestochen. Aber etwas hielt ihre Füße und Hände fest. Ihr Sprung geriet zu einem unkoordinierten Zucken, das sogleich durch hämmernde Schmerzen in Kopf und Gliedern bestraft wurde. Sie fluchte und wartete mit knirschenden Kiefern, bis der Schmerz abebbte. Dann blickte sie an sich hinunter, um herauszufinden, was sie am Aufstehen hinderte.
Sie stutzte: Ihre Hand- und Fußgelenke waren mit einem Seil gefesselt. Sie lag auf der Seite, das Gesicht im alten Laub von humosem Waldboden. Angst beschleunigte ihren Herzschlag. Hatten die Männer mit der Hahnentätowierung sie am Ende doch überwältigt? Sie blickte um sich. Es war Tag. Ein Rotkehlchen saß nicht weit von ihr entfernt in den Zweigen einer knorrigen Eiche und sang so schrill, dass es Merle in den Ohren schmerzte. Wind wisperte in den gelben Blättern der herbstlichen Buchen. Die Luft war mild, und es roch nach feuchter Erde und Pilzen. Vom Fluss war weit und breit nichts zu sehen.
Merle fluchte noch einmal in Gedanken. Sie hatte genug davon, ständig an unbekannten Orten aufzuwachen. Sie hasste es, sich nicht orientieren zu können, nicht zu wissen, wo sie war, und darauf angewiesen zu sein, dass man ihr half …
Das Grollen, das sie geweckt hatte, setzte von Neuem ein. Es kam von einer Stelle hinter ihr. Sie blickte über die Schulter. Dort saß Kenai an einen Baum gelehnt. Das Kinn war ihm auf die Brust gesunken, die Augen geschlossen und die Arme um seinen Körper geschlungen, als wäre ihm kalt. Und das Grollen war in Wirklichkeit gar kein Grollen, sondern sein Schnarchen. Er schlief. Er war nicht gefesselt, und das ließ nur eine Vermutung zu: Kein anderer als er hatte Merle festgebunden!
Sie begann vor Wut zu zittern. Die Erinnerung kehrte zurück. Sie waren entdeckt und angegriffen worden. Und danach hatte Kenai sie mit seiner Gabe attackiert. Er hatte ihr das Bewusstsein genommen, um sie ohne ihren Widerstand hierher bringen zu können. Wie hatte er es wagen können! Sie riss an den Fesseln und versuchte ihre Hände aus den Schlingen zu ziehen. Aber statt sich zu lockern, zogen sie sich immer enger zusammen. Merle fluchte. Wenn sie nur ein Messer hätte. Aber die kleine Lederscheide an ihrem Gürtel war leer. Sie musste ihr kleines Messer irgendwo zwischen hier und Dalsburg verloren haben. Oder hatte Kenai es ihr abgenommen? Ungeduldig riss sie noch energischer an den Seilen und brachte sich in eine sitzende Position.
Währenddessen schnarchte Kenai weiter. Er musste wirklich sehr tief schlafen. Merle fluchte noch einmal laut, nur um zu testen, ob er sich rührte. Doch nichts geschah. Eine Horde Wildschweine hätte zwischen ihnen durchjagen können, und er wäre nicht aufgewacht.
Die Seilschlingen um ihre Hand- und Fußgelenke waren mittlerweile aber so eng geworden, dass sie in ihre Haut einschnitten. Und ihr kleiner Finger begann zu kribbeln. Kein gutes Zeichen. Wenn ihre Hände nun auch noch gefühllos wurden, konnte sie eine Flucht vergessen! Da fiel ihr der kleine Dolch an Kenais Gürtel ins Auge. Jene Waffe, mit der er die Männer am Fluss getötet hatte. Wenn sie da herankäme, könnte sie das Seil durchschneiden und sich davonmachen, noch ehe er etwas mitbekam.
Er hatte sie nicht festgebunden. Nur Hände und Füße konnte sie nicht bewegen. Sie ließ sich zur Seite kippen und schob sich auf ihn zu. Als sie neben ihm angelangt war, setzte sich wieder auf und beugte sich zu ihm, bis sie ihm so nah war, dass sie seine Wimpern hätte zählen können. Ein Hauch von Heu und sonnenwarmen Steinen stieg ihr in die Nase. Er hatte einen Kratzer am Kinn, und sein linker Kieferknochen war unter den Bartstoppeln dunkel verfärbt. Sie betrachtete sein Gesicht mit dem knotigen Augenlid, der schiefen Nase und der etwas geschwollenen Unterlippe. Er sah ziemlich lädiert aus. Wäre sie nicht so wütend gewesen, dann hätte sie Mitleid verspürt. Er wirkte so unschuldig, wenn er schlief. Doch Unschuld war wohl nicht das richtige Wort, um Kenai zu beschreiben. Immerhin hatte er erst vor wenigen Stunden vier Männer getötet. Und Merle selbst hatte er betäubt, gefesselt und an einen unbekannten Ort verschleppt. Seine Gabe war wahrhaft Furcht einflößend. Es konnte nicht gut sein, wenn ein einzelner Mensch so viel Macht besaß.
Erst da kam ihr wieder zu Bewusstsein, dass sie selbst ja auch eine von diesen Begabten war. Oder gewesen war. Aber im Gegensatz zu Kenai konnte sie ihre Gabe nicht bewusst lenken. Er hingegen schien genau zu wissen, was er tat. Er setzte sie als Waffe ein, verteidigte sich damit, konnte andere Menschen schwächen, betäuben oder sogar töten.
Merle fuhr sich mit der Zunge über ihre aufgesprungenen Lippen. Nicht auszudenken, was sie selbst alles anrichten könnte, wenn sie ihre Gabe nicht unter Kontrolle brächte. Das Feuer in Simeons Lagerhalle war das beste Beispiel dafür. Es war aus ihr herausgebrochen, ohne dass sie gewusst hatte, was sie tat. Es war gut, dass sie die Gabe nicht mehr hatte. Um sich zu vergewissern, hielt sie die Luft einen Moment an und horchte in sich hinein. Nichts. Erleichterung ließ sie aufatmen.
Skips Gesicht tauchte vor ihrem inneren Auge auf. Die Erinnerung an das Grauen darin traf sie wie ein Hagelschauer. Schnell schob sie den Gedanken beiseite. Sie hatte keine Zeit zum Trauern. Nicht jetzt.
Stattdessen hob sie ihre an den Handgelenken zusammengebundenen Hände. Mit den Fingerspitzen angelte sie nach Kenais Messer. Es war nicht leicht, daran heranzukommen, ohne seine Haut zu berühren, weil sein rechter Unterarm gleich daneben lag. Zuerst musste ein kleiner Riemen zur Seite geschoben werden, der es daran hinderte, ungewollt aus der Scheide zu rutschen. Vorsichtig öffnete sie ihn und zog dann das Messer heraus. Ein kurzer Moment des Schreckens durchzuckte sie, als es, statt ins Laub, in Kenais Schoß fiel. Doch Kenai atmete ruhig weiter. Es war unnatürlich, wie tief er schlief. Merle ertappte sich dabei, wie sie sich Sorgen zu machen begann. Aber dann schalt sie sich eine Idiotin. Sollte er doch schlafen, bis die Soldaten ihn fänden!
Sie tastete nach dem Messergriff und robbte damit einige Meter von ihm weg. So weit, dass die Geräusche, die sie verursachte, selbst einen normal Schlafenden nicht mehr stören würden und dass er sie nicht sofort sehen würde, falls er die Augen aufschlug. Dann klemmte sie den Griff zwischen ihre Stiefelsohlen, drückte das Seil zwischen ihren Handgelenken gegen die Klinge und fing an, es schnell daran auf und ab zu bewegen.
Die Klinge war scharf, und es dauerte nicht lange, bis die Fessel riss und Merle die Hände freibekam. Sie ächzte vor Schmerz, als das Blut in ihre Finger schoss und sie die Hände probehalber öffnete und schloss. Dann schnitt sie auch die Fußfessel durch. Als die dünnen Seile von ihr abfielen, musste sie den Impuls unterdrücken aufzulachen. Sie konnte sich Kenais Miene bildlich vorstellen, wenn er zu sich kam und feststellte, dass sie abgehauen war. Er würde ordentlich fluchen in seiner merkwürdigen Sprache.
Sie erhob sich und warf ihm einen Blick zu. Er saß noch immer gegen den Baum gelehnt und schnarchte. Die Freude verging ihr, als sie das Messer in der Hand wog. Kenai war schnell und stark und alles andere als dumm. Sie hatte keine Ahnung, ob er Spuren lesen konnte oder wusste, wo sich das Riedinger Hochmoor befand. Würde er sie aufspüren können?
Er an ihrer Stelle würde vermutlich nicht zögern, seine potenzielle Verfolgerin auszuschalten, um sein Ziel zu erreichen. Sie hatte Kenai Menschen töten sehen. Um sich zu verteidigen, das musste sie ihm zugutehalten. Aber er hatte es geschickt, schnell und ohne sichtbare Skrupel getan. Sicherlich nicht zum ersten Mal. Ihr Blick wanderte über sein zerschlagenes Gesicht, seine großen, schwieligen Hände. Sie presste die Lippen zusammen und schloss die Finger fester um den Messergriff. Er hatte sie aus Dalsburg herausgebracht und ihr damit vermutlich das Leben gerettet. Aber zu welchem Zweck? Was hatte er mit ihr vor?
Merle holte tief Luft und trat einen Schritt näher. Sie zu betäuben und zu fesseln, war sicherlich kein freundschaftlicher Akt. Was Kenai vorhatte, was er von ihr wollte, wusste sie nicht. Aber sie wusste mit Bestimmtheit, dass er es sich nehmen würde, selbst wenn sie versuchen sollte, sich ihm zu widersetzen. Das Leben ihrer Eltern spielte für ihn keine Rolle. Und wenn er sie einholen und davon abhalten sollte, den Bruch zu erreichen, dann wäre das Carls und Bels Ende. Das konnte Merle nicht zulassen.
Sie hob das Messer. Waren die Leben ihrer Eltern es wert, einen anderen Menschen dafür zu töten? Plötzlich war ihr heiß, und sie zerrte am Kragen ihres Hemds, um ihn ein wenig zu lockern. Die Lederschnur mit den Perlen daran verhedderte sich in einem Knopf, und Merle hätte ihn in ihrer Ungeduld fast abgerissen. Mit zittrigen Fingern löste sie die Schnur vom Knopf und schob die Perlen zurück unter ihr Hemd. Ihr Herz fühlte sich an, als würde es zwischen zwei Felsen zerquetscht werden. Ruckartig wandte sie sich ab. Dann schob sie das Messer in ihre eigene Lederscheide am Gürtel und stolperte davon. Sie war sich ganz und gar nicht sicher, ob sie vor Kenai flüchtete oder vor sich selbst.
Nach ein paar Stunden, als die Dämmerung einsetzte und die herbstliche Kälte nicht mehr von der Sonne in Schach gehalten wurde, forderte ihr geschwächter Körper seinen Tribut. Sie hatte nicht einmal mehr genug Kraft, ein Feuer zu entzünden und sich etwas zu essen zu suchen. Sie rollte sich einfach in einer laubgefüllten Mulde unter hohen Buchen zusammen, und ihr sanken die Augen zu.
* * *
Als sie am nächsten Morgen erwachte, war es schon hell. Sie musste viele Stunden geschlafen haben. Zu viele. Sie fühlte sich elend. Das Laub hatte sie warm gehalten, aber ihre Zunge klebte am Gaumen, und ihre Augenlider waren schwer wie Bleigewichte. Der Durst machte sie schwindlig, ihr Schädel pochte, und ihr Magen knurrte vernehmlich. Mühsam stand sie auf und zupfte sich das Laub aus Kleidern und Haaren. Sie musste Wasser finden.
Benommen stolperte sie einen Hang hinunter in ein enges Tal, in dem sie von Weitem Wasser rauschen hörte. Am Bach angekommen, ließ sie sich auf die Knie fallen, tauchte das Gesicht hinein und trank gierig. Erst als ihr Durst gestillt war, setzte sie sich auf ihre Fersen zurück und wartete mit geschlossenen Augen, bis ihr Atem sich wieder beruhigt hatte und ihr Kopf klarer geworden war.
Ein Plätschern und Flattern, nicht weit von ihr entfernt, ließ sie zusammenzucken. Am gegenüberliegenden Ufer benetzte sich ein kleines Vögelchen das Gefieder. Es war ein Rotkehlchen, und als es ihren Blick bemerkte, hielt es inne, hüpfte auf einen Stein und sah Merle mit seitwärts geneigtem Kopf an. Sie musste lächeln. Das Tier war allzu possierlich mit seiner aufgeplusterten Brust, und die glänzenden schwarzen Augen erinnerten sie an den hochmütigen Bibliothekar, über den Skip sich immer beschwert hatte, wenn er sie im Bruch besucht und ihr von seinen Studien erzählt hatte.