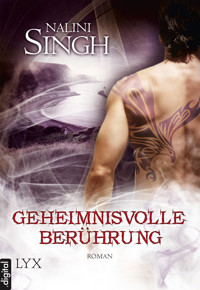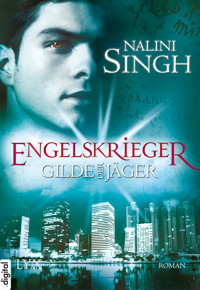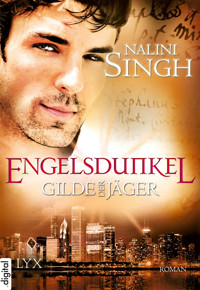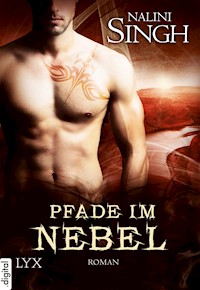9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Flieh, so weit du kannst – deiner Vergangenheit entkommst du nicht! Nalini Singhs fesselnder Thriller mit eine Prise Romantik vor der atemberaubenden Kulisse Neuseelands Als Ana nach acht Jahren am anderen Ende der Welt nach Golden Cove zurückkehrt, scheint sich dort kaum etwas verändert zu haben. Beinahe könnte sie glauben, dass die Zeit stehen geblieben ist – wäre da nicht Will, der neue und einzige Cop im Ort, der seltsam unnahbar wirkt. Wie sehr die Dinge tatsächlich beim Alten geblieben sind, wird Ana allerdings erst bewusst, als erneut ein schönes junges Mädchen verschwindet, so wie es auch schon früher geschehen ist.Nach und nach holt die dunkle Vergangenheit Golden Cove ein und zwingt die Bewohner, ihre gefährlichsten Geheimnisse preiszugeben. Denn eins steht fest: Wer auch immer für das Verschwinden des Mädchens verantwortlich ist, muss aus Golden Cove stammen! Bestseller-Autorin Nalini Singh hat einen Gänsehaut-Thriller geschrieben, der die raue Naturschönheit Neuseelands auf finstere menschliche Abgründe prallen lässt. Garniert mit einer Prise Romantik, garantiert »Im grausamen Licht der Sonne« perfekte Unterhaltung für alle Fans von Karen Rose oder Lisa Jackson.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Nalini Singh
Im grausamen Licht der Sonne
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Naumann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nach acht langen Jahren wagt Ana es endlich, in ihr Heimatdorf Golden Cove an der rauen Küste Neuseelands zurückzukehren. Nichts scheint sich dort verändert zu haben – bis auf Will, den neuen und einzigen Cop im Ort, wie Ana auf der Flucht vor seiner Vergangenheit. Als die junge Miri nicht von ihrer üblichen Joggingrunde zurückkehrt, macht sich das ganze Dorf auf die Suche, ohne eine Spur des Mädchens zu entdecken. Und Ana wird bewusst, wie sehr die Dinge tatsächlich beim Alten geblieben sind: Wer auch immer für Miris Verschwinden verantwortlich ist – er muss aus Golden Cove stammen!
Inhaltsübersicht
DER ERSTE STURZ
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
Epilog
Dank
DER ERSTE STURZ
Sonnenschein.
Das war sie.
Sonnenschein.
Hell. Etwas, das lebte. Etwas, das brennen konnte.
Und dieses Herz, es schlug nur für sie.
Es hätte für sie morden können.
Für die Liebe. Für den Sonnenschein.
1
Sie kam zweihundertundsiebzehn Tage nach der Beerdigung ihres Ehemanns zurück. Seine schwangere Geliebte hatte während der Beisetzung so laut geschluchzt, dass sie sich übergeben musste. Anahera hatte mit steinernem Gesichtsausdruck auf den glänzenden Mahagonisarg hinabgestarrt. Sie hatte ihn ausgesucht, weil sie wusste, dass Edward genau so etwas gewollt hätte. Schlichte Eleganz und Geld, das man nicht herzeigte, das war Edward gewesen. Der Schein war wichtiger gewesen als alles andere.
Seine Freunde hatten sie mitleidig angesehen, weil sie glaubten, dass ihr Kummer so groß sei, dass sie nicht einmal mehr weinen konnte.
Und die ganze Zeit hatte Edwards Geliebte geschluchzt.
Niemand kannte sie.
Anahera hatte nicht erklärt, wer diese Frau war.
Und sie hatte nicht geweint. Damals nicht. Und danach auch nicht.
Jetzt fuhr sie in dem dunkelgrünen Jeep, den sie unbesehen über das Internet gekauft und zum Flughafen hatte bringen lassen, zum letzten Halt auf ihrer langen Flugreise aus London.
Christchurch, Neuseeland.
Ein Land am Ende der Welt. So weit im Süden, dass sie nicht überrascht war, als ihr Pilot auf ein Frachtflugzeug zeigte, das für eine Forschungsstation in der Antarktis beladen wurde.
Wie viele Stunden war es her, seit sie durch das Abflugsgate in Heathrow gegangen war?
Sechsunddreißig? Achtunddreißig?
Irgendwann zwischen gestern und morgen hatte sie den Überblick verloren. Zwischen dem grauen Nieselregen einer Stadt voller Theater und Museen und dem kalten Sonnenlicht eines kaum zivilisierten Landes, das irgendwo im Ozean schwamm.
Edward hatte Städte gemocht.
Er und Anahera waren nie zusammen durch diese so ursprüngliche und ungezähmte Landschaft gefahren deren Bäume aus uralten Samen gewachsen waren, und deren Farne riesig und hoch standen und das Lied der Heimkehr sangen.
Tauti maki, hoki mai.
Und dieser Moment, ein Flüstern am Ende ihrer Reise, als sie auf einer zerklüfteten Klippe stand und auf die aufgewühlte See unter sich schaute. Nebel senkte sich auf die Baumkronen, ein leichter, feiner Regen fiel und löste sich auf, bevor er sie erreichte.
Dunkelgraues Wasser krachte gegen harten schwarzen Felsen und spritzte schaumig weiß empor, nur um unter der Gewalt der nächsten hohen Welle wieder zu verschwinden. Das Wasser erstreckte sich endlos, eine aufgewühlte Weite, die so ganz anders war als die europäischen Strände, die sie mit Edward besucht hatte. Man konnte hier nicht im Wasser schwimmen, es sei denn, man wollte in die kalten Arme des Ozeans hinausgezogen werden, aber seine Schönheit berührte Anaheras Herz, ließ es sich schmerzhaft zusammenziehen.
Sie hätte ewig zuschauen können, würde das vielleicht auch tun, sobald sie wieder in der Hütte war. Josie hatte ihr gesagt, dass sie noch stand – und dass niemand die Fensterscheiben eingeschlagen hatte.
Vielleicht aus Respekt. Oder aus Angst.
Für manche war die Hütte ein Geisterort.
Für Josie war es der Ort, an dem Anahera und sie einst auf der Veranda gesessen und gelacht hatten, zwei Neunzehnjährige, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatten. Ihre beste Freundin aus der Highschool war der einzige Mensch, mit dem Anahera seit ihrer Abreise aus Golden Cove den Kontakt gehalten hatte, und sie hatte Josie gesagt, sie solle sich keine Sorge um die Hütte machen und müsse nicht darauf aufpassen.
Denn Anahera würde niemals wiederkommen.
Sie wandte sich von der Klippe ab, stieg in ihren Jeep und startete den Motor.
Sie fuhr Richtung Inland, fort von den krachenden Wellen – es war nur noch ein Traumbild, das Meer, verborgen hinter den Bäumen – und die nächsten zehn Minuten durch das Nichts. Das Schild überraschte sie. Golden Cove hatte kein Ortsschild gehabt, als sie damals fortging. Nur einen alten Gummistiefel auf einem Zaunpfahl, den Nikau Martin dorthin gestellt hatte, als sie elf waren.
Aus irgendeinem Grund hatten die Erwachsenen ihn nie heruntergenommen.
Aber jetzt war der Stiefel fort, und an seiner Stelle stand ein leuchtendes Schild mit der Aufschrift: HAEREMAI, und darunter in verschlungenen Buchstaben GOLDENCOVE, und darunter wiederum WILLKOMMEN. Sie fuhr daran vorbei, blieb dann stehen und schaute sich um. Von dieser Seite aus waren auf dem Schild die Worte HAERERĀ zu sehen, darunter GOLDENCOVE, und darunter wiederum AUFWIEDERSEHEN.
Endlich schaffte sie es, das Unbehagen des Ungewohnten abzuschütteln. Sie fuhr weiter die leere Straße entlang.
Der Motor ihres Autos stotterte und ruckte dann.
»Wehe, du streikst jetzt«, sagte sie und schlug auf das Armaturenbrett. Aber der Jeep hatte keine Lust, auf sie zu hören. Er zischte und stotterte erneut und erstarb dann.
Anahera schaffte es noch, ihn an den Straßenrand zu lenken, stellte den Automatik-Schalter auf Parken und schaltete den Motor aus. Immerhin war das hier keine Katastrophe. Von hier aus würde sie nur zwanzig Minuten zu Fuß bis nach Golden Cove brauchen. Sie würde ihre beiden Gepäckstücke im Kofferraum lassen – aber vielleicht auch nicht. Immerhin waren es Rollkoffer. Und es passte ja, dass das zornige Mädchen, das eine Staubwolke hinterlassen hatte, als es dieses Städtchen verließ, staubig und erschöpft von der Reise zurückkehrte.
Das Schicksal hatte wirklich Sinn für Humor.
In der Ferne war der Motor eines Autos zu hören, wurde langsam lauter. Vor all den Jahren, als sie noch nicht die kahle Leere von Neuseelands Westküste hinter sich gelassen hatte, hätte Anahera sich nichts dabei gedacht, aus dem Auto zu springen und den Lastwagen oder das Auto herbeizuwinken.
Trotz ihrer Kindheit und der kalten Dunkelheit ihres vierzehnten Sommers war sie in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass diese wilde Landschaft sicher war, denn die, die darin lebten, waren alles Leute, die sie kannte. Aber die große weite Welt hatte ihr beigebracht, dass man niemandem trauen konnte. Also blieb sie in ihrem verriegelten Fahrzeug sitzen und sah zu, wie ein großer SUV in ihrem Rückspiegel größer wurde.
Er war weiß und hatte einen Kuhfänger vorn am Kühler. Das war nicht ungewöhnlich – ungewöhnlich war das auffällige blau-gelbe Schachbrettmuster an den Seiten, ein Muster, das sie erkennen konnte, weil der SUV jetzt neben ihr stand, immerhin noch weit genug entfernt, dass sie ihre Tür hätte öffnen können, wenn sie es gemusst hätte.
Das Wort POLIZEI stand in weißen Blockbuchstaben auf blauem Grund. Seit wann, überlegte sie, brauchte Golden Cove eine Polizei? Das Städtchen war zu klein, die Einwohner hatten sich immer auf die Polizeiwache in Greymouth, der nächsten großen Stadt, verlassen, wobei »groß« hier an der Westküste ein relativer Begriff war. Die Einwohnerzahl der gesamten Küstenlinie lag ungefähr bei einunddreißigtausend, jedenfalls war es so gewesen, als sie es das letzte Mal nachgeschlagen hatte.
Sie ließ vorsichtig ihr Fenster herunter, und der andere Fahrer tat dasselbe mit seinem Beifahrerfenster, damit sie miteinander sprechen konnten. Der Mann war in den Dreißigern. Er hatte einen ausgeprägten, hart wirkenden Kiefer, und tiefe Furchen hatten sich in sein Gesicht gegraben, als hätte er Dinge gesehen, die er nicht vergessen konnte – keine guten Dinge.
Sein Haar war dunkel, seine Haut hatte die hellbraune Tönung, die es schwierig machte zu bestimmen, ob er nur von der Sonne gebräunt war oder ob er Vorfahren mit ähnlichem Erbgut hatte wie sie. Seine Augen konnte sie hinter der undurchdringlichen, dunklen Sonnenbrille nicht erkennen, aber sie nahm an, dass sie ebenso hart waren wie sein Kiefer. »Alles in Ordnung?«, fragte er.
Sie bemerkte, dass er keine Uniform trug. Andererseits, wenn er wirklich in Golden Cove stationiert war, würde ihn wohl keiner der Bewohner anzeigen, weil er die Kleidungsvorschriften brach. »Ärger mit dem Auto«, antwortete sie. »Aber ich kann den Rest des Weges zu Fuß gehen.« Sie hatte nicht die Absicht, zu einem unbekannten Mann auf einer verlassenen Straße mitten im dunkelgrünen Urwald ins Auto zu steigen.
»Ich schau mir das mal an.« Bevor sie antworten konnte, stellte er sein Auto vor ihres und stieg aus. Sie sah sofort, dass er ein großer Mann war: breite Schultern, starke, lange Beine, ebenso starke Arme. Aber alles an ihm war hart, als hätte man alles Weiche an ihm eingeschmolzen.
Mit einem unangenehmen Druck im Magen ließ sie ihr Fenster ein wenig hochfahren, aber er trat nicht zu ihr an die Tür. Stattdessen machte er ihr ein Zeichen, sie solle die Kühlerhaube öffnen. Anahera hatte nichts zu verlieren, also kam sie der Aufforderung nach.
Er verschwand hinter der Haube, und sie versuchte, sich vorzustellen, wie es sein würde, nach all der Zeit in die Hütte zu kommen. Sie schaffte es nicht. Sie erinnerte sich nur an das letzte Bild, an den Fußboden, von dem das Blut gescheuert, und an die Leiter, die weggebracht worden war, um in einer Müllpresse zerdrückt zu werden.
Der Polizist schaute um die Haube herum. »Versuchen Sie es jetzt mal.«
Sie tat es ohne jede Hoffnung, aber der Motor sprang an. Sie rief ihm ein Danke zu, aber er lächelte nicht, löste die Stütze für die Kühlerhaube und schloss sie. Dann trat er endlich an ihr Fenster. »Sieht nicht nach einem größeren Schaden aus«, sagte er, »aber wenn Sie noch weiter an der Westküste entlangfahren wollen, sollten Sie das Auto vorher in eine Werkstatt bringen.«
Es war ein guter Rat; die Straßen hier waren eine Herausforderung. An ihrem Zustand lag es nicht – dafür, dass sie im Nirgendwo lagen, waren sie sogar ganz gut. Aber sie waren leer. Lange Strecken, die durch nichts als Wildnis und Wasser führten; wenn man dort irgendwo eine Panne hatte, kam vielleicht erst Stunden später jemand vorbei. Und was den Handyempfang anging: Die Berge ließen kaum Funksignale durch.
»Ich fahre nach Cove«, sagte sie. »Arbeitet Peter noch in der Werkstatt?« Vielleicht hatte ihr alter Schulkamerad ja längst größere und bessere Dinge zu tun.
Der Polizist zog eine Braue hoch und nickte. »Es ist keine Urlaubssaison. Sind Sie hier, weil Sie an einem Schreibseminar mit Shane Hennessy teilnehmen wollen?«
Josie hatte Anahera von dem berühmten irischen Schriftsteller erzählt, der nach Golden Cove gezogen war. »Nein«, antwortete Anahera. »Ich komme wieder nach Hause. Noch mal danke.« Sie ließ das Fenster wieder hochfahren, bevor er sie weiter ausfragen konnte.
Aber dieser Mann ließ sich nicht so einfach abspeisen. Er klopfte höflich gegen das Glas, nachdem er seine Sonnenbrille abgenommen hatte. Zum Vorschein kamen schiefergraue Augen, so dunkel wie die Wolken, die sich am Horizont ballten.
Sie ließ ihr Fenster ein Stückchen herunter, und er sagte: »Ich fahre hinter Ihnen her, damit Sie sicher ankommen.«
»Wenn’s sein muss«, erwiderte sie, ohne genau zu wissen, warum sie ihm gegenüber so feindselig war, obwohl er ihr gerade geholfen hatte.
Vielleicht lag es daran, dass sie jetzt in die Vergangenheit fuhr.
Sie startete den Motor.
Im Rückspiegel sah sie, dass sich der Polizist Zeit ließ, zurück in sein Auto zu steigen. Dann bog sie um eine Kurve, und er war fort. Aber bald erschien sein SUV wieder hinter ihr, und ihre kleine Kolonne fuhr in das Städtchen, das auf einer goldenen Illusion gegründet war.
Die ersten Siedler hatten gehofft, hier Gold zu finden, Reichtümer, eine Zukunft. Stattdessen stießen sie hier nur auf eine karge, erbarmungslose Landschaft, in der das Wasser ebenso trügerisch war wie die Felsen, von denen so viele von ihnen in den Abgrund gestürzt waren.
2
Will folgte dem unbekannten Fahrzeug die von Bäumen beschattete Straße entlang, die nach Golden Cove führte. Von hier aus konnte man nirgends anders hin.
Der selbsternannte Wirtschaftsrat des Städtchens hatte vielleicht ein paar Ortsschilder aufgestellt, aber im Winter hätten Fremde den Ort, den Will seit drei Monaten sein Zuhause nannte, trotzdem niemals gefunden. Es war daher keine Überraschung, dass er die dunkeläugige Frau mit dem lockigen schwarzen Haar und den auffälligen Wangenknochen unter der mittelbraunen Haut nicht kannte.
Ihre Haut war zwar weich, aber ihr Blick alt.
Ende zwanzig oder Anfang dreißig, nahm er an, vermutlich ein Kind Golden Coves, das sofort das Weite gesucht hatte, als es volljährig wurde, und jetzt zurückkam, um seine Eltern oder Großeltern zu besuchen. Man hätte annehmen können, dass Golden Cove eine Seniorenstadt wäre, zumal die Jüngeren eigentlich alle nur darauf warteten zu gehen – aber das war das Merkwürdige an dem Städtchen: Es schien sich seine verlorenen Kinder immer wieder zurückzuholen.
Peter Jacobs, der Werkstattbesitzer, den die Besucherin erwähnt hatte, war sechs Jahre lang Teil eines Formel-1-Teams gewesen und durch die Welt gereist, bis er wieder in Golden Cove gelandet war. Als man ihn fragte, warum er sein glamouröses Leben gegen die Familienwerkstatt, seinen alternden Vater und einen missgünstigen jüngeren Bruder eingetauscht hatte, zuckte er nur die Achseln und sagte, man habe eben irgendwann die Nase voll von Ferraris und wolle wieder am Meer wohnen.
Peter war aber erst seit einem Jahr wieder da, und die Frau im Auto hatte gefragt, ob Peter »noch« in der Werkstatt arbeite, was bedeutete, dass sie das letzte Mal vor mindestens sieben Jahren in Golden Cove gewesen sein konnte.
Will blinzelte nachdenklich: Die Frau und Peter waren vielleicht sogar gleich alt, zumindest ungefähr. Vielleicht sogar Schulkameraden. Und was, fragte er sich, ging ihn das an? Es war ja nicht so, als hätte man ihn als Detective nach Golden Cove versetzt. Er hatte vielleicht den Rang dafür, aber die Stelle als einziger Polizist der Gemeinde hatte er bekommen, weil er zu einem Problem geworden war – doch gleichzeitig zu ausgezeichnet und zu alt, um einfach gefeuert zu werden. Also hatten sie ihn auf die Weide von Golden Cove gestellt und dort vergessen.
Das war in Ordnung für Will. Bevor sie ihm diesen Job angeboten hatten, hatte er ohnehin kündigen wollen. Da er nach der Kündigung jeden beliebigen Job angenommen hätte, fand er, dass er ebenso gut die Ein-Mann-Polizeiwache in einer riesigen, aber sehr dünn besiedelten Gegend spielen konnte.
In seinem Gebiet gab es weit mehr Bäume als Menschen.
Die meisten Leute in Golden Cove ließen ihn in Ruhe, und wenn er eingreifen musste, dann meist, um eine Kneipenprügelei oder einen Nachbarschaftsstreit zu schlichten. Gestern hatte er einen Betrunkenen mit den Handschellen an einen Stuhl fesseln müssen, bis der Mann nüchtern genug war, um nach Hause gebracht zu werden.
Will hatte kein Gefängnis.
Und bisher hatte es in Golden Cove keine Probleme gegeben, die eine formelle Anklage gerechtfertigt hätten. Im Sommer, wenn die Touristen kamen, um hier die in den letzten Jahren von der Region verstärkt beworbenen Abenteuerurlaube zu verbringen, würde er vermutlich weit mehr Probleme haben. Das war der Grund dafür, dass das Städtchen sich jetzt überhaupt einen Polizisten leistete. Die regionale Tourismusbehörde hatte beinahe der Schlag getroffen, als ein paar Touristen nachts in Golden Cove verprügelt worden waren.
Es war eben nicht gut fürs Geschäft, wenn die Urlaubsgäste Fotos von Veilchen und gebrochenen Rippen posteten statt von der kargen Landschaft, gefährlichen Bergtouren oder der lokalen Küche.
Also hatte Golden Cove jetzt Will.
Das erste kleine Häuschen tauchte auf der rechten Straßenseite auf, samt weißem Lattenzaun und robusten Wildblumen in einem hübsch gepflegten Garten. Mrs Keith saß im Schaukelstuhl auf der Veranda, ihre Leibesfülle quoll über sein weißes Holz, und ihr Gesicht war ein blasser Vollmond, umrahmt von einem toupierten schwarzen Heiligenschein. Sie hatte den Mund mit pinkfarbenem Lippenstift bemalt und hob die dicken, beringten Finger zum Gruß.
Will wusste nicht, ob die kurz angebundene Frau im Jeep zurückwinkte, aber er tat es.
Das nächste Haus stand auf der linken Seite. Es war so heruntergekommen, wie das von Mrs Keith makellos war. Von der Fassade blätterte die blaue Farbe, und ein Auto ohne Lenkrad rostete in einem Vorgarten vor sich hin, in dem das Gras wadenhoch stand. Auf der Treppe saß ein gut aussehender Mann mit einer Zigarette in der Hand und tätowierter nussbrauner Gesichtshaut, einem kompletten tā moko, das vielleicht traditionell war, aber Fremden oft Angst machte. Es half nicht, dass Nikau Martin immer nur zerrissene schwarze Jeans, klobige Stiefel und T-Shirts mit dem Hells-Angels-Logo darauf trug.
Jetzt gerade folgte der dunkle Blick des Mannes dem grünen Jeep.
Will blieb vor dem klapprigen Gartentor stehen.
Nikau stand auf, schlenderte herbei und sprang lässig über den Zaun. Er stützte die Arme in den offenen Fensterrahmen von Wills SUV und sagte: »Ich hätte nie gedacht, dass ich Anahera mal wieder in der Stadt sehen würde.«
Anahera.
Will schmeckte dem Namen hinterher und konnte sich nicht recht entscheiden, ob er zu ihr passte oder nicht. Sein Māori war ein wenig eingerostet, aber er glaubte, dass der Name »Engel« bedeutete. Diese misstrauische Frau mit den wachsamen Augen war ihm gar nicht engelhaft vorgekommen. »Kennst du sie?«
»Sind zusammen zur Schule gegangen.« Nikau nahm einen Zug von seiner Zigarette und wandte den Kopf ab, damit der Rauch nicht in Wills Auto drang. »Sie ist hier mit einundzwanzig abgehauen. Ich erinnere mich genau daran, denn zwei Monate später habe ich Keira geheiratet.«
Will war sich nur allzu bewusst, dass Nikaus Ex-Frau sein wunder Punkt war, also überging er die Bemerkung und sagte: »Weißt du, wo sie die ganze Zeit war?«
»London, hab ich gehört. Josie hatte Kontakt zu ihr.«
Will fand es schwierig, Josie und Anahera in seinem Kopf zusammenzubringen. Die Besitzerin des Cafés der Stadt war so weich, wie Anahera hart war, so Heim und Herd, wie Anahera gefährliche Stürme und sintflutartiger Regen war. »Wollen wir heute Abend ein Bierchen trinken?«
Der Mann, der sich kleidete und benahm wie ein Gangster, aber vermutlich gebildeter war als alle anderen in der Stadt, nickte. »Um acht? Ich hab da ein paar Großstädter, die aus Greymouth kommen – sie wollen die alten Goldgräberhütten sehen.«
»Dann lass sie mal nicht in einen der Schächte fallen.« Der andere Mann lachte, Will winkte zum Abschied und fuhr weiter.
Etwa hundert Meter hinter Nikaus Haus standen die Häuser dichter beieinander, einige in gutem Zustand, andere nicht, und eins stand weiter entfernt auf einer Anhöhe, als herrschte es über die anderen. Immerhin auf dieser Seite der unsichtbaren Trennlinie.
Dann kam das Stadtzentrum.
Es war nicht mehr ganz so winzig wie vordem, denn seit dem Boom des Abenteuertourismus machten die Einheimischen das Beste aus den Adrenalinjunkies, die während der Urlaubssaison hier einfielen. Jetzt gab es die Polizeiwache, außerdem einen kleinen Supermarkt, der Lebensmittel und andere unverzichtbare Dinge sowie Souvenirs verkaufte, den Pub, der vermutlich existierte, seit der erste Goldgräber seinen Stiefel auf die Erde von Golden Cove gesetzt hatte, ein Café, eine zweistöckige Pension, eine Tierarztpraxis, ein Restaurant, das öffnete, wenn das Café schloss, und die Praxis des hiesigen Arztes – die hier alle entweder den »Operationssaal« oder »die Klinik« nannten.
Am anderen Ende der Hauptstraße stand eine Kirche mit weißem Turm, ein Outdoor-Shop war das letzte Geschäft davor. Dem Laden gegenüber waren die Feuerwehr und das Touristenbüro. Letzteres fungierte als Ausgangspunkt für alle Reisen und Touren, die von Golden Cove aus unternommen wurden. Die Liste der Aktivitäten, die hier angeboten wurden, war lang. Aber, wie der hiesige Wirtschaftsrat betonte, nahm Golden Cove auch einen »herausragenden Platz in der Kunstszene« ein. Immerhin konnte man auf eine Töpferwerkstatt verweisen, die eine etwa fünfzigjährige Einheimische hier eröffnet hatte, nachdem sie sich in Italien einen Namen gemacht hatte.
Das war es so ziemlich.
Es gab noch ein paar andere Unternehmen, die zu Hause oder in Garagen geführt wurden, aber das hier war Golden Coves Hauptstraße. Die Post wurde regelmäßig ausgeliefert, aber die Stadt hatte kein eigenes Postamt – wenn man etwas verschicken wollte, konnte der Supermarkt Marken und Verpackungsmaterial verkaufen. Den nächsten Laden für Landwirtschaftsbedarf gab es in der Nachbarstadt.
Jetzt, da die Herbstkälte schwer in der Luft lag und die Wellen viel zu gefährlich selbst für Extrem-Surfer waren, waren in der Straße keine rostigen Touristenautos oder schmutzigen Mietwagen mehr zu sehen. Das einzige neue Fahrzeug war der dunkelgrüne Jeep. Er parkte vor dem Golden Cove Café.
3
Anahera hatte gesehen, dass der Polizist vor Nikaus Haus angehalten hatte. Sie hätte dort auch anhalten sollen. Sie und Nik waren Freunde gewesen – bevor die Entfernung, die Bitterkeit und die Trauer sie auf unterschiedliche Weise verändert hatten. Aber sie wollte nicht, dass Nikau Martin der Erste war, den sie in Golden Cove begrüßte.
Vor Josies Café stieg sie aus, schloss die Autotür hinter sich, atmete die salzige Luft ein und trat in die fröhliche Wärme eines Cafés, das so gar nicht in diese graue Landschaft voller Wolken und Nebel passte.
»Ana!«
Strahlend schlang Josie die Arme um Anahera, die sie in dem Raum beinahe übersehen hätte. Ihre Freundin war gut fünfzehn Zentimeter kleiner als sie, aber ihre geringe Körpergröße hatte die Naturgewalt namens Josephine Wilson noch nie aufhalten können. Nein, jetzt hieß sie ja Josephine Taufa. Anahera war aus Gründen, über die sie lieber nicht nachdenken wollte, weil sie zu schmerzhaft waren, nicht zu Josies Hochzeit gekommen, also schob sie das beiseite und umarmte die weiche und kurvige Gestalt der besten Freundin, die sie je gehabt hatte.
Josies harter Bauch drückte sich gegen Anaheras.
Als sie sich voneinander lösten, winkte Josie einen kleinen Jungen herbei, der an einem der Tische saß und malte. »Niam ist schon drei, kannst du dir das vorstellen?« Sie vergrub ihre Finger im dichten schwarzen Haar des Kindes. »Du kennst doch Anahera, Niam – du hast doch gesehen, wie ich auf dem Laptop mit ihr gesprochen habe.«
Der Junge hatte einen warmen braunen Hautton, den er von seinem aus Tonga stammenden Vater geerbt hatte. Er lächelte Anahera schüchtern an und rannte dann wieder zu seinem Tisch, um weiterzumalen.
»Komm, setz dich«, sagte Josie, nahm Anaheras Hand und zog sie mit sich. »Im Café ist es heute ruhig, weil das Wetter schlecht werden soll, da können wir ein bisschen plaudern.«
Anahera setzte sich mit ihr an einen Tisch am Fenster. Sie hatte keine Eile, zur Hütte zu fahren. Sie würde noch viel zu viel Zeit allein mit ihren Erinnerungen verbringen, die so dunkel und brutal waren. »Ich habe dir etwas mitgebracht«, sagte sie zu ihrer Freundin. »Es ist aber im Koffer.«
»Du bist das Geschenk, Ana.« Josies Stimme war so warm und sanft wie immer. »Ich freue mich so, dass du wieder zu Hause bist.«
Zu Hause.
So ein belasteter Begriff.
Anaheras Blick fiel auf die beeindruckenden Fotos an der linken Wand des Cafés. Josie schaute lächelnd über ihre Schulter und sagte: »Miri, könntest du uns zwei Cappuccini machen? Einen entkoffeinierten für mich.«
Erst da merkte Anahera, dass ihre Freundin nicht allein im Café arbeitete. Ein schlankes, langbeiniges Mädchen mit einem so strahlenden Gesicht, dass es einem das Herz stocken ließ, lächelte von ihrem Platz hinter dem Tresen zurück. Anahera spürte instinktiv Angst um sie in sich aufsteigen.
»Für dich doch immer, Jo«, antwortete das Mädchen und ging mit der Eleganz einer Tänzerin zur Kaffeemaschine. »Kia ora, Ana.«
Anahera erwiderte den Gruß mit einem Winken. Es war so lange her, dass sie mit Menschen zusammen gewesen war, denen kia ora so leicht von den Lippen ging wie Hallo, dass ihr die Worte im Hals stecken blieben, eingerostet und alt.
»Wollt ihr auch Kuchen?«, fragte Miri. »Wir haben noch von dem Karottenkuchen mit dem Frischkäse.«
»Ja, dräng ihn uns nur auf«, lachte Josie und wandte sich wieder an Anahera. »Miri arbeitet schon eine ganze Weile für mich. Ich habe es bei einem unserer Telefonate erwähnt, weißt du noch? Aber noch sechs Wochen, dann genießt sie die Großstadtlichter von Wellington. Sie macht ein Praktikum.«
»Du bist doch Tante Matties Mädchen.« Anaheras Hirn hatte ein wenig gebraucht, um die Verbindung zwischen diesem hinreißenden Wesen und dem dünnen Kind namens Miriama Hinewai Tutaia herzustellen, das sie vor so vielen Jahren gekannt hatte und das jetzt hier bei Josie arbeitete. Als wäre die Zeit einfach so an ihr vorbeigerauscht, als sie kurz mal nicht hingesehen hatte.
»Tantchen hat noch Babyfotos von dir«, warnte Miriama mit einem Glitzern im Blick. »Keine Sorge, ich habe ihr gesagt, dass es nicht in Ordnung ist, sie zu rahmen und an die Wohnzimmerwand zu hängen. Kann aber nicht versprechen, dass sie sie nicht hervorholt, wenn du sie besuchst.«
Anahera lachte, und die Angst verging, die in einem lange vergangenen Sommer wurzelte. Menschen, die genetisch so gesegnet waren wie Miriama, gaben sich oft keine Mühe, Humor zu zeigen – oder auch nur Höflichkeit. Aber vielleicht war es genau dieser Unterschied, der Miriama so besonders machte. Das Mädchen war jetzt eine umwerfende Schönheit, aber dieselbe Knochenstruktur hatte sie als Kind ziemlich merkwürdig aussehen lassen – als wären Teile von ihr bereits in Erwachsenengröße, während andere noch wachsen mussten.
»Wo machst du das Praktikum denn?«, fragte Anahera und versuchte, die blassen Erinnerungen an die Bilder der inzwischen Neunzehnjährigen zu beleben, aber viel gab es da nicht. In diesem Alter waren zehn Jahre Unterschied einfach zu viel gewesen.
Ein so strahlendes Lächeln, als käme die Sonne hinter den Wolken hervor. »Bei einem Kollektiv professioneller Reisefotografen, die Anfänger unterstützen. Ich darf mit ihnen reisen und von ihnen lernen.«
»Die da sind von ihr.« In Josies Tonfall schwang Stolz mit, als sie auf die Fotos an den Wänden des Cafés zeigte.
Auf allen waren Bewohner von Golden Cove zu sehen, aufgenommen in Momenten, in denen sie lachten oder sich freuten. Nikau, der das Gesicht ein wenig geneigt hielt, grinste und sich mit der Hand durchs Haar fuhr. Die schwarzen Bögen seines tā moko waren ganz deutlich im Sonnenlicht zu erkennen. Mrs Keith, die den Kopf zurückwarf und so sehr lachte, dass man es beinahe zu hören meinte. Josie, die sanft lächelnd auf ihren Babybauch herunterschaute, den sie mit der Hand stützte.
»Sie sind wunderbar.« Jeder konnte die triste Landschaft der Westküste fotografieren – die Landschaft schrie geradezu danach, sie schien praktisch zu posieren. Aber Nikau zu einem Lächeln wie diesem zu bringen, obwohl er inzwischen, wie Josie ihr erzählt hatte, noch spröder und wütender geworden war – dazu brauchte man Können und Geduld. Miriama hatte nicht nur das geschafft, sondern auch noch die beeindruckenden Farben des Augenblicks eingefangen.
Und es entging Anahera nicht, dass Miriama ihre Modelle vor Hintergründen abgelichtet hatte, welche die Frage nach öffentlichen und privaten Gesichtern, nach der Wahrhaftigkeit des Glücks selbst stellten: zerknülltes Papier auf einem Fußboden, ein mit Puppen vollgestopftes Zimmer, ein einsamer Strand. »Du hast wirklich Talent.«
»Danke schön«, sagte Miriama erfreut und brachte die beiden Kaffees. »Mein Lieblingsbild ist das von Josie. Es ist ziemlich schwierig, den Ozean in den Schatten zu stellen, aber sie schafft das mit links.«
»Du musst mir keinen Honig ums Maul schmieren«, sagte Josie stirnrunzelnd. »Du bittest ja nicht um eine Gehaltserhöhung.«
Die junge Māori-Frau mit den tiefdunklen Augen und dem zu einem Dutt zusammengesteckten Haar beugte sich herunter, um ihre sonnengeküssten Arme um Josie zu schlingen. »Ich hab dich lieb, Jo. Tut mir leid, dass ich so eine untreue Tomate bin und in die große Stadt abhaue.«
»Solange du dich an mich erinnerst, wenn du reich und berühmt bist«, erwiderte Josie und tätschelte dem Mädchen mit schwesterlicher Zuneigung den Arm.
»Immer. Ich hole euch jetzt den Kuchen.« Sie brachte ihnen zwei großzügige Stücke. »Soll ich das letzte Stück unserem großen, schweigsamen und geheimnisvollen Kerl bringen?« Sie wackelte mit den Augenbrauen. »Du weißt ja, dass er eine Schwäche für Süßes hat. Und er bezahlt immer.«
Josie nickte. »Der Polizist«, erklärte sie, als Miriama gegangen war.
»Ich glaube, ich habe ihn schon kennengelernt.« Anahera erzählte Josie von ihrer Panne. »Seit wann habt ihr denn hier Polizei?«
»Seit drei Monaten. Er heißt Will. Kommt aus Christchurch.«
»Christchurch?« Das war die größte Stadt auf der Südinsel. »Was hat er denn verbrochen, dass man ihn nach Golden Cove verbannt hat?«
Josie zuckte die Achseln. »Keine Ahnung – aber ich habe mal seinen Namen in der Zeitung gesehen. In Christchurch hat er wohl besonders komplizierte Fälle gelöst, also muss es ziemlich schlimm gewesen sein.« Sie wandte sich kurz ab, um ihren Sohn zu rufen. »Schätzchen, möchtest du Kuchen?«
Niam schüttelte den Kopf und malte weiter.
»Es ist so schön, dass du wieder da bist, Ana«, sagte Josie. »Ich habe meine beste Freundin so vermisst. Endlich ist es wieder so, wie es sein sollte.«
Anahera lächelte, obwohl sie wusste, dass es unmöglich war, dass alles wieder so wurde wie früher. »Es ist schön, wieder hier zu sein«, sagte sie.
Wenn sie ehrlich war, wusste sie nicht, wohin sie sonst sollte. Und hier hatte sie immerhin Josie.
»Wirst du London vermissen?«, fragte Josie und schluckte einen Bissen Kuchen herunter. »Du hattest dort ein so glamouröses Leben. All diese Premieren und Shows, deine Auftritte in diesen riesigen Konzerthallen.« Ihr Gesicht glühte vor Begeisterung. »Ich habe allen die Artikel gezeigt. Meine Freundin, die Starpianistin!«
Anahera aß einen Bissen, um über eine Antwort nachzudenken, die Josies Illusionen nicht auf einen Schlag zunichtemachte. »Mein lieber Schwan!«, rief sie in ehrlicher Überraschung aus. »Dieser Kuchen!«
»Ich weiß – der ist toll, oder? Julia ist eine Zauberin.«
»Julia Lee? Ist die nicht Juristin geworden?«
Josie gab ihr einen kurzen Abriss der Lebensereignisse der Frau, kam dann aber wieder auf ihre Frage zurück. »Wirst du, oder? London vermissen?« In ihrem Blick lag noch eine Frage, die sie nicht stellte – Anahera hatte vorab gesagt, dass sie nicht über Edward sprechen wollte, und Josie war eine so gute Freundin, dass sie das respektierte.
»Es war schön, solange es anhielt«, sagte Anahera.
Es war schön, bis sie herausfand, dass ihr ganzes Leben eine einzige Lüge war, dass sie sechs Jahre lang nur eine Statistin im Leben eines anderen gewesen war. »Die Musik … ja, das war wunderbar.« Obwohl die Musik jetzt wie tot für sie war. »Und ich konnte die tollsten Shows sehen und so viele unfassbar talentierte Menschen kennenlernen.«
Anahera hatte immer gescherzt, dass das Theater Edwards Geliebte sei. Sie hatte sich nie vorstellen können, eine Rivalin aus Fleisch und Blut zu haben. »Aber ein Mädchen kann nicht von Premieren und Konzerthallen leben, wenn ihre whānau hier ist.« Anaheras Ehemann war tot, ihre Mutter ebenfalls, weshalb Josie der einzige Mensch war, den sie noch als Familie empfand.
Manchmal ging es eben nicht um Blutsverwandtschaft.
Wenn Josie sie am Grab von Edward gesehen hätte, wüsste sie jetzt, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war, mal abgesehen davon, dass Anaheras junger und begabter Theaterautor-Ehemann tot war.
Die kleine Glocke über der Tür klingelte.
Als Anahera den Kopf wandte, sah sie, wie Miriama wieder hereinkam. Sie reckte die Daumen. »Er hat den Kuchen genommen, und wir sind fünf Dollar reicher.«
»Sie ist wunderschön«, sagte Anahera leise zu Josie, als die junge Frau den Verkauf in die Kasse tippte.
Josie hörte die Frage, die in dieser Feststellung lag. »Zum Glück ist sie den üblichen Kleinstadtfallen ausgewichen – sie wird noch vor dem Winter aus Golden Cove heraus sein.« Ein leises Murmeln. »Wenn sie jemals zurückkommt, dann so wie du, aus eigener Entscheidung.«
Anahera wusste, dass Josies Worte auf sie selbst nicht zutrafen. Ihre Freundin führte genau das Leben, das sie schon mit vierzehn hatte führen wollen: verheiratet mit Tom Taufa, Mutter seiner Kinder und Besitzerin eines Cafés.
»Hey, Jo, macht es dir etwas aus, wenn ich heute ein bisschen früher gehe?«
Josie nickte Miriama zu. »Gehst du joggen?«
»Ich muss mir ein bisschen die Beine vertreten.«
Als das Mädchen gegangen war, warf Anahera einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Ich gehe dann auch mal lieber los«, stellte sie fest. »Ich möchte noch ein bisschen etwas in der Hütte tun, solange es noch hell ist.«
Josie runzelte die Brauen. »Ana, ich hätte nicht gedacht, dass du es ernst meinst und wirklich dort übernachten willst, sonst hätte ich Tom gebeten, die Hütte ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich habe mein Gästezimmer für dich hergerichtet.«
Anaheras kaltes, hartes Herz drohte zu zerspringen. »Ich muss dorthin«, sagte sie nur.
4
Josie hatte ihr eine Kiste mit Lebensmitteln gepackt, denn trotz ihrer Hoffnung auf einen gemeinsamen Abend kannte sie Anahera gut genug, um zu wissen, dass sie dennoch fahren würde.
Anahera packte die Vorräte gerade in ihren Jeep, als sie es in ihrem Nacken prickeln spürte. Sie schaute sich um und sah den Polizisten, der sie beobachtete. Der wohl ein Auge auf die Fremde in der Stadt hielt.
Wie hätte dieser Stadtpolizist auch wissen sollen, dass sich Golden Cove in jede ihrer Körperzellen eingebrannt hatte, dass sie immer von dieser winzigen Stadt am Ufer des Ozeans geträumt hatte, der so erbarmungslos war, dass er mehr Seelen als der Teufel auf dem Gewissen hatte – selbst als sie in einem weichen Bett in einem teuren Reihenhaus in London schlief, vor dessen Fenstern gepflegtes Gras im geteilten Stadtgarten wuchs und in dessen Schränken Designerkleider hingen.
Als sie die Kiste verstaut hatte, drehte sie sich um, um Josie erneut zu umarmen, stieg in den Jeep, um in Richtung ebenjenes erbarmungslosen Ozeans zu fahren, und als sie an einer schmalen Straße vorbeikam, die ins Landesinnere führte, schaute sie absichtlich nicht hin.
Dort gab es nichts für sie zu sehen.
Der dichte alte Wald am Rand der Stadt schloss sich etwa fünf Minuten lang um sie, bis er wieder spärlicher wurde und man zwischen den Bäumen das Meer sehen konnte. Aber die Hütte auf der anderen Seite des Waldes am Rande der Klippe stand im Schatten eines riesigen Rātā-Baumes. Nur an den hellsten Tagen drang das Sonnenlicht durch sein Laub, aber das war schon in Ordnung. Am Strand gab es genügend Sonne, wenn man es den gefährlich engen Pfad hinunter geschafft hatte.
Sie parkte den Jeep an der Seite der Hütte, blieb noch eine Weile sitzen und starrte vor sich hin, aber nichts änderte sich. Niemand war hier. Niemand würde mit breitem Lächeln herauskommen und sie zu einer Tasse Tee hereinwinken. Niemand würde sie zu einem Strandspaziergang einladen. Und zu Weihnachten, wenn der Rātā so rot wie frisches Blut blühte, würde niemand in seinem Schatten sitzen.
Sie schluckte den Kloß in ihrem Hals herunter und zwang sich dann, die Fahrertür zu öffnen und auszusteigen. Ihr Gepäck ließ sie im Auto, ging die paar Schritte zur Hütte hinüber und stieg die Stufen zur kleinen Veranda empor. Blätter raschelten unter ihren Füßen, und sie sah eine Spinne mit pelzigen, langen Beinen über das Holz eilen. Dicke Spinnweben hingen am Dachvorsprung, ein zarteres am Türknauf.
Sie drehte es gegen einen Widerstand und öffnete die Tür.
Und trat in tausend Erinnerungen.
5
Will nahm einen tiefen Schluck von seinem Bier. Nikau neben ihm drehte seine Flasche zwischen den Händen. »Die ist schon toll, oder?«, sagte der andere Mann.
Will musste nicht fragen, wen Nikau meinte; er hatte schnell gelernt, dass es nur eine Frau in der Stadt gab, über die die Männer in diesem Tonfall sprachen. »Sie ist ein bisschen jung für dich, Nik.« Er schaute zu Miriama Hinewai Tutaia hinüber, die dort Hof hielt. Ihr Haar reichte ihr bis über die Taille, und die Männer umschwärmten sie wie Bienen den Honigtopf.
Eine Frau, die so anziehend auf Männer wirkte, hatte normalerweise nicht viele Freundinnen, aber Miriama schon. Frauen umschwärmten sie ebenfalls, versuchten, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sie zum Lachen zu bringen. Sie behandelte sie mit großzügiger Eleganz, gab immer so viel, dass sich niemand ausgeschlossen fühlte, dass niemand das Gefühl bekam, nicht auszureichen. Und so, dass der schwarzhaarige Mann mit der dünnen Drahtbrille, der seinen Arm besitzergreifend um ihre Taille gelegt hatte, sich als der Wichtigste von allen fühlte. »Dr. de Souza ist dir außerdem zuvorgekommen.«
»Du weißt schon, dass der noch älter ist als ich?«
»Nur ein paar Jahre.« Viel zu jung, um als Hausarzt in einem abgelegenen Städtchen an der Westküste zu enden, aber als Will Dominic de Souzas Hintergrund überprüft hatte, tauchten keine dunklen Flecken auf, keine schwierigen Geschichten. Offenbar war der Mann tatsächlich aus dem Grund hier, den er angegeben hatte: In einer großen Stadt wäre er der Assistenzarzt in einer großen Praxis gewesen, aber in Golden Cove war er sein eigener Chef.
»Früher oder später hat sie ihn sowieso satt«, prophezeite Nikau. »Eine Frau mit so viel Leben in sich wird doch nicht mit einem Hinterwäldlerarzt glücklich. Sie wird es wilder wollen, und das kann ich ihr bieten.«
»Ich sag’s dir ja ungern, aber der Hinterwäldlerarzt wohnt in einem schönen Teil der Stadt und besitzt ein schickes europäisches Auto. Hast du dir schon mal den Zustand deines Hauses angesehen?«
Nikau zuckte die Achseln. »Wenn Miriama nur Geld wollte, hätte sie sich mit einem der reichen Touristen eingelassen, die hier vorbeikommen.«
Das konnte Will nicht bestreiten. Er war zwar erst drei Monate hier, hatte aber schon mehr als einen Touristen nach einem einzigen Blick auf Miriama praktisch auf die Knie fallen sehen. Und das waren nicht nur junge Rucksacktouristen; nach Golden Cove kamen auch die reichen Urlauber, die sich für die teuren Töpferwaren interessierten und im frisch renovierten Bed and Breakfast wohnten, das neuerdings in einem schicken Reiseführer als »geheimes Juwel« gepriesen wurde.
»Ich habe gehört, sie verlässt die Stadt.« So war das in dieser Stadt: Die Gerüchte verbreiteten sich, und man glaubte, alles über jeden zu wissen. Aber es gab dennoch Geheimnisse hier. Eine dicke Schicht Lava brodelte unter der Oberfläche. Will spürte sie, und damals, als er noch Detective gewesen war und grub und wühlte und forschte, hätte er darin herumgestochert. Aber andererseits: Wenn er noch dieser Mann wäre, wäre er nicht hier, also waren diese Überlegungen müßig.
»Noch sechs Wochen.« Nikau trank einen Schluck von seinem Bier. »Massenweise Zeit.«
Will schnaubte und betrachtete die Flaschen hinter der Bar. Hier gab es keine schicke Beleuchtung, keine gläsernen Regale. Die Bar bestand aus dunklem, stabilem Holz, und die Flaschen standen aufgereiht wie Soldaten da. »Du wirst dich an ihr verbrennen.« Will war dankbar dafür, dass er sich von Miriama nicht angezogen fühlte; für ihn war sie zu jung, zu leuchtend, zu unschuldig.
Will hatte seine eigene Unschuld schon vor so langer Zeit verloren, dass er sich kaum noch an ihren Geschmack erinnerte.
»Ein Mann verbrennt sich gern hin und wieder.« Nikau drehte sich wieder zu ihm um. »Was ist mit dir? Wie lange wirst du noch die Einladungen ablehnen, die du bekommst?«
»Sagen wir, ich bin nicht in der Stimmung.« Es gab nicht viel, wofür er in Stimmung war, nicht einmal das Leben.
»Aber einen Schwanz hast du schon noch?«
»Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, schon.«
»Dann bist du in Stimmung. Greif dir Miss Tierney mit den großen blauen Augen und den dicken Titten und wälz dich mit ihr in den Laken. Sie wirft dir schon die ganze Zeit diese ›Komm schon, Cowboy‹-Blicke zu.«
Will hatte nichts gegen die Lehrerin, die in der Nachbarstadt arbeitete, aber er hatte keine Lust, mit ihr ins Bett zu gehen, und schon gar nicht, mit ihr zusammen zu sein. Es war, als wäre dieser Teil von ihm vor dreizehn Monaten abgeschaltet worden. Will wusste nicht einmal genau, ob er ihn wieder einschalten wollte. Er beschloss, das Thema zu wechseln, und fragte: »Erzählst du mir eigentlich irgendwann, was du eigentlich in Golden Cove machst?« Will hatte ein paar Recherchen über den anderen Mann angestellt, nachdem er die Stelle als Polizist angetreten hatte – Nikau hatte auf ihn so gewirkt, als könnte er Probleme machen, und Will hatte wissen wollen, wie schlimm sie werden würden.
Was er entdeckt hatte, war etwas ganz anderes.
»Feldforschung«, lautete die scherzhafte Antwort. »Da wir gerade davon sprechen«, sagte er und drehte sich auf seinem Barhocker um, »dein Schwanz ist vielleicht im Urlaub, aber meiner nicht.« Ein Schlag auf Wills Schulter. »Ist Christine Tierney tabu?«
»Nur, wenn sie es sagt. Ich habe damit nichts zu tun.« Er hob seine Flasche. »Viel Glück.« Er trank den Rest seines Biers aus und stellte die Flasche auf das fleckige und zerkratzte Holz der Theke, um dann aufzustehen. »Ich gehe nach Hause.«
Nikau schüttelte den Kopf und schlenderte zu der Frauengruppe hinüber, in der auch Christine Tierney saß. Trotz Nikaus Frage nach Christine war sich Will nicht ganz sicher, wen Nikau tatsächlich im Auge hatte – und er war sich auch nicht sicher, ob das Nik nicht vielleicht egal war.
Da er wusste, dass Nikau zu Fuß nach Hause gehen wollte, verabschiedete er sich von einigen anderen Gästen und verließ dann die Bar. Der Wind war kalt, das Salzwasser hing schwer in der Luft. Er ging zur Straße, die ihn zum östlichen Teil der Stadt führen würde.
In seinem ersten Monat hier hatte er im Bed and Breakfast gewohnt, bis es ihm auf die Nerven ging, dass die Wirtin immer haargenau im Bilde darüber gewesen war, was er gerade tat. Also mietete er ein Haus, das einem Paar gehörte, das Golden Cove verlassen hatte, aber keinen Käufer für seinen Besitz hatte finden können. Nicht viele Menschen wollten dauerhaft an einen so abgelegenen Ort ziehen.
Ein paar Jugendliche lungerten vor dem geschlossenen Touristenbüro herum. Er überquerte die leere Straße, und sie schienen sofort Haltung anzunehmen. Er roch Tabak, beschloss aber, nichts dazu zu sagen. Das echte Problem waren die härteren Drogen – und in der Stadt gab es genug davon.
»Ich glaube, ihr geht jetzt besser nach Hause«, sagte er leise. »Ich habe gehört, ihr habt morgen Prüfung.« Die Jugendlichen mussten eine Stunde lang mit dem Bus zur nächsten Highschool fahren, was aber nicht bedeutete, dass man hier in der Stadt nicht genau über ihren Lehrplan Bescheid wusste.
Die Jugendlichen scharrten mit den Füßen. »Das wird total leicht«, murmelte einer von ihnen, aber als Will seinen Blick auffing, senkte der Junge den Kopf.
»Ich bringe euch nach Hause«, sagte Will, obwohl er wusste, dass zwei von ihnen ziemlich weit von ihm entfernt wohnten.
Die Jugendlichen waren von der Begleitung nicht gerade begeistert, aber sie waren noch jung genug, dass sie sich ohne Widerrede fügten. Er wusste, dass Golden Cove klein war, dass es unwahrscheinlich war, dass sie in die Art von Schwierigkeiten gerieten, mit denen Großstadtkinder zurechtkommen mussten, aber andererseits hatten die schlimmsten Ungeheuer oft ein vertrautes Gesicht. Es konnte natürlich sein, dass er sie direkt in die wahre Gefahrenzone zurückbrachte, aber er kannte die Eltern dieser Jugendlichen: Ein Elternpaar war ziemlich desinteressiert, ihnen war es egal, was ihre Kinder so trieben, aber der Rest gab sich trotz magerer Einkommen redlich Mühe.
Erst als hinter allen die Haustüren zugefallen waren, ging er weiter, den Blick auf die Bäume gerichtet, die das Meer verbargen. Es war ihm zu Ohren gekommen, dass das neue Gesicht in der Stadt, Anahera Spencer-Ashby, früher Anahera Rawiri, in eine der Hütten auf den Klippen gezogen war, die früher ihrer Mutter gehört hatte.
Als er das letzte Mal dort gewesen war, war ihm die Hütte nicht sicher vorgekommen, daher hatte er sich ein wenig erkundigt. Die Stadt war zu klein, um einen Bürgermeister zu haben, aber die Vorsitzende des Wirtschaftsrates hatte ihm versichert, dass die Hütte solide gebaut war. »Wird aber wohl ziemlich schmutzig darin sein«, hatte Evelyn Triskell mit einem Schaudern angemerkt, das den straffen Dutt auf ihrem Kopf verrutschen zu lassen drohte. »Vermutlich sind da überall Spinnen. Anahera ist viel mutiger als ich.«
Beinahe ohne nachzudenken, lenkte Will seine Schritte in Richtung Hütte. Es war ein weiter Weg dorthin, aber er hatte massenweise Zeit – er schlief ohnehin nicht viel –, und die Nacht war kühl, der Himmel über ihm voller Sterne. Er blieb auf dem Schotterweg stehen, der hinauf zur Hütte führte, und konnte sie von hier aus deutlich sehen. Licht drang aus dem Fenster zum Weg.
Ein Umriss bewegte sich hinter dem Fenster, eindeutig weiblich.
Sie hielt mitten in ihrer Bewegung inne und schaute in die Dunkelheit hinaus, als ob sie ihn spürte. Er wusste, dass sie ihn hier draußen in der Schwärze nicht sehen konnte, und fragte sich, wer sie wohl noch beobachtete. Sie musste sich unbedingt Vorhänge besorgen, dachte er, als sie das Licht ausschaltete, sodass sie wieder beide gleich viel sehen konnten.
Beruhigt, dass sie in Sicherheit war, wandte er sich um und ging. Das Donnern der Meereswellen war sein einziger Begleiter, und ihr Rhythmus ein dunkles Pulsieren.
6
Anahera wachte vom melodischen Gesang der Tuis vor dem Fenster auf. Die geschwätzigen Vögel aus der Familie der Honigfresser sangen und zwitscherten beim ersten Dämmern miteinander. Für Anahera waren das zutiefst vertraute Geräusche. Sie hatte gestern nicht viel geschafft, aber immerhin hatte sie das Zimmer für sich zurechtmachen können, das ihr Kinderzimmer in dem kleinen Häuschen gewesen war – sie hatte es nicht über sich gebracht, in das größere Schlafzimmer zu ziehen.
Denn das hatte ihrer Mutter gehört.
Der Metallrahmen ihres alten Bettes hatte die Jahre überlebt, aber die Laken und Steppdecken, einschließlich der Matratze, stammten von Josie. Ihr Mann hatte sie Anahera zwei Stunden nach ihrer Ankunft in der Hütte gebracht. Abgesehen von seinem kurzen Bart, war Tom Taufa immer noch genauso wie in Anaheras Erinnerung – groß und heiser und durch und durch praktisch veranlagt.
Josie hatte außerdem ein Kissen und einen kleinen Teppich mitgeschickt, den sie vor das Bett legen sollte, dazu Teller, Tassen und ein paar Haushaltsgerätschaften. Anahera war sehr froh, so eine Freundin zu haben, denn wenn sie ehrlich war, hatte sie die Reise hierher nicht richtig durchdacht. Ihre Habseligkeiten befanden sich noch auf einem Containerschiff irgendwo auf dem Nordatlantik. Sie hatte einen Koffer voller Kleider mitgebracht, ebenso ein paar andere Kleinigkeiten, die ihr irgendwie wichtig vorgekommen waren, aber die Dinge, die wirklich nützlich waren, hatte sie vergessen.
Offenbar war ihr Kopf immer noch nicht dort, wo er sein sollte.
Sie verdrängte ihre Erinnerungen, lag zehn Minuten regungslos im Bett und hörte den Vögeln zu. Der frische, zitronige Duft der Laken und der Decke hüllte sie ein. Erst als ihre Augen zu brennen begannen, merkte sie, dass sie auf das leise Klopfen ihrer Mutter an der Tür wartete, darauf, dass Haeata mit einer Tasse Kaffee für ihre Langschläfer-Tochter hereinkam. Dass sie sich auf ihre Bettkante setzte, das silbrig schwarze Haar ganz zerzaust vom Spaziergang am Strand, den sie bereits hinter sich hatte, die Haut kühl, aber mit warmem und fröhlichem Blick.
Anahera schluckte hart und setzte sich auf. Sie schaute aus dem Fenster. Gestern Nacht hatte sie das Gefühl gehabt, dass sie jemand von dort aus beobachtete. »Vorhänge«, murmelte sie. Es gab in der Stadt keine Geschäfte, in denen man Einrichtungs- und Haushaltswaren kaufen konnte, aber wenn Josie keine alten Decken hatte, die sie fürs Erste benutzen konnte, würde sie einfach zur nächsten Stadt hinüberfahren und sich dort eindecken. Sie hatte keine Ahnung, was mit den alten Vorhängen passiert war. Vielleicht waren sie einfach verrottet, bis die Kinder, die die Hütte vermutlich als Klubhaus und Treffpunkt benutzt hatten, sie abgerissen hatten.
Immerhin hatten die Kinder keine Graffiti hinterlassen, weder drinnen noch draußen.
Sie duschte schnell und beschloss, ein paar neue Schlösser anzubringen – und einen Klempner herzubestellen, der vielleicht etwas gegen das dünne Rinnsal unternehmen konnte, das aus dem Duschkopf kam. Letzteres würde einfach sein – Tom war Klempner und arbeitete in der gesamten Gegend, aber gestern Abend hatte er gesagt, dass er in nächster Zeit lieber in der Nähe von Golden Cove bleiben würde, weil Josies Schwangerschaft schon so weit fortgeschritten war.
Das Einzige, worum sie sich keine Sorgen machen musste, war Elektrizität. Sie hatte daran gedacht, den Stromversorger noch von London aus zu benachrichtigen. Und da die Lichter angingen und das Rinnsal aus der Dusche immerhin warm gewesen war, hatten die Drähte und Leitungen offenbar die Jahre überlebt, in denen sie nicht benutzt worden und die Hütte kalt und dunkel geblieben war.
Sie zog Shorts und ein weites T-Shirt über und machte sich einen Kaffee mit der Stempelkanne, die sie aus London mitgebracht hatte; den Kaffee hatte sie noch auf dem Flughafen gekauft. »Du hast eben deine Prioritäten, Ana«, murmelte sie. Dabei hatte sie die Glas- und Metallkanne nicht einmal besonders gut eingepackt, aber dennoch war sie unversehrt angekommen.
Dafür, dass sie völlig willkürlich gepackt hatte, war es pures Glück, dass sie die richtigen Kleider dabeihatte. Sogar genügend, um mit der Umkehrung der Jahreszeiten klarzukommen: Sie war an einem regnerischen Frühlingstag ins Flugzeug gestiegen und in der ersten Herbstkälte wieder ausgestiegen.
Sie trug ihre dampfende Kaffeetasse hinaus auf die Veranda und schaute zu, wie die Sonne den Himmel färbte, rubinrot und tieforange und knallpink mit zarten, vergoldeten Streifen.
Einen solchen Sonnenaufgang gab es in London nicht.
Das Knirschen von Reifen auf dem Schotter ließ sie aufschauen. Ein kleiner, zerbeulter Truck fuhr heran. Er war vielleicht früher einmal schwarz gewesen, aber jetzt bestand er nur noch aus Dellen und Rissen. Das Gesicht, das aus dem offenen Fahrerfenster schaute, als der Truck neben ihrem eigenen Auto anhielt, war bekannt – aber auch neu.
Er stieg aus.
»Nikau«, sagte sie und stieg die Treppe hinunter, um zu ihm zu gehen. »Immer früh auf den Beinen.«
»Ich dachte mir, dass du bestimmt Jetlag hast.« Er stemmte die Hände in die Hüften und sah sie von der Seite aus an. Das moko, das er sich vor fünf Jahren hatte stechen lassen, bestand aus geschwungenen Linien und Kurven, die sicher von seiner whakapapa, seiner Abstammung und seinem Platz in der Welt erzählten. Nikau schätzte tikaka Māori zu sehr, als dass er sich leichtfertig für irgendeine Zeichnung entschieden hätte.
»Also«, sagte er und wechselte in die Sprache, die sie nicht mehr gesprochen hatte, seit sie von hier fortgegangen war. »Du bist wirklich wiedergekommen. Das hätte ich nie gedacht.«
Anahera wandte den Blick zum Horizont und zum Sonnenaufgang, der mit derselben wütenden Schönheit »Heimat« schrie, mit der er von den Toten flüsterte. Sie sprach erst, als sein letztes Echo verblasst war. »Das Letzte, was ich gehört habe« – damit wandte sie sich zu Nikau –, »war, dass du auf internationalen akademischen Konferenzen über die Māori-Kultur referiert hast.« Die Worte kamen ihr heute leichter von den Lippen. Die Sprache war so ein großer Teil ihres Selbst, dass sie nicht einmal acht Jahre Schweigen hatten auslöschen können.
»Tja, nun, Shit happens.« Nikaus Gesicht wurde hart. Er schaute zurück, nicht auf den Schotterweg, sondern auf etwas, das weit entfernt lag. »Ich nehme an, Josie hat dir von mir und Keira erzählt?«
»Tut mir leid wegen der Scheidung.« Sie hatte sich immer gewundert, was Nikau in Keira sah, aber er hatte sie zweifellos geliebt. Sie waren unzertrennlich gewesen, seit sie siebzehn Jahre alt gewesen waren: der stille, eindringliche und wissbegierige Nik mit der wunderschönen, aber irgendwie … leeren Keira. Keira schien immer nur ein Echo der anderen zu sein, keine vollständige Person.
Nikau sah sie an. Sein Blick war merkwürdig ausdruckslos. »Mehr hast du dazu nicht zu sagen?«
»Ich weiß nicht genau, was du erwartest.« Anahera besaß nicht die emotionale Geduld, zwischen den Zeilen einer weiteren schlechten Ehe zu lesen. »Ich bin deine Freundin. Es tut mir leid, dass deine Ehe zerbrochen ist. Ich weiß, dass du sie geliebt hast.«
Nikau sah sie eine weitere verstörende Sekunde an, dann atmete er aus und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Mist, tut mir leid. Josie hat vermutlich die schmutzigen Details ausgelassen.«
Die Antwort auf seine Bitterkeit lag in ihrem eigenen kalten Zorn. »Hat sie dich betrogen?«
»Schlimmer. Sie hat sich ein Jahr nach unserer Trennung mit diesem Arsch zusammengetan.« Wieder ein Blick in die Ferne. »Sie haben vor vierzehn Monaten geheiratet.«
Dieser Arsch, zusammen mit der Richtung von Nikaus bösem Blick, machte klar, wer Keiras neuer Ehemann sein musste. »Daniel May?«
Ein hartes Nicken.
Sie kannten sich schon ihr ganzes Leben, Anahera und Josie, Keira und Daniel, Vincent und Nikau. Es hatte noch andere gegeben – Tom, Peter, Christine –, aber diese drei waren gekommen und wieder verschwunden. Aber sie sechs waren eine beständige, eng verwobene Clique gewesen, die sich nachts traf, um Lagerfeuer am Strand zu machen. Sie hatten sich in den Ferien, wenn alle wieder in Golden Cove waren, immer wieder gefunden. Es war egal gewesen, dass Daniel May und Vincent Baker aufs Internat gingen, weil sie aus den beiden reichsten Familien der Stadt stammten, während Nikau und Anahera zu den Ärmsten gehörten.
Und dann waren sie erwachsen geworden.
»Das ist scheiße, Nik.« Was hätte sie sonst sagen sollen? Daniel hatte das Geld und den Einfluss seines Vaters genutzt, um ein internationales Austausch-Stipendium zu »erringen«, für das Nikau weit besser qualifiziert gewesen war und das er auch weit mehr verdient hatte. Für Daniel war dieses Stipendium nur eine weitere Zeile in seinem Lebenslauf. Für den jugendlichen Nikau wäre es der einzige Weg gewesen, irgendwann einmal aus dem Land herauszukommen.
Das war die Art von Verrat, die man nie vergessen oder vergeben konnte. »Was ist denn mit Vincent?«, fragte Anahera. »Hat er sich in ein Arschloch verwandelt, während ich fort war? Ich habe ihn auf meiner Online-Freundesliste, aber eigentlich habe ich mich seit Monaten nicht mehr eingeloggt.«
Nikau, dessen Kälte jetzt schmolz, lachte bellend. »Nein«, sagte er. »Vincent ist immer noch Vincent.«
Was auch bedeutete, dass der gut aussehende Baker-Spross immer noch die Erwartungen seiner Familie erfüllte. »Auf den letzten Fotos, die ich von ihm gesehen habe, sah er glücklich aus – mit seiner Frau und den Kindern.«
»Ja, ich glaube, er ist wirklich glücklich. Wer hätte das gedacht, was?« Er zuckte die Achseln. »Eigentlich müsste er der Gestörteste von uns allen sein, bei dem Druck, den seine Eltern auf ihn ausüben.«
Anahera nickte; ihr hatte Vincent immer leidgetan – aber er schien die strengen Grenzen seines Lebens zu mögen, darin sogar zu gedeihen. »Sie waren sicher nicht die besten Eltern, aber er und sein Bruder vermissen sie bestimmt trotzdem.«
»Ja, das Feuer hat das alte Haus der Bakers vollkommen zerstört. Sie hatten keine Überlebenschance. Ich war auf der Beerdigung. Vin hat eine sehr schöne Rede gehalten.«
Anahera hatte von Vincent nichts weniger als das erwartet. »Na komm, ich schenke dir einen Kaffee ein.« Nik hatte sich verändert, sie ebenfalls, aber sie spürte, dass sie sich mit diesem zornigen Mann, der früher so ein hoffnungsvoller Junge gewesen war, immer noch wohlfühlte.
Nikau setzte sich auf einen wackeligen Stuhl, den er auf die Veranda zog. Anahera gab ihm einen Becher Kaffee und lehnte sich mit dem Gesäß an das Geländer der Veranda – nachdem sie kurz geprüft hatte, ob es standhielt. In diesem Moment hörten sie ein weiteres Auto den Schotterweg hinauffahren. »Der Londoner Verkehr ist nichts gegen Golden Cove.«
Halb hatte sie eine fröhliche Josie in Toms Klempner-Truck erwartet, aber es war der Polizei-SUV, der eine Sekunde später in Sicht kam. Der langbeinige Polizist mit den breiten Schultern und dem zu schmalen Gesicht stieg kurz darauf aus.
»Will.« Nikau hob seinen Kaffeebecher. »Bist du gekommen, um dich nach dem Wohlergehen unserer Heimkehrerin zu erkundigen?«
»Nik. Ms Spencer-Ashby.«
Seine Worte waren wie ein Schlag in die Magengrube. »Anahera reicht.« Rawiri oder Spencer-Ashby, sie wollte keinen der beiden Nachnamen. »Möchten Sie Kaffee? Ich glaube, ich trinke noch einen Becher.«
»Danke, aber gerade nicht.« Unmöglich, in diesen Augen, diesem grimmigen Gesicht zu lesen. »Ich wollte eigentlich dafür sorgen, dass Sie wissen, an wen Sie sich wenden können, wenn Sie Hilfe brauchen: Ich weiß, dass kein Telefon an dieser Adresse gemeldet ist.«
Anahera war sich nicht sicher, ob sie das amüsierte oder nicht; es war lange her, dass sie eine Festnetzleitung benutzt hatte. »Ich habe ein Handy, wie die meisten in diesem Universum.«
Sein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. »Könnten Sie mal das Funksignal hier checken?«
»Warum?«
Kein Lächeln. »Weil ich sonst wohl jeden Morgen hier vorbeikommen muss, um mich nach Ihrem Wohlergehen zu erkundigen.«
Nikau lachte, aber als er Anahera ansah, war sein Tonfall wieder ernst. »Will hat recht, Ana. Du solltest das nachprüfen. Diese Hütte hier steht mitten im Nirgendwo.«
Anahera verdrehte die Augen, ging in die Hütte und holte ihr Handy. Sie schaltete es ein, trat auf die Veranda – und fluchte. Immerhin sagte der Polizist nicht »Hab ich doch gesagt«. Stattdessen sagte er: »Ich schlage vor, Sie wechseln zu einem anderen Telefonanbieter.« Er nannte ihr eine Firma. »Deren Signal dringt in jede noch so abgelegene Ecke von Golden Cove.«
»Das Gute ist, dass deren Tarife billig sind«, fügte Nikau hinzu. »Ich kann dir mein Handy leihen, bis du gewechselt hast.«
Anahera winkte ab. »Das wird schon. Hier gibt es nichts zu stehlen, und wir wissen alle, dass kleine Einbrüche ganz an der Spitze der Kriminalstatistik von Golden Cove stehen.« Manche stahlen aus Langeweile, andere aus Armut.
»Es geht ja nicht nur um Verbrechen«, wandte der Polizist ein. »Wenn Sie hier einen Unfall haben, kann es sein, dass Sie erst nach Tagen gefunden werden.«
Anahera spürte, wie sie blass wurde. Sie hielt das Handy fest umklammert und starrte den Polizisten an. »Sie sind jetzt hier fertig. Soweit ich weiß, sind Polizisten keine Babysitter.«
7
Will fragte sich, was er falsch gemacht hatte. Anahera war plötzlich eiskalt geworden, aber auch Nikaus Gesicht wirkte von einem Herzschlag zum anderen feindselig. In Gedanken ließ er die Unterhaltung erneut ablaufen. Seine Bemerkung über einen möglichen Unfall war der Auslöser gewesen. Offenbar hatte er hier einen wunden Punkt berührt. Das passierte, wenn alle in einer kleinen Stadt etwas wussten, aber niemand darüber sprach: Ungeschickte Außenstehende trampelten dann mitten ins Fettnäpfchen.
»Stimmt«, sagte er sanft. »Ich war immer ein schrecklicher Babysitter. Habe die Kinder meiner Nachbarn den ganzen Abend lang Süßigkeiten essen lassen.« Er nickte Anahera zu, deren Gesicht versteinert wirkte, dann Nikau. »Einen schönen Tag noch.«
Er spürte, dass ihre Blicke ihm folgten, als er in sein Auto stieg, beide dunkel, beide undurchdringlich.
Es war gut, dass er sich nie eingeredet hatte, Nikau zu verstehen; ihre Freundschaft war oberflächlich und beruhte auf ihrer Vorliebe für denselben Sport, eine ordentliche Joggingtour durch den Wald und hin und wieder ein Bier. Will wusste, dass Nikau wütend und verletzt war, weil seine Ex den reichen und protzigen Daniel May geheiratet hatte, und dass Nikau eben wegen jener Ex überhaupt in Golden Cove wohnte.
Das war ungefähr alles, was er über das Privatleben von Nikau Martin wusste.
Nik wusste sogar noch weniger von Will.
Will fuhr rückwärts den Weg hinunter, weil er nicht wenden konnte, so, wie Nikau geparkt hatte, und er wusste, dass sie ihn beobachteten. Zuschauten, wie der Außenstehende fortfuhr. Er hatte sich nie Illusionen darüber gemacht – an einem Ort wie diesem blieb man jahrzehntelang Außenseiter, egal, wie sehr man sich bemühte.
Natürlich riss sich Will nicht gerade darum, irgendwo dazuzugehören.
Weshalb er genau der Richtige für den Job als einziger Polizist in Golden Cove war.
8
Anahera fuhr nach dem Frühstück in die Werkstatt, innerlich noch immer ganz kalt. Peter, der wie immer nicht lächelte und sich nur ein ganz kleines bisschen merkwürdig benahm, ohne dass man genau hätte sagen können, warum, begrüßte sie: »Hallo, Ana«, und machte sich daran, ihren Motor zu inspizieren.
Nichts Ernsthaftes, lautete das Ergebnis. Er tauschte ein kleines Teil aus, sagte ihr, ihr Jeep sei eine gute Investition, und winkte ab, als sie bezahlen wollte. »Nächstes Mal kostet es aber was.«
»Danke, Peter.« Sie hatte Gewissensbisse, als sie das sagte. Sie hatte sich nie dazu bringen können, ihn wirklich zu mögen, obwohl sie sich bemüht hatte; er war immer nett und hatte nie etwas getan, weshalb sie ihn nicht