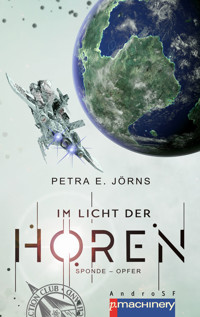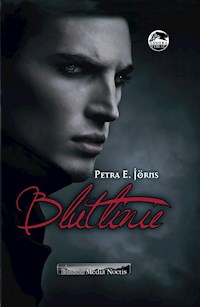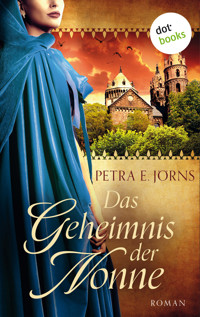Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Im Licht der Horen
- Sprache: Deutsch
Unerwartet erhalten die Chefingenieurin Deirdre MacNiall und der Pilot Jameson McAllister vom Botschafter der Erdregierung das Angebot, ihn zu den Aliens zu begleiten, die die Kolonien und die Erde bedrohen. Obwohl die Erdregierung den Botschafter entsendet, um mit den Aliens ein Beistandsabkommen gegen die Kolonien auszuhandeln, möchte er die beiden Psi-Begabten an seiner Seite wissen, um sich gegen die Gedankenmanipulation der Gegenseite wehren zu können. Die Ziele der drei beteiligten Parteien könnten unterschiedlicher nicht sein und sehr bald wird klar, dass wenigstens eine von ihnen falschspielt. Als Deirdre von einem Virus der Aliens infiziert wird, setzt McAllister alles auf eine Karte, um seine Geliebte zu retten. Dabei zeigt er zum einen, dass er immer noch mit dem Trauma seiner Entführung zu kämpfen hat, und zum anderen offenbart er Fähigkeiten, die weit über das hinausgehen, was sich die Admiralität durch die Serumgabe erhofft hatte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra E. Jörns
Im Licht der Horen
Dysis – Sonnenuntergang
AndroSF 207
Petra E. Jörns
DYSIS – SONNENUNTERGANG
Im Licht der Horen 4
AndroSF 207
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: November 2024
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Klaus Brandt
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 427 4
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 714 5
Prolog
Vollkommene Dunkelheit. Schwärze. Die Abwesenheit von Licht. Die Abwesenheit von allem.
Nichts.
War das der Tod?
Schweißnass schreckte Dee hoch. Im Dunkel konnte sie neben ihrem Bett eine Vielzahl kleiner, blinkender Lichter erkennen. Das Bett, in dem sie lag, war ihr fremd.
Endlich erinnerte sie sich. Sie befand sich im Militärkrankenhaus von New Haven, weil Tipton sie nach der letzten Mission aufgrund ihrer Schwangerschaft durchchecken wollte. Jamie war der Vater und er wusste nichts davon.
Jamie.
Ihr war mit einem Mal eiskalt.
War er etwa tot? Hatte sie deshalb im Traum nichts außer Schwärze gesehen?
Sie warf die Decke von sich, bemerkte das dünne Kabel, das sie mit einem der Monitore verband, und riss es einfach ab. Auf nackten Füßen und nur mit dem dünnen Krankenhaushemdchen bekleidet stürzte sie zur Tür.
Ein langer, kahler Korridor empfing sie, der in fahles Licht getaucht war. Die Intensivstation lag zur Rechten, wenn sie sich richtig erinnerte. Dee begann zu laufen. Ihr Herz hämmerte, als wolle es ihre Brust sprengen. Blind folgte sie ihrem Gefühl, in der Hoffnung, dass es sie nicht trügen würde. Doch der Weg wirkte weiter als am Nachmittag, als sie ihn gemeinsam mit Tipton gegangen war – wie in einem Traum, in dem die Korridore immer länger wurden, je schneller man rannte.
Als sie schließlich keuchend an der nächsten Ecke das Hinweisschild zur Intensivstation fand, wurde sie schwach vor Erleichterung. Mit zitternden Knien rannte sie weiter, stieß die Glastür auf und lief fast in eine Schwester hinein, die ihr entgegenkam.
»Misses …«
Es war nicht mehr weit. Drei Türen weiter prangte schon die 42, die Nummer des Zimmers, in dem Jamie sich befand. Die Schwester war nur das letzte Hindernis, das sie überwinden musste – wie in einem Albtraum. Dee schob sie einfach beiseite und lief weiter.
»Misses«, rief die Schwester erneut, »Sie können nicht …«
Außer Atem riss Dee die Tür auf. Fast hatte sie befürchtet, ein leeres Zimmer würde sie erwarten – so sehr hatte das Geschehen sich wie ein Traum angefühlt. Umso ernüchternder war das, was sie sah:
Ein kahler Raum mit einem Bett, neben dem zahllose Monitore standen, die leise blinkten. Die Gestalt im Bett lag reglos.
Hinter Dee schloss sich leise die Tür. Ihre Sicht verschwamm, während sie vorsichtig ein paar Schritte näher trat. Automatisch wischte sie die Tränen fort, obwohl sie eigentlich gar nicht alle Details sehen wollte – die Schläuche und Drähte, die den reglosen Körper im Bett mit den Monitoren verbanden, die Verbände und die Hälfte seines bleichen Gesichts, das daraus hervorschaute.
Die Tür klappte hinter ihr auf. »Misses«, keuchte die Schwester. »Sie dürfen hier nicht hinein. Nur Angehörige …«
»Ich bin seine Verlobte.«
Das war gelogen.
Die Tränen begannen wieder zu laufen und machten sie nahezu blind. Sie tat einen taumelnden Schritt auf das Bett zu und fasste nach seinem Handgelenk, nur um seine Haut zu spüren.
»Es geht ihm gut«, sagte die Schwester. »Sie können sich beruhigt wieder hinlegen, Misses …«
»MacNiall«, fügte Dee leise hinzu.
Seine Haut fühlte sich warm an, lebendig. Aber der goldene Funken, der sich stets in ihrer Brust einnistete, wenn sie ihm nahe war, blieb aus. Alles, was sich in ihrem Innern sammelte, war kalte, graue Asche.
1. Kapitel
»Guten Morgen, meine Teure.«
Das war Tiptons Stimme.
Verwirrt setzte Dee sich in ihrem Bett auf. Sie musste geschlafen haben. War ihr Besuch an Jamies Bett in der vergangenen Nacht etwa doch nur ein Traum gewesen?
»Guten Morgen«, erwiderte sie mechanisch.
Neben ihrem Bett stand der Arzt, die grauen Stoppeln im hageren Gesicht und die dunklen Ringe unter den hellen Augen mit dem spöttischen Blick sagten ihr, dass er wenig Schlaf genossen hatte.
Ihr Herz klopfte auf einmal schneller. Stimmte etwa etwas nicht mit Jamie?
Tipton lächelte schief und setzte sich auf ihre Bettkante. »Wie fühlen Sie sich, meine Liebe? Wie ich hörte, haben Sie heute Nacht die Intensivstation heimgesucht und dabei die gute Schwester Flemming fast zu Tode erschreckt. Da drängt sich mir doch der Verdacht auf, dass Sie mir vielleicht etwas erzählen möchten.«
Wollte sie das? Tipton den seltsamen Traum erzählen?
Im hellen Tageslicht, das durch das Fenster fiel, kam ihr das Geschehen der Nacht absurd vor.
»Ich wollte nur nach ihm sehen.«
»Ach so!« Fast wäre Dee auf Tiptons Tonfall hereingefallen. Doch dann setzte er hinzu: »So wie damals, als er auf der Krankenstation der Nyx lag und fast gestorben wäre. Sind wir über dieses Stadium des gegenseitigen Misstrauens nicht längst hinaus?«
»Ich hatte geträumt«, seufzte Dee verdrossen. »Naja, nichts wirklich Interessantes. Ich träumte von Dunkelheit und da dachte ich …«
Dass er tot wäre.
Sie konnte den Teil des Satzes nicht aussprechen, so sehr erschreckte er sie. Als würde er dadurch wahr werden, an Substanz gewinnen.
»Dass er von seinem Recht des Ablebens Gebrauch gemacht haben könnte«, beendete Tipton an ihrer Stelle ihre Worte. »Um der Ehrlichkeit den Vortritt zu lassen – Ihre Ahnung hat Sie nicht getrogen.«
Dee glaubte zu fallen.
»Doc …«
Sie wollte aufspringen, aber Tipton hielt sie mit erstaunlicher Kraft fest.
»Nicht so eilig, meine Teure. Ihr Objekt der Begierde ist stabil. Nachdem ich von Ihrer Eskapade erfahren habe, habe ich eingedenk Ihres schon mehrfach bewiesenen Gespürs seine Werte überprüft. Wie es scheint, zu Recht. Denn bedauerlicherweise haben sich seine Werte in den frühen Morgenstunden rapide verschlechtert.«
Und sie hatte geschlafen.
»Wie … wie geht es ihm«, wisperte sie.
Die Schuld brannte in ihren Augen.
»Den Umständen entsprechend gut«, antwortete Tipton. »Aber leider mussten wir die rekonstruktive Behandlung abbrechen. Wie es scheint, kam es zu einer Kreuzreaktion mit dem Testserum. Ich fürchte, so lange wir dieses Problem nicht gelöst haben, müssen wir die Behandlung aussetzen. Was nicht bedeutet, dass wir sie nicht fortsetzen werden.«
»Sie hatten versprochen …«
Dass er wieder wird wie neu. So hatte Tipton sich ausgedrückt.
»Glauben Sie etwa, ich hätte meine Worte vergessen? Mitnichten. Ich muss Sie nur leider ein wenig hinsichtlich der Umsetzung vertrösten, bis wir unsere Tests abgeschlossen haben. Damit Ihnen nicht langweilig wird, dachte ich mir, Sie wären vielleicht gerne dabei anwesend, wenn wir ihn aufwecken.«
»Sie wollen ihn aus dem künstlichen Koma holen? Aber …« Hatte Tipton nicht gesagt, dass es nötig wäre, um Jamie unnötigen Stress zu ersparen?
»Wie ich bereits sagte«, unterbrach Tipton sie. »Wir sind dazu gezwungen, einige Dinge zu überprüfen. Dazu gehören auch Kreuzreaktionen mit den Medikamenten, die ihn ins künstliche Koma versetzen. Wollen Sie nun dabei sein, wenn das männliche Dornröschen wachgeküsst wird – ja oder nein?«
Der Schlauch in seinem Mund war schon entfernt worden, als sie in sein Zimmer kam. Sie hatte sich angezogen, trug die Leggins und den ausgeleierten Pulli, die sie für ihre Tarnidentität benutzt hatte.
Wie gebannt hing ihr Blick an der einen Hälfte seines Gesichts, die aus den Verbänden hervorschaute. Sie wollte hinschauen und doch wieder nicht. Wollte die Verbände nicht sehen, nicht sein bleiches, hager gewordenes Gesicht – beides leibhaftig gewordene Erinnerung dessen, was ihm angetan worden war.
Ihretwegen. Weil sie versagt hatte. Weil sie ihm nicht vertraut hatte. Weil sie geglaubt hatte, er würde sie betrügen. Dabei war er es gewesen, der erneut hintergangen und deshalb als Verräter und Verbrecher abgestempelt worden war. Und sie war darauf hereingefallen, hatte das Spiel mitgespielt und ihn im Stich gelassen.
Wenn sie … Nein, sie musste aufhören damit, sich Vorwürfe zu machen. Was geschehen war, ließ sich nicht ändern. Er brauchte sie – jetzt mehr denn je. Sie musste für ihn da sein, ihm den Halt geben, den er nun brauchen würde und den sie ihm verweigert hatte.
Scheu machte sie einen Schritt auf das Bett zu. Hatte Tipton mit ihr geredet? Er zeigte auf einen der Monitore und nickte ihr ein zweites Mal auffordernd zu. Dee kam es vor, als hätte sie irgendetwas verpasst, wagte aber nicht nachzufragen. Stattdessen setzte sie sich auf die Bettkante.
In ihrer Kehle würgte es, als sie ihm so nah war. Es drängte sie danach, sein blondes Haar zu zerzausen, die blonden Bartstoppeln zu fühlen oder wenigstens seine schlanken Finger zu streicheln. Doch sein Kopf schien meilenweit entfernt und seine Hände, die direkt neben ihren lagen, wagte sie nicht zu berühren. Denn sie wirkten wie zwei leblose Vögel, an die man ein Exoskelett geschnallt hatte.
Hatte Tipton eben »gleich« gesagt?
Im Piepen der Monitore änderte sich etwas. Bildete sie sich das ein, oder hob sich sein Brustkorb nun stärker als zuvor? Nein, sie musste sich getäuscht haben. Im gleichen Augenblick zitterte sein rechtes Augenlid. Ein Schauer schien durch seinen Körper zu rinnen. Dann öffnete er blinzelnd das eine Auge.
Dee wusste nicht, ob sie weinen oder lachen sollte. Sie fühlte Tränen über ihre Wangen rinnen. Ein Schluchzen drängte in ihrer Kehle nach oben und trotzdem hätte sie am liebsten gejauchzt vor Freude.
»Jamie«, flüsterte sie.
Er blinzelte erneut. Die dunkelgraue Pupille richtete sich auf sie.
»Ich bin hier«, würgte sie hervor.
Ich verlasse dich nicht, wollte sie hinzufügen. Aber sie brachte es nicht über ihre Lippen, denn es wäre eine Lüge gewesen.
Doch sein Blick glitt über sie hinweg, als kenne er sie nicht. Irrte weiter an die Decke, verlor sich dort. Als sehe er dort etwas, was nur er sehen konnte.
In ihrer Kehle würgte es. Weit entfernt, wie durch Watte oder Nebel hörte sie Tiptons Stimme. Gut? Hatte er eben gesagt, Jamies Werte seien gut? Nein, sie musste sich verhört haben.
Die Sehnsucht, ihn zu berühren, überwältigte sie. Zitternd streckte sie die Hand aus, wagte es schließlich doch, über seine Finger zu streichen, die neben ihr so leblos auf der Decke lagen.
Sie war vorbereitet auf das wilde Konglomerat aus seinen Gefühlen, das sie mit der Berührung überfallen würde – überfallen musste. Aber da war nichts. Gar nichts. Als hätte er die Tür vor ihrer Nase zugeschlagen.
»Ich liebe dich«, sagte sie endlich, während die Tränen sie nahezu blind machten.
Das war nicht gelogen. Das war alles, was zählte.
Aber in ihrem Geist sah sie nur den blonden Jungen, der sich in seiner Festung vergrub. Und die Mauern waren dicker und höher als je zuvor.
Sie hatte gedacht, dass sie sich besser fühlen würde, wenn sie wieder zu Hause war in den vertrauten vier Wänden. Deshalb hatte sie sofort »ja« gesagt, als Tipton ihr am Nachmittag eröffnet hatte, dass sie nachhause gehen könnte, falls sie es wünschte, – und sich im nächsten Augenblick darüber geschämt, weil sie Jamie damit schon wieder im Stich ließ. Aber nachdem sie mehrere Stunden neben seinem Bett gesessen hatte, ohne dass er Notiz von ihr genommen hatte, fühlte sie sich seltsam überflüssig und verloren. Da kam ihr Tiptons Angebot gerade recht.
Sie hatte nur zwei Papiere unterzeichnen müssen. Eines, das sie zur Geheimhaltung verpflichtete und dazu, jederzeit für das Debriefing bereitzustehen. Und ein zweites, das besagte, dass sie das Krankenhaus auf eigene Verantwortung verließ. Sie hatte beide ohne Kommentar unterschrieben und sich verabschiedet.
Doch im gleichen Augenblick, in dem das Schloss der Wohnungstür hinter ihr zufiel, begriff sie, dass sie sich geirrt hatte. Ihr erster Blick fiel auf die zertrümmerte Badezimmertür, die das SWAT-Team hinterlassen hatte, als es Jamie verhaftet hatte. Sie war vor dem Einsatz nicht dazu gekommen, sie reparieren zu lassen.
Sie versuchte, so zu tun, als sehe sie es nicht, ging weiter ins Wohnzimmer und setzte ihre Reisetasche ab. Auf dem Sofa lag die Decke, mit der sie ihn zugedeckt hatte an jenem Tag vor … Wie lange war das her? Es kam ihr wie gestern vor und gleichzeitig wie ein Jahrzehnt.
Wie betäubt tappte sie in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen. Sie nahm kaum wahr, was sie tat, roch nur den Kaffee, als die Maschine anlief. Das Dröhnen übertönte die Fetzen einer Melodie. Einen Herzschlag glaubte sie tatsächlich, dass es Jamie war, der unter der Dusche sang, bis sie realisierte, dass nur einer der Nachbarn die Musik zu laut gedreht hatte.
Mit der Kaffeetasse in den Händen ließ sie sich auf den Barhocker sinken, der vor dem Küchenfenster stand und starrte hinaus aufs Meer. Am Himmel jagten sich die Möwen durch die Fetzen weißer Wolken. Jamie mochte Möwen. Die Tränen rannen über ihre Wangen, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte.
In diesem Augenblick klingelte es.
Blind vor Tränen stand sie auf und tappte zur Bedienkonsole der Kommanlage. »Ja«, fragte sie.
»Hier ist Aodhan. Ich muss mit dir über die Anklage gegen Paul sprechen.«
Aodhan? Hier? Das passte gar nicht zu ihrem überkorrekten Bruder, der sie bisher stets in sein Anwaltsbüro bestellt hatte, um einen Fall mit ihr zu besprechen.
»Einen Moment«, erwiderte sie und betätigte den Türöffner. Sie wischte die Tränen weg, während sie einen Blick auf ihr blasses Gesicht in der spiegelnden Scheibe der Kommanlage erhaschte. Als es an der Wohnungstür klopfte, zuckte sie zusammen und wunderte sich, wo die Zeit geblieben war, die Aodhan brauchte, um die Treppen zum Dachgeschoss zu erklimmen.
Mit zittrigen Knien eilte sie zur Tür. Umso erstaunter war sie, als es Con war, der davor wartete. Aodhan langte gerade mit distinguierter Miene am letzten Treppenabsatz an.
»Hallo Dee«, sagte Con nur.
Da lag sie auf einmal in seinen Armen und weinte, ohne zu wissen, wie sie dorthin gelangt war.
»Hey«, sagte Con immer wieder. Sein Arm lag um ihre Schultern, nachdem er sie zum Sofa dirigiert und sich dort neben sie gesetzt hatte.
Aodhan stand noch an der Terrassentür, den Blick aufs Meer gerichtet, als genieße er die Aussicht. Oder als ginge ihn das alles nichts an.
Dees Schluchzen wurde endlich weniger. Bis zu diesem Moment hatte sie nicht geahnt, wie verzweifelt sie war.
»Nun beruhige dich doch. Es ist ja alles gut«, sagte Con. »Wir sind ja bei dir.«
»Ich werde schon dafür sorgen, dass er nicht so billig davonkommt.« Aodhans Worte klangen kühl wie immer, er drehte sich dabei nicht einmal zu ihr um.
Da begriff sie endlich. Die beiden waren hier, weil sie glaubten, ihr wegen der Vergewaltigung durch Paul beistehen zu müssen. Die Sache hatte sie in ihrer Sorge um Jamie nahezu vergessen gehabt. Trotz des Jammers entschlüpfte ihr ein bitterer Laut, halb Schnauben, halb Lachen.
»Es ist nicht wegen Paul«, würgte sie nach einem tiefen Atemzug hervor.
Con warf einen Blick in die Runde, als wolle er sichergehen, dass er niemanden übersehen hatte. »Wo steckt eigentlich Jamie?«
Nun drehte sich auch Aodhan zu ihr um. Seine Miene war angespannt. »Weinst du seinetwegen?«
Sie brachte kein Wort über die Lippen.
»Habt ihr euch getrennt«, fragte Con.
Neue Tränen schnürten ihr die Kehle zu. Stumm schüttelte sie den Kopf. Wenn es nur das wäre! Wenn …
»Krankenhaus«, würgte sie endlich hervor. »Er ist im Militärkrankenhaus …«
»Hat er sich etwa mit deinem Ex etwa geprügelt?« Cons Stimme schwankte zwischen Belustigung und Unglauben.
»Nein. Er … er … Ich kann nicht darüber reden.«
»Geheimhaltungspflicht?«, fragte Con.
Aodhan kam einen Schritt näher.
Dee nickte schwach. »Jamie … er wurde schwer verletzt. Ich kann nicht mehr sagen. Er … er …«
»Ach, Dee! Das tut mir so leid.« Ganz sacht zog Con sie in seine Arme.
Cons Mitleid brach all ihre Schutzdämme. Übergangslos begann sie wieder zu weinen und hielt sich an ihrem Bruder fest.
Auf der anderen Seite setzte Aodhan sich neben sie. Sie konnte nur seine Wärme fühlen. Aber es war mehr Mitgefühl als der ältere Bruder ihr je gezeigt hatte.
»Wir sind ja bei dir«, flüsterte Con und streichelte ihren Rücken.
Die Nähe ihrer beiden Brüder legte sich wie ein Pflaster über den Schmerz, der in ihrer Brust wühlte, wenn sie an Jamie dachte. Endlich versiegten ihre Tränen. Sie schaffte es, durchzuatmen und sich von Con zu lösen, um ihre beiden Brüder anzusehen.
»Können wir irgendetwas für dich tun?«, fragte Con.
Spontan wollte Dee den Kopf schütteln, als ihr etwas einfiel. »Ja«, meinte sie, »du könntest die Badezimmertür für mich reparieren lassen.«
Con schmunzelte. »Wenn’s weiter nichts ist.«
»Sonst noch was«, fragte Aodhan. »Seanan hat mich gefragt, ob …«
Mit einem müden Lächeln drehte sie sich zu ihrem anderen Bruder um: »Wenn Seanan etwas von mir will, soll er mich gefälligst selber fragen. Sorg du einfach dafür, dass Paul seine Strafe erhält. Das genügt!«
Trotz ihres Zorns auf Seanan begriff Dee, dass sie endlich zu Hause angekommen war. Denn hier waren die Menschen, bei denen sie all ihr Leid abladen konnte. Die Familie, die immer für sie da sein würde.
Jamie dagegen hatte nur sie.
Als sie minutenlang vor der Tür mit der Zimmernummer 42 stand, begriff sie endlich, dass sie Angst hatte. Wovor genau, konnte sie nicht benennen. Dass er sie wieder ignorieren würde? Dass es ihm schlechter ging? Dass nichts so sein würde wie früher? Dass sie ihn verloren hatte?
Was würde er an ihrer Stelle tun? Ganz sicherlich nicht minutenlang vor ihrer Tür ausharren, anstatt sie zu besuchen.
Da drückte sie schließlich die Klinke und öffnete die Tür.
Ein paar der Monitore waren verschwunden. Als sie nähertrat, bemerkte sie, dass auch ein paar Schläuche verschwunden waren, ebenso wie die Schienen an seinen Fingern und der Verband in seinem Gesicht.
Er schien sie nicht gehört zu haben. Seine Augen waren geschlossen, als schliefe er.
So leise sie konnte, trat sie neben ihn. Im diesigen Tageslicht, das durch das Fenster auf sein Gesicht fiel, konnte sie das feine Narbengeflecht erkennen, das seine linke Gesichtshälfte überzog. Die winzigen Sommersprossen dort waren verschwunden, verschluckt von den Narben. Ihr wurde flau bei dem Anblick. Wie wohl die anderen Stellen aussahen, an denen er misshandelt worden war? Sie wagte nicht, es sich auszumalen.
Unwillkürlich presste sie die Hand vor den Mund, aus Angst, sich zu übergeben. Aber das gewohnte Heben des Magens blieb aus.
Ihr Blick irrte zur Tür. Sicherlich war es besser, wenn sie ihn nicht weckte. Er brauchte Ruhe. Das hatte Tipton gesagt. Sie wollte sich gerade umdrehen, um zu gehen, als die Decke neben ihr raschelte.
»Dee?« Seine Stimme war nur ein heiseres Flüstern.
Sie fuhr herum und starrte ihn an, unfähig sich zu rühren. Da streckte er mit einer seltsam eckigen Bewegung die Hand nach ihr aus. Sie musste sie einfangen und festhalten, einfach aus dem Verlangen, ihn zu berühren, um zu erfahren, dass er real war. Den Druck seiner Finger zu fühlen, auch wenn er schwach und zittrig war.
»Hi«, wisperte sie.
Ein verlorenes Lächeln umspielte seine Lippen.
»Hi«, antwortete er rau.
Geh nicht, glaubte sie zu hören. Verlass mich nicht!
Ohne es zu wollen, setzte sie sich auf den Bettrand.
»Wie geht es dir«, fragte sie, obwohl sie eigentlich sagen wollte: »Ich liebe dich.«
»Beschissen.«
Das Verlangen, seine Haare zu zausen, kam so plötzlich, dass sie sich nicht widersetzen konnte. Seine seidigen Haare wieder zu fühlen, tat unerwartet gut. Sie konnte gar nicht aufhören, sie zu streicheln, seine Stirn, die Wange.
Seine Augen glitzerten. Eine Träne rollte über seine Wange.
»Ich liebe dich.« Nun sagte sie es doch.
»Ich weiß«, flüsterte er.
Da sah sie ihn endlich richtig an, umfasste sein Gesicht mit beiden Händen, liebkoste es, während er eckig und ungeschickt ihre Arme streichelte. Bis sie überquoll vor Zärtlichkeit und einen Kuss auf seine Stirn hauchte, auf seine Nase, die Wangen, den Mund.
Er seufzte nur leise und schloss die Augen, hielt still, als hätte er Angst, sie durch eine unbedachte Bewegung zu verscheuchen. Oder als fürchte er, einen dieser kostbaren Augenblicke zu verpassen.
Weshalb sie ihn nicht hatte besuchen wollen, verstand sie nun nicht mehr. Sie wollte nur bei ihm bleiben, ganz nah, bis ans Ender aller Tage. Plötzlich lag sie neben ihm auf dem Bett, sein Kopf schmiegte sich in ihre Armbeuge; sie drückte das Gesicht in sein Haar und wunderte sich nur noch, weshalb es so lange gedauert hatte.
»Ich liebe dich auch«, murmelte er.
Aber wieder hörte sie wie ein fernes Echo in ihrem Innern: »Verlass mich nicht!«
Da begriff sie, was fehlte. Es war das goldene Funkeln, das sich immer in ihrer Brust einnistete, wenn er sie berührte – das von ihm stammte und das sie so vermisste.
Denn auch wenn er sie in die Arme geschlossen hatte, war das Tor zu seinem Innern immer noch verschlossen.
In Nikolajewas Büro hatte sich nichts geändert. Es war immer noch zu klein und ohne persönliche Note.
»Setzen Sie sich«, sagte Nikolajewa. Ihre aschblonden Haare waren in einem strengen Knoten auf ihrem Hinterkopf zusammengebunden. Obwohl die Frisur Nikolajewa den Anschein von Mütterlichkeit verlieh, fiel Dee nicht darauf herein.
Sie gehorchte, ohne sich zu bedanken und sah die Admiralin wartend an.
»Ich habe mich dazu entschieden, das Debriefing selber durchzuführen. Trotzdem muss ich Sie darauf hinweisen, dass unser Gespräch aufgezeichnet wird. Sind Sie damit einverstanden?«
Als ob sie dagegen protestieren konnte. »Ja, das bin ich.«
»Lassen Sie uns vorab ein paar Eingangsfragen klären.« Nikolajewa sah kurz von ihren Notizen auf. »Sie sind schwanger. Ist das richtig?«
Schlagartig wurde Dee heiß. »Ja. Doktor Tipton wusste nicht, dass …«
»Es geht hier nicht um Doktor Tipton sondern um Sie. Lieutenant McAllister ist der Vater?«
»Ja.« Die Hitze nahm zu.
»Tipton hat Ihnen während der letzten Mission eine kleine Dosis des Serums gespritzt.«
»Auf meine Bitte. Weil ich hoffte, auf diese Weise Jamie … ich meine Lieutenant McAllister zu finden.« Inzwischen musste ihr Gesicht leuchten wie eine reife Tomate.
»Also ja.« Wieder musterte Nikolajewa sie. »Ihnen ist klar, dass Ihr Kind zwei Eltern als Mutanten hat, von denen einer derweil als Klasse 0 geführt wird. Sie selber wurden aufgrund des Serums auf Klasse 4 hochgestuft. Wir haben keine Ahnung, welche Konsequenzen das für Ihr ungeborenes Kind haben wird. Daher wird Doktor Tipton die weitere Überwachung der Schwangerschaft vornehmen. Sind Sie damit einverstanden?«
Sie nickte. »Ja«, setzte sie mit belegter Stimme hinzu.
»Schön.« Nikolajewa legte endlich ihre Notizen beiseite. »Vom Prinzip her weiß ich bereits alles. Nur ein paar Punkte sind mir noch unklar. Inwieweit konnten Sie Lieutenant McAllisters Entführung und Folter beiwohnen?«
»Ich … naja … Doktor Tipton hat es mir mal erklärt. Wir wären wie zwei Schwinggabeln, die in der gleichen Frequenz schwingen. Wir waren von Anfang an irgendwie miteinander verbunden. Wieso weiß ich nicht. Anfangs waren es nur Gefühle, die ich spürte, wenn wir uns berührten. Dann konnte ich fühlen, was er fühlt, obwohl wir nicht in einem Raum waren. Und jetzt … Als er entführt wurde, war es, als würde ich durch seine Augen schauen, durch seine Ohren hören. Als wäre ich er.«
»Das muss verwirrend sein.«
»Und ob es das ist. Terry hat mir einen mentalen Block gesetzt, damit es mich nicht behindert. Es … die Verbindung wurde immer stärker und unkontrollierbarer. Wie …« Sie suchte nach Worten. »… wie ein Wackelkontakt?«
»Verstehe. Und mit dem mentalen Block …«
»… gab es nur eine Verbindung, wenn Terry mir dabei geholfen hat. Bis … bis er fast gestorben ist. Seitdem kann ich wieder ohne Terrys Hilfe Kontakt zu ihm aufnehmen.«
Falsch, inzwischen konnte sie gar keinen Kontakt mehr mit ihm aufnehmen.
Nikolajewa machte sich eine Notiz. »Was Sie gesehen haben und was geschehen ist, weiß ich bereits. Aber bitte beschreiben Sie mir, wie Lieutenant McAllister sich verhalten hat. Was er getan hat. Was hat sich geändert? Wie funktioniert sein Talent?«
Da war es wieder!
»Sie wollen ihn immer noch gegen die Aliens einsetzen!«
»Commander MacNiall, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Nach all den Informationen, die wir Dank Ihnen gesammelt haben, ist er die einzige Option, die uns bleibt. Wir haben keine andere Wahl. Aber zu seinem und unserem Wohl muss ich wissen, wie er funktioniert. Und ich hege die berechtigte Hoffnung, dass ich von Ihnen eine weitreichendere Antwort erhalten werde als von ihm.«
»Die haben ihn tagelang gequält. Zu Tode gequält. Sie können doch nicht allen Ernstes …«
»Ich muss, Commander MacNiall. Ich habe keine andere Wahl. Wenn ich sie hätte, wäre er der Letzte, den ich wieder zum Einsatz bringen würde. Das versichere ich Ihnen.«
Sie konnte die andere Frau nur anstarren, bar jeglicher Regung, so fassungslos war sie.
»Also, Commander MacNiall, wie funktioniert sein Talent? Kann er wirklich die Realität verändern?«
Übergangslos stand Dee auf. »Das wissen sie doch schon. Ich habe meinem Bericht nichts hinzuzufügen. Und Ihr Urteil haben Sie auch bereits gefällt. Wozu brauchen Sie mich noch? Soll ich Ihre Meinung etwa auch noch bestätigen?«
»Setzen Sie sich, Commander MacNiall!« Bestimmt wies Nikolajewa auf den Stuhl. »Und hören Sie mir zu! Botschafter Duras lässt Sie grüßen.«
»Duras …«
Der Name nahm ihr die Luft aus den Segeln. Sie setzte sich wieder wie eine Marionette, deren Fäden gekappt wurden.
»Sind Sie nun doch gewillt, mir zuzuhören?«
Sie nickte.
»Coulthard sprach von einem Misston, der McAllister gestört hat. Was hat es damit auf sich?«
»Nun, es war wie ein sehr tiefes Pulsen. Wir nehmen an, dass es sich um ein astrophysikalisches Phänomen gehandelt hat – ein Pulsar vielleicht. Im Bericht steht, dass die These geprüft werden sollte. Wieso fragen Sie mich danach?«
»Weil ich mir sicher sein will, dass seine Fähigkeiten nicht erneut durch diesen Misston gestört werden können. Er arbeitet mit Tönen?«
»Ja, das habe ich doch alles in meinem Bericht geschrieben. Was wollen Sie denn noch wissen?«
»Was hat es mit dem kleinen Jungen auf sich?«
Das hatte nicht in ihrem Bericht gestanden. »Woher wissen Sie davon?«
»Beantworten Sie mir meine Frage!«
»Das muss Jamie Ihnen sagen.«
»Ich frage Sie!«
Sekundenlang stierte sie an die Wand hinter Nikolajewas Schreibtisch. Möglicherweise wurde er für untauglich erklärt, wenn sie davon erzählte. Er würde sie dafür hassen. Aber vielleicht ließ es ihn leben.
»Er ist ein Symbol für Jamies Flucht vor der Welt. Er hat alle Menschen verloren, an denen ihm etwas lag. Er hat Angst davor, noch mehr zu verlieren. Deshalb versteckt er sich. In dem kleinen Jungen. In einer Festung.«
Sinnend sah Nikolajewa sie an. »Verstehe. Sie sind sein Anker.«
So hatte sie das nie betrachtet. »Vielleicht.«
Eine Pause entstand.
»Sagen Sie mir, weshalb Botschafter Duras mich grüßen lässt?«, fragte Dee endlich.
»Hatten Sie ihm nicht einen Gruß ausrichten lassen?« Nikolajewa klang amüsiert.
»Doch. Hatte ich. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass er mir antwortet.«
Nikolajewas Miene wurde ernst. »Er lässt Sie aus einem guten Grund grüßen. Er bittet uns um Unterstützung. Der Feind hat eine Abordnung der Schwarzen Garde in ihr Heimatsystem geladen. Zur Aushandlung eines Unterstützungsabkommens.«
»Die Erdregierung will …« Unwillkürlich schnappte Dee nach Luft.
»Duras bietet uns an, dass eine Abordnung der Kolonien ihn begleitet.«
»Duras wurde eingeladen?«
»Ja, und er wünscht sich Sie und McAllister als Begleitung. Als Leibwache sozusagen. Weil Sie beide die einzigen Mutanten sind, denen er traut und weil er der Überzeugung ist, dass er ihre Hilfe dort brauchen wird, wenn Ihre Überlegungen hinsichtlich der Frau, die sich als Fay Hagen ausgibt, stimmen.«
»Sind Sie verrückt? Jamie lag noch bis vor zwei Tagen im künstlichen Koma. Er ist schwer verletzt. Tipton hat gesagt, dass er mindestens für weitere vier Wochen ins künstliche Koma versetzt werden muss, sobald die medizinischen Probleme geklärt sind. Sie können doch nicht …«
»Meine Entscheidung ist schon gefallen. McAllister wird Duras begleiten. Die einzige Frage, die ich noch klären muss, ist, ob ich ihn für eingeschränkt diensttauglich erklären lassen kann oder nicht. Ob er Duras also als Pilot begleiten wird oder nur als Beobachter.«
»Und was, wenn das wieder nur eine Falle ist, um Jamie in die Finger zu bekommen? Von Hagen oder … oder von der Schwarzen Garde.«
»Sie irren sich, Commander MacNiall. Wenn ich die Berichte richtig deute, dann hat Hagen bereits, was sie wollte. Und genau aus diesem Grund bin ich dazu bereit, das Risiko einzugehen. Nein, genau deshalb muss ich dieses Risiko eingehen. Um zu verhindern, dass sie das, was sie hat, gegen uns einsetzen kann.«
Dee fühlte sich inwändig wie hohl. »Wann?«, fragte sie nur noch.
»In sieben Tagen. Abzüglich der zwei Tage, die bereits verstrichen sind. Mehr Zeit haben wir nicht.«
»Das heißt, Sie wollen ihn in fünf Tagen wieder losschicken? Das …« Dee glaubte ersticken zu müssen.
»Ich habe keine andere Wahl.«
»Schön«, sagte Dee bitter. »Wenn es ohnehin schon beschlossen ist, dann sorgen Sie wenigstens dafür, dass er das Krankenhaus etwas früher verlassen kann. Damit er einen Tag durchatmen kann. Einen einzigen Tag. Ist das zuviel verlangt?«
»Nein, ich glaube, das kann ich arrangieren.« Nikolajewa machte sich wieder eine Notiz.
Nervös befeuchtete Dee ihre Lippen. »Und lassen Sie ihn fliegen. Bitte!« Sie erinnerte sich an die Ruhe und Zufriedenheit, die ihn erfüllte, wenn er die Töne dirigierte. »Es wird ihm helfen. Er braucht es. Es … Sie wissen nicht, wie das ist. Wie ein riesiger Chor, der auf die geringste seiner Bewegungen reagiert. So wunderschön. Wie Engelsstimmen. Sie dürfen ihm das nicht wegnehmen. Es ist alles, was er hat.«
»Ich werde darüber nachdenken.«
»Versprechen Sie es mir!«
Fest erwiderte Nikolajewa ihren Blick. »Ich verspreche es Ihnen, Commander MacNiall!«
2. Kapitel
Die Sonne versank in einem Farbenrausch im Meer. Es war ein ähnlich lauer Sommerabend wie der, als Jamie vor ein paar Wochen bei ihr eingezogen war. Als sie sich auf der Dachterrasse geliebt hatten. Das erste Mal.
Der Rotwein schmeckte auf einmal nicht mehr. Dee stellte das Glas auf dem Terrassentisch ab. Sie sollte bei ihm sein – im Krankenhaus –, anstatt gemütlich auf der Dachterrasse zu sitzen und den Abend zu genießen. Wieso machte sie sich eigentlich etwas vor? Sie konnte den Abend ja gar nicht ohne ihn genießen. Aber die eigentliche Frage war: Würde sie überhaupt jemals wieder einen Abend mit ihm genießen können wie zuvor?
Ihre Augen brannten auf einmal. In sinnlosem Trotz griff sie nach dem Glas und stürzte den Inhalt in einem Zug hinunter. Sich zu betrinken, war sicherlich nicht die Lösung, aber manchmal half es dabei, sich kurzzeitig besser zu fühlen. Um zu vergessen. Dabei war der Wein dafür eigentlich viel zu gut. Aber Lee würde sagen, dass, wenn man sich schon besaufen musste, man es wenigstens mit Stil tun konnte.
Der Gedanke entlockte ihr ein leises, bitteres Lachen. Wo er wohl steckte? Lee hatte viel riskiert, um ihr und Jamie beizustehen. Ihr zuliebe. Sie konnte nur hoffen, dass sie damit nicht das Leben ihres Bruders zerstört hatte. Noch mehr trübe Gedanken, die sie gerne vergessen wollte.
Sie griff nach der Flasche, um sich nachzuschenken. Als die Kommanlage im Wohnzimmer summte, war sie fast froh darum. Eigentlich konnte das nur Aodhan sein. Vielleicht konnte er sie ja mit ein paar Neuigkeiten zu Pauls Gerichtsverfahren aufheitern. Paul, der Mistkerl, hatte es verdient zu leiden.
Barfuß tappte sie im Dunkeln ins Wohnzimmer, das volle Glas in der Hand. Sie war vorbereitet auf den Sitzhocker, an dem sie sich schon mehrmals das Schienbein angestoßen hatte, und umkreiste ihn in weitem Bogen. Das Summen der Kommanlage wurde penetrant.
»Ich komm ja schon«, brummte sie und nahm das eingehende Gespräch an.
Auf dem Screen der Wohnzimmerwand erschien Seanans Gesicht. Dee schaffte es gerade noch, einen Fluch zu verschlucken.
»Was willst du denn?«
»Dee, ich …«
Ehe er weiterreden konnte, wurde er beiseite geschoben und Siobhan trat ins Bild.
»Dee, ich bitte dich! Ehe du etwas Falsches sagst, lass ihn erst reden.«
Aha! Siobhan erwartete also, dass sie etwas Falsches sagte. Dee fielen jede Menge Dinge ein, die sie ihrem selbstgerechtem Herrn Bruder gerne an den Kopf werfen würde. Aber falsch war nichts davon. Die hatten alle ihre Berechtigung. Dass er zum Beispiel selbstgerecht war und bigott und kein Recht dazu hatte, sich in ihr Leben einzumischen. Um zu versuchen, ihr Jamie auszureden. Schon gar nicht jetzt!
»Oh, kein Problem! Ich höre zu. Bin gerade in der richtigen Stimmung.« Dee winkte generös und nahm einen Schluck Wein.
»Bist du etwa betrunken?«, mischte Seanan sich ein.
Typisch!
»Hast du keine anderen Sorgen?«, konterte Dee. »Ich schon. Aber das interessiert dich ja wahrscheinlich nicht.«
»Dee!« Siobhan schüttelte den Kopf. »Wir wissen, was passiert ist. Deshalb rufen wir dich doch an.«
Verdammt! Warum mussten ihre Augen ausgerechnet jetzt wieder anfangen zu brennen? Sie wollte vor Seanan nicht heulen. Das würde er nur als Bestätigung sehen, dass er recht hatte.
»Na, da bin ich aber gespannt«, schnappte Dee.
Im gleichen Moment ärgerte sie sich über ihre Reaktion. Im Moment war sie diejenige, die selbstgerecht war. Wenn Seanan anrief, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen, dann sollte sie ihm auch die Chance dazu geben.
»Dee, ich …«
»Nein, entschuldige mich!«, winkte Dee ab. »Ich bin etwas … angespannt. Also rede! Was wolltest du mir sagen?«
Seanan schien zu zögern. Eine merkliche Pause entstand, die mit jeder Sekunde unangenehmer zu werden drohte.
»Wie geht es ihm«, fragte Siobhan in das Schweigen. »Jamie meine ich.«
Die Frage genügte, dass Dees Kehle eng wurde. Schnell nahm sie einen Schluck Wein.
»Besser.« Was redete sie denn da für einen Blödsinn! Mit einem Ruck trank Dee das Glas leer und ließ sich in das Sofa fallen. Zornig rieb sie sich die brennenden Augen. »Nun, wenn du es genau wissen willst: Es geht ihm beschissen. Aber wenigstens redet er wieder mit mir.«
»Es tut mir so leid, Dee«, erwiderte Siobhan. »Wenn wir irgendetwas für dich tun können …«
Mit zitternden Händen stellte Dee das leere Glas auf den Tisch. »Ich wüsste nicht, was …«
»Es tut mir leid, Dee«, unterbrach Seanan sie. »Ich hätte nicht so mit ihm reden dürfen. Wenn … wenn du ihn wirklich liebst, dann werde ich ihn akzeptieren müssen. Als was auch immer.«
Dee blieb der Mund offen stehen. Seanans Worte klangen barsch, aber das aus seinem Mund zu hören, glich einem Offenbarungseid. Damit hatte sie wirklich nicht gerechnet.
Ein zärtlicher Blick von Siobhan traf Seanan von der Seite. Er schien es nicht zu bemerken. Seine Augen waren starr auf Dee gerichtet, als warte er auf etwas. Vergebung?
»Danke«, sagte Dee. Mehr fiel ihr nicht ein.
»Aodhan hat uns von der Sache mit Paul erzählt. Wenn du möchtest, kommen wir zur Gerichtsverhandlung vorbei. Es …« Siobhan schien nach Worten zu suchen. »… es muss unangenehm sein, die Details vor Gericht wiederholen zu müssen.«
»Danke, aber das ist nicht nötig. Aodhan hat erwirkt, dass ich meine Zeugenaussage aufnehmen kann. Ich muss vor Gericht nicht erscheinen. – Gott sei Dank!« Dee lächelte. »Ihr müsst euch keine Sorgen machen.«
»Gut«, erwiderte Seanan, dennoch wirkte er nicht zufrieden. »Dann wollen wir dich nicht belästigen.«
»Ihr belästigt mich nicht. Wirklich.« Ihre erste Reaktion hatte anders gewirkt, erinnerte Dee sich. Wollte Seanan etwa nur vorbeikommen, um sie zu sehen? Der Gedanke war befremdlich, aber sie konnte den Wunsch verstehen.
»Hört mal!«, sagte sie schnell, ehe sie es bereuen konnte. »Ich schulde Con und Aodhan ohnehin noch ein Essen. Wollt ihr nicht dazustoßen?«
Reichlich verblüfft starrte Seanan sie an.
Siobhan antwortete an seiner Stelle: »Gerne, Dee! Wir freuen uns darauf. Wann hast du denn Zeit?«
»In vier Tagen. Und ladet auch noch Deaglan und Ciaran ein, falls sie Zeit haben.«
In vier Tagen musste Jamie aus dem Krankenhaus entlassen sein – falls Nikolajewa ihr Versprechen hielt.
»Was machst du denn da?«
Schockiert blieb Dee stehen. Sie hatte sich innerlich darauf vorbereitet, Jamie ähnlich schwach und kraftlos vorzufinden wie am Tag zuvor. Dass er den Rahmen des Bettes als Reck missbrauchen könnte, war jenseits ihrer Vorstellungskraft gewesen. Schnell schloss sie hinter sich die Tür, ehe eine Schwester den Irrsinn sehen konnte, den Jamie da anstellte, und eilte auf ihn zu.
»Hi, Dee«, ächzte er, während er sich ein weiteres Mal mit beiden Händen am hinteren Bettrahmen in die Höhe zog.
Als sie ihn erreichte, ließ er sich keuchend in sein Kissen fallen. Feine Schweißperlen standen auf seiner Stirn.
»Bist du verrückt geworden? Du kannst dich doch nicht so anstrengen! Du warst vorgestern noch im künstlichen Koma.« Und da sollte er eigentlich auch noch mindestens vier Wochen verbringen, erinnerte sie sich.
»Quatsch! Es geht mir gut. Nur meine Finger sind ein wenig steif.«
Kopfschüttelnd setzte Dee sich auf den Bettrand. »Das ist ja auch kein Wunder. Die waren alle gebrochen.«
»Eben! Und deshalb muss ich sie trainieren.« Als wolle er ihr das Gesagte demonstrieren, spreizte er seine Finger und ballte sie anschließend zu Fäusten. Seine Lippen wurden dabei ganz schmal, als würde er Schmerzen leiden oder als wäre das, was er tat, furchtbar anstrengend.
Sanft legte Dee ihre Hände auf seine Fäuste.
»Das wird wieder«, sagte sie leise. »Du musst nur etwas Geduld haben.«
Sie war vorbereitet gewesen auf den Wust seiner Gefühle, die sie mit der Berührung überfallen würden. Aber alles, was sie fühlte, waren die Knochen seiner Hände unter der schweißfeuchten Haut.
»Schon klar!«
Sie konnte sehen, wie er die Zähne zusammenbiss, ehe er endlich nachgab und langsam die Fäuste wieder öffnete. Sacht streichelte sie seine Finger. Sicherlich würde er ihr jetzt gleich widersprechen.
»Aber ein wenig muss ich ja trainieren, wenn ich übermorgen das Krankenhaus verlassen darf. Wie soll ich denn so fliegen?«
Ein Hauch von Übermut ließ seine Augen funkeln.
»Woher weißt du das?«
»Tipton hat es mir verraten«, grinste er. »Naja, das stimmt nicht ganz. Ich habe es aus ihm herausgekitzelt, nachdem die Psychotussi hier war.«
»Die Psychotussi?«
»Ach, so ‘ne blöde Psychotante. Die will irgendeinen bescheuerten Test mit mir machen, um festzustellen, ob ich noch richtig ticke. Du weißt schon!« Bei den Worten beschrieb er mit dem Zeigefinger einen kleinen Kreis neben seiner Stirn.
»Hast du das denn je?«, fragte Dee zweifelnd.
»Was?«
»Richtig getickt?«
»Hey, du Miststück! Was erlaubst du dir? Natürlich ticke ich richtig. Ich werde es dir gleich beweisen.«
Mit unerwarteter Kraft packte er Dees Handgelenke und zog sie daran zu sich herab aufs Bett. Ein sanfter Kuss landete auf ihren Lippen.
Irgendwo weit entfernt, suchte sich ein Sonnenstrahl den Weg durch dicke, dunkle Wolken. Wie eine Ahnung konnte Dee das goldene, warme Funkeln wieder in ihrer Brust spüren. Sie glaubte heulen zu müssen vor Glück.
»Ich bin noch nicht überzeugt«, wisperte sie.
Er schlang den Arm um sie und umfasste mit der Linken ihr Gesicht. Seine grauen Augen wurden ganz dunkel und weit, die Lippen waren halb geöffnet. Einen endlosen Augenblick sah er sie nur an. Dann berührte er mit seinen Lippen die ihren, erst sanft, dann umso hungriger küsste er sie. Seine Zunge schlüpfte in ihren Mund, seine Hand streichelte ihren Rücken, hielt sie fest – entzündete das Verlangen in ihr, so heiß und heftig, wie sie es nie für möglich gehalten hätte. Nicht hier, im Krankenhaus auf der Intensivstation.
Und mit jedem Augenblick gewann das goldene Funkeln an Wärme und Kraft.
Als er sich endlich von ihr löste, wurde sie sich dessen bewusst, dass sie in seinem Arm auf dem Bett lag. Er küsste ihr Haar, während er die freie Hand unter ihr Shirt schob und den BH beiseite zog. Besitzergreifend legte er seine Hand auf ihre Brust. Die Berührung genügte, dass sie lichterloh in Flammen stand. Ein leises Keuchen kam aus ihrem Mund.
»Jamie! Jamie, bitte …«
Er schien es als Aufforderung zu verstehen, fortzufahren, küsste sie erneut und begann ihre Brust zu streicheln.
Mit einem Ruck löste sie sich von ihm und packte seinen Arm. »Nicht hier! Bitte!«
Die goldene Wärme in ihrer Brust sank in sich zusammen. Verzweifelt drückte sie seine Hand gegen ihre Brust und hauchte einen Kuss auf seinen Mund.
»Übermorgen«, sagte sie. »Übermorgen sind wir zu Hause. Hältst du es bis übermorgen aus?«
Er nickte – zögerlich, dann mit grimmiger Entschlossenheit.
»Okay«, seufzte er endlich. »Übermorgen. Ich nehm dich beim Wort. Ich werde der Psychotussi schon beweisen, dass mit mir alles in Ordnung ist.«
»Jamie, das ist kein Wettbewerb. Du darfst der Psychotherapeutin nichts vormachen. Das könnte ernsthafte Konsequenzen haben.«
Sie könnte ihn als dienstuntauglich einstufen. Und dann? Was würde das nützen? Nikolajewas Entscheidung stand doch schon fest. Jamie würde Teil des Missionsteams werden. Daran würde auch die Einstufung der Psychotherapeutin nichts ändern.
»Wie kommst du denn darauf?«, erwiderte er mit schelmischem Grinsen.
Hoffnungslos.
»Idiot!«
Dee schüttelte den Kopf. Wider Willen musste sie lachen und drückte ihm einen Kuss auf den Mund.
»Wofür war der denn?«
»Einfach nur so«, erwiderte sie und kuschelte sich in seine Armbeuge.
Weil er war wie früher und er den goldenen Funken wieder in ihrer Brust entzündet hatte.
Gewohnheitsmäßig hatte Dee sich neben Tipton gesetzt. Ihr gegenüber saßen Coulthard und De Sutton.
Das Zimmer, in das Nikolajewa sie geladen hatte, war das Gleiche, das auch Paul für das Briefing genutzt hatte. Es fühlte sich seltsam an, wieder hier zu sitzen. Unwillkürlich erwartete Dee, dass Paul jeden Moment hereinstolzierte. Aber Nikolajewa schloss die Tür und das bedeutete wohl, dass niemand mehr erwartet wurde.
Erst jetzt begriff Dee, dass nicht nur Paul fehlte sondern auch Watanabe.
Aber Nikolajewa setzte sich, als sei dies völlig selbstverständlich und schlug die Akte auf, die sie mitgebracht hatte.
»Ich gehe davon aus, dass Sie alle über Ihre neue Mission informiert sind. Deshalb will ich es kurz machen.« An diesem Punkt sah Nikolajewa auf und musterte die Anwesenden aufmerksam. »Die Schwarze Garde steht anscheinend seit geraumer Zeit in Kontakt mit den Aliens und hat erwirkt, dass ein Vertreter der Erdregierung ins Heimatsystem der Aliens geladen wird. Ziel ist die Unterzeichnung eines gegenseitigen Unterstützungsabkommens.«
»Ein Affront, wenn Sie mich fragen«, warf De Sutton ein.
Ein kühler Blick von Nikolajewa traf ihn, ehe sie unbeirrt fortfuhr. »Zu unserem Glück ist Clark Duras als Unterhändler ausgewählt worden. Denn er hat Dank der Erlebnisse auf der Nyx Kontakt mit mir aufgenommen und darum ersucht, dass Lieutenant McAllister und Lieutenant Commander MacNiall ihn begleiten.«
»Mit Verlaub, Ma’am. Aber das ist eine Farce. Lieutenant McAllister hat mehrfach Befehle missachtet und dadurch unsere letzte Mission fast zum Scheitern verurteilt. Ich lehne es ab …«
Mit einem Schlag auf den Tisch beendete Nikolajewa De Suttons Tirade. »Lieutenant McAllisters Mitwirkung bei der anstehenden Mission steht nicht zur Debatte.«
»Das ist …«
»Kein Wort mehr«, unterbrach Nikolajewa ihn frostig. »Oder Ihre Person wird aus dieser Mission entfernt und für die erforderliche Dauer zwangsverwahrt, Commander De Sutton.«
Wortlos aber mit verkniffener Miene klappte De Sutton den Mund zu.
Eigentlich wünschte Dee sich nichts sehnlicher, als dass er widersprach. Damit Nikolajewa ihre Drohung wahrmachte und sie ihn für die Dauer der nächsten Mission loswaren. Aber den Gefallen tat er ihr leider nicht.
Überraschenderweise war es Tipton, der sich zu Wort meldete. »Ma’am, ich wiederhole mich ungern. Aber aus meiner unterschätzten medizinischen Sicht ist McAllister nicht soweit wiederhergestellt, um an diesem Himmelfahrtskommando teilnehmen zu können. Zudem muss zuerst noch die psychologische Beurteilung abgewartet werden.«
»Zur Kenntnis genommen«, erwiderte Nikolajewa. »Kann ich nun fortfahren und zum Kern dieser Besprechung kommen?«
Dee hätte sich eher die Zunge abgebissen, als zu sagen, was ihr auf der Zunge lag: Dass Tipton recht hatte und Jamie zu Hause bleiben sollte. Sie hätte vielleicht gewagt, es Coulthard gegenüber zu äußern, auch wenn diese gereizt war. Aber nicht gegenüber Nikolajewa.
»Gut«, nickte Nikolajewa zufrieden, als niemand antwortete. »Der Zweck unseres Gesprächs ist es, das Ziel der Mission zu klären. Denn die Admiralität wünscht, dass die Mission genutzt wird, um den Feind zu sabotieren. Und zwar so empfindlich, dass ein Angriff der Kolonien unmöglich gemacht wird. Ich sehe das vordringliche Ziel darin, Informationen zu beschaffen. Denn wir wissen so gut wie nichts über unseren Feind. Ein Sabotageakt könnte uns unter Umständen eine Richtung aufzwingen, die anschließend nicht mehr zu ändern ist. Ihre Meinungen dazu?«
»Ich stimme Ihnen zu«, meldete Coulthard sich zu Wort. »Ehe wir einen Sabotageakt erwägen, sollten wir zuerst Informationen über den Feind zusammentragen. Wenn wir es geschickt anstellen, gelingt es uns vielleicht, ein ähnliches Abkommen mit ihm zu schließen wie die Schwarze Garde. Bisher ist es immerhin nicht zu offenen Kampfhandlungen gekommen. Und wenn möglich, sollten wir dergleichen bei der zu erwartenden Stärke des Feindes vermeiden.«
Dann glaubte Coulthard also, dass die kolonialen Streitkräfte im Kampf gegen die Aliens unterliegen würden. Damit hatte Dee nicht gerechnet, nicht nachdem was Coulthard in der Schlacht um Hekate getan hatte.
»Commander De Sutton?«, wandte Nikolajewa sich an den nächsten.
Mit vorgeschobenem Kinn zog De Sutton seine Uniformjacke gerade. »Mit Verlaub, aber gerade die Stärke unseres Feindes zwingt uns aus meiner Sicht dazu, die Mission zu einem Sabotageakt zu nutzen. So leicht wird es uns sicherlich nicht ein zweites Mal gemacht werden, einen Angriff im Keim zu zerschlagen. Darüber hinaus werden wir zu diesem Zweck auch nicht die Unterstützung von Lieutenant McAllister benötigen, was aus meiner Sicht nur zum Gelingen der Mission beitragen kann.«
Dee hätte De Sutton für diese Bemerkung am liebsten die Augen ausgekratzt. Nur mit Mühe schaffte sie es, ruhig zu bleiben und zu warten, bis sie an der Reihe war.
»Doktor Tipton«, sagte Nikolajewa nur.
Als hätte er nur darauf gewartet, sich in Szene setzen zu können, kratzte Tipton sich am stoppeligen Kinn. »Ich glaube weder, dass wir mit diesen Mistkerlen von Aliens ein Abkommen schließen können, noch dass wir diesen Kommissköpfen der Schwarzen Garde vertrauen dürfen. Es fällt mir auch schwer zu glauben, dass wir es tatsächlich schaffen, unseren fremden Freunden ein Ei ins Nest zu legen, ohne dass sie was davon bemerken – noch weniger, dass der Schwarzen Garde das gefallen wird und erst recht nicht, dass wir das ohne unseren Goldjungen schaffen können. Aber Sabotage hin oder her, sie vergessen einen wichtigen Punkt: unsere werten Aliens sind im Besitz der DNA unseres goldenen Kalbes. Und ich will nicht mehr Tipton heißen, wenn sie die nicht dazu nutzen, um einen Klon von ihm zu erschaffen.« Tipton machte eine kunstvolle Pause, während er die Wirkung seiner Worte sichtlich genoss. »Haben Sie schon mal daran gedacht, was mehrere Exemplare unseres heißumstrittenen McAllisters auf der Seite des vielzitierten Feindes bewirken könnten? Nein? Also ich habe davor wesentlich mehr Angst als vor einem herkömmlichen Angriff des Feindes oder einem möglichen Verrat der Schwarzen Garde.«
»Sie überschätzen die Fähigkeiten dieses Querulanten«, schnaubte De Sutton.
»Nein«, schnappte Dee. »Sie unterschätzen sie, Sir. Er kann die Realität verändern. Ich habe es gesehen.«
»Papperlapapp! Das ist schierer Unfug! Niemand kann die Realität verändern. McAllister war nicht einmal dazu in der Lage, sich selbsttätig zu retten.«
Türkisfarbene Wellen, die an einen weißen Strand leckten. Dee kannte das Bild. Sie hatte es immer wieder in Jamies Kopf gesehen, während er in Gefangenschaft gewesen war. Mehr noch, sie hatte das warme Wasser gespürt. War fast dort gewesen, nur einen Wimpernschlag entfernt, so schien es ihr.
»Sie irren sich. Er hätte sich retten können, wenn dieser Pulsar – oder was auch immer es war – ihn nicht daran gehindert hätte.«
De Sutton schnaubte nur abfällig.
»Sind Sie sich sicher«, fragte Nikolajewa.
»Ja.«
Dee sagte es mit solcher Inbrunst, dass sie sich wunderte, woher sie ihre Überzeugung nahm. Im nächsten Moment begriff sie, dass sie damit Nikolajewas Meinung, dass er Teil der Mission werden musste, nur bestärkte. Aber um ihre Worte zurückzunehmen, war es zu spät.
Nikolajewas Blick wurde nachdenklich. Als gäbe es die anderen nicht, strich sie sich über die Unterlippe. Das Schweigen wurde schon ungemütlich, als sie ganz plötzlich den Blick wieder auf Tipton richtete.
»Was schlagen Sie vor, Doktor Tipton?«
»Wir müssen die Gelegenheit beim Schopf ergreifen und die DNA-Proben, die der Feind unserem Goldjungen entnommen hat, zerstören. Und zwar vollständig. Ehe er irgendeinen Unsinn damit anstellt.«
Coulthards Worte bei der letzten Mission fielen Dee wieder ein. Auch sie hatte gesagt, dass alle Zellproben von Jamie vernichtet werden müssten, ehe sie dem Feind in die Hände fallen könnten. Inklusive Jamie.
Dee fror auf einmal. Wer war denn nun der Feind? Jamie oder diese Aliens, die ihn fast zu Tode gequält hatten?
»Lieutenant Commander MacNiall?«
»Was?« Verwirrt wandte Dee sich Nikolajewa zu.
»Ihre Meinung, MacNiall!«
Ein wenig wunderte Dee sich, dass Nikolajewa sie dazu aufforderte, ihre Meinung, die diese eigentlich gut genug kannte, hier in dieser illustren Runde zu wiederholen. Dann begriff sie, dass Nikolajewa ihr absichtlich diese Gelegenheit gab, damit die anderen davon erfuhren. Sie musste vorsichtig sein mit dem, was sie sagte.
»Ich glaube, dass wir viel zu wenig wissen, um beurteilen zu können, wie unsere nächsten Schritte aussehen sollten. Wir brauchen als erstes viel mehr Informationen, um eine Entscheidung treffen zu können, ob es besser ist, mit den Aliens zu verhandeln oder Sabotage zu verüben oder was auch immer.« Ihr Blick irrte zu Tipton. Was sie noch sagen wollte, fiel ihr schwer. Denn sie hatte Angst, was sie dadurch bewirken könnte. »Und Doktor Tipton hat recht. Wir müssen die DNA-Proben, die die Aliens von Jamie gesammelt haben, vernichten. Und genau aus diesem Grund bin ich dagegen, dass er Teil der Mission wird. Das ist, als würde man dem Feind das Objekt seiner Begierde frei Haus liefern. Mit Verlaub, Ma’am, aber das ist Irrsinn!«
»Zur Kenntnis genommen, Lieutenant Commander MacNiall«, erwiderte Nikolajewa ohne eine Gefühlsregung und klappte ihre Notizen zu. »Ich danke Ihnen allen für Ihre offenen Worte. Sie hören wieder von mir, sobald wir Nachricht von Mister Duras hinsichtlich des weiteren Vorgehens haben.«
Wie? War das etwa alles gewesen?
Coulthard räusperte sich. »Ich hätte noch eine Frage.«
»Fragen Sie«, erwiderte Nikolajewa freundlich.
»Weshalb ist Watanabe nicht bei diesem Gespräch anwesend?«
Darüber hatte Dee sich auch schon gewundert.
»Oh, natürlich! Verzeihen Sie, dass ich vergaß, Sie zu informieren. Lieutenant Watanabe wurde für die Dauer von Miss Paulsens Verhör vom Dienst suspendiert. Es geschah auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin, da er es vermeiden möchte, als Sympathisant der Mutantenuntergrundbewegung zu gelten. Ich bin bereits auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz für ihn bei der anstehenden Mission. Ist Ihre Frage damit beantwortet?«
»Kann ich ihn besuchen«, fragte Coulthard.
Nikolajewa lächelte. »Jederzeit.«
»Ich hätte auch noch eine Frage«, platzte es aus Dee heraus. Als sie Nikolajewas Blick auf sich fühlte, wurde ihr heiß.
»Ich höre.«
Vorsicht! Sie durfte den Bogen jetzt nicht überspannen.
Dee räusperte sich. »Vor unserer letzten Mission hat Lieutenant Gallagher uns allen zugesichert, dass Jamie … ich meine Lieutenant McAllister … öffentlich rehabilitiert wird und die Anklage wegen Hochverrats von der Admiralität in aller Form zurückgezogen wird.«
»Ich erinnere mich«, erwiderte Nikolajewa. »Und Sie dürfen sich dessen gewiss sein, dass ich es nicht vergessen habe. Aber bitte erlauben Sie, dass ich mein Bedauern darüber zum Ausdruck bringen muss, dass mir im Moment die Hände gebunden sind. Ich befürchte, dass ich erst tätig werden kann, wenn die aktuelle Bedrohung beseitigt ist. Habe ich Ihr Verständnis?«
Nein, lag es Dee auf der Zunge. Ganz und gar nicht. Aber insgeheim verstand sie das Dilemma nur zu gut. Jamies Rehabilitation stand sicherlich als Letztes auf Nikolajewas To-Do-Liste. Sie wollte gerade nicken, als De Sutton sich einmischte.
»Nun, ich glaube, den Umstand kann sich die Admiralität sparen. Denn sobald Ruhe eingekehrt ist, werde ich ein Verfahren wegen Befehlsverweigerung und Anstiftung zur Meuterei gegen ihn einleiten lassen.«
»Das …« Dee fehlten die Worte.
»Sollte die Anklage wegen Hochverrats jedoch Bestand haben und Lieutenant McAllister in Sicherheitsverwahrung genommen werden, würde ich vielleicht von meinem Ansinnen absehen. – Admiral, mit Ihrer Erlaubnis empfehle ich mich!«
Nach einem Nicken in Nikolajewas Richtung verließ De Sutton den Raum.
3. Kapitel
Dee war immer noch übel vor Zorn, als sie nachhause kam. Reflexmäßig tappte sie ins Bad, um sich ins Klo zu übergeben. Nebenbei stellte sie dabei fest, dass die Badezimmertür repariert worden war, während sie fortgewesen war. Also hatte Con tatsächlich Wort gehalten.
Als nach mehreren Minuten doch nichts in der Kloschüssel landete, stand sie auf, spritzte sich Wasser ins Gesicht und ging in die Küche. Vielleicht kam die Übelkeit auch schlicht von übergangenem Hunger oder durch die Schwangerschaft. In den letzten Tagen hatte es manchmal geholfen, wenn sie dann eine Kleinigkeit gegessen hatte.
Sie suchte einen Joghurt aus dem Kühlschrank und setzte sich damit ins Wohnzimmer. Ihre Hände zitterten, als sie den Joghurt löffelte. Bei Gott, selten hatte sie jemanden so gehasst wie De Sutton! Sollte er doch an der Pest verrecken oder als Versuchskaninchen in einem Labor enden. Das geschähe ihm recht, diesem Mistkerl!
Ihr Magen rebellierte wieder. Sie stellte gerade den halbgegessenen Joghurt auf den Tisch, als das Komm summte. Ausgerechnet jetzt!
Seufzend stand sie auf, um das Komm zu aktivieren. Zu ihrer Überraschung war es Aodhan, der auf dem Screen erschien. Obwohl es schon spät am Abend war, trug er immer noch Anzug und Krawatte. War er etwa noch in seinem Büro?
»Tut mir leid, dass ich dich störe, Dee.«
»Du störst nicht. Ich habe mich nur gerade über einen Kollegen geärgert.« Seufzend ließ sie sich wieder aufs Sofa sinken.
»Nun, dann muss ich deine Laune leider noch mehr senken. Es geht um deine Zeugenaussage.«
Bei den Worten hob sich prompt ihr Magen.
»Oh nein! Heißt das etwa …«
»Dass du doch vor Gericht aussagen musst. Es tut mir wirklich sehr leid, aber mir sind die Hände gebunden. Pauls Verteidiger besteht darauf, dich ins Kreuzverhör zu nehmen. Außer du verzichtest auf die zivile Nebenklage und gibst dich mit der strafrechtlichen Verfolgung durch das Militärgericht zufrieden.«
»Kommt nicht infrage!«
Was das bedeutete, hatte Aodhan ihr haarklein erklärt. Sehr wahrscheinlich würde Paul nur unehrenhaft aus der Flotte entlassen werden unter Streichung all seiner Bezüge. Möglicherweise erhielt er auch eine Freiheitsstrafe. Die würde aber sicherlich nur auf Bewährung lauten, da Paul bisher nicht straffällig geworden war. Nur wenn sie als Nebenklägerin auftrat und dadurch nachwies, dass Paul schon immer durch sexuelle Übergriffe geglänzt hatte, würde er hinter Gitter wandern. Und da wollte sie ihn haben – denn so hatte er es verdient.
Zudem hatte Aodhan ihr zugesichert, dass er dann sehr wahrscheinlich auch noch ein Schmerzensgeld für sie herausschlagen konnte. Aber darauf kam es ihr eigentlich nicht an. Sie wollte nur Gerechtigkeit.
»Überleg es dir gut, Dee. Wirklich. Ich kenne den Verteidiger. Das Kreuzverhör durch ihn wird nicht leicht werden für dich. Er wird all die schmutzige Wäsche, die du in deiner Aussage angesprochen hast, nochmal ans Licht zerren.«
Wollte sie das wirklich?
Wollte sie wirklich vor Gericht erzählen, wie Paul sie dazu genötigt hatte, ihm einen zu blasen oder wie er ihr K.O.-Tropfen gegeben hatte, damit er dabei zusehen konnte, wie ein anderer Mann sie nahm? Ganz zu schweigen von den unzähligen sexuellen Übergriffen an anderen Frauen, während sie daneben stand!
Der Joghurt in ihrem Magen drängte nach oben. Keuchend presste sie die Hand vor den Mund.
»Und er wird behaupten, die Vergewaltigung im Gleiter sei mit deiner Zustimmung geschehen. Als Preis sozusagen, damit du deinen Termin bei Admiral Nikolajewa bekommst.«
»Das ist nicht wahr«, platzte es aus ihr heraus.
»Das weiß ich doch, Dee. Aber Pauls Verteidiger wird es behaupten. Schaffst du das, Dee?«
Mit Gewalt schluckte sie den aufsteigenden Joghurt wieder hinunter. Doch der saure Geschmack von Erbrochenem blieb.
Jamie.
Sie musste es tun – um seinetwillen. Damit er begriff, dass sie Paul dafür hasste. Und damit er nicht auf den irren Gedanken kam, die Gerechtigkeit selbst in die Hand nehmen zu müssen.
»Ja«, keuchte sie. »Und ob ich das schaffe. Sag mir nur wann!«
»Übermorgen«, antwortete Aodhan. »Ich hol dich ab.«
»Und kein Wort zu Seanan und Siobhan. Erst recht nicht bei unserem gemeinsamen Essen am Tag darauf!«
Das Zimmer mit der Nummer 42 war leer. Dee hatte nach dem Gespräch mit Aodhan schlecht geschlafen und war immer noch müde, obwohl es bereits später Vormittag war. Aber nun war sie mit einem Schlag hellwach. War Jamie etwa etwas passiert? Ging es ihm schlechter? War er bei einer Untersuchung?
Die Psychotherapeutin fiel ihr ein. Natürlich! Das musste der Grund sein, weshalb er nicht hier war.
Sie wollte schon wieder gehen, als ihr Blick auf die Monitore fiel. Wieso arbeiteten die noch, wenn Jamie nicht hier war?
»Jamie«, fragte sie und kam einen Schritt näher. »Bist du da?«
Ein blonder Schopf tauchte auf der anderen Seite des Bettes auf. Jamies graue Augen glitzerten übermütig.
»Ach, du bist’s! Ich dachte schon, es wäre Tipton.«
»Was machst du denn da unten? Ist dir etwas herunter gefallen?«
Jamie stemmte sich am Bett in die Höhe und setzte sich. Mit zitternder Hand wischte er sich den Schweiß von der Stirn.
»Ich habe Liegestütze gemacht. Naja, ich hab es probiert. Mit dem Ergebnis bin ich nicht wirklich zufrieden.«
»Du hast was?«
»Liegestütze gemacht. Sieben Stück.« Der Stolz war unverkennbar in seiner Stimme.
»Bist du verrückt geworden?«
»Eine Hantel wolltest du mir ja nicht mitbringen.«
»Natürlich nicht!«
Dee wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. In diesem Augenblick war sie geneigt, De Sutton doch zuzustimmen. Mit seinen verrückten Einfällen würde Jamie die Mission nur unnötig gefährden.
Kopfschüttelnd setzte sie sich auf die andere Seite des Bettes. Das erste Mal konnte sie dabei seine Beine sehen. Sie waren nicht nur erschreckend mager, sondern Dee entdeckte auch die wulstigen Narben darauf, die von den Verbrennungen herrühren mussten, die er erlitten hatte.
Als ahnte er ihren Blick, schob er schnell die Decke über seine Oberschenkel.
»Die Psychotussi war übrigens heute morgen da.«
»Und?«, fragte sie, obwohl sie bereits die Antwort kannte. Wenn er so grinste, dann konnte das nur bedeuten …
»Bestanden!«
»Und du warst wirklich ehrlich zu ihr?«
»Hey! Natürlich. Können diese Augen lügen?«
Dabei zeigte er immer noch grinsend auf seine grauen Augen.
Dee versetzte ihm einen Klaps.
»Die Augen nicht, aber der Kerl, der dazu gehört, schon«, konterte sie.
»Hey, hab ich dich je angelogen?«
Seufzend strich sie durch seine blonden Haare. Und im gleichen Augenblick nistete sich eine kleine goldene Sonne in ihrer Brust ein. Gott, wie sie das Gefühl vermisst hatte!
»Nein, hast du nicht.«
Nur etliches verschwiegen, aber sie verschluckte den Zusatz. Sie war froh, dass er wieder lachte und die Sonne wieder aufgegangen war. Um keinen Preis wollte sie einen Streit provozieren und sie wusste inzwischen, wie leicht eine unbedachte Bemerkung eskalieren konnte.
»Und? Was hat dich denn die Psychotussi so gefragt?«
Zärtlich wühlte sie weiter in seinem Haar. Er gab nach, ließ sich gegen sie sinken und dann lagen sie auf einmal nebeneinander auf dem Bett. Die kleine Sonne in ihrer Brust wärmte sie.
»Ach, nur Blödsinn. Ob ich gut schlafe, ob ich angespannt bin oder Albträume habe … Ich und Albträume! So ein Quatsch! Ob ich manchmal vergesse, wo ich bin. Im Krankenhaus habe ich ihr geantwortet – wo denn sonst? Aber im Bett mit ihr wäre mir lieber. Da wurde sie ganz rot im Gesicht. Nunja, ich geb zu, das war gelogen. Denn eigentlich wär ich viel lieber mit dir im Bett.«
Ein feuchtheißer Kuss traf ihren Hals und ein Schauer rieselte als Antwort durch ihren Körper. Jamies Hand strich von ihrem Hals herunter zu ihrer Brust, verharrte dort. Sie konnte weit entfernt seine Sehnsucht spüren – ein dunkles Ziehen, das von der goldenen Wärme in ihrer Brust ausstrahlte.
Behutsam drehte sie sich auf die Seite, um ihm in die Augen sehen zu können. Sein Gesicht war ganz nah. Sie konnte nicht anders, sie musste ihn küssen – seine Lippen spüren, ihn schmecken, seinen Nacken streicheln.
»Morgen«, flüsterte sie, als sie sich von ihm löste. »Morgen. Ich versprech es dir.«
Ein Klopfen, das von einem Räuspern gefolgt wurde, ließ Dee zusammenzucken. Ihr Kopf zuckte herum und fand Coulthard, die in der Tür stand. Der Moment glich einem Déjá-Vu. So hatte De Sutton sich geräuspert, als er sie mit Jamie in flagranti im Maschinenraum der Thessaloniki ertappt hatte. Erschrocken sprang sie vom Bett auf. Decken raschelten hinter ihr.
»Ma’am«, stotterte sie und versuchte vergeblich, Haltung anzunehmen.
Sichtlich genervt winkte Coulthard ab.
»Lassen Sie das! Ich habe nichts gesehen. Zudem ist mein Besuch auch nur halboffizieller Natur.«
Was sollte das nun wieder heißen?
Trotzdem gab Dee ihre Bemühungen, dem Flottenvorzeigesoldaten von den Werbeplakaten nachzueifern, auf und setzte sich nach kurzem Zögern auf Jamies Bettkante. Als ihr Blick zu ihm irrte, lag er wieder ordentlich unter seiner Decke, als sei nichts passiert.
»Ich hatte gehofft, dass ich Sie hier treffe«, sagte Coulthard und reichte Dee ein kleines Päckchen. »Hier! Ein kleines Präsent. Und nun zu dir, Jameson.«
Während Dee noch verdutzt auf das Päckchen in ihren Händen starrte, ging Coulthard um das Bett herum und setzte sich dort auf den einzigen Stuhl im Zimmer. Das Päckchen war leicht. Dee konnte sich nicht im mindesten vorstellen, was sich darin befinden mochte.
»Wie geht es dir?«, fragte Coulthard.