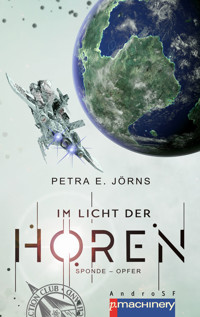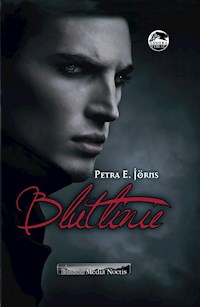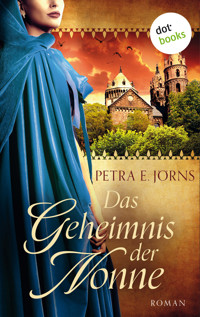4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Prophezeiung, die den Krieg verspricht: Das Fantasyepos „Erben des Zorns“ von Petra E. Jörns jetzt als eBook bei dotbooks. Einst wurden die magiebegabten Sidhe in die Anderwelt verbannt, um einen Krieg zwischen ihnen und den Menschen aufzuhalten. Ardainn – Sohn des Lords der Mittellande – glaubt nicht an die Prophezeiung, die eine Rückkehr der Sidhe voraussagt. Doch als er nach einer Schlacht schwer verwundet und von dunklen Visionen heimgesucht wird, erfährt Ardainn die Wahrheit über seine Abstammung: Er ist auserwählt, das Land vor einem verheerenden Krieg zu bewahren! Die Zeit drängt, denn der dunkle Feind hat bereits die Hand nach ihnen ausgestreckt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Fantasyepos „Erben des Zorns“ aus der Reihe „Legende der Welten“ von Petra E. Jörns. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch:
Einst wurden die magiebegabten Sidhe in die Anderwelt verbannt, um einen Krieg zwischen ihnen und den Menschen aufzuhalten. Ardainn – Sohn des Lords der Mittellande – glaubt nicht an die Prophezeiung, die eine Rückkehr der Sidhe voraussagt. Doch als er nach einer Schlacht schwer verwundet und von dunklen Visionen heimgesucht wird, erfährt Ardainn die Wahrheit über seine Abstammung: Er ist auserwählt, das Land vor einem verheerenden Krieg zu bewahren! Die Zeit drängt, denn der dunkle Feind hat bereits die Hand nach ihnen ausgestreckt …
Über die Autorin:
Petra E. Jörns, geboren 1964, ist gebürtige Pfälzerin. Sie studierte Biologie an der Universität Kaiserslautern, wobei ihr besonderes Interesse der Verhaltensforschung galt. Seit 1994 ist sie freiberuflich als Diplombiologin tätig. Unter den Pseudonymen P. E. Jones und Patricia E. James veröffentlicht sie Science-Fiction- und Liebesromane. Petra E. Jörns lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in ihrem Heimatdorf in der schönen Pfalz.
Der Fantasy-Epos »Legende der Welten« umfasst folgende Romane:
Band 1: »Erben des Zorns«Band 2: »Schwert des Zorns – Der Bastard«Band 3: »Schwert des Zorns – Der Novize«
Bei dotbooks veröffentlichte Petra E. Jörns auch den Sammelband »Das Geheimnis der Nonne« sowie die Trilogie in folgenden Einzelbänden:
Band 1: »Blutbann«Band 2: »Blutnacht«Band 3: »Blutzauber«
Die Website der Autorin: www.petra-joerns.de
Die Autorin im Internet: www.facebook.com/p.e.joerns.autorin/
***
Originalausgabe Juli 2016
Copyright © der Originalausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz unter Verwendung von shutterstock / Dmitrijs Bindemanis
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-549-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Erben des Zorns« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Petra E. Jörns
Legende der Welten
Erster Roman: Erben des Zorns
dotbooks.
Prolog
Am Anfang war Bith. Bith war alles, war Körper, Geist und Seele. Und Bith gebar aus ihrem Körper die Welt. Und siehe, es war gut. Und sie gebar aus ihrer Seele die Götter und aus ihrem Geist die Sidhe, auf dass sie ihrem Leib eine Form geben sollten. Und siehe, es war gut.
Gemeinsam schufen Götter und Sidhe die Hierwelt und die Anderwelt. Getrennt waren sie und doch verbunden. Wer die eine Welt änderte, änderte auch die andere. Das eine war Magie, das andere ein Wunder. Es war gleich und doch nicht gleich. Und siehe, es war gut.
Und Sidhe und Götter schufen gemeinsam das Alte Volk und pflanzten es in die Hierwelt. Seine Gabe und sein Verhängnis war es, zu sehen, was war, was ist und was sein wird. Und das Alte Volk ehrte die Gottmutter und den Gottvater und schenkte ihnen die Namen Chai und Churban. Und siehe, es war gut.
Doch die Götter und Sidhe vermehrten sich, und die Kinder und Kindeskinder der Götter fanden keinen Platz in den Herzen des Alten Volkes. Da schufen die Götterkinder die Menschen, damit jemand auch sie verehrte. Und die Menschen schenkten ihnen Namen für die Werte, für die jene eintraten. Und siehe, es war gut.
Aber die Menschen waren mit der Anderwelt nicht verknüpft, und die Ordnung der Welt geriet darüber in Unordnung. Die Sidhe stritten mit den Menschen um die Vorherrschaft, denn sie konnten nicht dulden, welchen Schaden die Menschen in ihrer Unwissenheit Bith zufügten.
So kam es zum ersten Krieg.
Er endete, indem die Götter die Tore zwischen Hierwelt und Anderwelt schlossen, damit ihre Kinder, die Menschen, in Frieden vor den Sidhe leben konnten. So verbannten sie diejenigen Sidhe, die die Menschen vom Antlitz Biths zu tilgen suchten. Und siehe, es war gut.
Doch die Prophezeiung sagt, dass die Zeit der Verbannung enden wird. Dann werden die verbannten Sidhe die Tore zwischen Realwelt und Anderwelt öffnen und zurückkehren, um ihr Werk zu vollenden. Und einer wird kommen, der das Blut der drei Völker in sich vereint. Er wird es sein, der entscheidet, welche Seite den Sieg davonträgt.
So kommt es zum nächsten Krieg.
1. Kapitel
»Du wirst heiraten.«
Die Schatten krochen in den Ecken des Turmzimmers an den Wänden hoch. Durch das Fenster war der glutrote Abendhimmel zu sehen.
Ardainn glaubte, sich verhört zu haben. Deshalb hatte sein Vater ihn also nach dem Abendessen in sein Arbeitszimmer bestellt. »Sicherlich«, antwortete er. »Sobald ich die Richtige gefunden habe.«
Aber zu Scherzen schien sein Vater nicht aufgelegt zu sein. Vielmehr runzelte er die Stirn und musterte ihn finster. »Unsere Reserven neigen sich dem Ende zu. Wir brauchen neue Verbündete. Sonst verlieren wir den Krieg. Die MacComhnalls sitzen uns im Nacken und …«
»Die MacComhnalls sitzen uns schon seit Jahren im Nacken. Wieso soll ich deshalb jetzt auf einmal heiraten?«
Die Augen des Lords verengten sich. »Weil Saor Bhradain und Saor Morchridhe sich weigern, mir den Eid zu schwören.«
»Das wundert mich nicht. Die beiden sind Tiefländer.«
Mit einem lauten Knall landete die flache Hand des Lords der Mittellande auf seinem Arbeitstisch aus Eichenholz. »Sie sind Mittelländer. Sind es immer gewesen. Sie weigern sich nur, ihrer Pflicht nachzukommen.«
»Vielleicht liegt das daran, dass sie diesen ewigen Krieg mit den Hochlanden leid sind, den du schürst.« Noch bevor Ardainn das letzte Wort ausgesprochen hatte, wusste er, dass er zu weit gegangen war. Wenn es vielleicht auch die Wahrheit war.
Der Lord saß hoch aufgerichtet hinter seinem Schreibtisch. »Wenn du deine Aufmerksamkeit mehr auf das politische Geschehen richten würdest anstatt auf Waffenübungen mit diesem Narr Fionnbarr …«
»Sprich nicht so über meinen Waffenbruder!«
»Die unseligste Entscheidung, die du je getroffen hast. Ich hätte es dir verbieten sollen.«
»Er hat mir das Leben gerettet.«
Der Lord schnaubte. »Das war seine Pflicht. Du bist der Sohn seines Lords.«
»Und wieso behandelst du mich dann, als wäre ich dein Bastard?«
»Schweig! Wie ich bereits sagte: Du wirst heiraten. Dieses Frühjahr noch. Deine Braut wird in wenigen Tagen hier eintreffen, damit ihr euch vorab kennenlernen könnt. Und das ist mehr, als ich dir schulde.«
»Das ist …« Ardainn ballte die Fäuste, um nicht vor Zorn aus seinem Stuhl aufzuspringen.
»Du kannst gehen.« Nach diesen Worten widmete sich der Lord wieder seinen Papieren.
»Hey, hey! Aufhören!« Fionnbarr wich vor Ardainns wütenden Schlägen zurück. »Nicht genug, dass du mich in aller Frühe aus dem Bett geholt hast, um mit mir den Schwertkampf zu üben. Willst du mich jetzt auch noch gleich umbringen?«
Der Staub der Übungsarena schmeckte bitter in Ardainns Mund. Fionnbarr konnte wirklich nichts dafür.
Das winzige Zögern kostete ihn den Sieg. Fionnbarr trat ihm die Beine weg. Ardainn schlug der Länge nach und mit voller Wucht in den Sand. Während er sich noch über seine Unachtsamkeit ärgerte, legte Fionnbarr ihm die Spitze des Schwertes an die Kehle.
Ein Grinsen lag auf Fionnbarrs Gesicht. »Gibst du dich geschlagen?«
Ardainns Hand umklammerte den Schwertgriff. Er hätte Fionnbarr am liebsten ein Nein ins Gesicht geschleudert. Eine leichte Drehung, ein Tritt und er konnte dem anderen das Schwert in den Unterleib rammen. Doch das ging nicht. Sein Gegner war sein Freund.
Mit einem Fluch ließ er das Schwert los und schlug mit der Faust in den Sand.
Fionnbarrs Grinsen machte dem Ausdruck von Besorgnis Platz. Er nahm das Schwert in die Linke und bot Ardainn die Rechte, um ihm beim Aufstehen zu helfen.
Fester als nötig schlug Ardainn ein und zog sich an Fionnbarrs Hand auf die Füße. Ohne den anderen anzusehen, wollte er sich nach seinem Schwert bücken, um es aufzuheben.
Aber Fionnbarr fasste nach seiner Schulter und hielt ihn fest. »Was ist los?« Seine Stimme klang unerwartet sanft.
Den Blick auf den Sonnenaufgang hinter der Holzumfriedung der Übungsarena gerichtet, blieb Ardainn stehen. »Vater.«
Ein Seufzen entrang sich Fionnbarr. »Was missfällt ihm diesmal? Sind wir zu oft in der Schenke gewesen, oder haben wir den Metvorrat der Burg erschöpft?«
Wider Willen musste Ardainn leise lachen. Mit gesenktem Kopf drehte er sich zu Fionnbarr um. »Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ich soll nur heiraten.«
Fionnbarr gaffte ihn mit offenem Mund an. »Heiraten?«
»Hey, nun hab dich nicht so.« Als Ardainn dem Freund gegen die Schulter boxte, wich das Entsetzen aus Fionnbarrs Blick. »Ich soll nicht hingerichtet werden.«
»Wo ist da der Unterschied? Hinrichtung, Heirat. Dein Leben endet, so oder so.«
»Du dramatisierst.«
»Keine Abende in der Taverne mehr mit Met und Weibern und Gesang …«
»Als ob du je eine der Dirnen ins Bett geladen hättest!«
»Ich hebe mich eben für die Eine auf.« Den Worten fehlte der leichte Ton von zuvor.
»Schon gut, ich wollte nicht in die alte Kerbe schlagen.«
»Ich weiß.« Fionnbarr fixierte ihn. So intensiv war sein Blick, dass Ardainn den Kopf senkte. »Und nun?«, fragte er.
»Keine Ahnung.« Bei den Worten sah Ardainn den Freund an. »Ich fürchte, zusammen abzuhauen ist keine Option.«
»Wer ist es denn? Vielleicht sieht sie ja gut aus.«
»Keine Ahnung. Aber sie wird in ein paar Tagen hier sein.«
Fionnbarr schlug ihm auf den Rücken, dass es Ardainn fast von den Füßen warf. »Dann sollten wir die Zeit gut nutzen.«
»In der Taverne?«
Da feixte Fionnbarr. »Hast du eine bessere Idee?«
»Es reicht!«
Nur ein paar Fackeln erhellten den Korridor vor Ardainns Zimmer. Dass sein Vater ihn hier abfangen könnte, mitten in der Nacht, damit hatte Ardainn nicht gerechnet.
Die scharfen Worte hallten im Korridor wider, dass Ardainn davon der Kopf schmerzte. Woran der viele Met, den er mit Fionnbarr gesoffen hatte, nicht unschuldig war.
»Wie lange willst du dich noch besaufen?«
Ardainn taumelte und musste sich an der Wand abstützen, um nicht zu fallen. »Solange ich will.«
Mit starrem Blick packte der Lord Ardainn an der Schulter. »Morgen besucht uns Saor Ultan mit seiner Tochter. Ich erwarte …«
»Saor Ultan also. Schön, dass ich endlich erfahre, wie mein Schwiegervater heißt.«
»Du bist betrunken.«
Ardainn lachte und riss sich los. »Mehr bleibt mir ja nicht, oder?«
»Was soll das heißen? Reiß dich gefälligst zusammen und benimm dich morgen, wie es dem Sohn eines Lords gebührt.«
»Damit du dich meiner nicht schämen musst?«
Der Lord musterte ihn, als wäre er ein besonders widerwärtiges Insekt. »Schlaf und werde nüchtern. Ich erwarte dich morgen in aller Frühe in der Halle. Damit wir die Formalitäten durchgehen können.«
»Das ist doch alles, was dich interessiert, oder? Dass ich dich nicht blamiere. Ist es nicht so?«
»Geh auf dein Zimmer!«
»Ich bin dein Sohn, verdammt!«
»Dann benimm dich auch so!«
»Wie denn, wenn du mich aus allem ausschließt? Sogar meine Braut suchst du ohne mich aus.«
»Du bist derjenige, der sich nicht für die Angelegenheiten seines Lords interessiert. Der in den Tag hineinlebt mit seinem Waffenbruderliebchen. Die Leute zerreißen sich schon das Maul über euch beide. Diese Hochzeit ist das Beste, was dir passieren kann.«
Ich interessiere mich sehr wohl für deine Angelegenheiten, wollte Ardainn brüllen. Doch der eine Satz über Fionnbarr nahm ihm den Wind aus den Segeln. »Sprich nicht so über Fionnbarr! Du hast kein Recht …«
»Ich habe jedes Recht, mein Sohn, denn ich bin der Lord der Mittellande. Und wenn du meine Regeln nicht befolgst, werde ich meine Macht nutzen, um gewisse unliebsame Personen aus deinem Umfeld zu entfernen.«
Er trug absichtlich die verdreckten Kleider vom letzten Übungskampf mit Fionnbarr. Unrasiert und ungekämmt machte er sich erst auf den Weg zur Halle, wo der Lord die Gäste stets empfing, als der Herold gegen Mittag ihre Ankunft im Innenhof meldete.
Ein finsterer Blick des Lords traf ihn, der gerade einem breitschultrigen Hünen mit roten Haaren die Hand bot. »Ich freue mich, Euch hier begrüßen zu dürfen, Saor Ultan.«
Ultan schlug ein. Entweder bemerkte er die Missstimmung nicht, oder er war gewillt, sie zu ignorieren. »Die Freude ist ganz meinerseits, Mylord.« Nach diesen Worten trat er mit einem Lächeln beiseite, um mit stolzer Miene den Blick auf eine junge Frau freizugeben. »Darf ich Euch meine Tochter Rhianna vorstellen?«
Eine Flut ungebändigter roter Locken umrahmte ein Gesicht mit marmorweißer Haut. Das moosgrüne Kleid ließ die Augen wie Smaragde leuchten. Rhianna machte anmutig einen artigen Knicks. »Mylord.« Als sie lächelte, schien die Sonne aufzugehen. Keck glitt ihr Blick dabei zu Ardainn.
Anstelle seines Vaters trat er vor, griff ungefragt nach ihrer Hand und hauchte einen Kuss darauf. »Ich freue mich, Eure Bekanntschaft zu machen.«
Sie hielt seine Finger eine Spur zu lang und zu fest, während sie einen weiteren Knicks machte und ihm dabei in die Augen sah. »Ich mich ebenso, Saor … Wie war der Name?«
»Mein Sohn Ardainn«, antwortete der Lord kühl.
Ultan deutete eine Verbeugung an. »Frisch vom Waffengang, wie mir scheint.« Er lächelte gutmütig. »Recht so.«
Der Lord winkte den Haushofmeister heran. »Wenn Ihr den Gästen jetzt ihre Zimmer zeigen wollt. Sobald Ihr Euch frisch gemacht habt, können wir die Modalitäten besprechen, Saor Ultan«, setzte er an den Gast gewandt hinzu.
Der lachte. »Nicht so eilig, Mylord. Wir werden uns schon einig. Wichtiger scheint mir, dass sich die jungen Leute einig werden. Vielleicht mag Euer Sohn meiner Tochter ja Eure Burg zeigen, während wir uns zurückziehen?«
Bevor sein Vater reagieren konnte, antwortete Ardainn an seiner Stelle. »Es wäre mir eine Ehre.«
»Wie mir scheint, habt Ihr Euch ebenfalls frisch gemacht.«
Angesichts des kecken Lächelns auf Rhiannas Gesicht schoss die Hitze in Ardainns Wangen. Mit einem Räuspern bot er ihr seinen Arm. »Was möchtet Ihr als Erstes sehen?«
Leicht wie eine Feder legte sich ihre Hand auf seinen Unterarm. »Den Kerker?«
»Den Turm vielleicht? Von dort hat man eine ganz wunderbare Aussicht.«
»Mein Vater sagt, kennt man den Kerker, kennt man den Lord. Den Kerker.«
»Ich fürchte, unser Kerker ist ein wenig staubig.«
Sie lachte. »Wenn das daran liegt, dass er wenig benutzt wird, dann spricht das für Euch.«
Ardainn zuckte mit den Schultern. »Ich fürchte, dass die Nutzung des Kerkers nicht in meinem Ermessensspielraum liegt.«
Ihr Blick wurde nachdenklich. »Wartet!«
»Möchtet Ihr doch lieber etwas anderes sehen?«
Sie runzelte die Stirn. Nach kurzem Zögern fragte sie: »Was würdet Ihr mir denn gern zeigen?«
»Wie wäre es mit einem Rundgang um die Burg?«
»Mit Vergnügen.«
Ihre Hand auf seinem Arm, führte er sie von der Halle in den Hof und durch ein kleines Seitentor nach draußen vor die Mauern der Burg. Ein schmaler Pfad zog sich dort entlang der Mauern in Richtung des Friedhofes. Er liebte diesen Platz. In der Stille konnte man den Trubel in der Burg eine Zeitlang vergessen. Die Felsen fielen steil ab, das Tal breitete sich wie ein grünes Juwel in der Tiefe aus, und der Himmel schien zum Greifen nah.
Angesichts der Aussicht schnappte Rhianna nach Luft. Ihre Finger umklammerten seinen Arm. »Das ist …«
»Schön, nicht wahr?«
»Atemberaubend.« Der Griff ihrer Hand lockerte sich wieder ein wenig. Still wie eine Statue stand sie neben ihm. Der Blick ihrer grünen Augen wanderte über die weite Ebene zu ihren Füßen, wo in der Ferne das silberne Band des Riths glitzerte, und glitt schließlich hoch zum Himmel, bis sie die Augen schloss und leise seufzte.
»Weiter?«
Sie sah zu ihm auf. »Es gibt noch mehr zu sehen?«
»Aber ja.« Da der Pfad zu schmal war, um nebeneinanderzugehen, griff er nach ihrer Hand und ging voran.
Immer höher führte der Weg, zuerst entlang der Mauern und dann fort von ihnen einem Berggrat folgend. Blaue Blumen säumten dort den Weg.
Mit einem Entzückensschrei ließ sie seine Hand los und kniete sich nieder. »Oh, seht nur! All die schönen Glockenblumen.«
»Wenn Ihr wollt, können wir daraus Euren Brautkranz winden.«
Ein schelmischer Blick traf ihn, während sie seine Hand ergriff, die er ihr bot, um ihr wieder aufzuhelfen. »Dann zieht Ihr also doch in Betracht, mich zu heiraten?«
Ganz nah stand sie nun vor ihm. »Wie kommt Ihr darauf, dass ich Euch nicht heiraten will?«
»Nun, Euer Aufzug bei unserer Begrüßung war ein sehr deutliches Zeichen. Ihr kamt doch nicht wirklich von einem Waffengang, oder?«
»Eher von einem Zechgelage.«
Sie lachte. »Eine solch ehrliche Antwort hatte ich nicht erwartet. Also seid Ihr doch gegen die Heirat.«
»Ich glaube nicht, dass mein Willen von großer Bedeutung ist.« Bei den Worten fasste er nach ihrer Hand und wollte sie weiterführen.
Aber sie blieb stehen. »Gibt es eine andere?«
»Nein. Aber selbst wenn dem so wäre, würde mein Vater keine Rücksicht darauf nehmen.«
»Wenn Ihr nicht wollt, dann … Ich könnte meinen Vater darum bitten, dass …«
»Gibt es einen anderen?«
»Nein.« Sie klang überrascht.
Stille herrschte. Nur der Wind zupfte an ihren Kleidern und versuchte eine Strähne ihrer roten Locken zu entführen.
»Wollen wir weitergehen?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Gerne.«
Ihre Hand in der seinen, setzte er den Weg fort. Schon nach wenigen Schritten kam der Friedhof in Sicht. Ein kleiner umfriedeter Platz auf einem Berggrat, umgeben von einem Meer aus blauen Glockenblumen und dem blauem Himmel.
»Der Friedhof?« Zögerlich ließ sie seine Hand los, um die Gräber abzuschreiten.
Er ließ sie gewähren, beobachtete sie dabei, wie sie die Inschriften studierte, und pflückte ein paar der Glockenblumen, bis sie zu ihm zurückkehrte.
»Wieso der Friedhof?«
»Damit Ihr wisst, wo man Euch zur Ruhe betten wird, wenn Ihr meine Frau werdet.« Bei den Worten hielt er ihr die Blumen hin.
»Glockenblumen und ein Platz auf einem Berg. Ist es das, was Ihr mir zeigen wolltet?«
»Möglicherweise«, sagte er. »Und wenn dem so wäre, was sagt das über mich aus?«
Ein funkelnder Blick aus grünen Augen traf ihn. »Ihr überrascht mich, Ardainn Ni Abhainnmor.«
»Man sieht dich kaum noch, seit deine Braut hier ist.«
Fionnbarrs Stimme überraschte Ardainn, als er aus der Vormittagssonne in den Stall trat, um die Pferde zu satteln.
»Bist du etwa eifersüchtig?«, fragte Ardainn belustigt.
»Lass das!« Mit einem Schritt trat Fionnbarr neben ihn.
Ardainn musste seufzen. »Ich will sie nur kennenlernen. Mehr nicht. Und sie werden nur noch ein paar Tage hier sein. Würdest du deine Braut nicht kennenlernen wollen?«
»Wenn ich sie nicht heiraten wollte, würde ich nein sagen oder einfach gehen!«
»Ich bin der Sohn des Lords. Ich trage eine Verantwortung …«
»Lass den Quatsch! Du bist nur dir selber verantwortlich und niemandem sonst.«
»Ardainn?« Rhiannas Stimme drang durch die Stalltür. Sie klang besorgt. »Ardainn, wo bist du?«
»Im Stall! Die Pferde satteln!«, rief Ardainn. »Warte draußen. Ich komme gleich!«
Fionnbarr schüttelte den Kopf. »Dann willst du sie wirklich heiraten?«
»Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Ich …« Ardainn schnappte nach Luft. »Sie könnte die Richtige sein.«
Fionnbarrs Faust schlug gegen seine Schulter. »Dann sattle die Pferde und sieh zu, dass du eine Antwort findest.« Er grinste. »Alles Gute, alter Freund!«
»Du gratulierst zu früh.«
»Das glaube ich nicht.«
»Langsam!«, rief Ardainn. »Du brichst dir noch den Hals. Der Untergrund ist tückisch!«
Steinchen wirbelten unter den Hufen von Rhiannas Stute hoch in die Luft. Ihr rotes Haar wehte wie eine Fahne im Wind. Sie lachte vor Lebensfreude.
Ardainn preschte auf seinem schwarzen Hengst hinter ihr her und wagte nicht, sie zu überholen, damit sich die Stute nicht auch noch herausgefordert fühlte.
»Fang mich!« Bei den Worten lenkte Rhianna die Stute vom Weg auf die Wiesen und hielt auf den Bach zu, der umsäumt von Erlen die Wiesenlandschaft durchquerte.
Die Bauern würden begeistert sein!
Trotzdem folgte Ardainn ihr. Sein Hengst schnaubte, als er den weichen Wiesenboden unter seinen Hufen spürte.
Rhianna warf ihm über die Schulter einen Blick zu und trieb ihre Stute jauchzend weiter an.
Ardainn glaubte, den Puls des Hengstes in sich zu spüren. Das schiere Leben durchströmte ihn. Der Wind zerrte an ihm. Der Himmel war so weit und die Wiesen so grün. Er machte sich leicht, beugte sich über den Hals des Tiers und trieb es an. Es war, als habe er den Hengst damit befreit. Wie der Wind schoss er dahin, überholte mit Leichtigkeit die Stute und sprengte auf das Band des Bachs zu.
Er fand die Lücke zwischen den Erlen und hielt darauf zu. Ein Schenkeldruck genügte, um den Hengst wie einen Vogel über den Bach fliegen zu lassen. Dumpf trafen die Pferdehufe das gegenüberliegende Ufer, fanden Wiesengrund und eilten weiter.
Ardainn hörte die Unterbrechung im Tritt der Hufe, als auch Rhianna über den Bach setzte. Dann folgte ein Schrei.
Mitten im Galopp wendete Ardainn sein Pferd. Er sah gerade noch, wie Rhianna von der Stute stürzte und im Gras landete. Sein Herz ließ einen Schlag aus. Er hetzte auf sie zu, sprang noch im Galopp vom Pferd und sank neben ihr auf die Knie.
»Rhianna! Seid Ihr verletzt?« Mit zitternden Händen zog er sie hoch in seine Arme.
Lächelnd schlug sie die Augen auf. »Ihr reitet wie der Wind.«
»Seid Ihr verletzt?«
Mit einem Kopfschütteln strich sie über seine Wange. »Ihr habt Angst um mich?«
»Ja.« Seine Stimme war unerwartet heiser.
Ihr Finger strich über seine Lippen. Sie brannten unter der Berührung und schickten einen atemlosen Schauer durch seinen Körper.
»Seid Ihr wirklich unverletzt?«
»Ja.« Ihr Atem ging schneller.
Wie unter Zwang beugte er sich über sie. Ihre Lippen berührten sich. Ardainn glaubte unter der Berührung zu verbrennen. Bevor er sich über die Unschicklichkeit der Situation Gedanken machen konnte, legte Rhianna ihre Arme um seinen Hals und zog ihn zu sich herunter.
Er gab nach, ließ sich fallen in ihre Umarmung und zog sie an sich. Seine Lippen öffneten ihre, ihre Zungen fanden sich, und die Berührung setzte ihn in Flammen.
Wie im Wahn irrten seine Hände über ihren Körper, fanden ihre Brüste, suchten im Ausschnitt ihres Kleides nach ihren Knospen und streichelten sie. Heizten die Glut weiter an, bis er von Sinnen vor Leidenschaft ihre Röcke raffte und seine Hosen öffnete.
Sie wehrte sich nicht, streichelte nur sein Gesicht und öffnete willig die Beine für ihn.
Der Blick der grünen Augen ließ ihn innehalten. Er keuchte vor unterdrückter Gier, hielt sein brennendes Glied mit letzter Kraft davon ab, in sie einzudringen.
»Warum hörst du auf?«, flüsterte sie. Ihre Lippen streiften seine, ihre Beine umschlangen sein Becken.
Seine Finger umschlossen eine ihrer Brüste. »Willst du mich heiraten?«, fragte er erstickt.
»Ja, Ardainn Ni Abhainnmor. Ich will.«
Jetzt erst gab er nach und versenkte sich in ihr, bis sie schrie vor Entzücken.
Mehrere Stunden lagen sie dort im Schatten der Erlen im saftigen Gras der Wiesen und liebten sich. Bis die Sonne sank und ihnen zeigte, dass sie endlich den Rückweg antreten mussten.
Die Pferde waren nirgendwo zu sehen. Hand in Hand suchten sie nach einer Furt im Bach, wateten schließlich durch das kalte Wasser, um dann auf der anderen Seite über die Wiesen dem Weg zuzustreben.
Weit entfernt waren Reiter zu sehen.
»Man sucht uns«, sagte Ardainn.
Rhianna lachte leise und legte kurz den Kopf gegen seine Schulter. »Gut, dass sie uns bisher nicht gefunden haben.«
»Ich hatte das nicht geplant.«
»Ich weiß.« Ihre Finger streichelten seine Hand.
»Was, wenn du schwa…«
Sie legte ihm die Fingerspitzen auf den Mund. »Wen kümmert es? Wir werden noch dieses Frühjahr heiraten.«
Hatte sie das etwa geplant? Auf Geheiß seines Vaters? »Bist du dir sicher?«
Mit sanfter Gewalt hielt sie ihn fest. »Ich liebe dich, Ardainn Ni Abhainnmor. Wenn dem nicht so wäre, würde ich mich eher vom höchsten Turm stürzen oder meinem Vater die Augen auskratzen, als dich zu heiraten. Was ist daran so schwer zu verstehen?«
»Dass wir heiraten sollen und uns sogar lieben.«
Sie schlang die Arme um ihn und küsste ihn. »Als ich hierherkam, hatte ich mir vorgenommen, dich zu ohrfeigen und so lange zu beleidigen, bis sogar mein Vater einsieht, dass es keinen Sinn hat, dass wir heiraten.«
Wider Willen musste er lachen. »Und was hat deine Meinung geändert?«
»Dein Aufzug bei unserer Begrüßung. Als ich dich in den dreckigen Kleidern sah, wusste ich, dass du mich genauso wenig heiraten wolltest wie ich dich.«
»Und das hat deine Meinung geändert?«
Das Getrappel der Pferdehufe näherte sich.
Rhianna schien es nicht zu kümmern. »Ich dachte mir, dass wir uns vielleicht zusammentun könnten, um unseren Vätern ein Schnippchen zu schlagen.«
»Und?«
Die Reiter waren schon ganz nah. Aber Ardainn sah nicht zu ihnen hin. Sein Blick hing wie gebannt an Rhiannas Lippen.
»Als du mir den Friedhof gezeigt hast, da habe ich mich in dich verliebt. Ich kann mir kein schöneres Ende vorstellen, als dort irgendwann neben dir zu ruhen.«
Ardainns Augen brannten. Ganz sacht küsste er Rhianna, während hinter ihm die Reiter ihre Pferde zügelten. Den Arm um ihre Schulter gelegt, drehte er sich endlich zu ihnen um.
Sie waren nur zu zweit: Fionnbarr und Saor Ultan. Im Stillen dankte Ardainn den Göttern dafür, dass nicht noch andere die kompromittierende Situation erkannten, in die er Rhianna gebracht hatte.
Fionnbarrs Miene war reglos, nur Saor Ultan wirkte erhitzt, als wolle er sich gleich auf ihn stürzen.
Doch ehe er lospoltern konnte, verkündete Rhianna: »Saor Ardainn hat um meine Hand angehalten, Vater. Wann dürfen wir heiraten?«
Fionnbarrs Miene wirkte wie aus Stein gemeißelt.
Aber auf Ultans Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. »Sobald es möglich ist.«
2. Kapitel
Ardainn stand neben Fionnbarr vor den Toren der Burg. Der Himmel, der sich über sie spannte, war so hell und klar, dass sich die Wiesen mit den Gehölzbändern darin spiegelten.
Eine Gruppe von Reitern sprengte auf sie zu. Einer davon war Rhianna. Ardainn erkannte sie an ihren Haaren, die wie ein leuchtend rotes Banner im Wind wehten. Darunter bauschte sich ihr Rock moosgrün über dem Fell des Pferdes.
Es drängte ihn danach, ihr entgegenzueilen. Aber eingedenk seines Vaters, der einige Schritt hinter ihm im Tor der Burg stand, ballte Ardainn die Hände zu Fäusten und zwang sich zu warten.
Endlich waren die Reiter heran. Pferde schnaubten, Hufe stampften. Ardainn hatte nur Augen für Rhianna.
Ihre Wangen brannten vom schnellen Ritt. Sie streckte Ardainn die Hände entgegen, und er half ihr vom Pferd. Einen Herzschlag lang sahen sie sich nur an, ihr Griff war so fest, als wolle sie ihn nie wieder loslassen.
»Trinkt etwas, Mylady«, sagte Fionnbarr.
Mit einem Lachen ließ Rhianna Ardainns Hände los und griff nach dem Becher, den Fionnbarr ihr reichte. Doch sie fasste ins Leere.
Klirrend zersprang der Becher in tausend Scherben. Eine Wasserlache breitete sich auf dem staubigen Boden aus.
Für einen Herzschlag lang gefror der Moment in der Zeit. Wurde zu einer Perle in einer Kette gleichartiger Perlen, die alle die gleichen Bilder zeigten. Von Bechern, die zerbrachen. Von Blut, das fließen würde. Rhiannas Blut.
Ardainn wusste, dass er eingreifen musste, wenn er es verhindern wollte. Aber seine Muskeln gehorchten ihm nicht. Wie gelähmt sah er, wie Rhianna sich bückte, um die Scherben einzusammeln.
Ein leises »Au!« entfuhr ihr. Mit einem Lächeln auf ihren Lippen richtete sie sich auf und zeigte ihm ihren Finger. Blut perlte aus dem Schnitt. Drei Tropfen rannen über ihre Haut, fielen zu Boden, drei blutroten Perlen gleich, die im Staub zerplatzten wie Glas …
Mit einem Schrei schreckte Ardainn im Bett hoch. Schweiß stand auf seiner Stirn, überzog seinen Oberkörper mit einem feinen Film. Ihn fröstelte in der durch das Fenster hereindringenden Nachtluft, wo der Mond fett und rund durch die Bahn der Vorhänge linste.
Warum endete jeder Traum von Rhianna damit, dass sie blutete? Warum zerbrachen jedes Mal die Becher, und warum trug sie Rosmarin?
Todesboten.
Ardainn glaubte an der Antwort zu ersticken. Mit einem Ruck sprang er auf und trat ans Fenster. Der Mond lächelte ihm höhnisch zu, als wüsste er ein Geheimnis.
Warum träumte er überhaupt? Nur beim Alten Volk hatte es Seher gegeben. Er gehörte nicht zum Alten Volk. Niemand konnte zum Alten Volk gehören. Das Alte Volk war eine Legende, mehr nicht. Genau wie die Sidhe.
Seine Mutter war eine Tiefländerin gewesen. Deshalb hatte er dunkle Haare und dunkle Augen. Weder war er ein Feenbalg noch ein Hügelfindling, wie ihn das Burgvolk nannte.
Und warum sah er dann?
Ardainns Finger umklammerten die Fensterbrüstung. Rhianna. Sie musste bald hier sein. Lampenfieber hatte Fionnbarr gestern seine Träume genannt. Als ob er Angst davor hätte, Rhianna ewige Treue zu schwören.
Zwei Tage noch. Warum waren sie noch nicht hier? Sie hatte früher kommen wollen, ihm ihren Bruder vorstellen und mit ihm Glockenblumen pflücken gehen, um ihren Brautkranz daraus zu winden. Pantoffelheld hatte Fionnbarr ihn deshalb genannt. Übermorgen war es so weit, und sie war immer noch nicht hier. Niemand war gekommen. Nicht einmal ein Bote.
Ardainn starrte auf den lächelnden Mond. Morgen. Er konnte die Träume nicht länger ignorieren. Morgen würde er ihr entgegenreiten.
»Wir werden keinen Suchtrupp losschicken!« Die Worte seines Vaters trafen Ardainn wie Peitschenhiebe. Mit schmalen Lippen stand der Lord seinem Sohn in dem kleinen Turmzimmer gegenüber, das er als Arbeitsraum nutzte. Durch das Fenster blinkte die Morgensonne.
»So wie du ihr keine Eskorte entgegenschicken wolltest?«, fauchte Ardainn.
»Du weißt, warum ich es abgelehnt habe. Die Gründe waren die gleichen.«
»Allmählich glaube ich, du willst nicht, dass es zu dieser Verbindung kommt.«
»Das ist Unfug, und das weißt du auch.«
»Und was wird ihr Vater sagen, wenn ihr etwas zugestoßen ist und du ihr nicht helfen wolltest?«
»Saor Ultan wird meine Vorgehensweise verstehen. Ich habe keine Lust, den Waffenstillstand mit Angus MacComhnall wegen deiner Kindereien zu gefährden.«
»Das sind keine Kindereien. Ich …« Ardainn biss sich auf die Lippen und wendete das Gesicht ab.
»Was dann?«
Sollte er es ihm erzählen? Erzählen, was niemand wusste – außer Fionnbarr? Ardainn schwitzte. »Ich habe geträumt …« Er konnte den Blick seines Vaters auf seinem Nacken spüren und wagte nicht, sich umzudrehen.
»Geträumt?« Die Stimme des Lords klang besorgt.
Wider Willen wandte Ardainn sich zu ihm um. »Geträumt.«
Die eisgrauen Augen seines Vaters musterten ihn mit neuem Interesse. »Was hast du geträumt?«
»Blut. Sie hat sich geschnitten. Immer wieder Blut. Und Krüge oder Becher, die zerspringen. Und Rosmarin.«
»Todesboten.«
Ardainn nickte. »Bitte …«
»Das ist nicht das erste Mal.«
Ardainn schüttelte den Kopf.
»Weiß jemand davon?«
»Fionnbarr.«
»Gut.« Der Lord presste die Lippen aufeinander, dann sagte er: »Sorg dafür, dass es so bleibt. Du bist mein Sohn, vergiss das nicht. Deine Ehre darf keinen Schaden nehmen. Hast du das verstanden?«
»Aber …«
»Es genügt, dass die Männer, deren Lord du einmal sein wirst, wegen deines Aussehens hinter deinem Rücken tuscheln. Ich will nicht, dass sie sich auch noch über angebliche Wahrträume die Mäuler zerreißen.« Bei den Worten wandte sich der Lord um und ging auf die Tür zu.
Sprachlos starrte Ardainn auf den Rücken seines Vaters. Doch bevor dieser die Tür erreichte, riss er sich aus seiner Starre und verstellte ihm den Weg. »Meine Träume werden wahr. Sie ist in Gefahr.«
»Dann lebe damit, dass du es nicht ändern kannst.«
»Das ist nicht dein Ernst!«
»Es wird Zeit, dass du erwachsen wirst, mein Sohn.«
In hilflosem Zorn ballte Ardainn die Hände zu Fäusten. »Das kannst du nicht von mir verlangen. Das kann niemand von mir verlangen.«
Als Ardainn sich umdrehen wollte, um hinauszustürmen, packte ihn der Lord am Arm. »Wage es nicht …«
Wortlos riss sich Ardainn los und warf die Tür hinter sich zu.
Niemand hielt Ardainn auf, als er an Fionnbarrs Seite durch das Tor der Burg galoppierte. Gleichgültig, was die Leute auch hinter seinem Rücken tuschelten, er war der Sohn des Lords, und nur der Lord konnte ihn aufhalten.
Als sie die Wegbiegung hinter sich gebracht hatten und sich die Wiesen vor ihnen ausbreiteten, in denen ein Erlenband den Bachlauf markierte, zügelte Ardainn sein Pferd. Dort am Bach hatten er und Rhianna sich vor einigen Wochen geliebt. Die Enge wich endlich aus seiner Brust. Befreit atmete er aus. Rhianna. Bald würde er sie in seinen Armen halten.
»Es wundert mich, dass er dich gehen ließ.«
Es dauerte eine Weile, bis Ardainn auf die Worte seines Freundes reagierte. »Er ließ mich nicht gehen.«
»Habt ihr euch gestritten?«
»Wie immer.« Ardainn nickte. Mit einem Stöhnen fuhr er sich übers Gesicht. »Ich hätte nicht so lange warten sollen.«
»Es nützt nichts, wenn du dir Vorwürfe machst.«
»Du weißt nicht, wie das ist. Herumzusitzen und zu warten, während derjenige, den man liebt, in Gefahr ist.«
»Vielleicht irrst du dich.«
»Du weißt, dass meine Träume wahr werden. Immer.«
»Das meinte ich nicht.«
Ardainn stutzte. »Willst du mir damit sagen, dass du die Richtige endlich gefunden hast?«
»Schon lange.«
»Und wer ist es? Kenne ich sie?«
Fionnbarr schüttelte den Kopf. »Sie … die Person weiß nichts davon.«
»Dann sag es ihr. Worauf wartest du?«
Fionnbarr sah ihn an. »Es würde nichts nutzen. Sie ist bereits vergeben.«
»Du solltest nicht so schnell aufgeben. Es geschehen manchmal Zeichen und Wunder. Sieh dir Rhianna und mich an!«
Fionnbarr schüttelte den Kopf. »Vergiss es. Es hat keinen Sinn.«
»Wenn ich dir helfen kann …«
»Denk an Rhianna. Wir sollten uns besser beeilen.«
Seite an Seite schlugen sie die Richtung zum Grenzweg ein, der entlang der Vorberge von Nord nach Süd führte. In dieser Gegend gab es keine Dörfer. Nur ein paar Schafhirten verschlug es ab und an mit ihren Tieren hierher. Niemand wollte die Hochländer durch seine Gegenwart provozieren. Nur Reisende nutzten den Grenzweg. Nur sie konnten sich dort sicher fühlen.
Das Gewissen regte sich in Ardainn. Wenn MacComhnalls Männer sie hier fanden, würde MacComhnall es als willkommenen Anlass nutzen, um den Waffenstillstand mit seinem Vater zu brechen. Dann würde der unselige Krieg zwischen den Mittel- und den Hochlanden seine Fortsetzung finden, und das, wo doch Ardainn derjenige war, der sich am meisten um sein Ende bemüht hatte.
Rhianna und ihre Verwandten hingegen durften den Grenzweg benutzen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Rhiannas Vater hatte dem Lord der Mittellande nicht die Treue geschworen. Der Krieg ging ihn nichts an. Nicht so lange, bis sich Rhianna und Ardainn ewige Treue geschworen hatten. Dies war der einzige Grund, weshalb sein Vater die Verbindung eingefädelt hatte. Dass er Rhianna liebte, war schieres Glück.
Ardainn schob die Gedanken beiseite und konzentrierte sich auf den Weg. Er und Fionnbarr galoppierten den Grenzweg entlang, legten in regelmäßigen Abständen kurze Pausen ein, in denen sie die Pferde im Schritt gehen ließen, um ihre Kräfte zu schonen.
Als sich die Sonne über den Hochlanden zur Ruhe begab, fragte Ardainn: »Bis zum Fiacaolan?«
Fionnbarr nickte.
So ritten sie in der hereinbrechenden Dämmerung weiter, bis sie das Gehölzband erreichten, das den Verlauf des Fiacaolans markierte. Nebeneinander führten sie die Pferde zum Bach, um sie saufen zu lassen.
Ardainn wollte sein Pferd gerade zurück zu seinem Freund führen, als ihn eine Vertiefung im Bachbett aufmerken ließ. Eine Spur? Waren etwa Reiter hier vorbeigekommen? Ardainn führte das Pferd vom Bach fort und band es an einen Busch, um allein zum Bach zurückzukehren.
Tatsächlich, die Vertiefung war eine Tierspur. Ardainn ging in die Hocke, um sie im fahlen Licht der Dämmerung besser in Augenschein nehmen zu können. Ein Pferd? Nein. Da, die Hufe waren gespalten. Wasser tränkte Ardainns Hose, als er sich tiefer beugte. Aber welches Tier war größer als ein Pferd und hatte gespaltene Hufe? Wobei … Vielleicht war die Spur an der Stelle auch nur zerbröckelt. Nein, das war Unfug. Die Spur war nicht zerbröckelt.
Ohne auf seine Kleider zu achten, folgte Ardainn dem Bachlauf und fand hinter einer Biegung weitere Spuren. Eine ganze Horde dieser Tiere musste hier den Bach gekreuzt und kurz angehalten haben, um zu saufen. Dann sah er den Fußabdruck. Ein Stiefel. Größer als seine, größer als die von Fionnbarr, aber schlanker.
Ein Schauer rann über Ardainns Rücken. Sidhe. In den Legenden hieß es, dass sie Einhörner ritten. Einhörner hatten gespaltene Hufe.
»Ich habe Spuren gefunden.«
Fionnbarr, der gerade den Sattelgurt anzog, sah auf. »MacComhnalls?«
Ardainn zog sein Pferd zu sich heran und kratzte sich am Kopf. »Ich bin mir nicht sicher. Besser, du siehst sie dir mal an.«
Fionnbarr runzelte die Stirn. »Wo?«
»Im Bachbett. In dieser Richtung. Nur etwa zehn Schritt entfernt.« Ardainn deutete in die Richtung, aus der er gekommen war.
Fionnbarrs Blick blieb an Ardainns durchnässten Hosen hängen. »Kümmere dich um mein Pferd.« Nach diesen Worten verschwand er in Richtung Bach.
Wortlos griff Ardainn nach den Zügeln von Fionnbarrs Wallach.
Er musste sich irren. Sidhe und Einhörner – das waren nur Legenden. Den Göttern sei Dank! Denn die Legenden berichteten, dass die Sidhe die Menschheit hatten vernichten wollen.
Ardainn schauderte. Die nassen Hosensäume klebten an seinen Unterschenkeln. Kälte kroch seine Beine hoch. Angestrengt lauschte er in die hereinbrechende Nacht. Als er endlich Fionnbarrs Schritte hörte, atmete er erleichtert auf.
Mit einem Brummen nahm dieser Ardainn die Zügel seines Wallachs aus der Hand.
»Und?« MacComhnalls. Bestimmt würde Fionnbarr das jetzt sagen. Und sie ritten in die Richtung, aus der Rhianna kommen würde.
Fionnbarr sah ihn mit gerunzelter Stirn an. »Eine Gruppe von mindestens zehn Reitern. Und sie haben nur wenige Stunden Vorsprung. Du hattest recht.«
»Wir müssen weiter. Sofort.« Ardainn griff nach den Zügeln und wollte aufsitzen.
Aber Fionnbarr legte ihm von hinten die Hand auf die Schulter. »Es könnte eine Falle sein, Ardainn.«
Ardainn wirbelte zu ihm herum. »Soll ich warten, bis ich die Nachricht von ihrem Tod erhalte?«
»Ardainn, denk nach! Sie ist neutral. Auch der alte Angus MacComhnall hält sich an die Gesetze. Er kann sie nicht angreifen, ohne seine Ehre zu verlieren.«
»Und wenn es nicht MacComhnalls Spuren sind, sondern die von jemand anders?«
Fionnbarr ließ seinen Arm los. »Jemand anders?«
»Strauchdiebe, eine Bande Gesetzloser, was weiß ich. Sie könnten auf Lösegeld aus sein.«
Nach einem Moment des Überlegens nickte Fionnbarr. »Schön, du hast mich überzeugt.« Noch während er sprach, begann er, die Blendlaterne aus seinem Gepäck hervorzuholen, und zündete sie an.
»Danke.« Ardainn schaffte es zu lächeln.
Mit der Andeutung eines Grinsens versetzte Fionnbarr ihm einen leichten Stoß mit der Faust, bevor er ihm die Laterne reichte.
Das Pferd am Zügel hinter sich herführend, schritt Ardainn voran, und Fionnbarr folgte ihm.
Gespaltene Hufe, grübelte Ardainn. Warum hatte Fionnbarr das nicht bemerkt? Oder war er – Ardainn – etwa so durcheinander vor Sorge, dass er keine Spuren mehr lesen konnte? Wahrscheinlich war das der Fall. Alles war wahrscheinlicher als ein Trupp Sidhe auf Einhörnern, die Rhianna verfolgten.
Ein Schrei ließ Ardainn zusammenzucken. Es war dunkel, nur ein paar Sterne erhellten die Szenerie, und er sah den Grenzweg und die nahen Vorberge.
Auf einmal erschütterte das Stampfen von Hufen den Boden, und plötzlich sah er sie ganz deutlich, schien die Dunkelheit für ihn nicht mehr zu existieren. Ein Trupp Reiter sprengte in eine Gruppe Unberittener, die sich vergeblich zu einem Kreis zu formieren suchten. Waffen klirrten. Die Fußsoldaten hatten keine Chance. Schon gingen die Ersten von ihnen zu Boden.
Eine Frau schrie, hoch und schrill.
Rhianna.
Ohne nachzudenken, ließ Ardainn die Laterne fallen, sprang auf sein Pferd und preschte auf die Kämpfenden zu. Das Schwert lag in seiner Hand, ohne dass er sich daran erinnern konnte, es gezogen zu haben. Sein Atem dröhnte in seinen Ohren, übertönte fast das Stampfen der Hufe und die Schreie der Sterbenden.
Wieder hörte er sie schreien. Dann sah er sie. Einer der Reiter hatte sie an den Haaren gepackt und zerrte sie zu sich heran. Sie wehrte sich, schlug um sich wie eine Furie. Der Angreifer ließ sie los, hieb ihr das Schwert in den Rücken und ließ sein Pferd steigen. Ardainn sah sie fallen, sah, wie die Pferdehufe auf den reglosen Körper stampften und der Reiter das Tier ein zweites Mal herumriss, damit es das grausige Werk vollenden konnte.
Ardainns eigener Schrei trieb ihn vorwärts, dem Mörder entgegen. Sein Schrei war so wild und voller Schmerz, dass der Mörder den Kopf hob und sich in seine Richtung wandte. Einen Herzschlag lang sah Ardainn in sein Gesicht. Dunkle Augen blickten ihn über hohen Wangenknochen an, umrahmt von einer Mähne dunklen Haares. In der Mitte seiner Stirn gloste ein Stein wie eine Wunde.
»Ardainn!«
Jemand versuchte mitten im Galopp nach Ardainns Zügeln zu greifen. Mit dem Schwertgriff wehrte Ardainn die Hand ab, setzte mit dem Ellbogen nach, um den Angreifer vom Pferd zu stoßen.
»Ardainn, was soll das?«
Die Stimme weckte eine Erinnerung. Fionnbarr war bei mir gewesen. Die Umgebung wirkte mit einem Mal fremd. Wo war Rhianna?
»Verdammt!« Der Sprecher holte auf, wurde zur Silhouette eines Reiters vor dem Sternenhimmel. »Du brichst dir noch den Hals!«
Ardainns Hände, mit denen er Schwert und Zügel hielt, zitterten. Wo war er? Der Galopp des Pferdes unter ihm wurde langsamer, verwandelte sich in einen holprigen Trab.
»Rhianna!« Mit einem Keuchen sah er sich um. »Rhianna!« Von weit entfernt glaubte er ihr Schreien zu hören. »Ich muss zu ihr. Ich muss zu ihr. Sie ist in Gefahr!« Ohne nachzudenken, trieb er sein Pferd wieder an.
»Warte!« Ein Fluchen folgte.
Jemand riss an Ardainns Zügeln, versuchte nach seinem Arm zu fassen. Erst jetzt bemerkte er wieder, dass er sein Schwert in der Rechten hielt. Wie ein Echo hallte Rhiannas Schrei durch seinen Kopf. Ein Blick aus kalten, dunklen Augen traf ihn. Er musste sich beeilen.
Zu spät, wisperte eine Stimme in seinem Kopf. Zu spät.
Mit einem Schrei schlug er um sich, traf etwas mit der flachen Seite der Klinge, hörte ein Keuchen, versuchte sich loszureißen und trieb den Hengst wieder an. Der Griff um seinen Arm bremste ihn jäh, traf ihn so überraschend, dass er den Halt verlor und aus dem Sattel rutschte.
Das Schwert fiel ihm aus der Hand. Im letzten Moment versuchte er sich abzurollen, bevor er am Boden auftraf. Da überraschte ihn schon die Dunkelheit.
Ardainn erwachte, weil ihn jemand an der Schulter rüttelte. Ein Blitz explodierte in seinem Kopf, als er sich auf die Seite rollen wollte. Mit einem Stöhnen öffnete er die Augen und entdeckte Fionnbarr, der neben ihm am Boden hockte und ihn im Licht der Morgendämmerung musterte.
»Geht’s wieder?«
Trotz des Hämmerns in seinem Kopf schaffte es Ardainn, sich aufzusetzen. Vorsichtig betastete er seinen Hinterkopf, von dem das Hämmern ausging, und entdeckte die Schwellung. Mit der Entdeckung kam die Erinnerung an den Sturz. Von weit entfernt glaubte er wieder, Rhiannas Schrei zu hören.
»Hier.« Fionnbarr hielt ihm ein nasses Tuch hin.
Einen Herzschlag lang starrte Ardainn es nur an. Dann stieß er Fionnbarrs Hand mit plötzlicher Heftigkeit beiseite, packte sein Schwert, das neben ihm am Boden gelegen hatte, und stemmte sich mit seiner Hilfe auf die Füße. Als Fionnbarr nach ihm greifen wollte, hielt er inne und stierte ihn an, bis Fionnbarr die Hand wieder zurückzog. Den Freund immer noch im Blick, stolperte Ardainn zu den Pferden und zog den Sattelgurt seines Hengstes an.
Mit versteinertem Gesicht stand Fionnbarr auf. »Es tut mir leid, Ardainn. Du hast mit dem Schwert nach mir geschlagen. Ich habe versucht, mit dir zu reden. Aber …«
»Spar dir die Mühe.« Ardainn verstaute Schwert und Mantel und griff nach den Zügeln. Mit zusammengebissenen Zähnen saß er auf und ließ den Hengst antraben, folgte den Spuren, die im Tageslicht nicht zu übersehen waren.
Er hatte eine Vision gehabt. Er hatte gesehen, wie die Gruppe, die Rhianna zur Burg seines Vaters hatte geleiten sollen, niedergemetzelt worden war. Und er hatte gesehen, wie Rhianna …
Die Erinnerung verstärkte die Übelkeit, die, verursacht durch das Hämmern, in Ardainns Kehle nach oben drängte. Wider besseres Wissen trieb er sein Pferd an.
Fionnbarr folgte Ardainn seit geraumer Zeit mit einigen Pferdelängen Abstand. Aber Ardainn ignorierte ihn, genauso wie er das Pochen ignorierte und die saure Enge in seiner Kehle. Sein Atem flog, Schatten tanzten vor seinen Augen.
Da entdeckte er sie. Eine Gruppe am Boden liegender Gestalten. Gedankensplitter. Augen, dunkel und kalt, blickten ihn über hohen Wangenknochen an. Blutrot blinkte ein Stein inmitten der Stirn. Drei blutrote Perlen fielen zu Boden und zerplatzten im Staub wie Glas.
Noch im Galopp sprang Ardainn vom Pferd und stürzte inmitten der Gruppe von Toten zu Boden. Moosgrün stach ein Rock durch den Nebel vor seinen Augen. Er rutschte auf den Knien darauf zu, tastete nach dem roten Haar und spürte die klebrige Nässe an seinen Fingern, als er sie berührte.
Sachte drehte er die reglose Gestalt auf den Rücken, ihre grünen Augen starrten in den Himmel. Das Gesicht war in Todesangst verzerrt.
Er zog sie in seine Arme und drückte sie an sich. Wiegte sie in seinen Armen. Wieder und wieder. Endlich schrie er, um nicht ersticken zu müssen.
Nach einer Weile oder einer Ewigkeit bemerkte er, dass Fionnbarr neben ihm stand. »Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich …«
Ardainn biss die Zähne zusammen, während er seinen Waffenbruder kurz ansah. Danach bettete er Rhiannas Körper ins Gras. Sanft drückte er ihr die Lider zu, strich das Haar aus ihrem Gesicht und faltete die Hände über ihrem Bauch. Er streichelte sie mit seinem Blick, suchte die Fröhlichkeit ihres Wesens, ihre Zärtlichkeit und Sanftheit. Hörte ihr Lachen, fühlte ihre Lippen auf seinem Mund und ihre Hände auf seinem Gesicht.
Endlich stand er auf. »Bring sie nach Hause.«
»Das ist deine Aufgabe.«
»Ich werde den Spuren folgen.« Die Fährte der Angreifer war noch frisch und deutlich zu sehen. Offensichtlich hatte sich dieses furchtbare Gemetzel tatsächlich erst in der vergangenen Nacht zugetragen, obwohl Rhianna und ihr Tross schon so lange überfällig waren. Pferde und Karren mussten sie bereits vorher verloren haben. Sie waren auf der Flucht vor ihren Mördern gewesen. Was sich genau in den letzten Tagen zugetragen hatte, konnte Ardainn nicht einmal erahnen.
Ohne Fionnbarr noch eines Blickes zu würdigen, ging er zu seinem Pferd, das sein Freund neben dem seinen an einen Busch gebunden hatte.
Fionnbarr vertrat ihm den Weg. »Allein?«
»Willst du mich daran hindern? So wie heute Nacht?«
»Verdammt, du warst nicht bei Sinnen!«
»Weil du nicht haben kannst, was du willst, soll ich es auch nicht haben?«
»O Ardainn, du hast keine Ahnung …« Fionnbarr hob die Hand, wollte nach Ardainns Arm fassen.
»Sie ist tot.«
Fionnbarr ließ die Hand sinken. »Wir wären jetzt genauso tot, wenn wir in der Nacht den Spuren gefolgt wären.«
»Lass mich vorbei!« Ardainns Rechte zuckte zum Schwertgriff.
»Ich bin dein Schwertbruder. Ich würde nie die Hand gegen dich erheben, um dir zu schaden.« Tränen glitzerten in Fionnbarrs Augen. »Nicht mit Absicht. Bei den Göttern, Ardainn, ich schwöre dir …«
»Ich habe keinen Schwertbruder mehr!«
Fionnbarr stand da wie gebannt. Das blonde Haar hing ihm wirr ins Gesicht.
Ohne ein weiteres Wort ging Ardainn an ihm vorbei zu seinem Pferd und saß auf.
3. Kapitel
Blind für seine Umgebung, folgte Ardainn den Spuren. Er wollte um sich schlagen, irgendjemanden für Rhiannas Tod büßen lassen, für den Abgrund, in den sich seine Zukunft verwandelt hatte, als ihm bewusst wurde, dass er nie mehr ihr Lachen hören würde, nie mehr ihre Hände halten konnte, niemals Kinder mit ihr haben würde und mit ihr gemeinsam alt werden konnte. Niemals.
Er sperrte den Gedanken fort, rief sich stattdessen das Gesicht ihres Mörders in sein Gedächtnis, das er in seiner Vision gesehen hatte. Er wollte sein Blut sehen. Leiden sollte er, wie er selbst litt. Ihn schlagen und demütigen wollte er, bis all der Zorn aus ihm gewichen war und nichts mehr blieb außer Erschöpfung. Eine Erschöpfung, die so groß war, dass sie alle anderen Empfindungen überdeckte. Damit er nicht mehr daran denken musste, was hätte sein können.
Am Rande seines Bewusstseins ahnte er, dass der Preis dafür sein Leben sein konnte. Aber die Erkenntnis schreckte ihn nicht. Er war schon tot. Er war gestorben in dem Augenblick, als Rhianna ihr Leben aushauchte. Eine Zukunft ohne sie war undenkbar, war leer und grau und ohne Hoffnung.
Eine Bewegung aus den Augenwinkeln ließ ihn aufmerken. Er glaubte, einen Reiter zu sehen. Aber jedes Mal, wenn er sich umdrehte, war er verschwunden. Folgte Fionnbarr ihm? Das konnte nicht sein. Fionnbarr musste Rhiannas Leiche nach Banuaine bringen. Er durfte sie nicht dort allein auf dem Grenzweg liegen lassen. Das Bild eines Raben, der Rhianna die Augen auspickte, quälte ihn derart, dass er den Blick immer wieder über die Schulter nach hinten richtete. Nachdem er aber den Reiter am Horizont schon seit Stunden nicht mehr gesehen hatte, konzentrierte er sich wieder ganz auf die Spuren, denen er folgte.
Er aß und trank im Sattel, um keine Zeit zu verlieren. Beeilen. Er musste sich beeilen, wenn er die Mörder einholen wollte. Wenn sie in der Dunkelheit weiterritten, war ihr Vorsprung am nächsten Tag so groß, dass er genauso gut umkehren konnte.
Schatten begannen erneut vor seinen Augen zu tanzen, verwischten die Spuren im Gras, so dass er sie nur noch mit Mühe ausmachen konnte. Das Pochen in seinem Kopf ließ kaum noch einen klaren Gedanken zu. Die Übelkeit bedrängte ihn wieder, machte jeden Schritt seines Pferdes zur Qual. Ein letztes Restchen Verstand sagte ihm, dass er sich ausruhen musste, wenn er durchhalten wollte. Aber er ignorierte es.
Er ritt, bis er die Spuren in der hereinbrechenden Dämmerung kaum noch erkennen konnte. Wider Willen saß er ab, packte eine Fackel aus, zündete sie an und folgte den Spuren zu Fuß, das Pferd am Zügel hinter sich herziehend. Er lief, bis er so müde war, dass er nur noch stolperte. Irgendwann war er so erschöpft, dass er stürzte. Mit Schwindel im Kopf stemmte er sich wieder auf die Füße, um weiterzugehen. Wenige Schritte später gaben die Beine erneut unter ihm nach. Wieder und wieder quälte er sich auf die Füße, bis seine Kraft aufgebraucht war und er liegen blieb.
Er lauschte auf seinen Atem, starrte auf die Fackel, die in seiner Hand brannte, hörte sein Pferd neben sich schnauben.
Sicherlich konnte er Rhiannas Mörder zur Blutrache fordern, wenn er sie fand. Genauso sicher würden dessen Begleiter dann die Blutrache von ihm einfordern, falls er Rhiannas Mörder besiegte. Irgendeiner würde ihn töten.
Doch der Gedanke berührte ihn genauso wenig wie der Waffenstillstand, der damit endgültig zerbrechen würde.
Aber was, wenn Rhiannas Mörder keine Menschen waren und den Gesetzen der Ehre nicht folgten?
»Wie kommst du hierher?« Die dunklen Augen unter dem roten Stein fixierten ihn.
Sofort sprang Ardainn auf und zog sein Schwert. Die Dunkelheit um ihn wurde nur durch ein paar Sterne erhellt. Das Ziel seiner Rache so urplötzlich vor sich zu sehen riss ihn auf die Füße.
Sein Gegenüber musterte ihn. Er hielt sein Schwert in der Hand. »Antworte, Mensch!«
Mit einem Schrei griff Ardainn an. Sein Gegner parierte mit Leichtigkeit. Er schien seine Hiebe vorauszuahnen. Seine Klinge war stets dort, wohin Ardainn zielte. Bald schwitzte Ardainn trotz der kalten Nachtluft. Sein Zorn und seine Wut liefen ins Leere, zerstoben wie Rauch im Wind. Seine Arme wurden schwer, bald konnte er nur noch stolpern. Sein Blick verschwamm. Im gleichen Augenblick biss Schmerz in seinen rechten Unterarm.
Sein Schwert fiel zu Boden. Er unterdrückte ein Stöhnen, ließ sich fallen, um nach seiner Waffe zu greifen und wieder aufzuspringen. Aber er verschätzte sich. Sein Griff ging ins Leere. Seinem Schwung fehlte die Kraft, um ihn wieder auf die Füße zu bringen. Er fand sich auf dem Rücken wieder und sah entlang der Klinge seines Gegners in dessen Gesicht.
»Du hast sie getötet«, keuchte er. »Mörder!«
Für einen Moment wirkte der Dunkelhaarige irritiert. »Du warst es, den ich sah.«
Seine Augen verengten sich. »Wie ist dein Name?«
»Du gibst es also zu!«
»Beantworte meine Frage.« Die Spitze der Klinge durchstach Ardainns Ledertunika und bohrte sich in seine Haut. »Was tust du hier? Und wer bist du?«
»Ich fordere dich. Im Namen der Ehre.«
»Schweig!« Die Schwertspitze sorgte dafür, dass Ardainn liegen blieb.
Warme Flüssigkeit rann über Ardainns Brust. Zitternd vor Zorn und Hass starrte er seinen Gegner an. Blind tastete seine Hand nach seinem Schwert, das irgendwo neben ihm im Gras liegen musste.
Und wenn er dabei starb, er musste es versuchen. Es war vielleicht die einzige Gelegenheit auf Rache, die sich ihm bieten würde.
Als hätte er Ardainns Gedanken geahnt, stellte der Gegner seinen Fuß auf Ardainns Waffe. »Lass das! Ich habe andere Pläne mit dir … Menschensohn.« In einer fließenden Bewegung ruckte sein Oberkörper hinab, und er schlug den Griff seines Schwertes gegen Ardainns Schläfe, bevor dieser begriff, was er vorhatte.
Dunkelheit umfing Ardainn.
Mit einem Stöhnen setzte sich Ardainn auf. In seinem Kopf hämmerte es, Schmerz biss in seinem Arm und seiner Brust. Weit im Osten kündete ein Silberstreif vom nahen Morgen. Das Gras war nass, seine Kleidung feucht und klamm. Er fror so sehr, dass er mit den Zähnen klapperte. Verwirrt sah er sich um, suchte nach Kampfspuren. Doch da waren keine. Sein Schwert lag neben der ausgebrannten Fackel am Boden, und einige Schritt von ihm entfernt graste sein Pferd.
Als er sich die Haare aus dem Gesicht strich, fuhr ein Stich durch seinen rechten Unterarm. Unwillkürlich hielt er den Atem an. Er hatte geträumt. Oder nicht? Langsam zog er den zerfetzten Ärmel seiner Tunika hoch und sah getrocknetes Blut, das aus einem tiefen Schnitt stammte, der etwa einen Tag alt sein musste. Seine Hand fuhr zu seiner Brust, fand den Riss und zog die Schnürung der Tunika auseinander. Dort sah er den Stich, der ebenfalls mit getrocknetem Blut bedeckt war.
Mit steifen Knien stand er auf und ging zu seinem Pferd, um die Satteltaschen zu holen. Das Tier nahm keine Notiz von ihm, graste einfach weiter, während er sich neben ihm zu Boden sinken ließ. Er kramte das Bündel mit Verbandsmaterial heraus, strich Salbe auf seine Wunden, verband sie und versuchte dabei nicht daran zu denken, wie er sie sich zugezogen hatte. Danach warf er die Satteltaschen wieder über den Rücken seines Pferdes und saß auf.
Die Spuren waren noch immer gut zu sehen. Fast hatte er erwartet, dass sie über Nacht verschwunden wären.
»Wie kommst du hierher?« Hatte der Dunkelhaarige damit das Gebiet der MacComhnalls gemeint? Arbeitete er etwa für den alten Angus?
Nein, der Mann war kein Mensch gewesen.
Ardainn hatte zwar noch nie einen Sidhe gesehen, aber er hätte schwören könne, dass der Dunkelhaarige einer war.
Seit wann arbeiteten Sidhe für den Lord der Hochlande? Seit wann waren Sidhe reale Wesen? Und wie konnte es sein, dass er in einem Traum reale Wunden davontrug?
Kurze Zeit nach seinem Aufbruch stieß er auf ein ausgebranntes Lagerfeuer. Sie hatten also gerastet. Die Entdeckung gab ihm Auftrieb. Dann hatte er immer noch eine Chance, sie einzuholen. Mit neuem Elan folgte er den Spuren. Wenn ihm auch sein Instinkt sagte, dass irgendetwas nicht stimmte. Aber vielleicht lag das ja nur daran, dass er Wesen verfolgte, die es eigentlich nicht geben durfte.
Noch vor Mittag erreichte er den Wald. Er war damit tiefer in das Gebiet der MacComhnalls vorgedrungen als je ein Mittelländer zuvor. Die Spuren zogen sich über einen schmalen Pfad, der an einigen Stellen kaum als solcher zu erkennen war. Das nahm Ardainn etwas von der Sorge, an der nächsten Wegbiegung auf eine Horde Hochländer zu stoßen. Immer tiefer drang er in den Wald vor, bis er die Ebene mit dem großen Strom nicht mehr durch die Bäume sehen konnte, weil die Berge die Sicht verdeckten.
Die Begegnung mit dem Sidhe ließ ihm keine Ruhe. Die Wunden, die er in der Nacht davongetragen hatte, waren zu real.
Aber gesetzt den Fall, der Kampf hatte tatsächlich stattgefunden, wie konnte ihn Rhiannas Mörder dann gesehen haben, als dieser sie getötet hatte? Außer … außer Ardainn war bei Rhiannas Tod tatsächlich anwesend gewesen.
Wenn dem so war, hätte er ihr dann etwa helfen können?
Wenn nur Fionnbarr bei ihm gewesen wäre, dann hätte Ardainn mit ihm darüber reden können. Voller Zorn biss er die Zähne zusammen. Fionnbarr hatte ihn aufgehalten. Fionnbarr war schuld, dass er Rhianna nicht rechtzeitig erreicht hatte. Er war damit genauso schuld an ihrem Tod wie dieser Mann, dem er folgte.
Aber wenn er tatsächlich Rhiannas Ermordung mit angesehen hatte, wären sie nicht auch in diesem Fall zu spät gekommen?
Er versuchte, die wirren Gedanken aus seinem Kopf zu verbannen, rief sich stattdessen das Gesicht ihres Mörders ins Gedächtnis. Wieder sah er den Blick der schwarzen Augen unter dem glitzernden roten Stein.
Weshalb hatte der Sidhe Rhianna getötet? Und weshalb hatte er ihn leben lassen? Das ergab keinen Sinn. Sollte der Mörder nicht den Einzigen, der ihn identifizieren konnte, töten? Außer … er wollte ihn in eine Falle locken, um ihn für seine Zwecke zu missbrauchen.
Ardainn zögerte. War es unter diesen Umständen sinnvoll, weiterhin den Spuren des Sidhe und seiner Begleiter zu folgen? Sollte er dann nicht besser umkehren, um seinem Vater, dem Lord, davon zu berichten? Irgendetwas Großes steckte dahinter. Aber ohne einen Beweis würde sein Vater ihm nie glauben. Nein, wenn sein Vater seinen Vermutungen Glauben schenken sollte, dann musste er ihm mehr bringen als ein paar Träume. Vielleicht musste Ardainn sogar vorerst auf seine Rache verzichten, um herauszufinden, welche Pläne der Sidhe hatte.
Gegen Abend war aus dem Pfad eine bloße Spur auf dem Nadelteppich geworden, die sich am Hang eines Berges entlang nach unten ins Tal zog. Ein Bach rann über Steine und unter umgestürzten Bäumen hindurch, machte den Boden so morastig, dass Ardainn dazu gezwungen war, sich an den hangwärts gelegenen Rand der Spuren zu halten. Als die Nacht hereinbrach, begriff er, dass er rasten musste. Mit einer Fackel durch die Nacht zu wandern, war mitten im Gebiet der MacComhnalls keine gute Idee. Und ohne Fackel würde er hier am Grunde des Tals durch absolute Finsternis stiefeln.
So wandte er sich mit seinem Pferd zum Hang, band es dort an die Zweige eines Baumes und lagerte hinter dem Wurzelteller eines umgestürzten Baumes. Nachdem er getrunken und ein paar Happen von seinem Proviant gegessen hatte, wickelte er sich in seinen Mantel, starrte in die Dunkelheit, lauschte auf die Geräusche der Nacht und wartete auf den Schlaf, der sich nicht einstellen wollte.
Als der Gesang der Vögel ihm das Nahen des Morgens ankündigte, stand er auf. Er tappte zum Bach, um seinen Wasserschlauch zu füllen, spritzte sich das eiskalte Wasser ins Gesicht, schüttelte sich und machte sich auf den Weg zurück zu seinem Pferd.
Da entdeckte er es.
Die Spuren, die gestern noch im morastigen Boden nicht zu übersehen gewesen waren, waren verschwunden.
Er suchte den ganzen Vormittag, ritt den Weg zurück, den er gekommen war. Doch da waren keine Spuren. Nicht einmal seine eigenen fand er.
Er wurde irre. Kein Zweifel. Er sah Dinge, die nicht existierten, wie diesen Kerl mit dem roten Stein auf der Stirn. Folgte Spuren, die es nicht gab. Das Lachen, das in seiner Kehle lauerte, erstickte im Ansatz. Fühlte sich so der Wahnsinn an?
»Ich habe andere Pläne mit dir.« Die Erinnerung glich einem Schlag ins Gesicht.
Der Kerl hatte ihn an der Nase herumgeführt. Hatte ihn mitten ins Gebiet der MacComhnalls geführt, damit er sich selbst umbrachte. Das Lagerfeuer, das er entdeckt hatte, war viel zu nah an jener Stelle gewesen, wo er die Nacht verbracht hatte. In der Dunkelheit hätte er seinen Schein sehen müssen. Warum war er nicht gleich darauf gekommen? Dieser Kerl hatte ihm das alles nur vorgegaukelt, damit er weiterritt. Damit er nicht aufgab.
Bei den Göttern, das würde er ihm heimzahlen! Er würde ihn finden. Irgendwie. Und er schwor sich, dass er ihn töten würde.
Rhianna. Der Schmerz überkam ihn so plötzlich, dass der Zorn mit einem Schlag verebbte. Müde wandte er sich wieder seiner Umgebung zu, suchte nach dem Pfad, dem er gefolgt war. Aber die Umgebung war fremd, als wäre er am Tag zuvor durch einen anderen Wald geritten. Atemlos zügelte er sein Pferd. Die Erkenntnis stand vor ihm wie in Stein gemeißelt.
Magie. Hieß es nicht in den Legenden, dass Sidhe der Magie mächtig waren? Ganz klar. Der Sidhe hatte ihn hierhergelockt und dann seine Spuren mit Hilfe von Magie verschwinden lassen. Aber weshalb?
Im nächsten Moment wurde ihm klar, dass er mindestens zwei Tage brauchen würde, um das Gebiet der MacComhnalls wieder zu verlassen.