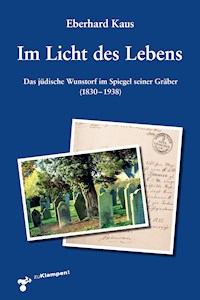
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Synagogengemeinde Wunstorf war eine der vielen jüdischen Landgemeinden in Königreich und preußischer Provinz Hannover im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Heute noch sichtbares Zeugnis dieser Gemeinde ist vor allem der von 1830 bis 1938 belegte neue Friedhof. Dessen noch erhaltene Grabsteine erzählen, zusammen mit weiteren Quellen, die Geschichte der Gemeinde und der Menschen, die ihr angehörten. Dabei umfasst die Lebenszeit der hier Begrabenen mit den Jahren von ca. 1750 bis 1938 eine bedeutsame Epoche des deutschen Judentums: den von Rückschlägen gekennzeichneten Weg zur bürgerlichen Gleichstellung, innerjüdisch begleitet von der Entstehung neuer Strömungen wie Reformjudentum und Neo-Orthodoxie – ein wichtiges Kapitel deutsch-jüdischer Geschichte im Schatten des Holocausts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eberhard Kaus
Im Licht des Lebens
Das jüdische Wunstorf im Spiegel seiner Gräber (1830 – 1938)
© 2021 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe
www.zuklampen.de
Gestaltung: zu Klampen Verlag · Springe
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH · Rudolstadt
Übersetzungen/Fotos: Eberhard Kaus (sofern nicht anders angegeben)
ISBN Printausgabe: 978-3-86674-817-0
ISBN E-Book-Pdf: 978-3-86674-929-0
ISBN E-Book-Epub: 978-3-86674-930-6
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Dieses Buch wurde klimaneutral und auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
Einführung
Die Synagogengemeinde Wunstorf
Der Vorsteher
Der Lehrer, Vorbeter und Schächter
Der Mohel
Frauen und Männer
Sprache
Synagoge und Gottesdienst
Die Schule
Die Mikwe
Die Friedhöfe
Zur vorliegenden Ausgabe der Inschriften
Besonderheiten einer hebräischen Grabinschrift
Der jüdische Kalender
Abkürzungen
Häufig wiederkehrende Formeln
Die Inschriften des neuen jüdischen Friedhofs Wunstorf
Anhang
Grabinschriften des jüdischen Friedhofs Steinhude (Auswahl)
Glossar
Angaben aus den Personenstandsbüchern
Verzeichnis der Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof Wunstorf
Konkordanz zur Nummerierung bei Homeyer
Quellen- und Literaturverzeichnis
Register
Schematischer Plan des neuen jüdischen Friedhofs Wunstorf
Über den Autor
»Die jüdische Gemeinde in der Stadt Wunstorf gehört zu den ältesten in der Provinz Hannover. […]
Daß meine Familie nun 260 Jahre in dem hannover schen Städtchen gehaust hat, begründet zur Genüge die Verbundenheit mit der Heimat.«
Meier Spanier (1937)
Vorwort
In seinem 2018 erschienenen Roman »Das Feld« lässt der österreichische Schriftsteller Robert Seethaler die Toten auf dem Friedhof des fiktiven Provinzstädtchens Paulstadt aus ihrem Leben erzählen. Ihre Darstellungen verweben sich zu einem Bild der kleinstädtischen Gesellschaft.
Die vorliegende Veröffentlichung folgt einer verwandten Methode – freilich ohne literarischen Anspruch. Die auf dem Friedhof an der Nordrehr bestatteten Jüdinnen und Juden, deren Grabsteine und -inschriften im Mittelpunkt dieses Bandes stehen, sollen aus den erhaltenen Quellen ein Gesicht bekommen. So entsteht, wenn auch notgedrungen nur bruchstückhaft, ein Porträt der jüdischen Gemeinde Wunstorf im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Hatte bereits der Leipziger Rabbiner Gustav COHN im Vorwort zu seiner Schrift »Der jüdische Friedhof« (Frankfurt/M. 1930) die alten jüdischen Friedhöfe als eine »geschichtliche Quelle von eminenter Bedeutung« bezeichnet, gilt dies nach der weitgehenden Vernichtung des deutschen und europäischen Judentums in der Zeit des Nationalsozialismus erst recht, und ebenso für die jüngeren Begräbnisplätze. Der durch den erhaltenen Wunstorfer Friedhof dokumentierte Zeitraum hat innerhalb der Geschichte des deutschen Judentums zudem eine besondere Bedeutung durch den Durchbruch der Emanzipationsbewegung sowie – innerjüdisch – der Entstehung neuer religiöser Strömungen wie dem Reformjudentum und der Neo-Orthodoxie.
Angesichts der immer noch zu konstatierenden, überwiegend auf den Holocaust reduzierten Wahrnehmung jüdischer Geschichte in der breiten Öffentlichkeit, scheint der erweiterte Blick auf die Zeit vor 1933 besonders geboten. So unverzichtbar die lebendige Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen ist und bleibt, so dürfte das Jahr 2021 mit der Feier von 1700 Jahren jüdischen Lebens auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands die unzulässige Ausblendung einer reichen Vergangenheit erneut bewusst machen.
Neben den vor allem im Stadtarchiv Wunstorf und dem Niedersächsischen Landesarchiv Hannover und Bückeburg erhaltenen Akten sind es die Erinnerungen des in Wunstorf geborenen Germanisten und Pädagogen Dr. Meier SPANIER (1. November 1864 bis 28. September 1942), die Einblicke in die Lebenswelt der Wunstorfer Jüdinnen und Juden gewähren.
Die Grabinschriften des 1982 unter der Leitung von Friedel Homeyer dokumentierten Friedhofs werden hier erstmals vollständig, zusammen mit einer neuen Übersetzung, herausgegeben und kommentiert (Näheres hierzu s. S. 37 f.). Die chronologische Anordnung lässt die Veränderungen in der Gestaltung von Stein und Inschrift sowie, zusammen mit den biographischen Angaben, die sich wandelnden Lebensumstände der Verstorbenen erkennen. Die Einleitung skizziert die rechtliche und gesellschaftliche Situation der jüdischen Bevölkerung im Königreich bzw. in der preußischen Provinz Hannover in dem hier relevanten Zeitraum und stellt die Gemeinde in ihren wichtigen Ämtern und Einrichtungen vor. Der Anhang bietet neben einer Auswahl von Grabsteinen des jüdischen Friedhofs Steinhude u. a. die in den Personenstandsverzeichnissen der jüdischen Gemeinden bzw. der Standesämter enthaltenen Daten. Ich hoffe, dass sich das vorliegende Buch auf diese Weise sowohl für historisch als auch genealogisch Interessierte als hilfreich erweist und zu einer weiteren Erforschung der jüdischen Vergangenheit Wunstorfs anregt.
Der Anstoß zur intensiveren Beschäftigung mit der jüdischen Gemeinde Wunstorf und ihrem Friedhof geht auf die von Dr. Peter Schulze, Hannover, konzipierte Ausstellung »Mit Davidsschild und Menora – Bilder jüdischer Grabstätten aus Hannover und Wunstorf« zurück, die im Herbst 2017 beim Heimatverein Wunstorf gezeigt wurde, und zu der ich einen kleinen Lokalteil erstellt hatte. Herrn Dr. Schulze danke ich für sein Engagement bei der Erforschung der Geschichte der jüdischen Friedhöfe in Wunstorf und Steinhude, für manch anregendes Gespräch und das Interesse an meiner Arbeit. Die Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse soll im kommenden Jahr erfolgen.
Ich danke darüber hinaus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Niedersächsischen Landesarchivs an den Standorten Hannover, Pattensen und Bückeburg sowie des Stadtarchivs Hannover, für die – auch unter Coronabedingungen – zuverlässige Bereitstellung der benötigten Akten. Für Rat und Auskunft (auch auf schriftlichem Wege) gilt mein Dank Karina Niggemann, Niedersächsisches Landesarchiv, Abt. Oldenburg, Dr. Elke Strang, Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig, Nathanja Hüttenmeister, Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte, Essen, Christoph Brunken, Stadtarchiv Delmenhorst, Mag. theol. Gerd Brockhaus, P. i. R., Verein »Begegnung – Christen und Juden Niedersachsen e. V.«, Hannover, sowie Steinmetz- und Steinbildhauermeister Gregor Ferl, Wunstorf.
Das Team des Stadtarchivs Wunstorf – Stadtarchivar Klaus Fesche, Sabrina Bauch und Hinrich Ewert – hat mich, wie schon so oft, mit Rat und Tat unterstützt. Herr Fesche hat sich zudem in besonderem Maße für die Drucklegung des Buches eingesetzt und bei den Korrekturen wertvolle Hilfe geleistet.
Dankbar bin ich der Stadt Wunstorf, namentlich Herrn Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt, für die dem Projekt zuteil gewordene Unterstützung.
Meiner Frau, Margit Schneider, danke ich für ihre Ermutigung, ihren Rat und weiterführende Diskussion.
Einführung
Die Lebenszeit der auf dem (neuen) jüdischen Friedhof zu Wunstorf bestatteten Frauen, Männer und Kinder umspannt den Zeitraum von ca. 1750 bis 1938. Sie spiegelt damit die wechselvolle deutsch-jüdische Geschichte zwischen Aufklärung und Schoa im Rahmen einer nordwestdeutschen Landgemeinde.
Enttäuschte Hoffnungen
Die in den frühen Gräbern bestatteten Frauen und Männer erlebten noch die Reformen zur Zeit des napoleonischen Königreichs Westfalen, zu dessen Aller-Departement Wunstorf von 1810 bis 1813 gehört hatte. Die neuen Gesetze hatten aus (»vergleiteten«) »Schutzjuden« und (»unvergleiteten«) »Betteljuden« rechtlich gleichgestellte Bürger gemacht, überstanden die mit der Rückkehr der alten Mächte und dem Wiener Kongress einsetzende Reaktionszeit aber nicht. So verlangte die Provisorische Regierungskommission in Hannover bereits am 31. Mai 1814 von der Stadtvogtei Wunstorf einen ergänzenden Bericht über evtl. »während der Zeit der Westphälischen Occupation« von den »jüdischen Einwohner[n] Simon Aron [Nr. 6], Moses Mendel [s. zu Nr. 51] und Isaac Heinemann« erworbene Häuser,1 da jüdischer Hausbesitz nun wieder an eine ausdrückliche Genehmigung gebunden war.
Von »Schutzjudentum« zu (eingeschränktem) Bürgerrecht
Stellte die Rückkehr zum diskriminierenden Sonderstatus der jüdischen Minderheit im nunmehrigen Königreich Hannover (abgesehen vom sog. Leibzoll2) eine herbe Enttäuschung aller fortschrittlichen Kräfte dar, so wirkten der Modernisierungsschub des westfälischen »Modellstaates«3 und aufklärerische Ideen von einer »bürgerlichen Verbesserung der Juden«4 doch in einem gewissen, wenn auch sehr bescheidenen Maße nach. Bereits die auf dem Wiener Kongress im Juni 1815 verabschiedete Bundesakte enthielt in Art. 16 die – vage – Absichtserklärung, die Bundesversammlung darüber beraten zu lassen,
wie auf eine möglichst übereinstimmende Weise die bürgerliche Verbesserung der Bekenner des jüdischen Glaubens in Deutschland zu bewirken sey, und wie insonderheit denselben der Genuß der bürgerlichen Rechte gegen die Übernahme aller Bürgerpflichten in den Bundesstaaten verschafft und gesichert werden könne5.
Als die Landdrosteien im März 18286 auf Beschluss des Kgl. Kabinettsministeriums den Oberhäuptern der jüdischen Familien oder jüdischen Einzelpersonen im jeweiligen Bezirk, sofern sie ein Bleiberecht genossen, zur Pflicht machte, einen Familiennamen zu wählen, scheint dies als Zeichen eines – wenn auch im Vergleich zu anderen deutschen Staaten späten – Emanzipationswillens gedeutet worden zu sein.7 Denn in den Folgejahren nahmen die jüdischen Gemeinden – wohl zusätzlich motiviert durch die französische Juli-Revolution von 18308 und die hannoversche Verfassungsdiskussion des Jahres 18329 – ihre bereits seit 181310 immer wieder erfolglos eingereichten Petitionen auf Gewährung bürgerlicher Rechte erneut auf.11 So gehörte auch die Wunstorfer Gemeinde mit ihrem Vorsteher Moses David Spanier (Nr. 37) zu den 26 jüdischen Gemeinden, die sich 1832 auf dem Petitionsweg an die Ständeversammlung in Hannover wandten.12
In der zeitgenössischen Argumentation um rechtliche Zugeständnisse an die jüdische Bevölkerung wird, wie Albert Marx hervorhebt13, der aufklärerische Gedanke einer »bürgerlichen Verbesserung« meist zur Begründung der Beharrung auf dem Status quo verwendet, indem auf Defizite in Bildung oder Moral der »Israeliten« verwiesen wird. Diese Haltung klingt auch in der Bemerkung an, die die Ständeversammlung im Januar 1833 ihrem Schreiben anlässlich der Weiterleitung der oben erwähnten Petitionen an die Regierung einfügte und in der sie bat,
die Vorlegung des im 25sten Postscripte vom 30sten Mai v. J. verheißenen Gesetz-Entwurfs über die künftigen Verhältnisse der Israeliten möglichst beschleunigen zu wollen, damit durch das demnächst zu erlassende Gesetz die Lage der Israeliten, so weit es mit dem allgemeinen Wohle verträglich [Hervorhebung E. K.], verbessert, vor Allem aber rechtlich festgestellt und möglichst gleichmäßig, in den verschiedenen Theilen des Königreichs geordnet werde.14
Die angesprochenen Defizite wurden dabei auch von jüdischer Seite nicht in Abrede gestellt. Im Vormärz waren es besonders jüdische Intellektuelle wie der Berliner Jurist Eduard Gans (1797 bis 1839), die auf die Notwendigkeit entsprechender Anstrengungen hinwiesen.15 Im Unterschied zu manchen christlichen Politikern und Publizisten machten sie jedoch darauf aufmerksam, dass es nicht ein bestimmter »Volkscharakter«, sondern der jahrhundertealte Ausschluss von Zünften, Gilden oder Grundbesitz sei, der die »typisch jüdische« Beschränkung auf (Trödel-)Handel, Geldverleih oder das – aus religiösen Gründen Juden gemeinhin gestattete – Schlachterhandwerk verursacht habe.16
Eingriffe der Regierung in jüdische Religionsangelegenheiten, wie sie mit der Neubegründung des hannoverschen Landrabbinats 1829 erfolgten, wurden daher von reformorientierten Mitgliedern der jüdischen Gemeinden durchaus begrüßt.17 Besonders die in der »Instruction für den Land-Rabbiner zu Hannover«18 vom 15. April 1831 (§ 4) verordnete Sorge für einen regelmäßigen Schulbesuch und die Verwendung der deutschen Sprache in Schule und Synagoge verhieß eine stärkere Breitenwirkung religiöser, moralischer und allgemeiner Bildung. Sie stellte neben weiteren Faktoren eine Grundlage für den im 19. Jahrhundert zu verzeichnenden erfolgreichen Aufstieg zahlreicher Angehöriger der jüdischen Unter- und Mittelschicht in das gehobene Bürgertum19 dar; ein Phänomen, das allerdings eher das städtische als das Landjudentum betroffen haben dürfte20, zu dem die Wunstorfer Jüdinnen und Juden zu zählen sind.21
Wie u. a. der am 20. März 1828 verfügte Ausschluss jüdischer Juristen von der Zulassung als Advokat22 zeigt, lag eine Emanzipation noch in weiter Ferne. Selbst das am 30. September 1842 erlassene »Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Juden«23 hob zwar das diskriminierende »Schutzverhältnis« (§ 5) – bei vorläufigem Weiterbestehen der daran gebundenen Zahlungen – auf, gewährte jedoch keine rechtliche Gleichstellung. Immerhin konnten Juden in ihrer Gemeinde das Bürgerrecht erwerben (§ 8) und »zünftige oder unzünftige Gewerbe gleich wie die christlichen Landeseinwohner erlernen und betreiben« (§ 51); dennoch blieben sie von politischen Rechten ausgeschlossen und unterlagen weiterhin Sonderregelungen, wie der obrigkeitlichen Genehmigung bei Niederlassung, Geschäftsgründung oder Verehelichung. Der Wunstorfer Magistrat bezog sich in seinem Bericht an die Hannoversche Landdrostei, »das Gesuch des Schutzjuden Aaron Rosenberg [Nr. 59/60] hieselbst um Erlaubniß zum Ankauf eines Hauses betreffend«, vom 31. Oktober 1842 ausdrücklich auf das jüngst erlassene Gesetz und ließ einen generellen Vorbehalt erkennen:
Wir sind im Allgemeinen dem Ankauf von Häusern durch Israeliten abgeneigt, da noch viele Bürger sich anzukaufen wünschen. Da nun der § 50 des Königlichen Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Juden vom 30sten September 1842 es rücksichtlich des Erwerbes von Grundeigenthum durch Juden bei dem bestehenden Rechte gelassen hat; so geben wir ganz gehorsamst anheim, dem Supplicanten den Ankauf eines hiesigen Hauses überhaupt hochgefälligst abzuschlagen.24
Erst 1847 wurden die nach Beseitigung des »Schutzverhältnisses« verbliebenen Zahlungsverpflichtungen aufgehoben, das Zeugnis eines Juden dem eines Christen gleichgestellt und der (beschränkte) Erwerb von Haus- und Grundbesitz gestattet.25
Für die jüdischen Gemeinden kam dem Gesetz von 1842 demgegenüber große Bedeutung zu, da es u. a. in §§ 35–49 das Synagogen-, Schul- und Armenwesen neu ordnete. So wurde nicht nur die Schulpflicht jüdischer Kinder derjenigen der christlichen gleichgestellt, sondern auch für jüdische Schulen die Anstellung geprüfter Lehrer gefordert, die in der Lage waren, neben den religiösen auch allgemeine Kenntnisse zu vermitteln, wobei Letzteres in der Anfangszeit wegen des Fehlens geeigneter Kandidaten in den Gemeinden zu Problemen führte. So kam es z. B. in Wunstorf erst mit dem Reskript der Kgl. Hannoverschen Landdrostei vom 4. September 1856 zur Einführung einer jüdischen Elementarschule.26 Ferner wurde die Stellung der Vorsteher gestärkt, die nun Verstöße gegen die Synagogenordnung im Einvernehmen mit Landrabbiner und Obrigkeit sanktionieren konnten (§ 37), und (»soweit nötig«) die Neuordnung der Gemeindebezirke verordnet (§ 35). Letzteres führte am 24. November 1843 zur (Neu-)Bildung einer Synagogengemeinde aus den Ortschaften Wunstorf und Luthe.27
Rechtliche Gleichstellung, divergierende Alltagserfahrungen
Das Jahr 1848 brachte mit § 6 des »Gesetzes, verschiedene Änderungen des Landesverfassungs-Gesetzes betreffend«28 vom 5. September 1848 formal die völlige rechtliche Gleichstellung; dort heißt es u. a.: »Die Ausübung der politischen und bürgerlichen Rechte ist von dem Glaubensbekenntnisse unabhängig.«29 Ende 1853 wurde der Ziegeleiverwalter Aron Rosenberg (Nr. 59/60) in Wunstorf zum ersten jüdischen Mitglied des Bürgervorsteher-Kollegiums und 1854 zu dessen stellvertretendem Vorsitzenden (»Vice-Wortführer«) gewählt. Dennoch klaffte zwischen Verfassungstheorie und Verfassungswirklichkeit eine nicht unbeträchtliche Lücke, die sich etwa in diskriminierenden Verwaltungsentscheidungen oder dem Verlust des passiven Wahlrechts zur Ständeversammlung (1855) zeigte.30
Auch nach der Annexion Hannovers durch Preußen 1866 bestand die Diskrepanz zwischen theoretischer Gleichberechtigung und realer Diskriminierung weiter.31 Selbst nach 1871 zeigte sich, von Ausnahmen abgesehen32, dass die Gleichstellung zwar im freiberuflichen und gewerblichen Bereich galt, man in staatlichen Angelegenheiten (z. B. im Schulwesen oder der öffentlichen Verwaltung) jedoch merken ließ, dass jüdische Belange an zweiter Stelle rangierten.33
Im ländlichen Wunstorf mit seiner fast ausschließlich in Handel und Handwerk tätigen jüdischen Bevölkerung dürften negative Erfahrungen, wie sie z. B. jüdische Akademiker machten, die eine Hochschulstelle anstrebten, allerdings kaum eine Rolle gespielt haben. Wenn die »Erinnerungen« (SPE) des Germanisten und Pädagogen Meier Spanier (1864–1942), Sohn von Leser (Nr. 50) und Elise Spanier, geb. Meyer (Nr. 65), auch ein in der Erinnerung und im Kontrast zu dem erlebten Antisemitismus der späten Weimarer Republik etwas geschöntes Bild wiedergeben dürften34, so deckt sich die Darstellung eines weitestgehend friedlichen Zusammenlebens von christlicher und jüdischer Bevölkerung doch mit anderen Beschreibungen des gesellschaftlichen Miteinanders im ländlichen Raum.35 1925 erinnerte sich Spanier in einem Artikel der »Jüdischen Schulzeitung«:
An warmen Sommerabenden saßen meine Eltern auf einer Bank vor der Tür mit den Nachbarsleuten, der Familie eines Ackerbauers. Wir Kinder hörten zu, wenn meine Mutter und mein Vater, der sein Handwerk in Hannover gelernt hatte, vom Hoftheater erzählte, von Devrient36 und andern Größen, von den herrlichen Aufführungen von Schillers Räubern, Kabale und Liebe u. a. Zuweilen auch spielten wir mit den andern in der Nähe, und es hat die Freundschaft niemals gestört, ja, unserer Unterhaltung manchen neuen Reiz gegeben, daß die Nachbarskinder in die christliche und wir in die jüdische Schule gingen. Im Winter vereinigte uns ein Leseabend der beiden Familien, an dem die Größeren von uns aus guten Büchern vorlasen. Ich muß oft daran denken, mit welchem Feingefühl diese einfachen Leute Rücksicht nahmen auf die religiöse Stellung und Uebung der andern. […] Und als 1871 die Soldaten in das kleine hannoversche Städtchen siegbeglückt heimziehen sollten, verzierten wir jüdischen Kinder gemeinsam mit den christlichen durch unsere Blumenkränze die hohe von uns allen bewunderte Ehrenpforte. So hatte die deutsche Bildungsarbeit und das Miterleben deutschen Schicksals uns in einem Deutschtum geeint, das unverlierbar unsern Herzen bleibt.37
Der Text ist zugleich ein Zeugnis für den Patriotismus großer Teile des deutschen Judentums im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. In städtischem Milieu und späteren Jahren wurde dieser Patriotismus immer wieder mit dem sich seit dem »Gründerkrach«, der nach dem Boom der »Gründerjahre« einsetzenden Überproduktionskrise (1873–79), verstärkenden Antisemitismus38 konfrontiert.39 Dieser bediente sich in seiner Hetze nicht zuletzt des Klischees vom »reichen«, aber »unproduktiven« Juden. Den realen Hintergrund dieses Konstrukts stellte der erfolgreiche soziale Aufstieg großer Teile der jüdischen Bevölkerung während des 19. Jahrhunderts aus der Unter- in die Mittel- und Oberschicht dar, der zu einem großen Teil auf wirtschaftlichen Erfolgen im tertiären Sektor (Handel, Bankwesen) beruhte.40 Diesem waren viele jüdische Bürger nach Aufhebung der Beschränkungen treu geblieben, da hier die in der jahrhundertealten erzwungenen Beschränkung gewonnenen Erfahrungen genutzt und immer noch bestehende Benachteiligungen in anderen Bereichen umgangen werden konnten.41 Zusammen mit den durch die jüdische Aufklärung (Haskala) seit der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts angestoßenen und später auch staatlicherseits unterstützten Reformen im Bildungsbereich förderte das zeitliche Zusammentreffen von Judenemanzipation und Industrialisierung bzw. dem Übergang zur kapitalistischen Wirtschaft die beschriebene soziale Dynamik. Als »reich« konnte jedoch nur ein kleiner Teil der jüdischen Bevölkerung bezeichnet werden.42 Das gilt erst recht für Dörfer und Kleinstädte wie Wunstorf.
Eine Folge des mehr oder weniger latenten Antisemitismus war auf jüdischer Seite eine Rückbesinnung auf die eigene Religion und Tradition sowie die Gründung zahlreicher jüdischer Vereine und Organisationen, wie dem »Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens« (C. V., 1893).43 Der C. V. vertrat eine bewusste Verbindung von deutscher und jüdischer Identität, was der Haltung der überwiegenden Mehrheit der deutschen Judenheit entsprach.44 Die 1920 gegründete C. V.-Ortsgruppe Wunstorf wurde zunächst von Lehrer Siegfried Weinberg (s. Komm. zu Nr. 77), später von dem Holzhändler und Senator Emil Kraft geleitet.45 Die Bindung von Vereinen an Konfessionen oder politische Richtungen findet sich im 19. und 20. Jahrhundert allerdings auch außerhalb des jüdischen Milieus, so dass das Entstehen jüdischer Vereine nicht allein auf antisemitische Ausgrenzung zurückgeführt werden kann. Das betrifft einerseits die älteren, wie den seit 1849 in Wunstorf bestehenden »Israelitischen Frauenwohltätigkeitsverein«, andererseits jüngere Organisationen wie den (zumindest seit Ende 1922) zionistisch geprägten »Jungjüdischen Wanderbund« (J. J. W. B.), dem 1922/23 der Wunstorfer Harry Schloß, Sohn von Nathan (Nr. 74) und Emma Schloß (Nr. 81), als Einzelmitglied angehörte.46
Der Krieg als »Gleichmacher«?
Die Hoffnung, mit dem »Dienst am Vaterland« im Ersten Weltkrieg vollends als nicht nur formal gleichberechtigte Bürger akzeptiert zu werden, wurde spätestens mit der sogenannten »Judenzählung« der Obersten Heeresleitung (1916) enttäuscht. Diese sollte den Anteil jüdischer Deutscher unter den Soldaten belegen, offenbarte vor allem aber durch den impliziten Generalverdacht der »Drückebergerei« die antisemitische Haltung im Offizierskorps.47 Ihre bis zum Kriegsende geheim gehaltenen Ergebnisse, die danach einem bekennenden Antisemiten zur Auswertung und Veröffentlichung überlassen worden waren48, führten im Gegenzug zu peniblen Untersuchungen von jüdischen Stellen, wie dem »Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten«, der u. a. ein Gedenkbuch für die ca. 12000 jüdischen Gefallenen herausbrachte.49 Aus Wunstorf nahmen u. a. Bernhard und Adolf Kreuzer, Richard Lazarus, Sohn von Gustav (Nr. 86) und Dina Lazarus, geb. Ikenberg (Nr. 72), Henry Mendel, Student in Göttingen und Sohn des Wunstorfer Kaufmanns Albert (Jakob) Mendel und seiner Frau Riecka, geb. Schloß (Nr. 84), Jakob Schloß50, Ehemann von Amalie, geb. Möllrich (Nr. 83), und Siegfried Weinberg (s. Komm. zu Nr. 77) am Weltkrieg teil.
Zwischen Integration und Gefährdung
Die Weimarer Republik brachte einerseits die weitere rechtliche Gleichstellung jüdischer Bürgerinnen und Bürger51 sowie die Anerkennung der jüdischen Gemeinden und Landesverbände als Körperschaften des öffentlichen Rechts52 und damit die Gleichbehandlung mit den christlichen Kirchen. Dem entgegen stand ein sich radikalisierender Antisemitismus der rechten Parteien, der »den Juden« alle tatsächlichen oder vermeintlichen Übel der Zeit (u. a. militärische Niederlage [Dolchstoßlegende!], Wirtschaftskrisen, Moderne in Kunst und Literatur [»Kulturbolschewismus«]) anlastete.
Während, wie Meier Spaniers Ausführungen zeigen, in größeren Städten dieser Antisemitismus in den Zwanzigerjahren zunehmend als Problem wahrgenommen wurde, dürften in der Wunstorfer Gemeinde vorläufig eher die Abwanderung vor allem junger Menschen und die immer wieder geplante Schließung der jüdischen Elementarschule, an die mit der Lehrer- auch die Vorbeterstelle gebunden war, Sorgen bereitet haben. 1926 stellt der 1919 gegründete und von Lehrer Siegfried Weinberg geleitete »Jüdische Jugendverein Wunstorf« seine Arbeit ein, weil alle jugendlichen Gemeindemitglieder fortgezogen waren.53 In der Bevölkerungsstatistik steigen die absoluten Zahlen nach einem signifikanten Einbruch zwischen 1885 und 1895 (von 80 auf 56 Personen) bis 1925 wieder auf 69 an, bevor sie nach 1925 massiv (über 46 [1933]) auf 12 im Jahre 1939 zurückgehen. Dagegen sinkt der prozentuale Anteil der jüdischen Bevölkerung Wunstorfs kontinuierlich von 3,9 % im Jahre 1861 auf 0,8 % 1933 (0,2 % 1939).54
Trotz z. T. guter Integration in das gesellschaftliche Leben55 dürfte das sich insgesamt verändernde Klima manchen zur Auswanderung veranlasst haben.56 Doch abgesehen von der dramatischen Entwicklung ab 1933 lässt sich die Abnahme der jüdischen Bevölkerung in Wunstorf und anderen ländlichen Gemeinden und Kleinstädten zudem mit der seit dem 19. Jahrhundert in ganz Deutschland festzustellenden Tendenz zu deren Verstädterung erklären.57 1920 lebten in Preußen ca. 72 % aller jüdischen Bürgerinnen und Bürger in Großstädten.58 Hinzu kommt, dass sich nicht nur regional eine Verringerung der jüdischen Bevölkerung, trotz Zuwanderung aus Ost- und Ostmitteleuropa, feststellen lässt. Denn die Urbanisierung hatte u. a. geringere Kinderzahlen sowie vermehrte »Mischehen« und Konversionen zur Folge.59
Die wirtschaftlichen Probleme der Zwanziger- und Dreißigerjahre trafen die meist selbstständige oder in Handel und Bankwesen tätige jüdische Bevölkerung besonders hart.60 In Wunstorf trug die Weltwirtschaftskrise vermutlich dazu bei, dass das Haus des Pferdehändlers Alexander Schönfeld (Nr. 87) in der Bahnhofstraße (ab 1933: Hindenburgstraße) der Zwangsversteigerung zum Opfer fiel.61
Auf dem Weg zum Holocaust
Die Machtübertragung an die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 bedeutete den Anfang vom Ende des deutschen und europäischen Judentums. »Das Schicksal der Juden in Wunstorf« in diesen Jahren hat Heiner WITTROCK ausführlich dargestellt. Ich beschränke mich daher auf einen allgemeinen Überblick für die Zeit bis 1938, dem Jahr, in dem einerseits die letzte Bestattung auf dem Wunstorfer Friedhof erfolgte, andererseits der Novemberpogrom (»Reichskristallnacht«) inszeniert wurde, der, zusammen mit seinen Begleitmaßnahmen (u. a. Deportationen, Morde, »Arisierung«), als »der erste Schritt zur Endlösung«62 bezeichnet werden kann.
Bald nach Verabschiedung des sogenannten »Ermächtigungsgesetzes« (24. März 1933) begann mit dem Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte (1. April 1933) der schrittweise Ausschluss jüdischer Bürgerinnen und Bürger vom öffentlichen Leben. Am 7. April verfügte das »Gesetz über die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« die Entlassung jüdischer Staatsbediensteter, wie des (seit 1924 wegen staatlichen Personalabbaus vorläufig beurlaubten) Lehrers Siegfried Weinberg (siehe den Kommentar zu Nr. 77). Die Maßnahmen erreichten mit den »Nürnberger Gesetzen« vom 15. September 1935, die u. a. Jüdinnen und Juden die Staatsangehörigkeit aberkannten und »Mischehen« verboten, einen vorläufigen Höhepunkt.
Das Jahr 1938 zeigte bereits vor dem Novemberpogrom eine weitere Entrechtung, u. a. mit dem Verlust der Approbation für jüdische Ärzte, der Einführung zusätzlicher Zwangsvornamen (»Israel«, »Sara«) und der Kennzeichnung der Pässe mit einem »J«. Nach dem Pogrom kam neben anderen Einschränkungen der Ausschluss vom Besuch kultureller Veranstaltungen (Theater, Kinos, Konzerte) und öffentlicher Schulen hinzu. Ebenso gehört die Erfassung »jüdischen Wohnraums« und vorhandener Vermögenswerte zu den (zumindest aus heutiger Sicht) auf Deportation und Vernichtung vorausweisenden Maßnahmen des Jahres 1938. Der staatlich verordnete Entzug der Existenzgrundlage stellt wohl auch den Hintergrund für den Suizid des Viehhändlers Gottschall de Jonge (Nr. 90) dar, der als letztes Mitglied der jüdischen Gemeinde im März 1938 auf dem Wunstorfer Friedhof an der Nordrehr bestattet wurde.
Die Synagogengemeinde Wunstorf
Bereits Ende des 13. Jahrhunderts könnten Jüdinnen und Juden in Wunstorf gelebt haben. Darauf deutet eine Urkunde Bischof Ludolfs von Minden und Graf Johanns von Wunstorf vom 28. Mai 1300 hin, in der diese die Einnahmen aus Mühle, Münze, Juden u. a. unter sich aufteilten.63 Während es sich hierbei, wie auch bei weiteren indirekten Zeugnissen aus dem 14./15. Jahrhundert, um lediglich formelhafte Wendungen handeln könnte, gehen direkte Belege für jüdisches Leben in Wunstorf auf das (frühe) 16. Jahrhundert zurück.64
Wie aus der Existenz eines jüdischen Friedhofs vor dem »Westertor« (heute Ecke Haster Straße/Amtshausweg) seit ca. 1690, der Synagoge an der Nordstraße (seit ca. 1810) und der oben erwähnten Einreichung einer Petition der Wunstorfer Juden an die Ständeversammlung in Hannover (1832) hervorgeht, gab es nach der Vertreibung der jüdischen Minderheit aus dem Fürstentum Calenberg (1591) schon viele Jahrzehnte vor der Bildung des Synagogenbezirks Wunstorf-Luthe wieder eine jüdische Gemeinde in der Stadt.
Die Synagogengemeinde dürfte besonders in für die Minderheit schwierigen Zeiten ein wichtiger Ort der Selbstvergewisserung und der gegenseitigen Unterstützung gewesen sein. Sie war zudem die Institution, die im ländlichen Raum die Möglichkeit zu (religiöser) Bildung und Gottesdienstbesuch bot. Dabei war das Miteinander in dem hier im Mittelpunkt stehenden Zeitraum nicht immer konfliktfrei, wie nicht nur Meier Spanier in seinen »Erinnerungen« erwähnt,65 sondern sich auch aus den Akten der Gemeinde und des Landrabbinats ergibt. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass in den Akten vorwiegend die Problemfälle erscheinen, während das positive Miteinander nur selten Niederschlag finden dürfte. Und Meier Spaniers Erleben war u. a. geprägt von der Ungeduld einer jungen Generation, die die Enge der heimischen Gemeinde auch als eine Belastung empfand,66 der man durch Studium und Beruf entkommen konnte.
Das Konfliktpotential ergab sich – ähnlich wie nach Sammy Gronemanns Zeugnis im nahen Hannover67 – u. a. aus unterschiedlichen religiösen Anschauungen, und aus der Notwendigkeit, sich bei einer relativ kleinen Mitgliederzahl bei unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen über zum Teil wichtige und (relativ) kostenintensive Gemeindebelange, wie die Anstellung eines Lehrers, verständigen zu müssen. Hinzu kamen Probleme, die die – im Zuge der Emanzipation möglicherweise noch verschärfte – soziale Ungleichheit widerspiegelten. So fühlte sich etwa Meier Spaniers Mutter Elise (Nr. 65) bei einem Rosch-ha-schana-Gottesdienst von der ihrem Empfinden nach arroganten Haltung der Gattin des im Verhältnis zu den anderen Gemeindemitgliedern »reichen« Vorstehers brüskiert.68 Die häufigen Klagen, etwa über Abweichen von der vorgegebenen Reihenfolge beim Aufruf zur Toralesung,69 oder die Beschwerde des Trödlers Jacob Rosenberg (Nr. 46), er habe sich bei der Jahrzeit schon zum dritten Mal vergeblich um Minjan, also die notwendige Anzahl von zehn (männlichen) Betern für das Kaddisch, bemüht,70 dürften zumindest teilweise auf diese sozialen Konflikte zurückzuführen sein.
Während Meier Spaniers Familie sich zwar als religiös, nicht aber als orthodox einstufte,71 galt das – wie seine Betonung der eigenen häuslichen Praxis zeigt – für andere Gemeindemitglieder offenbar nicht. Für eine (neo-)orthodoxe Position spricht etwa die Haltung des Wunstorfer Vorstehers [Levy] Löwenberg, eines Sohnes von Abraham Löwenberg (Nr. 32), in der Frage des Parochialzwangs (22. Januar 1874), also der festen Zuordnung zu einer Gemeinde aufgrund des Wohnortes, wobei er sich der nicht zuletzt von orthodoxen Gruppierungen vertretenen Befürwortung einer Möglichkeit zum Austritt aus der Ortsgemeinde anschloss.72
Der Vorsteher
Die Leitung der Gemeinde oblag dem ehrenamtlichen Vorsteher (hebr.: parnas u-manhig, vgl. Nr. 37), dem normalerweise ein Rechnungsführer zur Seite stand.73 Die Übernahme beider Wahlämter musste von der (staatlichen) Obrigkeit bestätigt werden. Während der Rechnungsführer eine unentgeltliche Führung ablehnen konnte (was in Wunstorf offenbar nicht vorkam), war der Vorsteher bei Wahl durch die wahlberechtigten Gemeindemitglieder in der Regel verpflichtet, das Amt als reines Ehrenamt für die Amtszeit von drei Jahren zu übernehmen. Vorgeschrieben war eine Beeidigung, die, wenn die Wahlversammlung dies beschloss, durch ein »Gelöbnis an Eidesstatt« ersetzt werden konnte.
Für beide Amtsinhaber, besonders für den Vorsteher, dürfte die nebenberufliche Tätigkeit im Allgemeinen eine nicht geringe zusätzliche Belastung dargestellt haben. Zu den Aufgaben des Vorstehers gehörten u. a. die Aufsicht über die jüdische Schule (Anstellung und Aufsicht über den Lehrer; Kontrolle des regelmäßigen Schulbesuchs der Kinder u. a.) sowie die Ordnung in der Synagoge. Er vertrat die Gemeinde nach außen, z. B. gegenüber dem Magistrat, dem Landrabbiner oder vor Gericht. Wie die Akten von Gemeinde und Landrabbinat zeigen, war mit seinen Aufgaben ein umfangreicher Schriftverkehr verbunden.
Andererseits erhöhte das von der Gemeinde entgegengebrachte Vertrauen und ein erfolgreiches Wirken das Ansehen des jeweiligen Amtsträgers in Gemeinde und Stadt. Umgekehrt war es für die Gemeinde von Vorteil, eine bereits in der Stadt anerkannte Persönlichkeit zum Vorsteher zu wählen.
Vorsteher der Synagogengemeinde Wunstorf
Vor 1844:
1806
Samuel Moses [Spanier]
?
Simon Aron [Aronschild] (?)
1819
David Moses Spanier
1825
Moses [David] Spanier
1827
Abraham Moses Löwenberg
1838
Moses David Spanier
Nach der Neuordnung des Gemeindegebietes (1843):
1844–1847
Elias David Spanier
1848–1850
Moses David Spanier
1851–1853
Moses Abraham Löwenberg
1854–1856
Ephraim Abraham Spanier
1857–1859
Moses David Spanier
1860–1862
Aron Rosenberg
1863–1865
Moses Abraham Löwenberg
1866–1871
Moses David Spanier
1872–1874
Levy Abraham Löwenberg
1875–1900
Mendel Löwenstein
1900–1939
Albert (Jakob) Mendel
1939–1940 (?)
Richard Lazarus
Die aus den Akten74 teilweise rekonstruierbare Liste der Vorsteher zeigt, dass das Amt, von Ausnahmen abgesehen, im 19. Jahrhundert in der Hand der beiden angesehenen Familien (Abraham) Spanier und Löwenberg lag. Ausnahmen sind, neben dem aus Springe gebürtigen Simon Aron (Aronschild, Nr. 6), der zuvor zum Bürgervorsteher avancierte Ziegeleiverwalter Aron Rosenberg (Nr. 59/60) und der aus Luthe stammende Holzhändler Mendel Löwenstein (siehe den Kommentar zu Nr. 9), dessen Wirken auch außerhalb der jüdischen Gemeinde gewürdigt wurde, wie das Glückwunschschreiben des Magistrats (Bürgermeister Ernst Ouvrier) vom 10. Januar 1900 zu seinem drei Tage zuvor gefeierten 25. Amtsjubiläum zeigt:
Wie wir erfahren haben, blicken Sie bei der Wende des Jahrhunderts auf eine ununterbrochene Thätigkeit von 25 Jahren als Vorsteher der hiesigen Synagogen-Gemeinde zurück.
Mit dem Ausdruck der Freude, daß es Ihnen vergönnt gewesen ist, diesen wichtigen Tag zu feiern, verbinden wir denjenigen des Dankes, daß Sie stets es verstanden haben, Ordnung und Zucht in Ihrer Gemeinde, sowie Achtung vor dem Gesetz und Gotteswort aufrecht zu erhalten. Hierdurch, sowie durch die im Sinne eines friedlichen Zusammenlebens aller verschiedenen Konfessionen von Ihnen stets geübte Geschäftsführung haben Sie sich ein nicht unerhebliches Verdienst um die hiesige Stadt und den Dank der städtischen Behörden erworben. Diesen Dank hiermit auszusprechen, ist der Zweck dieses Schreibens. Zugleich fügen wir den Wunsch an, daß Sie noch lange Ihr Amt in demselben Geiste fortführen, oder aber es Ihnen vergönnt sein möchte, auf diese Thätigkeit noch recht lange zurück blicken zu können.75
Den Nachfolgern Mendel Löwensteins als Vorsteher, Albert Mendel und Richard Lazarus, kam die schwere, ja aussichtslose Aufgabe zu, die Interessen der jüdischen Gemeinde gegenüber den nationalsozialistischen Machthabern zu vertreten. Wie lange Richard Lazarus die Gemeindeleitung innehatte, lässt sich nicht exakt bestimmen. Der erste Beleg für seine Vorstehertätigkeit datiert vom 7. Juni 1939,76 also noch vor der »Zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der jüdischen Kultusvereinigungen« vom 4. August 193977, die der »Reichsvereinigung der Juden in Deutschland«78 das »Recht« zusprach, bei Gemeinden »ohne ordnungsmäßigen Vorstand« einen neuen Vorstand einzusetzen (§ 1).79 Er dürfte demnach noch von der Gemeinde gewählt worden sein. Letztmalig erscheint er als Gemeindevertreter in einem Vertrag über den Verkauf von Grundstücken der Synagogengemeinde vom 23. Oktober 1940, der von dem Wunstorfer Notar W. Dannheim beglaubigt wurde.80
Der Lehrer, Vorbeter und Schächter
Als ich schulpflichtig wurde, hatten wir wieder eine eigene jüdische Schule. Das war dem glücklichen Umstand zu verdanken, daß ich in demselben Alter mit dem ältesten Sohne des reichsten Gemeindemitgliedes war. Bis dahin hatten die Kinder genug in der allgemeinen Volksschule lernen können; aber nun mußten sie ›mehr davon abbringen‹. Das Leben stellt sofort größere Ansprüche, wenn ein reiches Kind zur Schule kommt. Und das sieht ja jeder ein, zehn Kinder in einer Klasse können mehr lernen als hundert, und außerdem müssen die Kinder auch etwas von ihrer Religion wissen, und es ist sehr schön, wenn uns jemand am Sonnabend und an den Festtagen etwas vorpredigen kann.
Diese Gründe schlugen umso eher durch, als alle Gemeindemitglieder schon seit Jahren von ihrer Richtigkeit überzeugt waren, mit Ausnahme des einen, der sie nun mit überzeugender Kraft und einwandfreiem Geldbeutel vorbrachte. […]
An und für sich waren [die Kosten für den Lehrer] zwar nicht allzu groß; denn man hatte aus der Zahl der sich bewerbenden Lehrer den billigsten herausgesucht. Das war ein ältlicher Mann, der schon seit einiger Zeit ohne Stellung und unverheiratet war, sonst hätte ja die Lehrerwohnung, die nur aus einer Schlafkammer und einem Kohlenraum bestand, nicht ausgereicht. Außer der freien Wohnung erhielt der Lehrer auch noch hundert Taler und das Recht, sich ›rund zu essen‹. Das ging so zu. Jeden Tag der Woche speiste er bei einer andern Familie, und am Ende der Woche war er rund, das heißt er war ›rund‹, aber bei der wenig üppigen Kost wurde er es nie. Die Einrichtung war übrigens vortrefflich. Es war die einfachste Lösung der heute noch so vielfach umstrittenen Frage, wie die Verbindung von Schule und Haus herzustellen sei. Wenn der Lehrer in die Lage versetzt ist, so gründlich den Geschmack eines jeden Hauses kennenzulernen, wenn die Mutter es wenigstens einmal in der Woche in der Hand hat, die ihrem Liebling widerfahrene Ungerechtigkeit an dem Übeltäter durch salzige Suppen und verbranntes Gemüse zu rächen: dann müssen sich auch die schroffsten Gegensätze in reinste Harmonie auflösen. […]
Gesenkten Hauptes, ohne nach rechts oder links zu sehen, schritt der neue Lehrer aus der Schulstube über den schmalen Flur die Synagoge hindurch zum Vorbeterpult. Bedächtig legte er sich den Tallis81 um, begann die Abendgebete zu rezitieren, und andächtig kritisch lauschte die Gemeinde. Fieberhafte Spannung lag auf allen Gesichtern, als die ersten Psalmen beendet waren. »Nun kommt's drauf an, der Lechodaudi82, das ist die Hauptsache.« Mit zitternder Stimme trug er eine wehmütige Weise des Sabbatbrautliedes vor. Seitwärts und rückwärts wandten sich die Köpfe der Zuhörer, um nach der ersten Strophe ihre Bemerkungen auszutauschen. […]
In allen jüdischen Häusern gab's an dem Abend nur eine Frage und ein Diskussionsthema: »Nun, wie hat er geort83?«
Und als sich am andern Morgen der männliche Teil der Gemeinde, jung und alt, wie gewöhnlich vor dem Gottesdienst im Vaterhause des langen Zender, das nahe bei der Synagoge stand, versammelte, da wurde nicht wie sonst von den Dorfereignissen oder von Geschäften gesprochen, da gab's nur einen Gesprächsstoff: der neue Lehrer.84
Die Schilderung des Lehrers und Schriftstellers Jakob Loewenberg (1856–1929), eines guten Freundes Meier Spaniers,85 bezieht sich nicht auf die Verhältnisse in der Wunstorfer Gemeinde, sondern auf die in seiner westfälischen Heimat (Niederntudorf bei Salzkotten). Die erhaltenen Quellen vermitteln jedoch ein ähnliches Bild. Hier wie dort wird die Diskrepanz zwischen der Bedeutung des Lehrers für die Gemeinde und dessen prekären Lebensumständen deutlich. Dies gilt in besonderem Maße für die Zeit vor der preußischen Annexion (1866), als die Schulaufsicht, Anstellung und Vergütung der Lehrer noch vorwiegend Sache der Gemeinden bzw. ihrer Vorsteher war.86 Doch auch noch nach 1871 konnte ein jüdischer Volksschullehrer sich in der Regel nur mit Nebentätigkeiten über Wasser halten.87 Erst seit dem »Gesetz, betr. das Diensteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Volksschulen« vom 3. März 189788 waren die festangestellten jüdischen Elementarlehrer (nicht aber die reinen Religionslehrer) ihren christlichen Kollegen finanziell gleichgestellt.
Lehrer der jüdischen Gemeinde Wunstorf89
Lehrer des Wunstorfer Cheders bzw. der jüdischen Religionsschule
1760er Jahre
Heine Benjamin
1813
Nachum Immanuel
1828
Pincus Rabins aus Westpreußen (bisher in Groß-Munzel)
1830 (?)
Religionslehrer Isidor Margner aus Berfa
um 1830
Lehrer Rosenfeld aus Dänemark
1832
Joseph Nachum
1832 (bis 18.3.)
B. Levysohn (wegen angeblicher »unsittlicher« Kontakte zu einer Frau entlassen)
1843 (28.3.)–1844
Religionslehrer Salomon Badt aus Schwersenz/Großherzogtum bzw. Provinz Posen
1846
Religionslehrer Jakob Herz aus Altona
1846–1848
Lehrer B[ernhard]90 Fuld (bittet am 10.12.1847 um Entlassung wegen geplanter Auswanderung nach Amerika im Frühjahr 1848)
1848 (20.3.)–1849 (Purim)
M.91 B. Rosendahl (geht nach Rehburg)
1849 (1.9.)–1852 (Mitte April)
Religionslehrer Joachim Adler aus dem Amt Tschestitz/Böhmen
1852 (1.9.)–1854
M. Wurzel (bittet im September 1854 um Entlassung, um ins Ausland zu gehen)
Lehrer nach Einrichtung der jüdischen Elementarschule
1856 (4.9.)–1863 (Ostern)
Lehrer Jacob Löwenstein aus Stolzenau (vorher in Eldagsen/gibt den Lehrerberuf auf, um Kaufmann zu werden). In Löwensteins Vertrag wurden Lehr- und Schächteramt getrennt.
1863 (26.11.)–1865 (30.6.)
Lehrer Theodor Philipp aus Wandsbeck, erneute Verbindung von Lehr- und Schächteramt (geht nach Lüneburg)
1866
Lehrer Luhs als provisorischer Lehrer (evtl. Markus Luhs aus Gemünden/Wohra)
1867 (24.8)–1868 (Ostern)
Baruch Baruch aus Gudensberg (geht nach Hamburg)
1868 (6.6.)–1870 (Michaelis)
Lehrer Julius (Isaak) Löwenstein aus Gudensberg (geht nach Celle)
1871 (3.6.)–1873 (April)
Lehrer Heinemann (Chajim ben Naftali)92 Neumark aus Vellmar in Kurhessen
1873 (1.5.)–1879 (Ostern)
Lehrer Jonas Goldschmidt aus Falkenberg, zunächst provisorisch; fest angestellt ab 22.6.1876 (geht nach Hamburg)
1879 (1.8.)–1880 (März)
Aron Selz aus Künzelsau/Württemberg, provisorischer Lehrer (wegen »ungebührlichen Verhaltens« entlassen)
1880 (3.10.)–1881 (Ostern)
Lehrer Joseph Josephsohn
1881 (1.5.)–1885
Lehrer Ludwig (Louis) Horwitz aus Vandsburg/Westpreußen (geht nach Graudenz)
1885–1887
Lehrer Julian Schöps aus Koschmin (nimmt eine Stelle im Regierungsbezirk Düsseldorf an)
1889
Lehrer Hermann Wallach
1890
Lehrer Josephsohn
1893–1896
Aron Neuhaus (später in Fritzlar)
1896–1898
Lehrer Capell
1899–1905
Lehrer Joseph Moses (geht nach Kassel)
1906–1910 (30.6.)
A. Gunzenhäuser aus Boppard/Rh. (auf Antrag entlassen)
1910 (1.9.)–1924 (30.11.)
Lehrer Siegfried Weinberg aus Schenklengsfeld (vorher in Gehrden)
Religionslehrer nach Aufhebung der jüdischen Volksschule Wunstorf
1924–1930
Lehrer Siegfried Weinberg (zieht nach Hannover; 1939 Emigration in die USA)
1930–1931
Lehrer Philipp Goldmann aus Wiesbaden (kommt von Köln, geht nach Wiesbaden; polnischer Staatsangehöriger)
1931–1933
Lehrer Adolf Cohen aus Aurich (kommt von Würzburg/unbekannt verzogen)
Bereits der häufige Wechsel der Lehrer, die sich eine besser dotierte Stelle suchten, nach Ansicht der Gemeinde bzw. des Vorstehers nicht die fachlichen oder sittlichen Voraussetzungen mitbrachten, den Lehrberuf zugunsten eines auf die Dauer befriedigenderen Gewerbes, wie desjenigen eines Kaufmanns, aufgaben oder sich zur Auswanderung entschlossen, lässt auf die schwierige Situation der meist unverheirateten Männer schließen. So bittet der damals 37-jährige93 Religionslehrer Joachim Adler am 27. August 1851 Landrabbiner Dr. Meyer um Unterstützung bei der kurzfristigen Bewerbung um eine einträglichere Stelle in Gehrden:
Denn in Wunstorf ist weder ein Zweck noch ein Bleiben für mich, ich müßte mich hier sehr einschränken und ein sehr beschränktes Leben führen, wenn ich mit meinem Gehalte auskommen will. Ich habe im Laufe des Sommers meinen Ueberzieher nach dem Leih[h]ause zu Hannover schicken müssen. – Mein Gehalt ist schon bereits 4 Wochen fällig und ich habe ihn noch nicht. Man will mir mit Gewalt 3 Thaler an Aufwartung u 5 Thaler an Beköstigung abziehen. – Auch habe ich hier keinen rechten Wirkungskreis, – aber Ärger und Verdruß habe ich genug. Das Weib im Hause, der ich so viele Gefälligkeiten erwiesen habe, ärgert mich täglich u stündlich, wie sie mich nur ein lautes Wort sprechen oder ein Kind weinen hört, so geht sie gleich zu den Eltern hin und erzählt es ihnen und lügt noch obendrein dazu.94
Die schwierige Rolle des Lehrers, der – selbst in der Regel kein Gemeindemitglied95 – einerseits eine exponierte Stelle in der Gemeinde einnahm, andererseits oft die Abhängigkeit von seinem Umfeld zu spüren bekam, mag manchen überfordert haben, so dass Vorwürfe wegen »sittlicher Verfehlungen« – im Allgemeinen waren dies »verdächtige« Kontakte zu Frauen oder Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit –, die zuweilen zu einer Entlassung führten, einen faktischen Hintergrund gehabt haben dürften.
Die Forderung nach einem streng sittlichen Lebenswandel beruhte zum einen auf der Vorbildfunktion des Lehrers, zum anderen auf seinem zweiten Amt als Vorbeter bzw. Kantor (hebr.: chasan). Dieser ersetzte in Wunstorf wie in vielen anderen Landgemeinden den Rabbiner, den man sich aus Kostengründen nicht leisten konnte. Er übernahm die Leitung des Gottesdienstes, predigte und nahm Beerdigungen sowie mit Erlaubnis des Landrabbiners Trauungen vor, sofern dieser hierzu nicht persönlich erschien.
Eine weitere Funktion, die in Wunstorf, abgesehen von der Amtszeit Jacob Löwensteins (1856–1863), fest mit der Lehrerstelle verbunden war, war das Amt des Schächters (hebr.: schochet). Dabei war eine Trennung beider Funktionen bereits in den »Bestimmungen wegen des jüdischen Schulwesens im Bezirke des Land-Rabbiners zu Hannover« vom 11. Juli 183196 angestrebt worden. Doch auch hier war Wunstorf keine Ausnahme.97 Dass man dem Lehrer diese für einen Pädagogen eher ungewöhnliche Funktion zuwies, lag an der religiösen Vorbildung und Frömmigkeit, die man auch bei einem Schochet voraussetzte. Für das Ansehen des Lehrers und Vorbeters, besonders in seinem nichtjüdischen Umfeld, wurde diese Aufgabe jedoch eher als Belastung empfunden.98
Festgehalten werden muss angesichts dieser »Ämterhäufung« allerdings, dass Nebentätigkeiten wie Küster, Organist oder Lektor auch auf einen christlichen Volksschullehrer zukamen; gleiches galt auch für den »Reihetisch«, also die als Teil des Lohns angerechnete Verköstigung im Haushalt von Gemeindemitgliedern.99
Was die fachliche und pädagogische Vorbildung der jüdischen Religions- und Elementarlehrer angeht, waren Klagen über diesbezügliche Defizite noch um die Jahrhundertmitte nicht selten. So schildert Gustav Goslar aus eigenem Erleben den oben erwähnten Religionslehrer Joachim Adler (nach seinem Wechsel an die Schule der jüdischen Gemeinde in Bremen, 1858) als einen »Mann mit wenig genügender fachmännischer Bildung«:
Das Schulzimmer war ein einfensteriger, schmaler Raum, der einen langen Tisch und an beiden Seiten eine Bank enthielt. Vor dem Tisch nun saß Adler im Schlafrock, mit seinem Hauskäppchen geziert, und qualmte mit seiner langen Pfeife das Zimmer so voll, daß einem das Atmen schwer wurde. Die wenigen Unterrichtsstunden verteilten sich auf den Sonntag-Vormittag und Mittwoch-Nachmittag. Adler erzählte uns in einem nicht einwandfreien Deutsch aus der biblischen Geschichte, dann hatten wir die zehn Gebote und die Dreizehn Glaubensartikel zu lernen, auch ab und zu – soweit möglich – aus dem Gebetbuch zu lesen, und das war der gesamte Unterricht.100
Mit der Zeit führte die zunehmende behördliche Kontrolle und die genauere Regelung der vor dem Landrabbiner (bei Elementarlehrern in Anwesenheit eines Vertreters der Landdrostei) abzulegenden Prüfung seit Erlass der »Schulordnung für jüdische Schulen« vom 5. Februar 1854101 im Sinne der Emanzipationsbestrebungen zu einer Ausbildung, die auch die zuvor eher randständigen »Elementar-Gegenstände«102 einbezog. Dies gilt besonders für die Zeit nach 1861, als sich die hannoversche Regierung zu einer deutlichen Erhöhung ihrer Zuschüsse für die 1848 als private Lehranstalt unter staatlicher Aufsicht gegründete »Bildungs-Anstalt für jüdische Lehrer« in Hannover entschlossen hatte.103 1875 waren ca. 97 % der Lehrerstellen mit geprüften Lehrern besetzt, wobei knapp 15 % der zur Verfügung stehenden Stellen allerdings aus unterschiedlichen Gründen frei blieben.104 Einen großen Anteil an den Verbesserungen in Ausbildung und Unterricht hatten die jüdischen Lehrer selbst, die sich 1863 zum »Verein der jüdischen Lehrer im Königreich Hannover« (später: »Verein jüdischer Lehrer in der Provinz Hannover«) zusammenschlossen.105 1870 fand die in späteren Jahren überwiegend in Hannover abgehaltene Konferenz des Vereins in Wunstorf (Lehrer Löwenstein) statt.106 Auf späteren Konferenzen finden sich als Teilnehmer und Vortragende (V) die Wunstorfer Lehrer Ludwig Horwitz (1882 [V], 1884),107 Capell (1896/1898) 108 und Siegfried Weinberg (V, 1927). 109 Zweck des Vereins war nach den 1866 in Lehrte verabschiedeten Statuten (§ 2) neben der »Hebung der Schule und des Gottesdienstes« der Einsatz für eine Verbesserung der materiellen Situation der Lehrkräfte.110 Deren Unterstützung und der ihrer Hinterbliebenen hatte sich der 1864 gegründete Selbsthilfeverein »Achawa« (dt.: »Brüderlichkeit«) verschrieben, zu dessen Gründungsmitgliedern der damalige Wunstorfer Lehrer Theodor Philipp gehörte.111
Der Mohel
Der Mohel (Beschneider) war als solcher i. e. S. kein Amtsträger der Synagogengemeinde oder einer übergeordneten Institution.112 Gleichwohl kam ihm eine besondere Bedeutung zu, da die Beschneidung (mila) einen Ritus darstellt, der eng mit der jüdischen Identität verbunden ist.113 Sie ist Zeichen des Bundes (berit), den Gott der Tora zufolge mit Abraham schloss (Gen 17, 10–14).
Die herausragende Bedeutung des Gebotes (mizwa) der Beschneidung wird u. a. daran deutlich, dass sie sogar am Sabbat durchgeführt werden darf.114 Die zeitweiligen innerjüdischen Diskussionen um Notwendigkeit und Praxis der Beschneidung im 19. Jahrhundert führten letztlich zu Verbesserungen in Ausbildung und Kontrolle der Mohalim, nicht aber zu einem Verzicht auf den Ritus selbst.115
In einem »Handbuch für Synagoge, Schule und Haus« (1891) heißt es zu den Anforderungen:
Abgesehen von den chirurgischen Kenntnissen, die wir in erster Linie verlangen, muß der Mohel aber auch ein frommer Jehudi sein, dem auch die übrigen biblischen und talmudischen Gesetze heilig sind. Die Mila ist keine Operation, sondern eine heilige Handlung, gewissermaßen ein heiliges Opfer, ein Weihezeichen des Bundes zwischen Gott und Israel und nur der kann dieses eminent wichtige Gebot ausüben, der durch sein Leben zeigt, daß ihm auch die übrigen Gottesgebote, z. B. Speise- und Sabbathgesetze heilig sind.116
Unter den auf dem neuen jüdischen Friedhof in Wunstorf begrabenen Männern übten Moses Samuel Spanier (Nr. 3), der Großvater Meier Spaniers, sowie Michael Moses Goldschmidt (Nr. 51) dieses Amt aus. Der Auftrag zu einer Beschneidung war nach dem Zeugnis des niederländischen Rabbiners Simon Philip de VRIES eine Ehrung, die oft zu einer dauerhaften Freundschaft zwischen dem Mohel und der jeweiligen Familie führte.117 Für einen Junggesellen wie Michael Goldschmidt dürfte dies ein erfreulicher »Nebeneffekt« der Mizwa gewesen sein. Die Achtung, die man ihm entgegenbrachte, zeigen die Berichte zu seinem 50-jährigen Jubiläum.
Meier Spanier erinnert sich:
Übrigens übte er [d. h. Michael Goldschmidt; E. K.] wie mein Großvater, dessen Mohelbuch in meiner Hand ist, die Mizwa der Mila. Als er zum tausendsten Male diese religiöse Pflicht erfüllt hatte, gab ihm die Wunstorfer Gemeinde ein Festmahl. Beglückt von den vielen Ovationen, die man ihm brachte, erhob er sich von seinem Ehrensitze, und dankerfüllt rief er nur die Worte aus: »Gott sei Lob, ich habe nie eine Verblutung gehabt!« Er war damals schon über siebzig Jahre alt, und da seine Hand, besonders in der Erregung, stark zitterte, hätte er eigentlich die Mizwa schon etwas früher anderen überlassen sollen. Aber sein frommer Eifer war stark. (SPE, S. 27 f.; RICHARZ, S. 206 f.)
Und in der in Hannover erscheinenden jüdischen Wochenzeitung »Jeschurun« (19. Jg., 1886, Nr. 15/16, S. 241) berichtete ein Gemeindemitglied (möglicherweise Albert Mendel):
A. M. Wunstorf, 10. April. Eine Feier, wie sie wohl selten begangen wird, vereinigte am letzten Sonnabend unsere Gemeinde. Herr Michael Goldschmidt, einer [!] unserer achtbarsten und ältesten Gemeindemitglieder, hatte mit dem heutigen Tage fünfzig Jahre lang das heilige Amt eines Mohels versehen. Die Gemeinde hatte große Vorbereitungen getroffen, um dem 77 Jahre alten, alleinstehenden Manne, der sich besonderer Erdengüter nicht zu erfreuen hat, durch reiche Geschenke und Festlichkeiten diesen Tag zu einem recht freudigen zu gestalten. Am Freitag Nachmittag wurden ihm die Geschenke der Gemeinde, des Frauenvereins und der einzelnen Mitglieder vom Komitee überreicht. Die Freude über diese Aufmerksamkeit und Theilnahme benahmen dem Greise die Fähigkeit zum Sprechen. Am Sonnabendmorgen überbrachte ihm ein vom Lehrer Schoeps geleitetes Doppelquartett ein Ständchen. Durch einen für diesen Tag eingerichteten Chorgesang gewann auch der Gottesdienst an Feierlichkeit. Nach demselben fand in der Wohnung des Herrn Levy ein Festessen statt, zu welchem die ganze Gemeinde, Männer, Frauen und Kinder, erschienen waren.
Nachdem Herr Vorsteher Löwenstein dem Jubilar die freudige Mitteilung über Verleihung des [chawer]-Titels seitens des Landrabbiner [!] Herrn Dr. Gronemann gemacht hatte, hielt Herr Lehrer Schoeps eine längere Ansprache an den Jubilar, in der er ihm den Dank für seine Verdienste um das Judenthum in herzlichen Worten ausdrückte. Herr Lehrer Spanier aus Neustadt, der zur Feier hierher gekommen war, ließ den Jubilar in geistreicher Rede hochleben. Weitere Toaste folgten auf Herrn Landrabbiner Dr. Gronemann von Herrn Schoeps, auf die Damen, auf die vielen Gratulanten, die in Depeschen und Briefen ihre Glückwünsche mitgetheilt hatten. Besondere Freude machten dem Jubilar zwei Bilder, die Herr Photograph Ahron angefertigt und die ihn im Walten seines Amtes darstellen. Möge der wackere Herr noch lange unter uns walten!
Frauen und Männer
Ähnlich wie in den zeitgenössischen christlichen Gemeinden, war die aktive (Mit-)Gestaltung des Gottesdienstes sowie die Teilhabe an der Verwaltung der Synagogengemeinde Männern vorbehalten. Eine gottesdienstliche Handlung erforderte den Minjan, die Mindestanzahl von zehn religiös Mündigen. Voraussetzung war die Gebotspflichtigkeit mit Vollendung des 13. Lebensjahres, wenn ein Junge als bar mizwa (»Sohn des Gebotes«) das erste Mal in der Synagoge zur Toralesung aufgerufen wurde.
In der Synagoge herrschte Geschlechtertrennung. Eine »Frauenempore« (»Frauenschule«) im rückwärtigen Teil des Gebetshauses sollte verhindern, dass die Männer bei ihrem Gebet abgelenkt würden. Frauen waren zur Teilnahme am Gottesdienst grundsätzlich nicht verpflichtet, wenn sie dadurch ihre häuslichen Pflichten hätten hintanstellen müssen. Diese Pflichten hatten allerdings, besonders aufgrund der umfangreichen Reinheitsgebote, eine besondere Bedeutung für das religiöse Leben, so dass die Konstatierung einer Randstellung der jüdischen Frauen in der Gemeinde zu relativieren ist.118
Der Ehestand war sowohl für Männer als auch für Frauen die am meisten anerkannte Lebensform,119 wobei die arrangierte Ehe die Regel war.120 Das durchschnittliche Heiratsalter (im 19. Jh. auf dem Land bei Frauen 25–28 Jahre, bei Männern um die 30 Jahre) lag dabei geringfügig höher als im christlichen Umfeld.121 Die geschlechtsspezifische Unterscheidung in den religiösen Pflichten korrespondierte grundsätzlich mit den Rollen in der Familie. Allerdings arbeiteten in jüdischen Geschäften Frauen eher mit als in zeitgenössischen nichtjüdischen.122
Die auf dem Wunstorfer Friedhof bestatteten Männer waren zum überwiegenden Teil Händler und Kaufleute, wie angesichts der zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch herrschenden weitgehenden Erwerbsbeschränkungen und der üblichen Weitergabe des Geschäfts vom Vater auf einen Sohn nicht anders zu erwarten ist. Im Bereich Banken und Versicherungen arbeiteten nur Moses David Spanier (Nr. 37), Moses Ephraim Löwenberg (Nr. 40), und Abraham Levy (Nr. 70). Das Handwerk und produzierende Gewerbe beschränkte sich weitgehend auf die in älterer Zeit Juden gestattete Schlachterei und damit in Zusammenhang stehende Berufe wie Seifensieder, Kürschner und Lohgerber. Insofern fallen der Klempner Leser Spanier (Nr. 50), der Vater Meier Spaniers, und der Kupferschmied Gustav Lazarus (Nr. 86), der zudem noch eine Meisterprüfung abgelegt hatte, aus dem Rahmen. Letzterer hatte allerdings in seinem Vater, dem Gelbgießer Simon Lazarus (*ca. 1820), einen Vorläufer. Noch um 1860 waren die Voraussetzungen für jüdische Handwerksbetriebe in einer Kleinstadt wie Wunstorf schwierig. So führt Leser Spanier in einem Brief an Landrabbiner Dr. Meyer vom 15. April 1860 zur Begründung seiner finanziell prekären Lage u. a. an: »3) Gehört als Jude sehr viel dazu ein Handwerk auf dem Lande zu treiben, das heißt, wen[n] man seine Religion doch einigermaßen behaupten will […].«123
Unverheiratete Frauen wie Rebekka Spanier (Nr. 56) und wohl auch Marianne Rosenberg (Nr. 64) unterstützten nahe Verwandte bei der Haushaltsführung. Eine Ausnahme unter den in Wunstorf bestatteten ledigen Frauen ist die Putzmacherin Betty Meyermann (Nr. 55), die sich neben ihrer Erwerbstätigkeit noch um die Tochter ihres alkoholkranken Bruders Samuel (Nr. 61) kümmerte.
Während der 1825/6 gegründete Wunstorfer »Krankenpflege- und Gesetzstudium-Verein« (Chewrat bikkur cholim we Talmud-Tora), dem zuletzt nur noch drei Männer aus der Gemeinde Wunstorf und ein Großenheidorner angehört hatten, 1867 aufgelöst wurde,124 bestand der »Israelitische Frauenverein«, der 1849 als »Israelitischer Frauenwohltätigkeitsverein« gegründet worden war, mit zehn Mitgliedern noch 1935. So waren es in Meier Spaniers Erinnerung besonders die Frauen, die auf religiösem und sozialem Gebiet vorbildlich handelten:
Auch in meinem Heimatorte, wo die Männer doch so oft in hässlichem Streit miteinander lebten und törichter Parteikram die Gemüter unnötig verbitterte, waren es die Frauen, die gottesfürchtig und gütig, ein edles Vorbild des Religiösen gewährten. Jede von ihnen hatte ein gerüttelt Maß an Arbeit im Hause, aber sie hielten alle zusammen, sahen die schwierige Lage der andern mitfühlenden Herzens und halfen sich gegenseitig. (SPE, S. 39 f.; RICHARZ, S. 211)
Sprache
In dem Dorf Luthe, eine halbe Stunde von Wunstorf, lebte die Familie von Leib Löwenstein, »Leibche Luthe« genannt. Auch bei hellstem Wetter ging er mit einem Regenschirm bewaffnet. Fragte man ihn nach dem Grunde, antwortete er mit etwas sonderbarem Deutsch: »Ich beabsichtige Regen!«125 (SPANIER 1937, S. 198)
Aus Meier Spaniers Darstellung wird nicht klar, ob das »sonderbare Deutsch« lediglich diese Standardantwort kennzeichnete oder allgemein für Levy Löwenstein (geb. 1804), den ältesten Sohn Abraham Löwensteins (siehe Nr. 9), charakteristisch war. Für Letzteres spricht, dass er in der Wunstorfer Gemeinde mit dem Spitznamen »Leibche Luthe« bedacht wurde. Offenbar handelt es sich dabei zumindest um den Rest eines jüdischen »Jargons«, der nach Spanier z. B. auch von Michael Goldschmidt (geb. 1809; Nr. 51) verwendet wurde:
Seine Erzählungen, immer im unverfälschten Jargon, unterbrach er auch nicht, wenn Kunden in die Werkstätte meines Vaters kamen. Der Vater machte dann wohl ein ärgerliches Gesicht, aber dem ehrwürdigen, überdies sehr empfindlichen alten Mann, den er schätzte, sagte er natürlich kein mahnendes Wort. (SPE, S. 29; RICHARZ, S. 207)
Das von der jüdischen Bevölkerung im Alltag ursprünglich verwendete Jüdischdeutsch oder Westjiddisch126 schwand seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend, hielt sich auf dem Land in Resten allerdings länger als in der Stadt. Darüber hinaus blieb es Bestandteil des Fachjargons, etwa der jüdischen Viehhändler.127 Meier Spaniers Schilderungen zeigen einerseits, dass er die genannten Sprecher als Ausnahmen empfand, und andererseits, dass der Gebrauch des Westjiddischen bzw. eines jüdischen Soziolekts, der Reste davon bewahrte, zumindest im Kontakt zu Nichtjuden von Jüngeren wie Meier Spaniers Vater Leser (geb. 1822, Nr. 50) als unpassend empfunden wurde. Da im Kontakt mit der nichtjüdischen Bevölkerung im 19. Jahrhundert auf dem Land das Plattdeutsche noch die eigentliche Umgangssprache war und auch die westjiddischen Dialekte sich im Unterschied zu dem, was wir heute unter Jiddisch verstehen, also dem Ostjiddischen, stärker von dem Dialekt der jeweiligen Umgebung beeinflusst waren,128 kann man davon ausgehen, dass sich im Laufe des 19. Jahrhunderts die Sprache der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung, von einzelnen religiösen Begriffen wie oren (»beten«), benschen (»segnen«) oder kaschern (»[Kochgeschirr etc.] koscher [im religiösen Sinn ›rein‹] machen«) abgesehen, immer mehr anglich. Im Einzelfall mögen freilich bei Zugewanderten dialektale Unterschiede erhalten geblieben sein, die sich aber nur im Fall einer zugezogenen Gruppe länger gehalten haben dürften, wie dies Fritz Goldschmidt für die Jüdinnen und Juden in Stolzenau bezeugt, von denen die Älteren sich bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts eines »frankfurterischen« Dialekts bedient hätten.129 Zumindest bei den jüdisch-deutschen Frauennamen scheint die dialektale Färbung jedoch in traditionsbehafteten Kontexten länger erhalten geblieben zu sein.130
Der Wille, sich zunehmend des von der Schule geförderten Standarddeutschen zu bedienen, war bei Angehörigen der jüdischen Minderheit sicher höher als beim Rest der Bevölkerung, da sie von der Mehrheitsbevölkerung auch nach weitgehender Verdrängung des Westjiddischen häufig pauschal mit einer ihnen eigentümlichen Sprache in Verbindung gebracht wurden.131
Was sich länger hielt als Anklänge an das Westjiddische, war die »jüdische Schrift«, d. h. die Wiedergabe des Deutschen in hebräischer (Kursiv-)Schrift, die z. B. auch Leser Spanier oder Michael Goldschmidt zuweilen verwendeten,132 und die noch 1854 auf dem Lehrplan der jüdischen Religionsschule stand (siehe dazu unten im Abschnitt »Die Schule«).
Die Kenntnisse des im religiösen Bereich vorherrschenden Hebräischen dürften angesichts der problematischen Situation in der einklassigen jüdischen Religions- bzw. Volksschule im Durchschnitt nicht sehr hoch gewesen sein. Meier Spaniers (geb. 1864) Annahme, in seiner Jugend hätten die meisten (männlichen) Gemeindemitglieder trotz ihrer ansonsten nur geringen religiösen Kenntnisse zumindest »die fünf Bücher Moses mit etwas Raschi und das Gebetbuch« übersetzen können133, dürfte in dieser Verallgemeinerung zu einem nicht unbeträchtlichen Teil auf das Vertrauen des Kindes in die Fähigkeiten der Eltern und gleichaltriger Erwachsener zurückgehen. Man kannte aus dem Religionsunterricht sicher die wichtigsten Textstellen und Gebete, die einmal erworbenen Sprachkenntnisse dürften, von der reinen Lesefähigkeit abgesehen, im Alltag bei den meisten jedoch weitgehend verloren gegangen sein. Eine Ausnahme stellte sicher der schon oben erwähnte Michael Goldschmidt dar, von dem es bei Meier Spanier heißt:
Er hatte im Hebräischen wohl etwas mehr gelernt als die andern und gab oft Proben seines Wissens. Die Stelle ›kilohauch haschaur‹134 (Num 22,4) wollte er aus der Anschauung erklären, ›wie der Ochse frisst‹, nämlich die Zunge nach beiden Seiten streckend, was er zu unserer Freude uns auch vormachte. (SPE, S. 29, RICHARZ, S. 207)
Wie die in Meier Spaniers »Erinnerungen« zitierten hebräischen Textstellen belegen, verwendete man, wie auch anderenorts in mittel- und osteuropäischen Gemeinden, eine Variante der aschkenasischen Aussprache, die sich durch Akzent und Vokalisierung deutlich von der sefardischen unterscheidet, die seit Reuchlin der hebräischen Schulaussprache im christlichen Bereich und weitgehend der Aussprache des heute in Israel gesprochenen Modernhebräischen (Iwrit) zugrunde liegt.135 Dabei dürfte sich auch in Wunstorf die Aussprache je nach Vorbeter und Grad der Formalität etwas unterschieden haben, wie es Werner WEINBERG für seine westfälische Heimatstadt Rheda beschreibt.136
Synagoge und Gottesdienst
Die Synagoge, der »Juden-Tempel«, befand sich von ca. 1810 bis 1913 in Haus Nr. 200. 1828 erwarb die jüdische Gemeinde noch das angrenzende Haus Nr. 199 von dem zeitweiligen Gemeindevorsteher Kaufmann Samuel Moses (Spanier, s. zu Nr. 3 und 4). Beide Hausstellen lagen im Bereich der heutigen Nordstr. 14.137 Ab 1913 wurde in der neuen Synagoge, Küsterstr. 9, Gottesdienst gefeiert.
In beiden Synagogengebäuden befanden sich auch Lehrerwohnung und Schule, eine Konstellation, die in ländlichen Gemeinden des 18./19. Jahrhunderts die Regel war.138 Es war die geringe Finanzkraft der Gemeinden, die diese Multifunktionalität, vergleichbar der Verbindung von Lehrer-, Vorbeter- und Schächteramt im Personalbereich, notwendig machte. Die schlichte Fachwerkbauweise der alten Wunstorfer Synagoge, die sich häufig bei norddeutschen und hessischen Landsynagogen findet, hat ihren Grund ebenfalls in den ärmlichen Verhältnissen.139 Typisch war auch das sonstige äußere Erscheinungsbild, das sich kaum von dem eines Wohnhauses unterschied, was im Falle Wunstorfs weniger erstaunlich ist, da es sich bei beiden Synagogengebäuden tatsächlich um umgewidmete Wohnhäuser handelt.140 Das unauffällige Erscheinungsbild kann in diesem Fall daher nicht als Anzeichen für eine gewollte Abgrenzung von christlichen Kirchenbauten oder den Wunsch nach »Unsichtbarkeit« in einer tendenziell feindlichen Umgebung gewertet werden.141 Dies gilt auch für die rückwärtige Lage des eigentlichen Betraums bzw. eventuelle bauliche Ergänzungen, da diese aus Raumgründen kaum zur Straßenseite hin hätten erfolgen können.142
Über die Innenraumgestaltung der alten Synagoge gibt es nur wenige Anhaltspunkte in den archivalischen Quellen. Erwähnt wird 1858 die durch ein Geländer abgetrennte, also wohl etwas erhöht eingerichtete »Frauen-Schule«,143 eine Entsprechung zur Frauenempore der 1913 eingeweihten Synagoge in der Küsterstraße. Über deren Ausstattung gibt eine bei BURKHARDT (im Anhang) abgedruckte Skizze nähere Auskunft, die auf Karl-Heinz Heußmann, Großenheidorn, den 1922 geborenen Sohn der von ca. 1921 bis 1955 im Dachgeschoss des Hauses wohnenden (christlichen) Familie, zurückzugehen scheint.144 Danach war die Blickrichtung der Gottesdienstbesucher durch die Anordnung der Bänke nach Osten zum Toraschrein (Aron ha-kodesch) hin ausgerichtet. Dies ist die gängige Sitzordnung in aschkenasischen Synagogen und keineswegs Kennzeichen einer Reformsynagoge, wie die Autorinnen und Autoren der an der TU Braunschweig erstellten Studienarbeit zur Synagoge in der Küsterstraße annahmen.145 An der Westseite war die Frauenempore, die einen von der »Männersynagoge« getrennten Eingang hatte. Die Apsis zeigte auf blauem Grund – vermutlich weiße – Sterne. Der Toraschrein, zu dem zwei oder drei Stufen hinaufführten, bestand aus einem zweitürigen Holzschrank, der von einem roten Samtvorhang verdeckt wurde. In der Mitte des Synagogenraumes befand sich der Almemor (auch Almemar, bzw. Bema oder Bima/Kanzel für die Toralesung und das Vorbeten), über dem ein Kronleuchter hing. Der Skizze nach hing auf beiden Seiten des Toraschreins je eine Öllampe. Das »Ewige Licht« (Ner tamid), das sonst – als einzelne Lampe – meist146 vor dem Toraschrein hängt147, scheint sich hier also an dessen Seiten befunden zu haben. Vielleicht kann man dies auf Einflüsse aus Polen zurückführen, wo die Lampen allerdings eher in (gemauerten) Wandnischen angebracht wurden.148 Auf den Einfluss »polnischer Rebbes« auf die Wunstorfer Gemeinde und ihre Bräuche verweist Meier Spanier in seinen »Erinnerungen«.149 Insgesamt spricht die Raumgestaltung mit der strikten Trennung von Männer- und Frauenbereich und der zentralen Stellung des Almemors eher für eine orthodoxe bzw. konservative Ausrichtung150





























