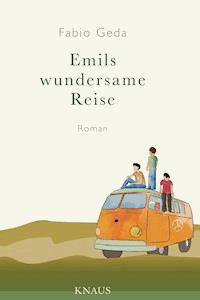9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die wahre Geschichte eines afghanischen Flüchtlingskindes, die uns den Glauben an das Gute zurückgibt
Als der 10-jährige Enaiat eines Morgens erwacht, ist er allein. Er hat nichts als die Erinnerungen an seine Familie und drei Versprechen, die er seiner Mutter noch am Abend zuvor gegeben hat. Auf der Suche nach einem besseren Leben begibt er sich auf eine jahrelange Odyssee durch viele Länder, immer Richtung Europa. Er reist auf Lastwagen, muss hart arbeiten, lernt das Leben von seiner grausamen Seite kennen. Und trotzdem bleibt er voller Zuversicht, denn er hat den unerschütterlichen Willen, das Glück zu finden ...
Die erweiterte Neuausgabe enthält ein exklusives Interview mit Fabio Geda und dem (inzwischen über 30jährigen) Enaiatollah Akbari, Hintergrundinformationen über die Erfolgsgeschichte des Buches sowie Anregungen für Diskussionen im Schulunterricht oder in Lesekreisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Autor
FABIO GEDA, 1972 in Turin geboren, arbeitete zunächst als Lehrer, bevor er begann, Romane zu schreiben. Bei einer Lesung lernte er den Afghanen Enaiatollah Akbari kennen, der ihm die Geschichte seiner Flucht erzählte. Ihr gemeinsames Buch Im Meer schwimmen Krokodile eroberte in Italien und dann weltweit die Bestsellerlisten und steht in vielen Ländern als Schullektüre auf dem Lehrplan.
Im Meer schwimmen Krokodile in der Presse:
»Ein Buch für alle, die wirklich etwas wissen wollen von den Schicksalen hinter dem Wort ›Flüchtlingsströme‹.« Stern
»Ein atemberaubendes Buch, tief und ungeheuer reich.« Die Welt
»Die Reise eines Jungen, den man niemals vergessen wird. Ein wunderbares Buch über die Würde und den Überlebenswillen des Menschen.« Vanity Fair
»Die wahre Geschichte des Enaiatollah Akbari – schlicht, eindringlich und durchaus poetisch.« WDR 5
»Hier sprechen nichts als die Fakten. Und doch kündet diese Geschichte – hochaktuell – von der unzerstörbaren Kraft der menschlichen Hoffnung auf ein besseres Morgen.« Deutschlandradio Kultur
»Ein poetischer, zu Herzen gehender Roman über den unbedingten Willen, glücklich zu sein – und sei es nur, weil man am Leben ist.« ttt – titel, thesen, temperamente
»Ein Roman voller Poesie, dennoch erzählt er nüchtern, ohne Larmoyanz – und genau deswegen trifft er mitten ins Herz.« Bayern 2
Außerdem von Fabio Geda lieferbar:
Emils wundersame ReiseDer Sommer am Ende des JahrhundertsVielleicht wird morgen alles besserBesuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Fabio Geda
Im Meer schwimmen Krokodile
Eine wahre Geschichte
Aus dem Italienischen von Christiane Burkhardt
Die italienische Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbaribei Baldini Castoldi Dalai, Mailand.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Baldini Castoldi Dalai editore, Mailand
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 by Albrecht Knaus Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: semper smile, München, nach einem Entwurf von buerosued, München
Umschlagmotiv: www.buerosued.de
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-05480-9V004www.penguin-verlag.de
»Sag nicht, die Chilischote ist klein.Probier lieber, wie scharf sie ist.«
Afghanistan
Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass sie wirklich weggeht.
Wenn man als Zehnjähriger abends einschläft, an einem ganz normalen Abend, der auch nicht dunkler, sternenklarer, stiller oder übel riechender ist als andere; an einem Abend, an dem dieselben Muezzin von den Minaretten zum Gebet rufen wie immer; wenn man als Zehnjähriger – und das ist nur so dahingesagt, weil ich gar nicht genau weiß, wann ich geboren bin, denn in der Provinz Ghazni gibt es kein Geburtenregister – also, wenn man als Zehnjähriger einschläft, und deine Mutter drückt deinen Kopf vor dem Schlafengehen länger an ihre Brust als sonst und sagt:
Drei Dinge darfst du nie im Leben tun, Enaiat jan, niemals, versprich es mir.
Erstens: Drogen nehmen. Manche duften und schmecken gut, und wenn sie dir vorgaukeln, mit ihnen ginge es dir besser als ohne, hör nicht auf sie, versprich es mir!
Versprochen.
Zweitens: Waffen benutzen. Auch wenn jemand dich oder deine Ehre beleidigt, versprich mir, dass deine Hand niemals zu einer Pistole, einem Messer, einem Stein, ja nicht einmal zu einem Holzlöffel greifen wird, wenn dieser Holzlöffel dazu dient, einen Menschen zu verletzen. Versprich es mir!
Versprochen.
Drittens: Stehlen. Was dir gehört, gehört dir. Was dir nicht gehört, nicht. Das Geld, das du zum Leben brauchst, wirst du dir erarbeiten, auch wenn es mühsam ist. Du wirst niemanden betrügen, Enaiat jan, versprochen? Du wirst allen gastfreundlich und großzügig begegnen. Versprich es mir!
Versprochen.
Also, auch wenn deine Mutter solche Sachen zu dir sagt, anschließend zum Fenster schaut und anfängt, von Träumen zu reden, und dich dabei ununterbrochen liebkost – wenn sie von Träumen spricht wie dem Mond, in dessen Schein man abends essen kann, und von Wünschen. Davon, dass man immer einen Wunsch vor Augen haben soll, wie ein Esel eine Karotte, und dass uns erst der Wille, unsere Wünsche wahr zu machen, die Kraft gibt, morgens aufzustehen, ja, dass es das Leben lebenswert macht, wenn man nur immer schön seinen Wunsch im Kopf behält. Also, auch wenn dir deine Mutter beim Einschlafen solche Dinge sagt, mit einer leisen, sonderbaren Stimme, die dir die Hände wärmt wie Kohlenglut, wenn sie also damit die Stille füllt, ausgerechnet sie, die stets nüchtern und wortkarg war – selbst dann fällt es dir schwer zu glauben, dass ihre Worte khoda negahdar bedeuten: Lebewohl.
Einfach so, aus heiterem Himmel.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, reckte und streckte ich mich und suchte rechts neben mir nach dem vertrauten Körper meiner Mutter. Nach dem beruhigenden Duft ihrer Haut, der für mich so etwas bedeutete wie: Los, wach auf, steh auf! Aber meine Hand griff ins Leere, und ich bekam nur das weiße Baumwolllaken zu fassen. Ich zog es an mich, drehte mich um und riss die Augen auf. Ich setzte mich auf und rief nach meiner Mutter. Aber weder sie noch sonst irgendjemand hat mir geantwortet. Sie war in dem Zimmer, in dem wir übernachtet hatten und das noch warm war von den sich im Dämmerlicht regenden Leibern. Sie war nicht an der Tür und nicht am Fenster, um auf die von Autos, Lastwagen und Fahrrädern befahrene Straße zu schauen. Sie war auch nicht bei den Wasserkrügen oder in der Raucherecke, um sich, wie sie es in den letzten drei Tagen gemacht hatte, mit jemandem zu unterhalten.
Von draußen drang der Lärm von Quetta herein, der sehr viel lauter ist als der in meinem kleinen Heimatdorf, einem Fleckchen Erde voller Häuser und Bäche in der Provinz Ghazni. Für mich ist das der schönste Ort der Welt, und das sage ich jetzt nicht nur, um damit anzugeben, sondern weil es wahr ist.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es die Größe der Stadt war, die diesen Lärm verursachte. Ich dachte, es handelte sich um ganz normale Nationalitätsunterschiede wie die Art, das Fleisch zu würzen. Ich dachte, der Lärm in Pakistan wäre anders als der in Afghanistan, und dass jedes Land seinen eigenen Lärm hat, der von allem Möglichen abhängt. Zum Beispiel davon, was die Leute essen und wie sie sich fortbewegen.
Mama!, rief ich. Mama!
Keine Reaktion. Also schob ich die Decke weg, zog meine Schuhe an, rieb mir die Augen und suchte nach dem Besitzer der Unterkunft, der hier das Sagen hatte, um ihn zu fragen, ob er meine Mutter gesehen hätte. Schließlich hatte er uns gleich nach unserer Ankunft vor drei Tagen mitgeteilt, dass niemand seine Herberge betrete oder verlasse, ohne dass er etwas davon mitbekomme. Darüber hatte ich mich gewundert, schließlich musste auch er hin und wieder schlafen.
Die Sonne teilte den Eingang zum Samavat Qgazi in zwei Hälften. In Pakistan heißen solche Herbergen auch Hotel, obwohl sie keinerlei Ähnlichkeit mit hiesigen Hotels haben. Das Samavat Qgazi war weniger ein Hotel als ein Aufbewahrungsort für Körper und Seelen. Ein Aufbewahrungsort, an dem man eng zusammengepfercht darauf wartet, zu Paketen verschnürt und in den Iran, nach Afghanistan oder sonst wohin verschickt zu werden. Ein Ort, an dem man Kontakt zu Schleppern aufnimmt.
Wir waren drei Tage im Samavat geblieben, ohne ihn ein einziges Mal zu verlassen: Während ich spielte, unterhielt sich meine Mutter mit anderen Müttern oder ganzen Familien, mit Leuten, denen sie zu trauen schien.
Ich weiß noch, dass meine Mutter in Quetta die Burka getragen hat. Bei uns zu Hause in Nawa trug sie sie nie, ich wusste nicht einmal, dass sie eine besaß. Als sie die Burka an der Grenze zum ersten Mal anzog und ich sie nach dem Grund dafür fragte, antwortete sie lachend: Es ist ein Spiel, Enaiat, kriech drunter!
Daraufhin hob sie einen Zipfel ihres Gewands, und ich tauchte unter den blauen Stoff, als spränge ich in ein Schwimmbecken. Ich hielt die Luft an, aber ohne zu schwimmen.
Wegen des grellen Lichts legte ich meine Hand schützend vor die Augen, näherte mich Onkel Rahim, dem Besitzer, und entschuldigte mich für die Störung. Ich fragte nach meiner Mutter, erkundigte mich, ob er sie hatte fortgehen sehen, schließlich kam hier niemand rein oder raus, ohne dass er es bemerkte.
Onkel Rahim las gerade Zeitung. Es war eine englische Zeitung mit roten und schwarzen Buchstaben, ganz ohne Bilder. Er rauchte eine Zigarette. Er hatte lange Wimpern und Wangen, die mit einem Flaum bedeckt waren wie manche Pfirsiche. Auf dem Tisch im Eingangsbereich stand ein Teller mit Aprikosen, drei prallen, orangefarbenen Früchten und einer Handvoll Maulbeeren. Meine Mutter hatte mir erzählt, dass es in Quetta jede Menge Früchte gibt. Auf diese Weise wollte sie mich dafür begeistern, denn ich liebe Früchte. Quetta heißt auf Paschtu »befestigtes Handelszentrum« oder so was Ähnliches. Es ist also ein Umschlagplatz, an dem mit Waren, Menschenleben und vielem mehr gehandelt wird. Quetta ist die Hauptstadt von Belutschistan, dem Obstgarten Pakistans.
Ohne aufzublicken, pustete Onkel Rahim den Rauch in Richtung Sonne und sagte: Ja, ich habe sie gesehen.
Ich war froh. Wo ist sie hingegangen, Onkel Rahim?
Fort.
Fort, wohin?
Fort.
Wann kommt sie wieder?
Sie kommt nicht wieder.
Sie kommt nicht wieder?
Nein.
Wie, sie kommt nicht wieder? Onkel Rahim, was soll das heißen, sie kommt nicht wieder?
Sie kommt nicht wieder.
Da war ich sprachlos. Vielleicht hätte ich noch andere Fragen stellen sollen, aber mir fielen keine ein. Ich schwieg und starrte den Flaum auf den Wangen des Samavat-Besitzers an, allerdings, ohne ihn wirklich wahrzunehmen.
Dann sagte er doch noch was. Sie lässt dir etwas ausrichten.
Was denn?
Khoda negahdar.
Sonst nichts?
Doch, noch etwas.
Was denn, Onkel Rahim?
Dass du die drei Dinge, die sie dir verboten hat, niemals tun darfst.
Ich werde meine Mutter Mama nennen, meinen Bruder Bruder und meine Schwester Schwester. Nur das Dorf, in dem wir wohnten, werde ich nicht Dorf nennen, sondern Nawa, ganz einfach, weil es so heißt. Sein Name bedeutet »Rinne«, weil es in einem Tal liegt, das von zwei Bergketten umgeben ist. Als Mama eines Abends, als ich vom Spielen auf den Feldern zurückkam, sagte, mach dich fertig, wir müssen los, und ich fragte, wohin, worauf sie antwortete, wir verlassen Afghanistan, dachte ich, dass wir einfach nur die Berge überqueren würden. Für mich war Afghanistan bloß dieses Tal mit den Bächen. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie groß es wirklich ist.
Wir nahmen einen Stoffbeutel, packten Kleider zum Wechseln und etwas zu essen ein: Brot und Datteln. Ich war völlig aus dem Häuschen wegen der bevorstehenden Reise. Am liebsten wäre ich zu den anderen gerannt und hätte ihnen alles erzählt, aber meine Mutter verbot es mir. Sie befahl mir, auf sie zu hören und keinen Lärm zu machen. Meine Tante, die Schwester meiner Mutter, kam vorbei, und sie unterhielten sich ein Stück weit von mir entfernt. Dann tauchte ein Mann auf, ein alter Freund meines Vaters, der nicht ins Haus kommen wollte. Er meinte, wir müssten los, der Mond sei noch nicht aufgegangen, und die Dunkelheit sei Sand in den Augen der Taliban.
Kommen mein Bruder und meine Schwester nicht mit, Mama?
Nein, sie bleiben bei der Tante.
Mein Bruder ist noch klein, er will nicht bei der Tante bleiben.
Deine Schwester wird sich um ihn kümmern. Sie ist beinahe vierzehn und schon eine richtige Frau.
Und wir, wann kommen wir zurück?
Bald.
Wann bald?
Bald.
Ich muss zum Buzul-bazi, zum Würfelturnier.
Hast du die Sterne gesehen, Enaiat?
Was haben die Sterne damit zu tun?
Zähle sie, Enaiat.
Das geht nicht, es sind zu viele.
Dann fang wenigstens damit an, sagte meine Mutter. Sonst wirst du niemals fertig.
Der Bezirk Jaghori, in dem wir lebten, ist nur von Hazara bevölkert, also von Afghanen wie uns. Wir haben mandelförmige Augen und eine platte Nase. Na ja, ganz platt ist sie auch nicht, nur ein bisschen platter als normal. Mit anderen Worten, wir haben mongolische Züge. Angeblich stammen wir von den Soldaten des Dschingis Khan ab. Andere behaupten, dass unsere Vorfahren Kuschanen waren. Das sind die Ureinwohner jener Gegend, die legendären Erbauer der Buddhastatuen von Bamiyan. Wieder andere behaupten, dass wir Sklaven sind und wie Sklaven behandelt werden müssen.
Für uns war es extrem gefährlich, diesen Bezirk oder die Provinz Ghazni zu verlassen (und ich benutze die Vergangenheitsform nur, weil ich nicht weiß, wie es heute ist, obwohl ich nicht glaube, dass sich die Lage groß geändert hat). Denn wenn man Taliban oder Paschtunen begegnete – die zwar nicht ein und dasselbe sind, aber beide nur Leid über unser Volk gebracht haben –, musste man äußerst vorsichtig sein. Deshalb brachen wir nachts auf: meine Mutter, ich und der Mann, den ich einfachheitshalber nur Mann nennen werde, und den meine Mutter gebeten hatte, uns zu begleiten. Wir marschierten los und gelangten im Schutz der Dunkelheit, aber bei Sternenlicht – das in einer Gegend ohne Elektrizität wirklich hell ist – in drei Nächten bis nach Kandahar.
Ich trug wie immer meinen grauen Pirhan, weite Baumwollhosen und eine lange, bis zu den Knien reichende Jacke aus demselben Material. Mama war im Tschador unterwegs, hatte aber eine Burka dabei, die sie anzog, sobald wir anderen Leuten begegneten – ein idealer Trick, um zu verbergen, dass sie eine Hazara war, und um mich zu verstecken.
Am ersten Tag ruhten wir uns bei Sonnenaufgang in einer Karawanserei aus, die, wie man an den vergitterten Fenstern sah, von den Taliban oder wem auch immer als Gefängnis genutzt wurde. Zum Glück war niemand da, aber ich langweilte mich, also zielte ich mit Steinen auf eine an einem Mast befestigte Glocke. Ich versuchte, sie aus einer Entfernung von hundert Schritt zu treffen. Schließlich gelang es mir, doch sofort kam der Mann auf mich zu gerannt, packte mich am Handgelenk und befahl mir, damit aufzuhören.
Am zweiten Tag sahen wir, wie ein Raubvogel über einem Esel kreiste. Der Esel war natürlich tot, seine Beine waren zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Für uns war er völlig wertlos, weil wir ihn nicht essen konnten. Ich weiß noch, dass wir ganz in der Nähe von Schajoi waren, für Hazara der gefährlichste Ort Afghanistans. Es hieß, die Taliban würden durchreisende Hazara gefangen nehmen, bei lebendigem Leib in tiefe Brunnen stoßen oder den wilden Hunden zum Fraß vorwerfen. Neunzehn Männer aus meinem Dorf waren auf dem Weg nach Pakistan verschwunden. Der Bruder eines dieser Männer war losgezogen, um nach ihnen zu suchen. Er war es auch, der uns das mit den wilden Hunden erzählt hatte. Von seinem Bruder fand er nur noch die Kleider und in den Kleidern seine Knochen.
So ist das bei uns.
Es gibt ein Sprichwort bei den Taliban: Den Tadschiken Tadschikistan, den Usbeken Usbekistan, den Hazara Goristan. Gor bedeutet Grab.
Am dritten Tag begegneten wir vielen Leuten, die wer weiß wohin unterwegs und wer weiß wovor auf der Flucht waren: Es war eine ganze Karawane aus Lastwagen voller Männer, Frauen, Kinder, Hühner, Stoffballen und Wasserkanister.
Wenn Lastwagen kamen, die in unsere Richtung fuhren, baten wir die Fahrer, uns ein Stück mitzunehmen, wenigstens ein kleines Stück. Waren sie nett, hielten sie an und ließen uns einsteigen. Waren sie dagegen wütend auf sich und die Welt, gaben sie Gas und fuhren weiter, wobei sie uns völlig einstaubten. Sobald wir Motorenlärm hinter uns hörten, versteckten Mama und ich uns so schnell wie möglich in einem Graben, zwischen Sträuchern oder hinter Felsen, falls es welche gab. Der Mann blieb am Straßenrand stehen und fuchtelte wild mit den Armen, damit er auch ja gesehen und nicht überfahren wurde. Wenn der Lastwagen hielt und alles in Ordnung war, stiegen Mama und ich vorne ein (was zweimal vorkam) oder hinten zu der Ware (was einmal vorkam). Als wir hinten einstiegen, war die Ladefläche voller Matratzen. Ich habe ausgezeichnet geschlafen.
Als wir den Fluss Arghandab überquerten und nach Kandahar kamen, hatte ich dreitausendvierhundert Sterne gezählt (eine stolze Zahl, wie ich finde). Davon waren mindestens zwanzig groß wie Pfirsichkerne, und ich war sehr müde. Aber nicht nur das: Ich hatte auch die von den Taliban gesprengten Brücken gezählt, die ausgebrannten Autos und die vom Militär zurückgelassenen verkohlten Panzer. Aber lieber wäre ich nach Nawa zurückgekehrt und hätte mit meinen Freunden Buzul-bazi gespielt.
In Kandahar hörte ich auf, die Sterne zu zählen. Und zwar deshalb, weil ich zum ersten Mal in einer so großen Stadt war und mich die Lichter der Häuser und Straßenlaternen viel zu sehr ablenkten. Ansonsten hätte ich mich aus Müdigkeit verzählt. Die Straßen von Kandahar waren asphaltiert. Es gab Autos, Motorräder, Fahrräder, Läden und viele Lokale, in denen man Chaitrinken und von Mann zu Mann reden konnte. Mehr als drei Stockwerke hohe Häuser mit Antennen auf den Dächern und überall Staub, Wind und Staub. Und so viele Leute auf den Gehsteigen, dass unmöglich noch irgendjemand zu Hause sein konnte.
Nachdem wir ein Stück gegangen waren, blieb der Mann stehen und befahl uns zu warten – er müsse etwas regeln. Er sagte uns weder, wo noch mit wem. Ich setzte mich auf eine Mauer und zählte die vorbeifahrenden Autos (die bunten), während Mama regungslos stehen blieb. Es roch nach Frittiertem. Aus einem Radio plärrten Nachrichten, es hieß, in Bamiyan gäbe es Schießereien, und in einem Haus hätte man zahlreiche Tote gefunden. Ein alter Mann hatte die Hände zum Himmel erhoben und flehte Gott um ein wenig Gnade an. Ich bekam Hunger, bat aber nicht um etwas zu essen. Ich bekam Durst, bat aber nicht um etwas zu trinken.
Der Mann kehrte mit einem Lächeln zurück, ein anderer Mann war bei ihm. Ihr habt Glück gehabt, sagte er. Das ist Shaukat, er bringt euch mit seinem Lastwagen nach Pakistan.
Meine Mutter sagte: Salaam, agha Shaukat. Danke.
Shaukat, der Pakistani, schwieg.
Und jetzt geht!, sagte der Mann. Bis bald.
Danke für alles, sagte meine Mutter.
Aber das habe ich doch gern getan.
Richte meiner Schwester aus, dass wir eine gute Reise hatten.
Wird gemacht. Viel Glück, kleiner Enaiat.
Er umarmte mich und küsste mich auf die Stirn. Ich lächelte ihn an, als wollte ich sagen, na klar, bis bald, mach’s gut. Dann fiel mir auf, dass viel Glück und bis bald nicht besonders gut zusammenpassen: Warum viel Glück, wenn wir uns ohnehin bald wiedersehen würden?
Der Mann verschwand. Shaukat, der Pakistani, bedeutete uns, ihm zu folgen. Der Lastwagen parkte in einem staubigen Innenhof, der von einem Metallzaun umgeben war. Auf der Ladefläche lagen zig Holzstämme. Als ich sie aus der Nähe betrachtete, sah ich, dass es Laternenmasten waren.
Warum transportierst du Laternenmasten?
Shaukat, der Pakistani, schwieg.
Was es damit auf sich hatte, habe ich erst später erfahren. Nämlich dass Leute wie Shaukat aus Pakistan kommen, um in Afghanistan alles zu stehlen, was nicht niet- und nagelfest ist, obwohl es dort ohnehin kaum etwas zu holen gibt. Laternenmasten zum Beispiel. Sie kommen mit ihren Lastern, fällen die Masten und bringen sie über die Grenze, um sie zu benutzen oder weiterzuverkaufen. Aber damals interessierte uns nur, dass wir eine gute Mitfahrgelegenheit hatten, ja eine ausgezeichnete sogar, da pakistanische Lastwagen an der Grenze seltener kontrolliert werden.
Es war eine lange Reise, wie lange, weiß ich nicht mehr. Wir fuhren stundenlang durch die Berge, über Stock und Stein, vorbei an Zelten, Märkten und Staubwolken. Als es bereits dunkel war, stieg Shaukat, der Pakistani, aus, um etwas zu essen. Aber nur er, denn für uns war es besser, im Wagen zu bleiben. Man kann nie wissen, meinte er. Er brachte uns Fleischreste mit, und danach fuhren wir weiter, während der Wind durchs Fenster pfiff. Das Fenster war zwei Fingerbreit heruntergekurbelt, um frische Luft hereinzulassen, aber so wenig Staub wie möglich. Als ich sah, wie diese unendliche Weite an uns vorüberzog, musste ich an meinen Vater denken: Auch er war lange Lastwagenfahrer gewesen.
Nur dass man ihn dazu gezwungen hatte.
Meinen Vater werde ich Vater nennen, obwohl er nicht mehr lebt. Weil er nicht mehr lebt. Und ich werde seine Geschichte erzählen, obwohl ich sie nur aus zweiter Hand kenne. Ich kann sie also nicht beschwören. Tatsache ist, dass die Paschtunen ihn – und nicht nur ihn, sondern auch viele andere Hazara aus unserer Provinz – gezwungen hatten, in den Iran zu fahren und dort Waren zu holen, die sie dann in ihren Geschäften verkauften: Besteck, Stoffe oder diese dünnen Schaumgummimatratzen. Und zwar deshalb, weil die Iraner wie wir Hazara Schiiten sind, während die Paschtunen Sunniten sind. Und unter Glaubensbrüdern handelt es sich bekanntlich besser. Außerdem sprechen die Paschtunen kein Persisch, während wir die Iraner ein bisschen verstehen können.
Um ihn zu erpressen, drohten sie meinem Vater: Wenn du nicht in den Iran fährst und dort Waren für uns einkaufst, bringen wir deine Familie um. Wenn du mit der Ware durchbrennst, bringen wir deine Familie um. Wenn du mit zu wenig oder mit beschädigter Ware zurückkommst, bringen wir deine Familie um. Wenn du dich übers Ohr hauen lässt, bringen wir deine Familie um. Mit anderen Worten: Sobald etwas schiefgeht, bringen wir deine Familie um.
Ich war ungefähr sechs Jahre alt, als mein Vater starb.
Vermutlich wurde er in den Bergen von Banditen überfallen und getötet. Als die Paschtunen erfuhren, dass der Lastwagen meines Vaters überfallen und die Ware geraubt worden war, gingen sie zu meiner Familie und verlangten Schadensersatz. Ihre Ware wäre verschwunden, weshalb wir jetzt dafür aufkommen müssten.
Zuerst gingen sie zu meinem Onkel, zum Bruder meines Vaters. Sie sagten, dass er jetzt die Verantwortung trage und etwas unternehmen müsse, um sie zu entschädigen. Mein Onkel versuchte eine Zeit lang, die Angelegenheit zu regeln. Er wollte Felder aufteilen oder verkaufen, allerdings ohne Erfolg. Eines Tages sagte er ihnen, dass er nicht wisse, wie er sie entschädigen solle. Außerdem gehe ihn das Ganze nichts an, er habe selbst eine Familie, die er ernähren müsse. Womit er im Grunde recht hatte, ich kann ihm da keinen Vorwurf machen.
Also sind die Paschtunen eines Abends zu meiner Mutter gekommen: Wenn wir kein Geld hätten, würden sie eben mich und meinen Bruder als Sklaven mitnehmen, drohten sie – etwas, das überall auf der Welt verboten ist, auch in Afghanistan, aber so war es nun mal. Seitdem hatte meine Mutter keine ruhige Minute mehr. Sie befahl mir und meinem Bruder, draußen zu spielen, uns unter die anderen Kinder zu mischen. Denn als die Paschtunen uns zu Hause aufgesucht hatten, waren wir beide gar nicht da gewesen, so dass sie uns nicht wiedererkennen konnten.
Daher spielten wir tagsüber immer draußen, was eigentlich kein Problem war. Die Paschtunen, denen wir im Dorf begegneten, liefen an uns vorbei, ohne uns zu erkennen. Für die Nacht hoben wir in der Nähe der Kartoffeln eine Grube aus, in der wir uns versteckten, wenn jemand klopfte, und zwar bevor meine Mutter die Tür aufmachte. Eine Strategie, die ich allerdings wenig überzeugend fand: Wenn die Paschtunen mitten in der Nacht kommen, um uns zu holen, sagte ich zu meiner Mutter, werden sie bestimmt nicht vorher anklopfen.
So sah unser Leben aus, bis meine Mutter beschloss, mich fortzuschicken. Ich war ungefähr zehn Jahre alt und damit zu groß, um mich noch länger verstecken zu können. In die Grube passte ich kaum noch, ja, ich drohte meinen Bruder regelrecht zu zerquetschen.
Ich sollte also fort.
Dabei wollte ich nie aus Nawa weg. Mein Dorf war wunderschön. Es gab keinen Strom. Um Licht zu machen, benutzten wir Petroleumlampen. Doch stattdessen gab es Äpfel. Ich konnte zusehen, wie das Obst wuchs: Die Blüten knospten vor meinen Augen und verwandelten sich in Früchte. Auch hier verwandeln sich Blüten in Früchte, aber man kann nicht dabei zusehen. Und dann die Sterne, jede Menge Sterne. Der Mond. Ich weiß noch, wie wir manchmal im Freien bei Mondschein aßen, um Petroleum zu sparen.
Unser Haus sah folgendermaßen aus: Es gab einen Gemeinschaftsraum, in dem wir auch schliefen, ein Gästezimmer und eine Ecke mit Feuer- und Kochstelle. Diese lag etwas tiefer, so dass das Feuer im Winter dank eines ausgeklügelten Leitungssystems den Fußboden heizte. Im ersten Stock befand sich noch ein Raum für Vieh und Vorräte. Draußen gab es eine zweite Küche, damit es im Sommer nicht noch heißer im Haus wurde als ohnehin schon. Und einen großen Innenhof mit Apfel-, Kirsch-, Granatapfel-, Pfirsich-, Aprikosen– und Maulbeerbäumen. Die Mauern waren mehr als einen Meter dick und aus Lehm. Wir aßen selbst gemachten Joghurt, eine Art griechischen Joghurt, nur besser. Wir besaßen eine Kuh, zwei Schafe und die Felder, auf denen wir Getreide anbauten. Das brachten wir dann zur Mühle, wo es zu Mehl gemahlen wurde.
Das war Nawa, und ich wollte nie von dort weg.
Nicht einmal, als die Taliban meine Schule schlossen.
Darf ich erzählen, wie die Taliban meine Schule geschlossen haben, Fabio?
Natürlich.
Interessiert dich das?
Mich interessiert alles, Enaiatollah.
Ich passte nicht besonders gut auf an jenem Morgen. Ich hörte dem Lehrer nur mit halbem Ohr zu und war mit meinen Gedanken beim Buzul-bazi-Turnier, das wir für den Nachmittag organisiert hatten. Buzul-bazi ist ein Spiel, das mit einem ausgekochten Schafsknochen gespielt wird. Der Knochen erinnert an einen Würfel, ist aber knubbeliger. Man spielt damit tatsächlich wie mit einem Würfel oder wie mit Murmeln. Bei uns wird ständig Buzul-bazi gespielt, zu jeder Jahreszeit, während wir im Frühling oder im Herbst eher Drachen bauen und im Winter Verstecken spielen. Wenn man sich eng aneinandergeschmiegt zwischen Getreidesäcken, einem Stapel Decken oder hinter einem Felsen versteckt, ist das bei der winterlichen Kälte durchaus angenehm.
Der Lehrer erklärte die Zahlen und brachte uns gerade das Rechnen bei, als wir hörten, wie ein Motorrad die Schule umkreiste, so als suchte es den Eingang, obwohl der nicht schwer zu finden war. Der Motor wurde ausgestellt. Ein riesiger Mann erschien auf der Schwelle, mit einem langen Bart, wie ihn die Taliban haben. Wir Hazara könnten den Bart nie so tragen, weil wir eher an Chinesen oder Japaner erinnern und kaum Bartwuchs haben. Einmal hat mich ein Taliban geohrfeigt, angeblich weil ich keinen Bart trug. Aber ich war doch noch ein Kind!
Der Taliban kam mit einem Gewehr ins Klassenzimmer und verkündete mit lauter Stimme, dass die Schule geschlossen würde. Der Lehrer wollte wissen, warum. Daraufhin sagte der Taliban: Das ist uns so befohlen worden, und ihr müsst gehorchen. Anschließend verschwand er, ohne auch nur eine Antwort abzuwarten.
Der Lehrer schwieg. Er war wie erstarrt, wartete, bis das Motorengeräusch verklungen war und machte dann mit dem Mathematikunterricht weiter. Mit derselben ruhigen Stimme wie vorher und mit seinem schüchternen Lächeln. Mein Lehrer war nämlich ein wenig schüchtern. Er wurde niemals laut, und wenn er doch einmal schrie, tat es ihm fast mehr leid als uns.
Am Tag darauf kehrte der Taliban zurück. Es war derselbe, mit demselben Motorrad. Er sah, dass wir im Klassenzimmer waren und dass uns der Lehrer unterrichtete. Er kam herein und fragte den Lehrer: Warum habt ihr die Schule nicht geschlossen?
Weil es keinen Grund dafür gibt.
Der Grund heißt Mullah Omar.
Das ist kein ausreichender Grund.
Du versündigst dich. Mullah Omar hat befohlen, die Schule zu schließen.
Und wo sollen unsere Kinder dann zur Schule gehen?
Sie werden gar nicht zur Schule gehen. Die Schule ist nichts für Hazara.
Aber diese Schule schon.
Diese Schule verstößt gegen den Willen Gottes.
Diese Schule verstößt gegen euren Willen.
Ihr unterrichtet Dinge, die Gott nicht genehm sind. Lügen. Dinge, die dem Wort Gottes widersprechen.
Wir bringen den Kindern bei, gute Menschen zu sein.
Was sind gute Menschen?
Setzen wir uns doch hin und reden!
Das bringt nichts. Ich verrate es dir: Ein guter Mensch ist, wer Gott dient. Wir wissen, was Gott von den Menschen verlangt und wie wir ihm dienen müssen. Ihr nicht.
Wir lehren hier auch Demut.
Der Taliban lief durch unsere Reihen, so schwer atmend wie ich, als ich mir einmal einen Kiesel in die Nase gesteckt hatte und ihn nicht mehr herausbekam. Dann verschwand er ohne ein weiteres Wort und stieg wieder auf sein Motorrad.
Der dritte Vormittag danach war ein schöner Herbsttag, einer, an dem die Sonne noch so wärmt, dass der erste Schnee die Luft nicht abkühlt, sondern nur mit Schneeduft anreichert: der ideale Tag zum Drachensteigenlassen. Wir lernten gerade ein Gedicht auswendig, um uns auf den Poesiewettbewerb vorzubereiten, als zwei Jeeps mit Taliban vorfuhren. Wir rannten zu den Fenstern, um sie zu bestaunen. Alle Kinder der Schule schauten hinaus, obwohl sie Angst hatten. Etwa zwanzig oder dreißig Taliban sprangen von den Jeeps. Der Mann, den wir schon kannten, betrat das Klassenzimmer und sagte zum Lehrer: Wir haben dir befohlen, die Schule zu schließen. Du hast nicht auf uns gehört. Jetzt werden wir dir eine Lektion erteilen.