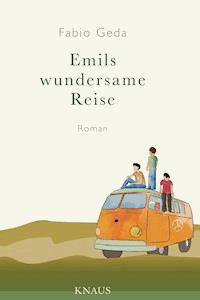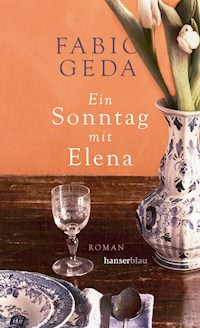10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Offen, berührend, wahrhaftig: Wie es dem afghanischen Flüchtling Enaiatollah Akbari gelungen ist, in Europa eine neue Heimat zu finden
Als der Afghane Enaiatollah Akbari nach jahrelanger Flucht ganz allein Europa erreichte, war er fünfzehn Jahre alt. Aus eigener Kraft musste er sich eine neue Existenz aufbauen. Er lernte eine neue Sprache, machte seinen Schulabschluss, studierte Politikwissenschaft. Zusammen mit dem Schriftsteller Fabio Geda erzählt er jetzt, wie es ihm gelungen ist, in Europa eine neue Heimat zu finden. Und warum er dafür vorher zu seinen Wurzeln zurückkehren und seine afghanische Familie wiedersehen musste.
Geda und Akbari führen die Geschichte des weltweiten Bestsellers »Im Meer schwimmen Krokodile« eindrucksvoll fort– wahrhaftig, spannend und voller Charme.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kann die Fremde zur Heimat werden?
Als der Afghane Enaiatollah Akbari nach jahrelanger Flucht Europa erreichte, ohne Eltern, ohne Schulbildung, war er fünfzehn Jahre alt. Aus eigener Kraft musste er sich eine neue Existenz aufbauen. Dann lernte er den Schriftsteller Fabio Geda kennen, und sein Leben nahm eine Wendung. Zusammen erzählen die beiden, wie es Enaiatollah trotz unüberwindlich scheinender Hürden gelang, den Schulabschluss zu machen und Politikwissenschaft zu studieren. Wie ihm die fremde Kultur immer vertrauter wurde, er Freundschaften schloss und sich trotzdem täglich nach seiner Mutter und der Familie in Afghanistan sehnte. Eines Tages werden Heimweh und Sorge um sie so groß, dass er aufbricht, um nach Jahren seine Familie endlich wiederzusehen …
Geda und Akbari erzählen die Geschichte des weltweiten Bestsellers »Im Meer schwimmen Krokodile« eindrucksvoll weiter – wahrhaftig, spannend und voller Charme. Ein wichtiges, berührendes Buch über die Frage nach Identität, Zugehörigkeit und Heimat.
Enaiatollah Akbari weiß nicht genau, wann er geboren ist, daher haben die italienischen Behörden sein Geburtsdatum auf den 1.9.1989 festgelegt. Mit zehn Jahren begann seine Flucht. In Italien angekommen, wohnte er zunächst bei einer Gastfamilie, lernte Italienisch, studierte später Politikwissenschaft. Nach dem weltweiten Erfolg von Fabio Gedas Buch »Im Meer schwimmen Krokodile«, in dem er die Geschichte von Enaiatollahs Flucht erzählt, beschlossen beide, gemeinsam eine Fortsetzung zu schreiben.
Fabio Geda, 1972 in Turin geboren, arbeitete lange als Lehrer, bevor er sich dem Schreiben widmete. Das Buch »Im Meer schwimmen Krokodile«, in dem er die Flucht von Enaiatollah Akbari beschreibt, brachte ihm international den Durchbruch und ist zu einem modernen Klassiker geworden. In Im Winter Schnee, nachts Sterne erzählen Akbari und Geda, wie Enaiatollahs Leben nach seiner Ankunft in Europa weiterging.
»Eine faszinierende Geschichte, die exemplarisch zeigt, wie es sich anfühlt, zwischen zwei Kulturen zu leben; und eine Geschichte davon, wie wichtig eine Reise in die Vergangenheit ist, um für die Zukunft gewappnet zu sein.« La Stampa
»Hier sprechen nichts als die Fakten. Und doch kündet diese Geschichte – hochaktuell – von der unzerstörbaren Kraft der menschlichen Hoffnung auf ein besseres Morgen.« Deutschlandradio Kultur »Radiofeuilleton/Kritik« (über Im Meer schwimmen Krokodile)
»Die wahre Geschichte des Enaiatollah Akbari – schlicht, eindringlich und durchaus poetisch.« WDR 5 (über Im Meer schwimmen Krokodile)
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook
Fabio Geda
Enaiatollah Akbari
Im Winter Schnee,
nachts Sterne
Geschichte einer Heimkehr
Aus dem Italienischen
von Christiane Burkhardt
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Storia di un Figlio. Andata e ritorno bei Baldini + Castoldi, Mailand.
Die Übersetzung dieses Buches wurde vom italienischen Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit gefördert.
Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo alla traduzione assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2020 First published in Italy by Baldini + Castoldi
This edition published in arrangement with Grandi & Associati
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
C. Bertelsmann in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Claudia Franz
Karten: © Peter Palm
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagabbildung: www.buerosued.de
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-27549-5V002
www.cbertelsmann.de
Der einzige Wunsch, den ich für unser Volk habe, ist der, dass es kein Verbrechen mehr ist, den Hazara anzugehören.
Abdul Ali Mazari
0
Die Geschichte ist folgende (und einige dürften sie bereits kennen): Ich heiße Enaiatollah Akbari, aber alle nennen mich Enaiat. Ich kam in Afghanistan zur Welt, im Hazarajat, einer sehr unwegsamen, felsigen Bergregion westlich von Kabul, übersät von Weideflächen und mit dem klarsten Himmel, den man sich nur vorstellen kann. Im Winter Schnee, nachts Sterne – so unendlich viele, dass man sich regelrecht die Taschen damit füllen kann. Der Hazarajat ist die Heimat meines Volksstamms der Hazara, eine Region, die ungefähr halb so groß ist wie Italien, nur dass dort weniger als zehn Millionen Menschen leben.
Schaue ich in Turin, wo ich heute wohne, Richtung Alpen (vor allem gegen Ende des Winters, wenn es noch letzte Schneereste über den gefrorenen Wäldern gibt), spüre ich manchmal eine Art Sehnsucht, die mich im Nacken kitzelt. Dann bin ich auf einmal wieder bei den wärmenden, glimmenden Kohlen in unserem Haus in Nawa, beim Geschrei der Freunde, die sich draußen auf der Straße treffen, um Buzul-bazi zu spielen, eine Art Würfelspiel, bei den Düften der Speisen meiner Mutter und vor allem bei ihrer Stimme, die ruft: »Enaiat, Enaiat Jan, ich brauche deine Hilfe, wir müssen Wasser holen. Enaiat, wo steckst du bloß?
Als ich zehn Jahre alt war, beschloss meine Mutter, dass ihr angesichts meiner schwierigen Lage nichts anderes übrig blieb, als mich nach Quetta in Pakistan zu bringen und dort zurückzulassen, damit ich mich den Scharen von Straßenkindern anschließe. Anfangs habe ich das nicht verstanden, später schon: Für sie war es besser, mich in Gefahr, aber eben auch unterwegs in eine andere Zukunft zu wissen, als mich bei sich zu behalten, im Klammergriff ständiger Angst. Lieber übergab sie mich einem lärmenden Haufen von Halbwaisen, die dank der Großzügigkeit einiger Bazarhändler überlebten, als mich in unserer Heimat einem reichen Geschäftsmann auszuliefern, einem Verbündeten der Taliban, um die angeblichen Schulden meines Vaters zu begleichen.
Ich weiß noch gut, wie alles anfing. So klein ich noch war, merkte ich doch, dass etwas nicht stimmte: Der Gestank der Angst hatte sich in unserem Haus breitgemacht wie der eines auf dem Feuer vergessenen Korma Palau. Eines Morgens hatte dieser Mann, der, wie gesagt, mit den Taliban gemeinsame Sache machte, auf meinen Vater gezeigt, ihn herbeigewinkt und ihm befohlen, mit einem Laster in den Iran zu fahren, um gewisse Waren zu besorgen, die er dann in seinen Läden verkaufen wollte: Decken, Stoffe und dünne Schaumgummimatratzen. Um ihn dazu zu zwingen, sagte er: »Wenn du nicht in den Iran fährst und Waren für uns einkaufst, bringen wir deine Familie um. Wenn du mit zu wenig oder beschädigter Ware zurückkommst, bringen wir deine Familie um. Wenn du dich übers Ohr hauen lässt, bringen wir deine Familie um.« Mit anderen Worten: Sobald etwas schiefgeht, bringen wir deine Familie um. Nicht gerade eine sympathische Art, Geschäfte zu machen, wie ich gar nicht oft genug betonen kann.
Als mein Vater Monate später einen Gebirgspass passierte, wurde er mit seinem Laster von Banditen überfallen. Die Nachricht von seinem Tod erreichte uns abends bei Einbruch der Dunkelheit, und trotz unserer Bemühungen, sie nicht hereinzulassen – nein, das stimmt nicht, das kann einfach nicht sein! –, gelangte sie irgendwann doch ins Haus, um zu bleiben und die Nacht bei uns zu verbringen. Am nächsten Morgen war sie immer noch da. Und nicht nur sie, sondern auch der reiche Geschäftsmann. Kaum hatte er von der Sache erfahren, stand er bei meiner Mutter vor der Tür. Aber nicht um ihr sein Beileid auszusprechen oder ihr zu sagen, dass es ihm leidtue, ob er irgendwie helfen könne. Sondern um ihr mitzuteilen, dass er durch den Tod meines Vaters wirtschaftliche Einbußen erleide und dass es seine Schuld sei, wenn die Ware jetzt fehle, weil mein Vater nicht in der Lage gewesen sei, sie zu beschützen, und jetzt verlange er Schadenersatz.
Sollte sie das Geld nicht zusammenbringen, sei das kein Problem, dann würde er eben mich nehmen.
In Pakistan lebte ich etwas über ein Jahr, dann im Iran (ungefähr zweieinhalb Jahre), anschließend in der Türkei und in Griechenland. Um irgendwann nach Italien zu gelangen. Das war 2004, genauer gesagt im September desselben Jahres. Und weil ich nicht nur keine gültigen Papiere besaß, sondern überhaupt nie welche besessen habe, keinen einzigen Ausweis, ja, weil ich nicht einmal mein genaues Geburtsdatum kannte, beschloss man auf dem italienischen Einwohnermeldeamt, dass ich für den Rest meines Lebens am Ersten dieses Monats, also am ersten September, Geburtstag feiern werde – nur für den Fall, dass mich jemand beglückwünschen will.
Vier Jahre nachdem ich nach Italien gekommen war, wo ich irgendwann einen Ort fand, den ich als mein Zuhause bezeichnen konnte, und wo sich, während ich noch mit meinen inneren Dämonen kämpfte, immer mehr Möglichkeiten ergaben, ging mir auf, dass ich vielleicht endlich damit aufhören sollte, nur ans Überleben zu denken. Stattdessen trat die Frage in den Vordergrund, ob ich vielleicht meine Familie wiederfinden könnte: meine Mutter, meinen Bruder, meine Schwester und gewisse Onkel, die mir nahestanden. Ich wollte wissen, was aus ihnen geworden war. Lange hatte ich sie mehr oder weniger verdrängt, weil das eine gute Methode ist, sich nicht unnötig zu quälen – nicht aus Bosheit natürlich, sondern weil man einen Weg finden muss, mit sich selbst ins Reine zu kommen, bevor man sich um andere kümmern kann.
Als mir dann mithilfe derjenigen, die mich bei sich aufgenommen hatten, klar wurde, dass ich tatsächlich etwas aus meinem Leben machen kann, vielleicht sogar etwas Sinnvolles, kamen bestimmte Gedanken ganz automatisch, ohne dass ich dafür lange in meinem Gedächtnis hätte kramen müssen. Meine Mutter und meine Geschwister – waren sie nach sieben Jahren Krieg noch am Leben? Seit diesem Herbst 2001, als nach den Terroranschlägen des 11. September der Konflikt ausbrach, war das Leben in Afghanistan einfach nur noch die Hölle. Nicht, dass es bis dahin leicht gewesen wäre, schon gar nicht für uns Hazara, aber ab 2001 wurde alles noch einmal deutlich schwieriger: Inzwischen sorgten nicht mehr nur fundamentalistische Gruppierungen für Tausende von Toten, sondern auch die Bombardierungen durch die NATO-Koalition, die die afghanische Regierung gegen die Taliban und gegen al-Qaida unterstützte. Wie war es meinen Angehörigen in der ganzen Zeit ergangen? Waren sie verwundet worden? Waren sie noch zusammen, oder hatten sie sich getrennt? Waren sie geflohen? Und wenn ja, wohin?
Für sie war es ausgeschlossen, Kontakt zu mir aufzunehmen, weil sie a) nicht die leiseste Ahnung hatten, wo ich gelandet war und b) über keinerlei Mittel und Wege verfügten, das herauszufinden. Ich dagegen hatte schon die eine oder andere Möglichkeit, etwas über ihren Verbleib in Erfahrung zu bringen, und so beschloss ich, aktiv zu werden.
Eines Tages rief ich einen meiner afghanischen Freunde in Qom an – einer Stadt im Iran, in der ich auf meiner langen Reise gearbeitet hatte. Sein Vater lebte in Pakistan, in Quetta, und ich fragte ihn, ob sich einer seiner männlichen Verwandten vielleicht aufmachen könne, um in Afghanistan nach meiner Familie zu suchen.
»Wenn dein Vater meine Mutter, meinen Bruder und meine Schwester ausfindig machen könnte, bezahle ich ihm das natürlich und gebe ihm genug Geld, damit er alle nach Quetta holen kann.« Vor lauter Begeisterung wartete ich seine Antwort gar nicht erst ab, sondern sprudelte wild drauflos: wo sie wohnten und so, vorausgesetzt sie waren überhaupt noch in Nawa oder zumindest im Hazarajat.
Mein Freund, ein netter Kerl, mit dem ich nach der Fabrikarbeit oft Fußball gespielt hatte, ließ mich reden (ich war total aufgeregt und bekam kaum noch Luft). Als ich endlich geendet hatte, meinte er, er könne diese Informationsflut gar nicht verarbeiten, geschweige denn weitergeben: »Wie wär’s, wenn ich dir die Telefonnummer von meinem Vater gebe, und du rufst ihn in Pakistan an und sprichst selbst mit ihm?«
Gesagt, getan. Ich rief ihn an. Sein Vater – den ich von nun an Onkel Asan nennen werde – war wahnsinnig nett. Zunächst einmal meinte er, wegen des Geldes solle ich mir keine Gedanken machen. Sollte meine Mutter – die genauso wenig wisse, ob ich noch am Leben sei, wie ich das von ihr wisse – tatsächlich noch im Hazarajat sein, betrachte er es als seine Pflicht, sie dort ausfindig zu machen.
Ich sagte, dass ich ihn für die Reise und seine Mühen trotzdem bezahlen werde. Dass er es als seine Pflicht betrachte, sei ja gut und schön, aber Geld sei schließlich auch wichtig. Außerdem sei es eine gefährliche Reise in ein Kriegsgebiet.
Ich wartete geduldig. Es verging einige Zeit, und ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, als ich eines Abends einen Anruf bekam. Onkel Asan war dran. Er begrüßte mich und erzählte, dass es alles andere als einfach gewesen sei, meine Angehörigen ausfindig zu machen, weil sie Nawa verlassen hätten und innerhalb des Hazarajat umgezogen seien, aber schließlich sei es ihm doch gelungen. Als er meiner Mutter erzählt habe, dass der Vorschlag, nach Quetta zu gehen, von mir stamme, habe sie es kaum glauben können. Mein Bruder genauso wenig. Sie hätten sich geweigert mitzukommen, und er habe sie nur mit Müh und Not überzeugen können. Dann sagte er: »Warte!« Er wollte jemanden ans Telefon holen. Meine Augen füllten sich mit Tränen, weil ich schon ahnte, wer das sein würde.
»Mama«, sagte ich.
Am anderen Ende war es still.
»Mama«, wiederholte ich.
Aus dem Hörer kam nur ein Seufzer, aber ein erleichterter, tränennasser Seufzer. Da begriff ich, dass sie ebenfalls weinte. Nach acht – acht! – Jahren sprachen wir das erste Mal wieder miteinander, und diese tränennassen Seufzer waren alles, was sich Mutter und Sohn nach so langer Zeit sagen konnten. Wir schwiegen, bis die Verbindung unterbrochen wurde. Damals erfuhr ich, dass sie noch am Leben war, und begriff vielleicht zum ersten Mal, dass auch ich noch am Leben war.
1
Obwohl wir seit acht Jahren nicht mehr miteinander gesprochen hatten, und obwohl meine Stimme inzwischen eine ganz andere war, erkannte mich meine Mutter sofort. Ich selbst konnte mich an ihre Stimme nicht mehr erinnern. Anfangs hatte ich oft noch versucht, sie heraufzubeschwören, jedoch erfolglos, was sehr schmerzlich für mich war. Die Stimmen verschwanden als Erstes, noch vor den Gesichtern und anderen Details. Doch kaum hatte ich sie gehört – und es war zweifellos ihre –, war mir, als könnte ich nach ewigem Luftanhalten endlich wieder frei durchatmen. Ein Zittern durchlief meine Wirbelsäule und explodierte in meinem Kopf.
Wie bereits gesagt, tauschten wir bei diesem ersten Gespräch nur Seufzer aus, bis die Verbindung unterbrochen wurde. Dann rief der Mann noch einmal an und gab mir erneut meine Mutter. Trotzdem waren wir viel zu mitgenommen, um wirklich reden zu können, und brachten nur ein paar gestammelte Worte heraus. Am nächsten Tag, gleich nach der Schule, auf der ich meinen Hauptschulabschluss machte, um dann einen sozialen Beruf zu erlernen, eilte ich in ein Callcenter an der Porta Palazzo ganz in der Nähe und rief sie erneut an.
Ein Mann ging dran, aber nicht Onkel Asan. Ich erklärte, wer ich war, und kurz darauf hatte ich sie wieder am Telefon, ihre Stimme, Sauerstoff pur, der mir im Kopf kribbelte. Da rissen wir uns beide zusammen, um uns nicht weiterhin über siebentausend Kilometer Entfernung hinweg eine Art Schneeballschlacht der Gefühle zu liefern. Und begannen richtig zu reden, Sachen, die einen Sinn ergaben. Zumindest versuchten wir es, und mit der Zeit klappte es tatsächlich immer besser. Ich weiß noch, dass das Gespräch achtundsechzig Cent die Minute kostete. Die Verbindung wurde ständig unterbrochen, sodass ich, wenn ich die Nummer noch einmal wählte, immer wieder Münzen nachwerfen musste. Unter normalen Umständen hätte mich das rasend gemacht, da ich wirklich kein Geld zu verschenken hatte – aber ich war so froh, mit ihr sprechen zu können, dass ich jede Summe gezahlt hätte.
Wie man sich denken kann, hatten wir uns so einiges zu erzählen. Auf beiden Seiten hatte es waghalsige Abenteuer gegeben, über die wir weinen, lachen, erschrecken, erleichtert aufseufzen oder sonst was hätten tun können. Stattdessen taten wir nichts dergleichen. Es war unglaublich, aber ohne darüber zu reden, ohne uns abzustimmen, sprachen wir beide über Nebensächlichkeiten – über meinen und ihren Alltag, also über die Gegenwart, nicht die Vergangenheit.
Mit das Erste, was sie mich fragte, war, ob ich auch genug esse. Man muss sich das mal vorstellen: ob ich auch genug esse! Das, was jede x-beliebige Mutter ihren Sohn fragen würde, der gerade wegen eines Schulausflugs oder eines Ferienkurses von zu Hause fort ist. Ich erwiderte, dass ich jede Menge esse, da könne sie ganz beruhigt sein – und dass ich dafür offen gestanden keinen besseren Ort hätte finden können. »Ich bin in Italien, Mama«, sagte ich. »Und ob ich genug esse!«
Wir sprachen über die Familie, die mich aufgenommen hatte, von ihrem Haus, von der Schule. Wie sehr sich meine Mutter freute, als sie hörte, dass ich wieder zur Schule ging! Sie war überglücklich. Ich wiederum wollte alles über meine Geschwister wissen. Es ging ihnen gut, sie waren die ganze Zeit über zusammengeblieben, und meine Schwester hatte geheiratet. Geheiratet? Sie hatte eine Tochter. Eine Tochter? Ich konnte es kaum glauben. Wir redeten hier von dem Mädchen, das mir das Gesicht abgewischt hatte, wenn ich weinte, und das mir Salbe aufgetragen hatte, wenn ich meinen Klassenkameraden nicht schnell genug hinterherkam und am Flussufer stürzte. Ein Mädchen, das inzwischen allerdings Anfang zwanzig Jahre alt sein dürfte, und in unserer Kultur war es ganz normal, dass sie da Mann und Kinder hatte.
Ich erkundigte mich nach Verwandten und Freunden, die mir wichtig waren. Einige waren gestorben, andere zum Fortgehen gezwungen worden. Wieder andere befanden sich immer noch in Flüchtlingslagern, in denen sie wer weiß wie lange bleiben würden. Von vielen wusste sie nichts mehr. Nur wenige hatten in ihren Häusern bleiben können. Manche waren zurückgekehrt und hatten erneut fortgehen müssen. Im Hazarajat, meiner wunderbaren Heimat, war das Leid nach wie vor allgegenwärtig, in der Luft, die man atmete, in den Straßen voller Schlaglöcher, in den wie Spielzeug aussehenden Landminen, zwischen den Zweigen der Pflaumenbäume und im Opiumrauch. Meine Mutter meinte, ich könne mich glücklich schätzen, überglücklich, da ich so etwas wie einen Geheimtunnel ans andere Ende der Welt gefunden habe. Eine magische Tür. Wie diese Türen, die Mohsin Hamid in Exit West beschreibt, einem ganz wunderbaren Roman, den ich unlängst gelesen habe: Man tritt hindurch, und kaum ist man über die Schwelle, findet man sich in Europa oderAmerika wieder.
Das mit der magischen Tür konnte meine Mutter nur deshalb sagen, weil ich ihr noch nichts von meiner Reise erzählt hatte. Hätte ich das getan, hätte sie gewusst, dass es mitnichten eine Geheimtür gab. Es gab keinen Zaubertrick und keine Schwelle, die man mal eben so überschreitet, um hoppla hopp!, wie durch ein Wunder in London zu landen.
Meine Mutter hat mich nie gefragt, was alles passiert ist, nachdem sie mich in Quetta zurückgelassen hatte. Sie hat sich nie danach erkundigt, und ich wollte es ihr nicht erzählen. Sie hat nie erfahren, was ich in diesen fünf Jahren alles durchgemacht habe. Nichts von der Fabrik in Qom, von dem Steinbrocken, der mir aufs Bein fiel und es zerfleischte, von dem Grenzpolizisten, der mir die Uhr klaute, und von seinen Kollegen, die mich an der Grenze zum Iran fast erschossen. Sie hat nie von dem sechsundzwanzigtägigen Gewaltmarsch durch den Schnee in die Türkei erfahren, von den Toten, denen ich die Schuhe stahl, von den drei Tagen, die ich versteckt im Hohlraum eines Lasters quer durch Kappadokien fuhr – mit zwei Flaschen in der Hand: einer zum Trinken und einer, um hineinzupinkeln. Sie hat nie von Liaqat erfahren, der über Bord ging, als wir von Ayvalik nach Lesbos übersetzten, von dem schrecklichen Leben in Athen, den hilflosen Nächten in Ostia, von der Angst und den Fragen, der Wut und der Ohnmacht. Von der Erschöpfung, die manchmal noch heute an mir nagt wie gewisse Wüstenwürmer. Von den Gespenstern, die mich nachts jahrelang heimsuchten. Ich habe nichts davon erwähnt, ihr nie etwas darüber erzählt. Weil es sie belastet hätte. Und das wollte ich nicht.
Was hätte es schon geändert?
All diese Informationen hätten meine Erinnerungen, geschweige denn die Ereignisse, auch nicht ungeschehen gemacht. Ich habe gesagt, dass die Reise kompliziert war, das schon: der übliche Stress mit den Schleusern – wem kann man schon trauen? Aber dass es nichts bringe, das alles wieder aufzuwühlen. Hauptsache, ich hatte es geschafft. Ich war an einem sicheren Ort, ging zur Schule, hatte Freunde und vor allem die Anerkennung als Flüchtling, sodass ich mir in Europa ein neues Leben aufbauen konnte.
So war es nun einmal. Seit wir wieder voneinander gehört hatten und auch wieder miteinander sprachen, war es, als hätten wir stillschweigend vereinbart, uns auf die Gegenwart und die Zukunft zu konzentrieren, ohne die Vergangenheit, die unsere Gespräche zu ersticken drohte, auch nur zu erwähnen. Denn darüber zu reden, hätte bedeutet, die Herbstnacht im Samavat Qgazi in Quetta anzusprechen, in der sie mir drei Versprechen abgenommen hat, um am nächsten Morgen verschwunden zu sein. Es hätte bedeutet, mich entscheiden zu müssen, ob ich wütend auf sie war: ob es da etwas zu verzeihen gab, ob ich ihr bereits verziehen hatte oder ob ich ihr sogar dankbar sein musste. Viel zu kompliziert.
Das bedeutete allerdings, dass auch ich lange nicht wusste, was ihnen zugestoßen war – angefangen von der Rückkehr meiner Mutter aus Quetta über die Anschläge des 11. September und die darauf folgenden Bombardierungen durch die Amerikaner bis hin zu dem Tag, als ein Mann, den ich mit der Suche nach ihr beauftragt hatte, wie durch ein Wunder vor ihrer Tür stand, zusammen mit einer Frau aus Nawa, die sich vor langer Zeit eine Kugel einfing, mitten in die Stirn. Ich weiß, das klingt seltsam, aber dazu später mehr.
So war das.
Eine Geschichte, die mir letztlich meine Schwester erzählt hat, und zwar vor noch gar nicht allzu langer Zeit.
2
Doch bevor ich dazu komme, muss ich erst noch ein paar Informationen über Afghanistan loswerden. Es ist nun einmal so, dass alles von dem Ort abhängt, an dem man geboren wird, und je nachdem, wo der liegt, auch von der Gemeinschaft, der man angehört. Meine Geschichte ist eng mit der Afghanistans und der Hazara verbunden. Deshalb dieser Überblick – ich mach es auch kurz, versprochen!
80 000 v. Chr. – erste Siedlungen der Neandertaler.
60 000 v. Chr. – Wildziegen, einfach überall.
50 000 v. Chr. – Der Homo sapiens taucht in der Region auf.
10 000 v. Chr. – immer noch hauptsächlich Wildziegen.
5000 v. Chr. – Erste Ziegelbauten werden errichtet, die Menschen leben in immer zahlreicheren Gruppen zusammen.
2000 v. Chr. – nichts Besonderes.
1000 v. Chr. – Die riesige Region, die heute Iran, Afghanistan und benachbarte Nationen umfasst, wird zunehmend besiedelt. Alle möglichen Leute schauen vorbei, und da es sich um eine magische, wunderschöne Landschaft handelt, entstand plus/minus hundert Jahre um diese Zeit der Zoroastrismus, eine Religion, die auf den Lehren von Zarathustra beruht, den Eingeweihte Zoroaster nennen.
500 v. Chr. – Dareios I. von Persien, auch Dareios der Große genannt, Sohn des Hystaspes usw., feiert in seinem Palast in Persepolis das Fest Nouruz, also den Tag, an dem die Sonne genau in der Mitte der im Palast errichteten Sternwarte einfällt. Es ist der Tag der Frühlingstagundnachtgleiche, das persische Neujahrsfest, wie es noch heute gefeiert wird.
300 v. Chr. – Alexander der Große fällt mit seinem Heer in die Region ein. Er glaubt, sie leicht erobern zu können, aber da täuscht er sich. Am Ende gelingt es ihm doch. Als Alexander sein neues Reich vom Gipfel eines Berges betrachtete, soll er gesagt haben: In dieser Gegend leben aber wirklich viele Ziegen!
200 v. Chr. – Das mächtigste altindische Reich, das Reich der Maurya, breitet sich im Süden des heutigen Afghanistan aus. Der Buddhismus gelangt in die Region.
100 v. Chr. – Seit Jahrhunderten kommen und gehen die Armeen und Kulturen. Das, was eines Tages Afghanistan genannt werden wird, ist das Herz Zentralasiens. Wegen seiner strategischen Lage beschließt immer wieder jemand, sich einen Teil davon einzuverleiben: im Süden, im Norden, im Osten, im Westen … so geht das ununterbrochen weiter.
Das Jahr 0 – Peng!
100 n. Chr. – In dieser Zeit gehört die Region zum Kuschana-Reich, das sich von Tadschikistan am Kaspischen Meer bis zum Ganges-Tal erstreckt.
200 n. Chr. – Man beginnt mit der Errichtung der Buddha-Statuen von Bamiyan. Das sind zwei riesige, fantastische, in den Fels geschlagene Statuen – die eine achtunddreißig, die andere dreiundfünfzig Meter hoch –, von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt, bevor die Taliban sie zwei Jahre später, am 12. März 2001, in die Luft sprengen. Heute sind nur noch Fotos davon übrig. Und schon die sind der Wahnsinn!
300 n. Chr. – In der Region treiben sich mehrere eurasische Stämme herum.
400 n. Chr. – In der Region treiben sich die Hunnen herum.
500 n. Chr. – Ziegenkäse erfreut sich großer Beliebtheit.
600 n. Chr. – Muslimische Araber besetzen die Region. Das fällt ihnen nicht weiter schwer, denn trotz der in dieser Region hochentwickelten Kultur – sei es nun Ackerbau oder Handel, Wissenschaft oder Medizin, Mathematik oder Philosophie – fehlt eine zentrale Macht, die in der Lage wäre, die verschiedenen, von lokalen Stämmen regierten Zonen militärisch zu organisieren. Die Araber gehen hart gegen alle vor, die sich nicht zum Islam bekehren wollen. Die angestammte Bevölkerung will das nicht hinnehmen, und es kommt zu zahlreichen Revolten.
700 n. Chr. – Chaos, Schlachten.
800 n. Chr. – Die Araber werden vertrieben. Aber inzwischen hat sich der Islam als Religion durchgesetzt.
900 n. Chr. – Mittlerweile befindet sich das Gebiet in der Hand der Ghaznawiden, einer ursprünglich türkischen Dynastie.
1000 n. Chr. – Es passiert etwas.
1100 n. Chr. – Es passiert noch mehr.
1200 n. Chr. – Die Mongolen des Dschingis Khan, der bescheiden behauptet, die ganze Welt erobern zu wollen, fallen in die Region ein. Ihre Grausamkeit ist berüchtigt. Dschingis Khan plant die Eroberung dessen, was eines Tages Afghanistan heißen wird, äußerst sorgfältig. Er greift mit Zigtausenden von Reitern an. Er belagert die Stadt Balch, ein wichtiges kulturelles Zentrum, das sich sofort ergibt. Die Bewohner öffnen die Stadttore, um die Mongolen einzulassen, die alles in Brand setzen. Für Dschingis Khan kann eine Stadt, die sich kampflos ergibt, nur spurlos vernichtet werden. Dass sie im Lauf der Jahrhunderte eine feste Größe für all jene war, die Philosophie, Astrologie und Mathematik studierten, ja eine der wichtigsten Handelsstationen an der Seidenstraße, spielt für ihn keine Rolle. Als ungefähr fünfzig Jahre später Marco Polo vorbeikommt, beschreibt er Balch als einzige Staubwüste.
1300 n. Chr. – Die Mongolen herrschen hundertfünfzig Jahre über die Region, dann ist Timur am Zug. Der beendet die Epoche der in Asien und Europa einfallenden Reiternomaden.
1400 n. Chr. – Das Übliche.
1500 n. Chr. – Es beginnt die Epoche der aus der Türkei stammenden Safawiden.
1600 n. Chr. – Die Safawiden, immer noch.