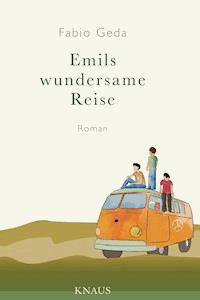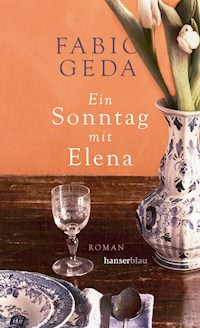15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitten in einer Ehekrise reist Andrea nach New York, in die Stadt seiner Jugend. Seit einem Aufenthalt vor vielen Jahren sehnt er sich hierhin zurück. Was als Kurzurlaub beginnt, wird zu einem alles verschlingenden Strudel an Eindrücken, Erlebnissen und Erinnerungen – doch zu Hause in Italien wartet Andreas Familie auf ihn, und eines Tages muss er sich zwischen altem und neuem Leben entscheiden.
Warmherzig und klug verwebt Fabio Geda die Schicksale seiner Charaktere miteinander, bis ein Netz entsteht, das die ganze Welt zu umspannen scheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Mitten in einer Ehekrise reist Andrea nach New York, in die Stadt seiner Jugend. Seit einem Aufenthalt vor vielen Jahren sehnt er sich hierhin zurück. Was als Kurzurlaub beginnt, wird zu einem alles verschlingenden Strudel an Eindrücken, Erlebnissen und Erinnerungen — doch zu Hause in Italien wartet Andreas Familie auf ihn, und eines Tages muss er sich zwischen altem und neuem Leben entscheiden.Warmherzig und klug verwebt Fabio Geda die Schicksale seiner Charaktere miteinander, bis ein Netz entsteht, das die ganze Welt zu umspannen scheint.
Fabio Geda
Was man sieht, wenn man über das Meer blickt
Roman
Aus dem Italienischen von Verena von Koskull
hanserblau
1
Und so kehrt er am Ende wieder vom Flughafen zurück, läuft, bis er Füße und Beine nicht mehr spürt, zieht das Handy aus der Tasche, das die dösige Luft im Central Park mit Summertime erfüllt — auf dem Display ein Foto von Agnese, die über den Rand ihrer Sonnenbrille lugt —, und wirft es in einem von Billie Holidays rauer Stimme beschriebenen Bogen in einen der Teiche, zwischen den Bäumen hindurch, unter dem Blick eines Falken; wenige Meter vom Ufer erstirbt die Stimme mit einem Plumpsen im Süßwasser, geht unter und verliert sich für einen winzigen Augenblick, der Andrea so unnatürlich lang erscheint, dass er glaubt, der See würde singen, in einem letzten summertime and the livin’ is easy, fish are jumpin’ and the cotton is high.
Derselben Melodie wegen hatte er sich, an einem Frühlingsmorgen fünf Monate zuvor, in seiner Stadt in Italien die Lunge aus dem Leib gerannt.
Ein auf dem Rasen liegender Unistudent reckte, als er ihn sah, den Kopf wie eine Schildkröte über sein Chemiebuch und löste die Finger aus den Locken des Mädchens neben sich; ein kleiner Junge mit offenen Schnürsenkeln hörte auf, seinem Ball nachzulaufen; eine Touristengruppe, die neben ihren frisch gemieteten Fahrrädern stand, blickte vom Lageplan des Parks auf. Alle folgten der unsteten Bahn dieses kalligrafischen Läufers, der, gekleidet wie jedermann, wie einer der vielen, die morgens dort unter den Kastanien unterwegs sind, in leichten Schuhen, kurzen Hosen und grauem Sweatshirt vorbeirannte, als ginge es — so schien es immerhin — um sein Leben. Ein Stück weiter vorn schoben zwei Frauen schwatzend ihre Kinderwagen vor sich her; sie lachten unbeschwert und sahen ihn nicht kommen. Um ihnen auszuweichen, schoss Andrea schmal wie eine Klinge zwischen ihnen und der Mauer des botanischen Gartens hindurch und schürfte sich dabei den Handrücken auf. Die größere Frau ohne Halstuch ließ die Wasserflasche fallen, aus der sie gerade trinken wollte, und schlug die Finger vor den Mund, um den Schreck zu ersticken; die andere krümmte sich katzenhaft über ihr Kind, um es zu schützen. Ein greiser Chinese unterbrach seine Atemübungen und drehte, die Arme vorgestreckt, mit mondartigem Phlegma den Kopf — später sollte er zu Hause einen Dokumentarfilm über die Gezeiten sehen und seine Frau überreden, das Foto ihres Sohnes zu vernichten.
Auf den zwei Kilometern, die ihn von der gynäkologischen Abteilung trennten, zog Andrea eine knirschende Spur hinter sich her. Aus einem fernen Winkel stieg die Erinnerung auf, wie er mit acht oder neun Jahren von einem Baum gefallen war und sich den Oberarm gebrochen hatte: Der erkletterte Ast war zu schwach gewesen, um ihn zu tragen, und von der Beobachtung eines Rotmilans gebannt, hatte er das Knacken des Holzes überhört.
Bei der Brücke ließ er den schützenden Park hinter sich und stürzte sich in die Straßen. Die Autos machten eine Vollbremsung, um ihn nicht zu überfahren, und doch musste er sich mit der Hand auf der Motorhaube eines Taxis abstützen. Er schnellte auf den Gehsteig und rannte entlang der Häuser weiter.
Frauen und Männer betraten und verließen Geschäfte, bestiegen und entstiegen Autos, nahmen Anrufe entgegen. Recycling-Müllcontainer wurden geleert, Fahrräder geklaut, Brotlaibe aus Öfen gezogen.
Hinter einer Reihe niedriger Gebäude tauchte das Krankenhaus auf. Die Schiebetür öffnete sich, ohne dass Andrea abbremsen musste. Er schlitterte über den Marmor und hielt mit rudernden Armen das Gleichgewicht; bog in den Gang ein und folgte der hellblauen Linie am Boden, die zur Abteilung führte. Es war heiß, unerklärlich heiß. Doch das irritierte ihn nicht, auch nicht die fragenden Blicke der Leute. Was ihn wirklich stutzen ließ, war, dass die Stimmen der Ärzte und Patienten, die Reifen der Rollstühle, das Klackern der Absätze, das Schlagen der Türen, das Knirschen der Rohrleitungen wie das des Astes, auf dem er als Kind gesessen hatte, und des berstenden Knochens in seinem Oberarm mit einem Mal verstummten.
Und als ihm das bewusst wurde, verloren die Sohlen die Bodenhaftung.
Das ist der Mann unserer Tochter, sagten zwei Stimmen.
2
Irgendwo muss ein Feuer ausgebrochen sein, dachte Agnese. Zwei Löschfahrzeuge hatten die Kreuzung mit gellenden Sirenen überquert, sie hatte sie vorbeisausen sehen, ohne sich aus dem Bett zu rühren, gespiegelt in den offenen Fenstern. Ein Tag für offene Fenster heute, sagte sie kaum hörbar zu sich selbst; dann drifteten ihre Gedanken zu der Tragweite eines Feuers, zu der Bedeutung des Wortes, zu der freigesetzten Hitze; sie verdrängte das Bild eines verbrannten Gesichtes, das sie im Fernsehen gesehen hatte, und aus der Erinnerung stieg das eines Skiausfluges auf — sie trug eine kaninchenförmige Mütze, die nicht ihr gehörte —, die Terrasse eines Restaurants mit Blick auf die Skipiste, die bunten Overalls, der Geruch nach Sonnencreme; dann konzentrierte sie sich wieder auf das spiegelnde Fensterglas.
Ein Tag für offene Fenster heute, sagte sie noch einmal.
Die Ärztin kam herein; hinter ihr Andrea. Sie trat zur Seite, um ihn vorbeizulassen, und nachdem sie eine Winzigkeit zu lang neben ihm gestanden hatte, wie um Agnese und ihn einander vorzustellen, sagte sie: Wenn Sie mich brauchen, ich bin am Ende des Flurs.
Es war ein Zweibettzimmer, aber nur ihr Platz war belegt; an den Wänden alte Drucke der Stadt — keine Poster von Kindern in Nussschalen. Mit linkischen Bewegungen nahm Andrea einen Hocker, setzte sich und streichelte flüchtig über das von ihrem Fuß gewölbte Stück Bettdecke.
Wo warst du, verdammt?
Laufen.
Laufen, klar.
Das konnte ich doch nicht ahnen.
Nein, sagte sie, das konntest du nicht. Du nicht und ich nicht, und genau das — sie schüttelte den Kopf, als wollte sie die bereits herabrinnenden Tränen vertreiben — lässt mir keine Ruhe. Also springe ich dauernd von einem lächerlichen Gedanken zum nächsten, denn wenn ich zu denken aufhöre und innehalte, fange ich an zu überlegen, was ich heute gemacht habe, und ich schwöre dir, ich habe nichts Besonderes gemacht heute, ich habe weder schwer gehoben noch bin ich Rad gefahren, ich bin losgegangen, um Tee zu kaufen, okay? Tee. Also überlege ich, was ich gestern gemacht habe, aber auch gestern habe ich nichts falsch gemacht, und so gehe ich noch einen Tag zurück und noch einen und einen weiteren, ohne etwas zu finden, keinen Hinweis, keine Spur. Ihr Atem versagte und sie brach in verzweifeltes Schluchzen aus. Wie soll ich ohne einen beschissenen Hinweis kapieren, was nicht in Ordnung ist? Wie soll ich so ein Kind kriegen?
Andrea nahm ihre Hand. Sie zog sie weg, als hätte eine Spinne sie gebissen. Drehte sich auf die Seite. Am liebsten hätte sie die Knie zur Brust gezogen, um sich in den Fötus zu verwandeln, der ihr genommen worden war, doch sie vermochte die Beine nicht anzuwinkeln.
Geh weg, sagte sie.
Agnese …
Bitte, geh weg. Geh.
Andrea blieb noch einen Moment sitzen, bis ihm ein Stich durch den Oberarmknochen fuhr und er den Schrei des Rotmilans hörte; aber nein, es waren weitere Sirenen, die auf der Straße aufflammten.
Auf dem Weg hinaus sah er die Schwiegereltern auf dem Gang, die Augen geschlossen, die Hände im Schoß. Er klopfte an die Praxistür der Ärztin. Agnese müsse noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben, sagte sie. Und, ja, wenn sie wollten, könnten sie es erneut mit einer Schwangerschaft versuchen. Und, nein, es gebe keine Möglichkeit herauszufinden, ob und wann eine Schwangerschaft erfolgreich wäre. Jetzt müssen Sie sich um Ihre Frau kümmern, sagte sie.
Ja.
Drängen Sie sie nicht.
Nein.
Es braucht Zeit.
Zeit, wiederholte er.
Das Telefon klingelte und die Ärztin klemmte den Hörer zwischen Schulter und Ohr, um sich eine Zigarette anzuzünden; sie trat ans Fenster und öffnete es weit. Andreas Blick fiel auf den Druck eines Klimt-Gemäldes hinter dem Schreibtisch: ein Ausschnitt aus Die drei Lebensalter der Frau, das ergriffene Antlitz der Mutter, die ihre kleine Tochter in einer Umarmung an sich drückt, Blumen im Haar, porzellanene Wangen. In der anderen Hälfte die alte Frau mit der trockenen Haut und dem aufgedunsenen Bauch, die Hand über den Augen, gequält von der eigenen welken Nacktheit, niemand kennt sie.
Ich habe leider keine Zeit mehr für Sie, sagte die Ärztin, warf die Zigarette auf die Straße und legte den Hörer auf; das Morgenlicht fiel auf ihr Gesicht. Attraktive Frau, dachte Andrea und schämte sich sofort. Zeit, wie gesagt, es braucht Zeit, sagte sie. Verlieren Sie nicht die Geduld.
In der Tür fuhr Andrea herum. Hören Sie, gibt es zufällig noch einen anderen Ausgang?
Wie bitte?
Aus dem Krankenhaus, meine ich. Oder … Mit dem Daumen deutete er Richtung Hauptflur.
Folgen Sie der roten Linie. Die führt zur Hintertreppe. Links, nach den Toiletten.
Agneses Eltern saßen noch immer in der gleichen schmerzvollen Haltung da; sie bekamen nicht mit, wie er floh, die Treppen hinunter und nach draußen schlüpfte, zwischen die vom zarten Hauch des Frühlingstages trunkenen Menschen. Durch Seitenstraßen, an den Häuserwänden entlang machte er sich auf den Heimweg. Vor der Eingangstür schob er die Hände in die Taschen und stellte fest, dass er keine Schlüssel bei sich hatte. Im Geist ging er die Handgriffe vor dem Verlassen der Wohnung durch und kam zu dem Schluss, dass er sie eingesteckt hatte; er musste sie beim Laufen verloren haben. Er klingelte bei den Nachbarn, die ein paar Ersatzschlüssel hatten, doch niemand reagierte. Er blickte sich um. Stellte fest, dass er Hunger hatte, aber kein Geld. Ein Hund schlug an und reckte den Kopf von einem der obersten Balkone des Mietshauses gegenüber. Andrea ließ sich auf die Eingangsstufe sinken, blinzelte zu dem Kläffen empor, die Augen mit der Hand gegen die Sonne beschirmt, eine unbeschwerte Sonne, die alles jenseits des Dickichts aus Antennen und Schornsteinen bestrahlte, die aufgehängte Wäsche trocknete, die Fesseln des langen Winters löste und die Menschen drängte, ihre Häuser zu verlassen und den Anbruch einer neuen Jahreszeit zu feiern.
Nach vier Tagen voller Nachuntersuchungen und Schmerzmitteln kehrte Agnese nach Hause zurück. Ehe sie das Krankenhaus verließ, hatte sie versucht, sich wieder herzurichten: Von Andrea hatte sie sich einen schwarzen Rock und eine Bluse mitbringen lassen, die sie sonst zur Arbeit trug. Es war ein Fehler gewesen, das war ihr sofort klar geworden, als sie vor dem Badezimmerspiegel stand und ihre matten Augen und ihre Haut musterte, vor allem die am Hals, die so dünn war, dass die Adern hindurchschimmerten.
Beim Aufschließen der Wohnungstür hatte Andrea Mühe, den Schlüssel zu drehen, als würde etwas oder jemand ihn von innen blockieren. Na bitte, das hat uns gerade noch gefehlt, sagte er lächelnd. Sie lächelte nicht zurück. Morgen rufe ich den Schlosser an.
Als das Schloss endlich nachgab, schlich Agnese auf Zehenspitzen hinein; mit zusammengekniffenen Augen, die Hand schräg an die Stirn gelegt, taxierte sie die Wohnung, auf der Suche nach einer Zuflucht, einem Ort, an dem sie sich in dieser urvertrauten, mit einem Mal feindseligen Umgebung verkriechen konnte.
Willst du einen Kräutertee oder einen Saft? Es ist Joghurt da, wenn du möchtest.
Sie antwortete nicht. Sie hatte sich für den Sessel entschieden. Ja, der Sessel war in Ordnung. Sie kauerte sich darauf zusammen und zog die Schuhe aus, schnappte sich ein Kissen, schob es zwischen Kopf und Rückenlehne und schloss die Augen. Nein, es war gar nicht so schwer, die Welt auszusperren.
Andrea schaltete das Küchenradio ein und suchte nach einem passenden Sender, doch jede Musik ging ihm auf die Nerven und er machte es wieder aus. Er nahm einen kleinen Topf aus dem Spülbecken, setzte Wasser auf, wartete, bis es kochte, hängte zwei Teebeutel hinein — einmal Minze und einmal Fenchel —, füllte die Tassen und trug sie ins Wohnzimmer. Es war später Nachmittag. Der Wind drückte gegen die Fenster und ließ die Rahmen knarren. Er setzte sich aufs Sofa und schlug die Beine übereinander. Stellte eine Tasse auf dem Couchtisch ab, behielt die andere in der Hand und drückte sie gegen sein Hemd, um die Wärme zu spüren.
Haben sie dich angerufen?, fragte Agnese, ohne die Augen zu öffnen.
Andrea dachte an die Ärzte. Wie bitte?
Aus der Schule. Haben sie dich angerufen?
Noch nicht.
Glaubst du, sie rufen dich noch an?
Wie immer, sagte er. Wieso sollten sie nicht?
Agnese lachte grunzend auf. Sie drehte sich um und nahm die Tasse vom Tisch.
Gestern hat Carla angerufen, sagte Andrea.
Wie lang bist du jetzt zu Hause? Drei Wochen?
Andrea nickte. Carla sagte, sie hätte es auf deinem Handy probiert. Aber es war ausgeschaltet.
Ich verstehe das nicht.
Was?
Wie du das aushältst.
Agnese … Das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Augenblick.
Agnese setzte sich auf und verdrehte die Augen. Nicht der richtige Augenblick?
Ich meine, wenn es uns nicht gelingt, ein Kind zu bekommen, liegt das nicht … na ja, es liegt bestimmt nicht am Job. Das wollte ich sagen.
Das wolltest du sagen?
Ich unterrichte Kunst und Zeichnen, Agnese. Was soll ich denn tun?
Sie hörten das Geräusch des haltenden Fahrstuhls, den freudigen Lärm der Nachbarskinder, die in Dialekt gesprochenen Zurechtweisungen der Großmutter. Dann ein Klingeln, Gelächter, das Klimpern der Schlüssel. Das geschmeidige Klacken des Schlosses.
Andrea senkte die Stimme. Es ist nur eine Frage der Zeit, sagte er.
O bitte, blaffte sie und hob die Hand. Die brüske Bewegung ließ den Kräutertee aus der Tasse schwappen, ein Spritzer traf ihren Hals und landete auf der Bluse. Scheiße, sagte sie. Sie griff sich ein paar Papiertaschentücher, tupfte sich ab, fühlte sich dennoch schmutzig und unwohl und fing an, über Haut und Blusenstoff zu reiben, zuerst sacht, dann immer ungehaltener, doch je heftiger sie rieb, desto mehr lösten sich die Taschentücher auf und hinterließen staubige Flusen. Sie stieß einen Schrei aus. Schleuderte die zerfledderten Taschentücher zu Boden, knallte die Tasse, die trudelnd einen Teil des Kräutertees vergoss, auf den Tisch, sprang auf und stürmte ins Schlafzimmer.
Andrea wartete auf das Schlagen der Tür. Doch es blieb aus.
Vom Sofa aus sah er zu, wie Schmerz sich auf die Möbel und Bücher, auf die Zeitschriften Vorhänge Pflanzen, auf die Fotorahmen und schließlich auf den Fußboden senkte. Dann kniete er sich hin, stellte eine Glasvase beiseite, die auf dem Couchtisch neben einem Stapel Internazionale gestanden hatte, hielt Agneses Tasse an die Tischkante, schob die vertrockneten Blütenblätter zusammen, die seit wer weiß wann dort lagen, und ließ sie in den Rest Kräutertee rieseln. Er sammelte die Taschentücher auf, ging in die Küche und räumte alles ins Spülbecken.
Er überlegte, dass sie über die Fehlgeburt nicht mehr sprechen würden.
Aun-Liang war vier Jahre alt, jeden Donnerstag ging Andrea zu ihm nach Hause. Die Familie Zhao lebte im zweiten Stock eines Gründerzeithauses, rund dreißig kleine Wohnungen, von Italienern an Einwanderer vermietet, fünf oder sechs wurden noch von den alten Eigentümern bewohnt, von denen zwei vor dem Krieg geboren waren. Der gelblich getünchte Putz rieselte auf die Stufen aus Luserna-Stein. Geruch nach gekochtem Gemüse. Auf dem Austritt des Treppenabsatzes zum Trocknen aufgehängte Wäsche. Die Gegensprechanlage am Hauseingang war ein Kartogramm der Migrationsströme, mit einer auffälligen Häufung ostasiatischer Nachnamen.
Aun-Liang war ein Patient von Agnese. Er war gehörlos geboren worden, aber niemand hatte es bemerkt. Nach der Geburt hatte man kleinere Pathologien diagnostiziert, jedoch keine Taubheit, und erst mit anderthalb Jahren war aufgefallen, dass er auf Geräusche nicht reagierte, nicht einmal auf plötzlichen Lärm wie einen herunterfallenden Topf oder eine LKW-Hupe. Die Eltern hatten sich für eine Operation entschieden, und nachdem man ihm ein Cochlea-Implantat eingesetzt hatte, war er zweimal die Woche zu Agnese gegangen, die Logopädin war. Die Familie hatte Lernförderung erhalten, doch dann war das Programm eingestellt worden, und als Andrea wieder einmal keine Vertretungsstelle hatte, hatte Agnese ihm vorgeschlagen, den Jungen ehrenamtlich zu betreuen.
Am Tag ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus aß Agnese nichts zu Mittag. Andrea knabberte ein Stück Käse im Stehen, den Rücken gegen den Kühlschrank gelehnt, dann steckte er den Kopf ins Schlafzimmer und sagte, er würde zu Aun-Liang gehen. Agnese antwortete nicht.
Er wollte erst das Auto nehmen und entschied sich dann kurzerhand für den Bus. Ein paar Minuten lang lehnte er am Haltestellenmast, dann wanderte er los. Er wurde zu keiner bestimmten Uhrzeit erwartet und verspürte einen verzweifelten Bewegungsdrang.
Durch die Vitrinen der Bar, die sie zwei Hausnummern vor ihrer Wohnadresse mit ihrem Mann betrieb, sah Aun-Liangs Mutter ihn kommen. Sie kam heraus, um ihn zu begrüßen. Sie hatte ein frisches, breites Gesicht und gütige Augen. Sie sagte nie mehr als: Andrea Andrea, beteuernd und dankbar. Mitunter ließ sie sich zu einem anerkennenden ›Nicht wärst du‹ hinreißen, woraufhin er sich jedes Mal fragte: Wer wäre ich dann?
Andrea Andrea, sagte sie und kam auf ihn zu. Nicht wärst du.
Wenn ich nicht wäre, wärt ihr da, entgegnete er — Agnese hatte ihm nahegelegt, jeden Versuch von Verantwortungszuweisung postwendend zurückzuspielen — und deutete auf die Frau, um zu bekräftigen, dass er sie meinte.
Nein nein. Nicht wärst du.
Ist Aun-Liang zu Hause?
Warten.
Er wartet auf mich oder soll ich warten? Kann ich raufgehen? Läuft im Kindergarten alles gut? Schläft er?
Ja.
Er ist zum Schlafen dortgeblieben? Wann?
Ja.
Signora, ich habe Sie gefragt, ob er zum Schlafen dortgeblieben ist. Aun-Liang. Im Kindergarten.
Frau Zhaos Miene verdüsterte sich, konzentriert schloss sie die Augen. Schlafen noch nicht, sagte sie und schüttelte den Kopf.
Die Großmutter öffnete die Tür. Hinter ihr, an ihren Kittel geklammert, linste Aun-Liang hervor. Wegen seines kurzen Haars waren die Mikrofone hinter den Ohren und die flache Empfängerantenne zu sehen, die mit einem Magnet am Kopf befestigt war. Die Großmutter sagte etwas auf Chinesisch, Andrea nickte grüßend. Wie immer nahm Aun-Liang ihn bei der Hand, und zusammen zogen sie sich in ihre übliche Nische zwischen Bett und Fenster zurück. Der Junge legte sich rücklings auf den Boden, griff sich ein Spielzeugauto, einen Feuerwehrwagen, und ließ ihn fliegen. Andrea zog eine alte Blechkiste von einem Bord, die Kiste mit den Holzbauklötzen, und baute, von Aun-Liang unbeachtet, eine Art Triumphbogen. Er nahm eine Trommel, die unter einem Stuhl liegen geblieben war, holte eine Trillerpfeife aus der Tasche und kniete sich hinter den Jungen.
Aun-Liang.
…
Aun-Liang, wiederholte er ein wenig lauter.
…
Aun-Liang, sagte er noch einmal. Und endlich rollte sich der Junge auf den Bauch, legte den Feuerwehrwagen an die Wange, ließ die Reifen darüberkitzeln und blickte zu Andrea auf. Begleitet von Einwortsätzen, Spielzeugauto, Tunnel, Durchfahren, Geräusch, zeigte er Aun-Liang, was er tun sollte, und sagte, beim Pfiff solle das Löschfahrzeug durch den Bogen hindurchfahren und ihn beim Schlag auf die Trommel umrunden. Doch ehe er pfeifen oder trommeln konnte, schleuderte Aun-Liang das Auto gegen den Bogen; Bauklötze flogen in alle Richtungen.
Chá?, fragte die Großmutter und schaute zur Tür herein — sie meinte, ob er Tee wolle.
Nein, danke, sagte Andrea. Die Frau verschwand im Flur und er hockte sich hin, um den Bogen wieder aufzubauen. Nicht so, sagte er zu Aun-Liang und türmte die Bauklötze aufeinander. Nicht so. Er nahm ihm das Spielzeugauto aus der Hand, steckte sich die Trillerpfeife in den Mund, wartete, bis Aun-Liang ihn ansah, ihn wahrnahm, pfiff und ließ es unter dem Bogen hindurchfahren. So, verstanden? Ich pfeife, sagte er und pfiff. Auto, sagte er und zeigte darauf. Bogen, sagte er und wiederholte den Vorgang.
Aun-Liang grinste, hob den Arm und ließ ihn mit voller Wucht auf den Bogen niedersausen.
Aun-Liang!, schrie Andrea.
Der Junge flitzte davon und Andrea rannte ihm nach, doch als er in den Flur kam, war Aun-Liang verschwunden. Ein alter Mann trat aus einer Tür und blieb wie angewurzelt stehen. Andrea hatte ihn noch nie zuvor gesehen.
Aun-Liang?, fragte er den Alten und deutete auf die Tür hinter ihm.
Der Mann antwortete nicht und starrte ihn unvermindert an.
Mit einer Entschuldigung schob sich Andrea an ihm vorbei und steckte den Kopf durch die Tür: Dort stand ein Ehebett, darauf lagen drei Männer und eine Frau und schliefen. Hastig fuhr er zurück und drehte sich auf dem Absatz um. Der Alte war verschwunden, stattdessen stand Aun-Liang vor ihm.
Die Eingangstür stand sperrangelweit offen.
Aun-Liang schoss auf den Treppenabsatz hinaus und die Stufen hinunter — seine Flipflops machten ein Geräusch wie Regen, der in Pfützen fällt.
Aun-Liang!, schrie Andrea und wusste, dass es zwecklos war.
Das Haustor zur Straße stand offen, die Sonne ging gerade unter. Unter lautem Rädersurren rollte ein Junge auf einem Skateboard in den Hauseingang. Bestimmt ist er zu seinen Eltern gelaufen, dachte Andrea, doch als er in die leere Bar stürzte, drehten sich Vater und Mutter gleichzeitig um, einen feuchten Putzlappen in der einen, ein Glas in der anderen Hand. Ihr leerer Blick beantwortete seine Frage, noch ehe er sie gestellt hatte. Er machte kehrt, gefolgt von den beiden, die ihm nachriefen und wissen wollten, was passiert war — die strenge Stimme des Vaters, das hektische Trippeln der Mutter. Gemeinsam betraten sie den Hauseingang.
Aus dem Schatten hinter der Tür tauchte Aun-Liang auf und lachte. Abermals wollte er Richtung Hof davonflitzen. Andrea packte seine Hand und zog ihn wie ein Tau zu sich heran: erst das Handgelenk, dann den Arm, die Schultern, schließlich hob er ihn hoch.
Halt still. Halt still, habe ich gesagt. Verdammt!
Aun-Liang strampelte, riss sich das linke Hörgerät herunter und schleuderte es zu Boden; eine Salve von Tritten brach los, von denen einer Andrea so heftig in den Unterleib traf, dass er sich vor Schmerz zusammenkrümmte und den Jungen loslassen musste. Er rannte die Treppen hinauf, gefolgt vom Vater, während die Mutter Andrea auf die Beine half.
Andrea Andrea. Sie fasste ihn unter die Achseln. Nicht wärst du.
Als Andrea nach Hause kam, erwiderte Agnese seinen Gruß nicht. Er machte Gemüsecremesuppe warm und brachte ihr eine Tasse davon ins Schlafzimmer, die sie auf dem Nachttisch kalt werden ließ. Sie fragte nicht, wie es mit Aun-Liang gelaufen war; er sagte nichts.
Nach Mitternacht schaltete er den Fernseher aus, trank einen Schluck Wasser und entschied sich für das Bett. Agnese wandte ihm den Rücken zu. Das durch den Vorhang sickernde Licht der Straßenlaterne lag wie Flaum auf der Bettdecke. Er zog sich aus, warf die Kleider auf einen Stuhl, schlüpfte in seinen Schlafanzug, glitt unter die Laken und schmiegte seinen Körper an den seiner Frau: die Knie in ihre Kniekehlen, die Brust gegen ihre Schulterblätter, die Nase in ihr Haar. Er legte seine Hand auf ihre Hüfte, und die Stille begleitete sie bis zum Erwachen.
Den folgenden Tag brachte Andrea damit zu, die Schwangerschaft aus der Wohnung zu verbannen. Bücher über Mutterschaft; vorzeitig erhaltene Geschenke; auf Zetteln des Gesundheitsamtes notierte Namenslisten — sie wollten es Lorenzo nennen, oder Chiara; ein hingekritzelter Grundriss, der die Umwandlung des Arbeitszimmers in ein Kinderzimmer durchspielte; ein Katalog für Umstandsmode. Und dennoch, nachdem alles zusammengeräumt und weggeworfen und jede Spur beseitigt war, schien der Geruch der Schwangerschaft noch immer in der Luft zu hängen. Er saugte Staub, steckte die Vorhänge in die Waschmaschine, besprühte Sofa und Sessel mit Desinfektionsspray — wo hatten er und Agnese am Abend der Zeugung miteinander geschlafen? Nein, nicht auf dem Sofa. Er würde die Laken verbrennen; sie hatten noch nagelneue im Schrank.
Er ging hinunter auf die Straße, um die Müllsäcke wegzuwerfen.
Auf dem Rückweg lief er der Frau aus dem obersten Stock in die Arme, die ihn über eine Eigentümerversammlung informierte, bei der er nicht gewesen war: ein Problem mit den Farben der Deckenlampen im Keller, der Wechsel der Reinigungsfirma. Andrea sah, wie sich die Lippen der Frau bewegten, doch die Worte drangen nicht zu ihm durch. Dann ließ Billie Holidays raue Stimme Summertime aus seiner Tasche klingen.
Ja, hallo? Mit einem Winken verabschiedete er sich von der Frau und ging die Treppe hinauf.
Eine grelle Stimme fragte nach Signor Luna.
Das bin ich.
Sie rufe aus der Mittelschule Don Milani in San Rocco an, wegen einer Vertretung. Der Kunstlehrer habe sich krankgemeldet. Der Kartei entnehme sie, dass er in der Stadt lebe und mit dem Auto oder der Bahn kommen müsste.
Ja. Aber das ist kein Problem. Ich komme mit dem Zug.
Sie sagte, der Lehrer habe sich ausgebeten, immer zur ersten Stunde zu kommen.
Kein Problem.
Sie sagte, Professor Rostagno, der Lehrer, habe darum gebeten, Andrea seine Nummer zu geben, er solle ihn anrufen.
Ich rufe den Lehrer, den ich vertrete, immer an.
Sie sagte, da habe sie keine Zweifel, und Andrea fragte sich, warum, schließlich kannte sie ihn gar nicht.
Als das Gespräch beendet war, verharrte er noch einen Moment mit dem Telefon in der Hand, dann ging er freudig ins Schlafzimmer. Agnese kehrte ihm den Rücken zu.
Morgen muss ich früh raus, sagte er. Ich habe eine Vertretung. Den ganzen Monat.
Sie änderte ihre Position, ließ die Beine unter den Laken rascheln und umarmte das Kissen — was auch immer das heißen mochte.
Den Nachmittag über beschäftigte Andrea sich damit, wie man mit Nagellack und Prägefolie mittelalterlichen Schmuck nachbastelte, das war Professor Rostagnos Unterrichtsstoff für die sechste Klasse gewesen, ehe ihm eine Bauchfellentzündung diagnostiziert worden war; wie man Pixel-Art-Figuren mit Post-its herstellte — Lehrplan für die Fünfte —, und er suchte im Internet nach Informationen zur visuellen Poesie der Futuristen für die Siebte. Am nächsten Morgen stand er um halb sechs auf. Angezogen, den Rucksack auf den Schultern, überkam ihn der dringende Wunsch, die schlafende Agnese zu küssen. Er umrundete das Bett und wollte sich hinunterbeugen, ließ dann aber davon ab.
Gegen zwei Uhr nachmittags saß er auf der Bank am Bahnhof, wartete auf den Zug, der ihn nach Hause bringen sollte, und sah dem Spiel der Sonnenstrahlen in einer Pfütze zu. Während des Unterrichts in der Sechsten hatte es am Vormittag einen heftigen Regenguss gegeben, dann war die Sonne wieder durch die Wolken gesickert. Normalerweise hätte ihn ein solcher Moment — das Warten auf den Zug, die Ländlichkeit — mit Freude erfüllt. Doch an diesem Tag brachten ihn die Anzeichen der wechselnden Jahreszeit, die unbeständige Witterung, aus der Fassung.
Ihm ging auf, dass er ein Kind verloren hatte.
Nicht, dass ihm das vorher nicht bewusst gewesen wäre, doch war er zu sehr damit beschäftigt gewesen, Agnese beizustehen, als dass dieser Gedanke sich hätte setzen und Wurzeln schlagen können, wie ein solcher Gedanke sich setzen und Wurzeln schlagen muss — in gebührender Tiefe. Mit einem Mal ging ihm auf, dass nichts von diesem Kind existierte oder je existieren würde: seine Spiele nicht, seine Stimme nicht, seine Hausaufgaben nicht. Dass er vielleicht nie ein Kind haben würde. Dass das nicht selbstverständlich war. Dass bei Agnese vielleicht tatsächlich irgendetwas nicht in Ordnung war.
An mir kann es nicht liegen, dachte er, wie kann es meine Schuld sein?
Als der Zug einfuhr, hatte Andrea Mühe aufzustehen, sich einen Platz zu suchen: Er weinte nicht, doch die Tränen implodierten und trübten ihn gänzlich ein. In der Stadt war es nicht leicht, den Heimweg zu finden, und als er endlich ankam, seine Jackentaschen nach dem Schlüssel abtastete und ihn nicht fand, fiel ihm auf, dass er den Rucksack in der Bahn hatte stehen lassen: Schülerzeichnungen, Handy, Brieftasche; alles.
Hastig drückte er auf die Klingel, wie zur Entschuldigung. Dann zwei weitere Male. Er klingelte abermals, diesmal länger, noch immer nichts; als wäre niemand zu Hause. Also drückte er mit aller Kraft. Wohl wissend, dass die Heftigkeit der Geste an der Lautstärke des Läutens nichts ändern würde, straffte er die Schulter, den Arm, die Hand und hielt den Finger auf den Knopf gepresst, bis er den Schall der eigenen Klingel in den Fallrohren dröhnen und durch die Wände dringen hörte. Doch Agnese öffnete nicht. Dann fiel ihm ein, es bei den Nachbarn zu versuchen, die sonst nie zu Hause waren, doch diesmal waren sie es.
Ich habe geklingelt, sagte er zu Agnese, als er die Schlafzimmertür aufriss.
Sie seufzte, zog die Nase hoch und rollte sich im Bett zusammen.
Verschiedene Tiere hatten sich in ihr einen Bau gegraben; zumindest schien es ihr so. Der Dachs, die Haselmaus und das Murmeltier hatten sich zwischen den Knieknorpeln zum Winterschlaf verkrochen und machten sie bewegungsunfähig. Fuchs und Adler stritten zwischen den Magenwänden um einen Hasenkadaver, und kaum glitt er ihnen aus den Fängen, stürzten sie sich auf das Aas, zerbissen und zerfleischten es. Zwei Fledermäuse waren nachts durch ihre Ohren ins Gehirn gedrungen, und hin und wieder wurden sie wach, jagten einander kreischend nach und flüchteten sich in die Seitenventrikel, um dort für einige Zeit zu verstummen. In den Lungen hatte eine Schlange ihre Eier gelegt; Eidechsen in ihrem Haar.
Eines Morgens schlug Agnese die Augen auf und stellte fest, dass die Tiere über Nacht verschwunden waren. Andrea war gegangen, um den Zug zu nehmen: das Kissen ohne Abdruck, der Schlafanzug gefaltet; unter dem Rollladen bohrte sich ein Lichtstrahl hindurch.
Mühsam schälte sich Agnese aus dem Bett und ging duschen. Das dampfend heiße Wasser löste die Reste des Schlafs, schwemmte die Taubheit aus den Muskeln. Sie machte sich ein reichhaltiges Frühstück, wie sie und Andrea es sich aus Zeitgründen sonst nur am Sonntagmorgen gönnten. Sie zog die rutschfeste Matte unter dem Bett hervor, legte sie vor das Fenster und machte die Übungen, mit denen sie vorher — in jener Zeit, die sie von nun an einfach vorher nennen würde — stets ihren Tag begonnen hatte. Sie zog sich an und ging zur Arbeit.
So früh hatte man sie nicht zurückerwartet, Andrea hatte angerufen und gesagt, sie würde zwei Wochen fehlen, deshalb wurde ihre Rückkehr mit Freude und Staunen, Umarmungen, Handschlägen und Schulterklopfen begrüßt, jedoch ohne ein Wort zu dem, was passiert war, obwohl alle davon wussten, was das Vergangene unter den Schichten aus Nettigkeiten, überfürsorglichen Gesten und verlegenen Blicken noch spürbarer machte. Kurz nach zwei rief Andrea sie auf dem Handy an, er war aus der Schule zurück und hatte sie nicht angetroffen.
Du hättest eine Nachricht hinterlassen können.
Ich bin in der Praxis, sagte sie, als wäre das selbstverständlich.
Darüber sei er froh, entgegnete er. Und auch erstaunt. Froh und erstaunt. Er habe den Rucksack wiedergefunden, sagte er noch.
An dem Abend bestellten sie chinesisches Essen und aßen im Wohnzimmer vor einer politischen Sendung, die keiner von beiden sehen wollte.
Ich habe mit meiner Mutter gesprochen, sagte Agnese und schob die Reisreste in einen Behälter. Sie hat uns für Samstag zum Abendessen eingeladen.
Schön.
Schön?
Ja.
Andrea, du bist nie gern zum Abendessen zu meinen Eltern gegangen. Ihr hasst euch.
Andrea zuckte die Achseln. Nicht alles, was passiert, gefällt uns, oder?
Und nächste Woche habe ich eine Konferenz in Lyon. Moissan hat mich angefragt.
Professor Moissan. Tja, was soll ich sagen? Professor Moissan hält nun einmal große Stücke auf dich, sagte Andrea und richtete ein Essstäbchen auf sie.
Weißt du, was ich glaube? Du solltest dir dieses Vertrauen zunutze machen.
Er griff sich ein Stück Hühnchen.
Ich könnte Freitag nachkommen, wenn du möchtest. Samstag — er schob sich das letzte Stück Frühlingsrolle in den Mund —, Samstag habe ich frei.
Besser nicht. Was meinst du?
Wieso nicht?
Ich werde arbeiten müssen, bin die ganze Zeit mit Kollegen zusammen. Du weißt schon.
Sie machte eine Handbewegung, wie um zu sagen, das sei kein Urlaub, er würde sich ausgeschlossen fühlen.
Niemand bringt seinen Partner mit, sagte sie. Sie stand auf, um die Reste des Abendessens hinauszutragen. Willst du, dass ich sie einlade?
Andrea fragte, wen sie meine.
Meine Eltern. Samstag. Oder dass ich allein hingehe?
Nein, sagte Andrea noch einmal, das sei nicht nötig, er würde eine Flasche von diesem sizilianischen Passito besorgen — Weißt du noch, wie der hieß? —, der ihrer Mutter so gut geschmeckt hatte.
In der Küche knipste Agnese das matte Licht über dem Gasherd an. Sie trennte den Abfall: Feuchtmüll, Papier und Pappe, Plastik. Dann schälte sie sich einen Apfel und knabberte ihn, gegen die Spüle gelehnt. Von dort aus dem Halbdunkel konnte sie, eingerahmt von der Küchentür, Andrea im Schneidersitz auf dem Teppich hocken sehen, den Rücken gegen das Sofa gelehnt. Das kalte Flackern des Fernsehers umriss seine Züge, doch er achtete nicht auf den Fernseher. Sein Blick verlor sich an der Wand, an der sie vor einiger Zeit ein Bild oder ein großformatiges Foto hatten aufhängen wollen — ein Renaissancegemälde oder eine Stadtlandschaft von Gabriele Basilico —, sich jedoch nie hatten entscheiden können. Die Wand war leer geblieben. Agnese fragte sich, was er dort sah.
Das Abendessen am Samstag war ein Debakel. Agnese hatte keinen Hunger und ihre Mutter, die sich ausgesprochen ungern an den Herd stellte, beklagte sich, das hätte sie vorher sagen können, sie hätte liebend gern darauf verzichtet, den halben Nachmittag lang Gemüse zu schälen und zu dünsten. Nach einer Bemerkung zu einer Nachrichtenmeldung verstrickten sich Andrea und Signor Ardenzi in eine Diskussion darüber, ob eine Polarisierung der Parteien notwendig sei oder nicht. Andrea sagte, er halte sich für einen Gemäßigten mit katholischer Prägung, und die besten Entscheidungen für die größtmögliche Mehrheit der Leute ließen sich nur mit gesundem Menschenverstand und Konsens treffen. Ardenzi brach ihn übertriebenes Gelächter aus. Er sagte, die gemäßigten Schlappschwänze — so seine Wortwahl —, und vor allem die mit katholischer Prägung, seien am Niedergang Italiens schuld. Hörst du dir eigentlich zu?, schnaubte Adrenzi. Mit Mäßigung regieren … Hörst du nicht den knirschenden Widerspruch? Er machte eine Handbewegung, als schraubte er sich etwas ins Ohr. Entweder man regiert oder man regiert nicht; entweder das eine oder das andere.
Die Konferenz in Lyon war indes ein Erfolg. Nicht zuletzt für Agnese. Als sie zum Abschluss der fünf Tage beim Abendessen saßen und winzige, mit Lauch und Ziegenkäse gefüllte Crêpes verzehrten, schenkte Professor Moissan ihr ein Glas Bordeaux ein und fragte sie, ob sie an einem Forschungsstipendium an seinem Lehrstuhl interessiert sei. Drei Tage die Woche in Lyon, sie würde nicht umziehen müssen. Wohnen könnte sie bei ihm — sein Arbeitszimmer verfüge über ein Schlafsofa und ein Duschbad. Du hast den ganzen Sommer Zeit, um darüber nachzudenken, sagte er. Ich schicke dir den Vertrag und alles Weitere, und du lässt es dir durch den Kopf gehen. Sprich mit deinem Mann darüber.
Sie stießen auf das Angebot an. Agnese sagte, sie müsse nicht darüber nachdenken, würde es aber trotzdem tun. Sie war so beglückt, dass sie in der Nacht kein Auge zutat und trotz des Nebels um sechs Uhr morgens das Hotel verließ, um am Fluss spazieren zu gehen.
Zwei Wochen später saß Andrea wieder einmal ohne Job zu Hause und wartete darauf, dass ihm eine Vertretungsstelle angeboten wurde. In acht Jahren Lehrtätigkeit war es ihm zweimal gelungen, ein ganzes Jahr lang dieselben Klassen zu betreuen, und nur dreimal waren es mehr als sechs Monate gewesen. Ansonsten ging es darum, die Krumen aufzulesen und jedes Mal von vorn anzufangen: neue Kollegen, neue Arbeitszeiten, neue Schüler. Was ihm am meisten zu schaffen machte, waren die Namen: Sie nicht zu kennen und, kaum hatte er sie gelernt, wieder gehen zu müssen.
In dieser arbeitslosen Zeit lief Andrea eines Maimorgens, nach einer Stunde Jogging, Vincenzo über den Weg. Er ging gerade die Bogengänge entlang, im Kopf bei den Einkäufen, die auf dem Bauernmarkt zu machen waren, als er aus einem Café seinen Namen rufen hörte.
Einige Jahre zuvor hatten er und Vincenzo zusammen drei Monate in New York verbracht und in einem italienischen Restaurant in der Bronx schwarz gearbeitet: Er hatte gerade seinen Abschluss in Architektur gemacht und Vincenzo hatte beschlossen, sein Ingenieurwissenschaftsstudium an den Nagel zu hängen. Doch aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen eines irischen Mädchens namens Dáire, hatten sie sich nach dieser Zeit aus den Augen verloren. Dann hatte Andrea eines Tages von gemeinsamen Freunden erfahren, dass Vincenzo wieder nach New York gegangen war, beruflich, und diesmal endgültig.
Vincenzo hatte sich einen Bart wachsen lassen. Er trug einen maßgeschneiderten Anzug; das Haar an den Schläfen war weiß geworden. Sie umarmten einander.
Setz dich doch, ich spendiere dir einen Kaffee.
Er drehte sich um.
Signorina, noch einen Kaffee. Was treibst du? Warst du laufen?
Wie viele Jahre sind es jetzt, Vincenzo? Nein, halt, ich will es gar nicht wissen. Andrea legte eine Hand aufs Herz und mimte einen Infarkt.
Scheiße, ich habe nur zehn Minuten, tut mir leid. Mein Cousin heiratet. Und morgen früh hetze ich zu meinem Flieger, weil ich nach New York zurückmuss. Ich habe so wahnsinnig viel um die Ohren. Aber du solltest mal meine Eltern hören, wenn ich nicht gekommen wäre. Du weißt schon: Du bist weg, du lässt uns allein, du rufst nie an …
Und die Familie ist dir wurst …
Und die Familie ist dir wurst, ganz genau.
Andrea dachte, dass er dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht mehr empfunden hatte, seit seine Eltern in seinem ersten Studienjahr bei einem Unfall ums Leben gekommen waren. Bist du noch dort?, fragte er. In New York, meine ich.
Wer rührt sich von da schon weg, Andrea? Ich habe zwar keine Villa in den Hamptons, aber ich komme ganz gut über die Runden. Ich habe geheiratet: Rosa kommt aus Mexiko. Wir haben zwei Mädchen. Ich habe eine Gebäudereinigungsfirma aufgezogen, weißt du? Dem Vater sei Dank, muss ich dazusagen, Rosas Vater …
Gebäudereinigung?
Büros, Mietshäuser. Aber erzähl mir von dir. Die kleine Irin?
Dáire? Gute Güte. An die habe ich seit … seit wann habe ich nicht mehr an sie gedacht? Was soll ich dir sagen, Vincenzo? Ich bin auch verheiratet und unterrichte Kunst und Werken.
Du bist Lehrer?
Sagen wir, ich wäre es gern, wenn Schule und Staat mich ließen.
Aber wie geht es dir? Erzähl mir, wie es dir geht. Bist du glücklich?
Die Kellnerin brachte den Kaffee und fragte, ob er Milch wünsche.
Nein, danke, sagte er. Wie es mir geht? Sagen wir es so: Im vergangenen Jahrhundert hatten wir zwei Weltkriege, dazu den Kalten Krieg und die Angst vor einem Atomkrieg, und trotzdem haben die Menschen an die Zukunft geglaubt. Sie hatten Vertrauen in die Zukunft. Und ich … Ich kriege das nicht hin, Vincenzo.
Er holte tief Luft.
Ich kriege es einfach nicht hin. So geht’s mir.
Weil wir noch immer zu viel Geld haben, Andrea. Es geht uns prima, und trotzdem sind wir neidisch auf das, was unsere Eltern hatten.
Er schaute auf die Uhr.
Scheiße! Es ist schon verdammt spät. Ich muss los.
Sie standen auf und umarmten einander.
Such »Leogrande Janitorial Services« im Internet, da steht meine Mail-Adresse. Wir schreiben uns, in Ordnung? Im Ernst, ich zähle drauf.