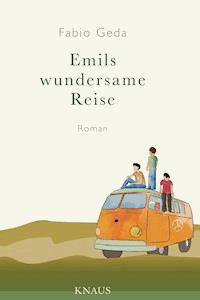Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Elena prostete ihm zu: 'Danke', sagte sie, 'Heute Morgen beim Aufwachen hatte ich den Kopf voller Schatten. Alle haben Sie nicht verjagt, aber ein paar schon. Danke dafür, wirklich.'"
Einst reiste er als Ingenieur um die Welt und baute riesige Brücken. Nach dem Tod seiner Frau aber ist es still geworden in der Turiner Wohnung am Fluss. Sein Sohn lebt in Finnland, mit der jüngeren Tochter hat er keinen Kontakt, nur die älteste sieht er ab und zu mit ihrer Familie. An einem Sonntag kocht der ältere Mann ein traditionelles Mittagessen für sie. Doch sie sagt kurzfristig ab. Im Park lernt er Elena und ihren Sohn kennen und lädt sie spontan zum Essen zu sich ein. Diese zufällige Begegnung wird alle drei für immer verändern.
Eine Geschichte voller Zuversicht und Wärme, die ein stilles Glück in den Herzen zurücklässt.
"Wie die Brücken, die der Protagonist baute, scheint der Roman komplex und zugleich mühelos. Fabio Geda weckt tiefe Empathie für seine Charaktere und beschwört eine durchdringende Sehnsucht nach dem Glück." – La Lettura
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Elena prostete ihm zu: 'Danke', sagte sie, 'Heute Morgen beim Aufwachen hatte ich den Kopf voller Schatten. Alle haben Sie nicht verjagt, aber ein paar schon. Danke dafür, wirklich.'«Einst reiste er als Ingenieur um die Welt und baute riesige Brücken. Nach dem Tod seiner Frau aber ist es still geworden in der Turiner Wohnung am Fluss. Sein Sohn lebt in Finnland, mit der jüngeren Tochter hat er keinen Kontakt, nur die älteste sieht er ab und zu mit ihrer Familie. An einem Sonntag kocht der ältere Mann ein traditionelles Mittagessen für sie. Doch sie sagt kurzfristig ab. Im Park lernt er Elena und ihren Sohn kennen und lädt sie spontan zum Essen zu sich ein. Diese zufällige Begegnung wird alle drei für immer verändern.Eine Geschichte voller Zuversicht und Wärme, die ein stilles Glück in den Herzen zurücklässt.»Wie die Brücken, die der Protagonist baute, scheint der Roman komplex und zugleich mühelos. Fabio Geda weckt tiefe Empathie für seine Charaktere und beschwört eine durchdringende Sehnsucht nach dem Glück.« — La Lettura
Fabio Geda
Ein Sonntag mit Elena
Roman
Aus dem Italienischen von Verena von Koskull
hanserblau
Meiner Mutter, Heimat
Man sollte darüber eine Geschichte schreiben:
nehmen wir […] einen Mann, der allein lebt,
außer an den Wochenenden, wenn ein paar Enkel
aus Spokane herüberkommen.
RAYMOND CARVER
Im Morgengrauen jenes Sonntages war da mein Vater und stand im dritten Stock des Hauses am Boulevard Lungo Po Antonelli am Küchenfenster. Er sah dem Fließen des Flusses zu. Jenseits des Wassers lagen die Häuser von Madonna del Pilone und dahinter die Collina, die gelben und roten Blätter der Ahornbäume, die auf die erste Sonne warteten. Er war siebenundsechzig Jahre alt und seit acht Monaten Witwer, in denen ihm klar geworden war, den Dringlichkeiten in seinem Leben mehr Aufmerksamkeit gewidmet zu haben als den Wichtigkeiten; doch konnte er daran nun nicht mehr viel ändern, außer sich und seinen Kindern zu beweisen, dass er in der ihm verbleibenden Zeit das eine bewusster vom anderen zu unterscheiden vermochte.
Er trank seinen Kaffee, den Blick auf einen Baum geheftet, den der für Turiner Verhältnisse ungewöhnlich starke Wind in der vorigen Woche niedergerissen und flusswärts gestoßen hatte; jetzt bevölkerten Vögel die dürren Äste, die sich wie die Finger eines Verdurstenden nach dem Wasser streckten.
Er ging ins Bad, leerte seine Blase und blieb lang auf der Kloschüssel sitzen, dann drückte er einen Strang Zahnpasta auf die Zahnbürste, begann, sorgfältig zu putzen, und betrachtete sein von der Seite beleuchtetes Gesicht im Spiegel. Zufrieden stellte er fest, dass das zwar feine graue Haar über der Stirn nicht an Dichte verlor und die dunkel umschatteten Augen noch immer eine ruhelose Kraft bewahrten. Auf den Zustand der Haut hatte er keinen Einfluss: Im letzten Jahr — seit ihrem Tod allemal — war sie dünn und trocken geworden, und an der Schläfe war ein Fleck aufgetaucht, gefolgt von weiteren Sprenkeln derselben Farbe: Ihr Muster erinnerte an ein Sternbild. Er bückte sich zum Wasserhahn, nahm einen Schluck, spülte aus und spuckte ins Becken; der Abfluss verschluckte die cremige Flüssigkeit, die sich rot verfärbt hatte. Das lag am Zahnfleisch. Er spülte zwei weitere Male, griff nach einem Handtuch, öffnete das Fensterchen, das auf den Hof hinausging, und atmete die kalte Morgenluft ein.
Er durchquerte den Flur, an dem sich die Zimmer der Wohnung reihten. Das kleinste war Alessandros gewesen. Jetzt diente es als Arbeitszimmer oder als eine Art Werkstatt, in der er mit Kleber, Schere und wiederverwertbarem Krimskrams hantierte, um Gegenstände zu reparieren und Modelle zu bauen. Meine Schwester Sonia und ich hatten zwanzig Jahre lang das Zimmer gegenüber geteilt, das geräumigste. Damit wir während der Gymnasialzeit ein wenig Privatsphäre hatten, hatte mein Vater eine Gipskartonwand eingezogen, die bis auf einen kreidigen Schatten am Fußboden inzwischen wieder verschwunden war. Das Elternschlafzimmer lag auf derselben Seite des Flurs. Das Ehebett aus Bambus, in dem jeder von uns in unterschiedlicher Absicht gezeugt worden war: Grundsteinlegung, Statikprüfung, Untermauerung. Der weiß lackierte Schrank mit den schablonierten Palmwedeln verwahrte noch immer die Garderobe von beiden; ich gebe sie weg, hatte er gesagt, nächste Woche, sobald ich dazu komme. Und später: Jetzt kümmere ich mich wirklich darum.
Im Wohnzimmer standen der große Tisch, das Bücherregal, der Fernseher, die von ihr hingebungsvoll umhegten Pflanzen, die inzwischen vermickert waren; die Farne hingen gelb aus den Töpfen, und die Sansevieria litt an Bakterienbefall und hatte bläuliche Flecken bekommen. Dem Drachenbaum ging es gut. Er war ein Geschenk von Sonia und mir gewesen, ich weiß nicht mehr, ob zu Weihnachten oder zum Muttertag. An den Wänden hingen zahlreiche Fotos, hauptsächlich von Brücken, die Papa in Venezuela, Libyen, Angola oder Paraguay gebaut hatte.
Die Zimmertüren standen sperrangelweit offen. Alle. Er ertrug es nicht, sie geschlossen zu sehen. Wenn die Zimmer schon leer standen, sollten sie wenigstens atmen können.
(Ich weiß noch, wie er einmal viele Jahr später, ehe er ins Krankenhaus kam, unvermittelt im Flur herumfuhr, als wollte er ein Gespenst erwischen, und dann wie ein betretenes Kind zu Boden blickte, als er die von einem Luftzug bewegte Gardine sah.)
In der Küche schaltete er das Radio an und stellte die Nachrichten ein, dann nahm er den hölzernen Tisch, die Schöpfkellen, die Schaumlöffel, die an den Haken baumelnden Küchengeräte aus Edelstahl und Silikon und den Geschirrschrank ins Visier. Er öffnete den Kühlschrank, stützte sich mit einer Hand auf die Tür und inspizierte den Inhalt. Auf dem Fußboden standen die Tüten mit den Einkäufen vom Vortag.
Habt ihr einen Feldherrn vor Augen, der auf dem Hügel steht, ehe die Schlacht beginnt? Genau so. Fehlte nur noch das Fernrohr, und währenddessen saß ihm die Angst im Nacken, der Tochter und den zwei Enkelinnen fades oder versalzenes Essen vorzusetzen, sich bei den Mengenangaben zu vertun und ungenießbaren Brei zusammenzurühren — Greta und Rachele, die beklommen zur Mutter linsten: Nimm’s ihnen nicht übel, sie haben keinen Hunger, wir haben spät gefrühstückt.
In meiner Vorstellung werden seine Gedanken erst abgelenkt, als sein Blick den hellblauen Zettel streift, der unter einem Pfirsich-Magneten am Kühlschrank hängt. Darauf hatte Sonia meine neue Handynummer notiert. »Ruf sie an«, hatte sie mit einem Ausrufezeichen darübergeschrieben.
An jenem Sonntagmorgen betrachtete Papa ihn lange, so sagte er mir.
Dann, weil ihm der Zettel dort unerträglich wurde wie grelles Licht in den Augen, nahm er ihn ab und heftete ihn an die Pinnwand in der Diele; er warf einen letzten Blick darauf, drehte sich um und kehrte in die Küche zurück.
Daran kann ich mich noch gut erinnern: Ich war zehn Jahre alt, als Papa eines Nachmittags kurz vor Weihnachten mit mir Eislaufen ging. Sonia war beim Schwimmen und Alessandro beim Fest eines Klassenkameraden. Ich sehe den Schlittschuhvermieter noch vor mir, ein Kerl mit rotem Wikingerbart und Zipfelmütze. Er gab mir ein auberginefarbenes Paar Schlittschuhe, das funkelnagelneu aussah, derweil seine, also Papas, hellblau und abgenutzt waren. Aus den Lautsprechern schallten von einem Kinderchor gesungene Weihnachtsschlager.
Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Aber er war gut. Wie immer. Damals kam es mir vor, als beherrschte er alles mit fragloser Selbstverständlichkeit.
Papa fasste mich an den Händen und zog mich im Rückwärtslauf über die Bahn. Ich sah ihm direkt in die Augen, und seine Augen hatten die Farbe des Waldes, genau wie meine. In meiner Erinnerung ist es, als wären wir allein und sonst niemand dort — das stimmte nicht, doch fühlte es sich so an: Als würden wir mit verschränkten Händen mitten auf einem weiten, zugefrorenen See schweigend unsere Pirouetten drehen, während ein seidiger, vanilleduftender Nebel uns umfing, sich für uns teilte und uns von der Welt trennte. Heute würde ich sagen, er trennte uns von Gehässigkeit, von grundlosem Neid. Wenn ich das Gleichgewicht verlor, hielt Papa mich fest. Wenn sich eine Schlittschuhkufe im Eis verhakte, genügte ein leichter Druck seiner Hand, um mir wieder Mut zu machen. Unter mir nahm ich Schatten wahr. Riesenhafte Schatten. Mir war, als glitten Walfische unter der durchscheinenden, mit Raureif bedeckten Oberfläche dahin. All das gleich hinter dem Turiner Messegelände, nur einen Steinwurf vom Straßenverkehr und den Billiglutscher-Buden entfernt.
Das konnte er, mein Vater.
Es begann zu schneien. Wir waren im Freien. Am liebsten wäre ich nie mehr fortgegangen. Am liebsten wäre ich für immer dortgeblieben, um mit ihm übers Eis zu schlingern; wenn ich hingefallen wäre, hätte er den blauen Fleck geküsst, und der Schmerz wäre wie durch Zauberhand verflogen. Da waren nur ich, er und die Walfische und hörten Last Christmas von Wham. Gesungen von einem kleinen Mädchen, das, da war ich mir sicher, die gleiche Zahnspange trug wie ich.
Mein Vater hatte den Samstag damit zugebracht, das Essen zu planen und sich Sonias, Gretas und Racheles Lieblingsgerichte ins Gedächtnis zu rufen. Um den Schwiegersohn hatte er sich keine Gedanken gemacht: Der liebte Arneis, und davon lagen stets ein paar Flaschen kalt.
Für Sonia wollte er gefüllte Zwiebeln, Seirass-Pudding und Tagliatelle mit Borretsch machen. Für die Enkelinnen Hühnchen in Aspik und Knoblauchbrot. Abschließend Zuppa inglese und Baci di Dama zum Kaffee. Traditionelle Gerichte. Gerichte unserer Tradition. Gerichte, um die sich in unserer Familie mit der Zeit Anekdoten und Erinnerungen gesammelt hatten, und er wusste, es wäre Betrug gewesen, sie im Restaurant zu holen, ein unverzeihlicher Verrat — von den gekauften Baci di Dama abgesehen. Als er beschlossen hatte, Sonias Familie einzuladen, wusste er, dass er sich zum ersten Mal in seinem Leben an den Herd würde stellen müssen. Und er wusste auch, dass er um Mamas rotes Rezeptbuch nicht herumkäme, dieses überdimensionierte Moleskine, das schon vor Alessandros Geburt Teil unseres Lebens gewesen war und uns, als wir klein waren, sogar in die Ferien begleitet hatte.
Obwohl er es nie aufgeschlagen hatte — in den letzten acht Monaten hatte er keine Gäste gehabt und dank Fertigsoßen, gegrilltem Hähnchenschnitzel und Tomatensalat überlebt —, war kein Tag vergangen, an dem Papa es nicht mit dem Finger gestreift hatte, durchzuckt von einem Gefühl, als bisse ein Maulwurf ihm in die Zehen. Als er es am Vortag zur Hand genommen hatte und ihm beim Blättern nach den fraglichen Rezepten die Handschrift meiner Mutter ins Auge gesprungen war — dieses schnörkelige s, eine Geziertheit, die gar nicht zu ihrer schnellen, pragmatischen Art passte, und das t mit dem überlangen Querstrich —, war ihm die Luft weggeblieben. Mit der Sorgsamkeit eines Blinden hatte er die Seiten gestreichelt, um die Druckspuren des Stiftes zu fühlen, und seine Augen hatten sich mit Tränen gefüllt.
Mit diesem Gedanken riss er, wo er schon einmal da war, das Zwiebelnetz auf. Er schaute durchs Fenster und sah den klaren Himmel mit jeder Sekunde heller werden. Er schüttelte seine Benommenheit ab und fing an, alle nötigen Zutaten auf den Tisch zu stellen. Im Radio berichtete eine rauchige Stimme von einer Kollektivausstellung im Palazzo delle Esposizioni in Rom: »Einundzwanzig ausgewählte Künstler, zehn Designer, siebzig Werke unterschiedlicher Materialen, ausgenommen Plastik, das in der Vergangenheit zwar Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung gewesen ist, wegen seiner umweltschädlichen Eigenschaften heute jedoch kritisch gesehen wird …« Er hatte gerade das Fleisch für die Zwiebelfüllung aus dem Kühlschrank geholt, als es an der Tür klingelte. »Ciao!«, krächzte eine heisere Stimme, die auf dem Treppenabsatz widerhallte, und dann noch fünf oder sechs Mal in derselben Tonlage, ehe er überhaupt den Gedanken fassen konnte zu öffnen.
Vierzig Jahre lang war Papa durch die Welt gereist, um Brücken und Überführungen zu bauen. Seine Familie stammte aus Como. In Mailand hatte er seinen Abschluss in Ingenieurwesen gemacht. Durch einen Freund der Familie war er von einer seinerzeit namhaften Firma angestellt worden, die einen guten Draht in die Politik hatte und in rund fünfzehn Ländern tätig war: Dämme, Wasserkraftanlagen, Bahnlinien. Und Brücken — Brücken, Brücken, Brücken, die er mehr als alles andere liebte und denen er sich verschrieben hatte. Er hatte rasch Karriere gemacht und dies weniger mit Verwunderung, denn als Folgerichtigkeit zur Kenntnis genommen: Er wusste, dass er gut war, und fand es selbstverständlich, dass die Welt seinem Können Rechnung trug.
Wenn er nicht auf Reisen war, erzählte er uns von seiner Arbeit, von den Orten, an denen er gewesen war, den Menschen, die er getroffen hatte, dem Leben auf dem Bau — einem Teil des Lebens auf dem Bau — und den Widrigkeiten, die er in spannende Abenteuer verwandelte — damals, als das Gewitter gekommen war, oder nein, wartet, ein Orkan, und damals, als die Heuschrecken eingefallen waren, eingefallen, ich schwör’s euch, wie eine biblische Plage. Er erzählte uns von den für ihn legendären Zeiten, in denen man zum Brückenbau ganze Flüsse umleitete und das Flussbett trockenlegte, um die Lehrgerüste zu bauen, auf denen die Quader bis zur endgültigen Schließung der Brückenbögen auflagen. Irgendwann während seiner mit Fachbegriffen und technischen Details gespickten Erzählungen gab es einen Moment — den gab es immer —, in dem er plötzlich verstummte und mit hin und her, her und hin haschenden Augen unseren Blick suchte, weil er annahm, wir hätten unterwegs den Faden verloren.
Er wartete auf eine Frage. Fragen waren für ihn ein Zeichen von Klugheit, und wir spielten mit: Wir fragten ihn, was Lehrgerüste und Quader seien, ließen uns die Aufgaben der Gewerke erklären und entlockten ihm die kuriosesten Details. Währenddessen aß Mama weiter, räumte ab, brachte den Nachtisch und lächelte vielsagend, als säße sie in einem Theaterstück, das sie schon kannte, und wartete auf den nächsten Gag. Papa malte mit den Fingern in die Luft, ihr müsst euch das so vorstellen, die Lehrgerüste sind Hilfskonstruktionen, die das gemauerte Bauwerk bis zur Fertigstellung tragen, und die Quader sind die Steinblöcke zum Bau der Bögen, und diese Quader können je nach Verwendung unterschiedlich geformt sein, und wenn sie anständig gemacht sind, dann halten sie auch ohne Mörtel, und, und, und.
Er erzählte, wie Brücken sich in Monolithen verwandeln konnten, war das Lehrgerüst erst einmal fort, und sich wie von Wind und Eis geformt in die Landschaften einfügten. Wenn Alessandro — er war es meistens — seine Erbsen und Karotten mit der Gabel traktierte und dagegenhielt, Brücken könnten auch einstürzen, Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen könnten sie einfach wegfegen, wedelte Papa mit den Händen und antwortete, sicher, genauso wie Klippen einstürzten und Berge verflachten. Menschliche Nachlässigkeit, Oberflächlichkeit und Unfähigkeit zählten für meinen Vater nicht. Er zog sie nicht in Betracht. Nicht, wenn es um Brücken ging. Er und Mama hatten sich während einer Silvesterparty bei gemeinsamen Freunden kennengelernt. Sie war achtundzwanzig, er zwei Jahre jünger. Am Dreikönigswochenende war er ihr nach Nizza nachgereist, wo sie mit ihrer Familie Verwandte besuchte. Als sie ihn während eines Spazierganges mit den Eltern und zwei Tanten an der Promenade des Anglais aus dem Auto steigen sah, hatte sie ihm die kalte Schulter gezeigt und auf sein plötzliches Auftauchen reichlich verärgert reagiert — und überhaupt, wie hießen Sie noch gleich? —, doch nach ihrer Rückkehr hatte sie sich von den Freunden, bei denen sie sich begegnet waren, seine Nummer geben lassen und ihn angerufen. Zwei Jahre später hatten sie geheiratet. Da Mamas Familie in Turin lebte und er häufig fort und mitunter sehr weit weg war und diese Dienstreisen Wochen oder Monate dauern konnten — als ich in der Zehnten war, blieb er von Ende August bis kurz vor Weihnachten ununterbrochen in Venezuela —, beschlossen sie, in die Nähe der Großeltern zu ziehen, und kauften mit Unterstützung beider Familien die Wohnung am Lungo Po Antonelli.
Sonia kam sofort. Dann ich. Alessandro vier Jahre nach mir.
Damals arbeitete Mama in einem Notariat. Als Sonia geboren wurde, beantragte sie Teilzeit. Als ich kam, gab sie die Stelle auf. Papa verdiente sehr anständig, sie musste nicht arbeiten, konnte zu Hause bleiben, Mutter sein und auf seine Rückkehr warten. War es ihr schwergefallen, ihre Karriere aufzugeben? Hatte sie sich herabgesetzt und zu kurz gekommen gefühlt? Ich weiß nur, dass Mama den Dingen nicht nachweinte und sich nur selten umentschied. Wäre ich damals so weit gewesen wie heute, hätte ich sie danach gefragt, ich hätte gründlich nachgehakt; jedenfalls war es bestimmt nicht einfach, sie hätte alles erreichen können, einfach alles, sie war eine brillante, fröhliche Frau mit beißendem Humor, den sie an der kurzen Leine hielt, um ihr Gegenüber nicht dumm dastehen zu lassen, doch bei passender Gelegenheit machte sie davon Gebrauch, wie um zu sagen: Komm mir bloß nicht so, Schätzchen!
Sie hatte ihren Abschluss in Jura gemacht. Sie liebte das gesetzliche Räderwerk, das das gemeinschaftliche Miteinander am Laufen hält, das empfindliche Zusammenspiel aus Rechten und Pflichten, zu dem sie uns beharrlich erzog. Fast die gesamte Schulzeit hindurch ist sie bei jedem von uns einmal Elternvertreterin gewesen. Im September half sie uns, die Schulbücher in Folie einzuschlagen, damit sie nicht zerfledderten, und bat uns, nur mit Bleistift hineinzuschreiben und anzustreichen, damit man sie im nächsten Jahr noch verkaufen konnte. Wenn ich an die Selbstverständlichkeit denke, mit der sie den Haushalt führte, und dann an die Unbedarftheit, die ich dabei an den Tag lege …
Sie hörte gern Radio, wenn sie in der Wohnung zugange war, stellte gern Gegenstände um, damit sie besser miteinander harmonierten, und hatte eine Schwäche für Origamis, die sie aus jedem rechteckigen Papier faltete, das sie in die Finger bekam, selbst aus Kassenbons; sie hatte einen Kurs bei einer Japanerin gemacht, die mit einem Professor an der Technischen Hochschule verheiratet war und auf der anderen Flussseite wohnte. Mama freute sich, wenn wir Freunde zum Spielen oder Lernen einluden, und waren sie gegen sechs Uhr noch immer da, versäumte sie es nie, sie zum Abendessen einzuladen.
Nur einmal habe ich sie in Panik erlebt. Es war an einem Aprilnachmittag. Ich war neun Jahre alt. Alessandro fünf. Wir waren auf dem Spielplatz, und während sie mit einer anderen Mutter plauderte, hatte Ale ein Klettergerüst erklommen, das Gleichgewicht verloren und war auf das Pflaster gestürzt. Damals gab es noch keine Fallschutzbeläge wie heute. Als Mama ihn unter den Achseln packte und hochzog, war das Gesicht meines Bruders ein roher Klumpen aus Blut und Splitt; sein Kinn unterhalb der Lippe war aufgeplatzt wie ein zweiter Mund, aus dem die noch im Zahnfleisch versteckten zweiten Zähne hervorschimmerten. Wir waren nicht weit vom Gradenigo-Krankenhaus. Das Logischste wäre gewesen, mit Vollgas in die Notaufnahme zu fahren. Doch stattdessen beschloss sie aus unerfindlichen Gründen, Alessandro und mich ins Auto zu bugsieren und uns, weil Papa nicht da war und sie so heftig zitterte, dass sie kaum sprechen konnte, zu den Großeltern nach Borgo Vittoria zu bringen. Als mein Opa Ale in diesem Zustand sah, war er außer sich. Er fragte meine Mutter, was zum Teufel sie bei ihnen zu suchen hätte — glaubte sie etwa, es wäre mit einem Pflaster getan? Ohne ein weiteres Wort ließ er mich bei Oma, setzte Ale und Mama in seinen Renault und raste ins Krankenhaus.
Ich weiß noch, wie sie sich irgendwann Jahre später — ich muss siebzehn oder achtzehn gewesen sein — beim mittäglichen Abwasch plötzlich mit der schaumbedeckten Hand gegen die Stirn schlug, ein, zwei, drei Mal, und kopfschüttelnd »So blöd so blöd so blöd« in sich hineinmurmelte. Ich ging zu ihr und fragte, was los sei. Sie sah mich mit tränenfeuchten Augen an, eine Schaumflocke im Haar, sie sah mich an und sagte: »Ich bin so blöd gewesen …« Sie war fassungslos. »Wie konnte ich nur …« Ich sagte, ich wisse nicht, was sie meine. »Alessandro … als er von dem Klettergerüst gefallen ist. Wieso habe ich ihn nicht sofort ins Krankenhaus gebracht?« Ich musste lächeln. Ich sagte: »He, was hast du denn? Das ist Jahre her. Mal überlegen, wie lang ist das her? Neun Jahre vielleicht. Oder zehn.« Ich sah, wie sich ihre Brust unter der Bluse hob. Sie war völlig außer sich vor Reue. »Wie konnte ich nur? Ich war so blöd«, wiederholte sie. »So blöd …«
Andrea sagte »Ciao!«, als er die Schritte hinter der Tür hörte, dann noch einmal, als sich der Schlüssel im Schloss drehte, und noch einmal, als die Tür sich öffnete. Er war der Sohn der Nachbarin. Er sah einem nie in die Augen. Er war sechzehn Jahre alt, benahm sich aber wie fünf. Das Haar wuchs ihm über Ohren und Augen. An diesem Tag trug er einen roten Adidas-Trainingsanzug, Jacke plus Hose — er liebte Adidas-Trainingsanzüge.
»Andrea …«
»Er nimmt die Leute hoch.«
»Was?«
»Er nimmt die Leute hoch.«
Papa kniff die Augen zusammen und presste die Fingerspitzen auf die Lider. »Andrea, weißt du, wie viel Uhr es ist? Um diese Zeit kannst du nicht einfach irgendwo klingeln. Es ist …« Er schaute auf die Uhr. »Es ist noch nicht einmal acht, Herrgott noch mal. Es ist Sonntag. Wo ist deine Mutter?«
»Schläft. Sie schläft.«
»Tja, wenn das so ist, solltest du zu Hause sein und lesen oder sonst was. In deinem Zimmer.«
»Ja, aber warte … er nimmt die Leute hoch.« Er prustete los, als hätte er etwas Urkomisches gesagt.
»Wer?«
»Das musst du sagen.«
»Wer nimmt die Leute hoch? Hat jemand dich auf den Arm genommen?«
Andrea lachte noch lauter, mit einem schnarrenden Sauggeräusch, schlug sich wild auf die Schenkel und machte eine seltsame Handbewegung, als wollte er sich eine Fliege von der Nase wischen.
»Nein. Du hast’s nicht kapiert. Du hast’s nicht kapiert. Du musst raten.«
»Entschuldige, Andrea, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, ich …« Mit dem Daumen deutete er vage hinter sich. »Ich habe zu tun. Tut mir leid.«
»Nein nein nein. Los. Rate. Rate.«
»Was soll ich erraten? Wer hat dich hochgenommen?«
»Keiner hat mich hochgenommen.«
»Du hast recht, Andrea, ich kapier’s nicht …«
»Er nimmt die Leute hoch. Ist doch ganz leicht!«
»Ist das ein Spiel? Spielst du?«
Andrea rieb sich den Bauch wie ein Kleinkind, dem etwas schmeckt, dann huschte ein neuer Gedanke über sein Gesicht. »Wo warst du die ganze Zeit?«
»Ich?«
»Wo?«
»Ich war nirgendwo, Andrea. Weißt du doch. Ich gehe nirgendwo mehr hin.«
»Ich habe eine Eidechse gesehen.«
Papa runzelte die Stirn und sagte nichts.
»Hast du sie auch gesehen?«
»Ja.«
»Wo?«
»Manchmal sehe ich welche am Fluss.«
»Meine saß auf dem Bürgersteig vor dem Supermarkt.«
»Nein«, sagte mein Vater, »die habe ich nicht gesehen.«
»Du musst gucken, wo du hintrittst. Reiß dich mal zusammen!«
»Andrea … willst du eine Rumpraline? Ich glaube, ich habe noch welche da.«
Andrea schlug die Hände vors Gesicht und linste durch die Finger auf den Treppenabsatz, als wollte er sichergehen, dass niemand kommt: Zwei aufgeregte Augen blitzten zwischen Zeige- und Mittelfinger hervor, und hinter den Handflächen war ein unterdrücktes Glucksen zu hören.
»Willst du eine?«
Andrea nickte ungestüm, ohne die Hände vom Gesicht zu nehmen.
»Warte hier.«
Aus der Küche drang die Stimme eines Journalisten, der eine Europaabgeordnete zur Reform der Dublin-Verordnung interviewte — »das ist nicht der Punkt, vielmehr gibt es noch immer Widerstand gegen den Verteilungsschlüssel, vor allem von Ländern der Visegrád-Staaten wie Polen, der Tschechischen Republik oder der Slowakei«. Mein Vater kehrte mit einer unverpackten Praline zurück, wie es sie früher in Konfektschachteln gab, keine Ahnung, ob es die heute noch gibt, ich habe seit Ewigkeiten keine mehr gesehen — »Großbritannien hat sich noch nicht geäußert, die anderen Staaten der Union zeigten sich verhandlungsbereit; und ja, Griechenland, Malta und Zypern waren ebenso wie wir schon immer der Meinung, dass ein Verteilungsschlüssel unabdingbar ist«. Andrea hopste auf der Stelle, als müsste er dringend aufs Klo.
»Hier. Es war noch eine da.«
»Mit Rum?«
»Mit Rum.«
Andrea schnappte danach, schob sie sich mit der flachen Hand in den Mund und leckte die winzige Spur Schokolade von seiner Handfläche, und die Unbekümmertheit dieser Geste, die auf alle Regeln pfiff, verschaffte meinem Vater eine flüchtige Erleichterung, als würde man an einem Wintertag heimkommen und die kalten Hände unters warme Wasser halten, doch als er Andrea endlich überredet hatte, zu seiner Mutter zurückzukehren, und die Tür hinter sich zuschob, blieb er mit einer Wehmut zurück, die er vergeblich abzuschütteln versuchte. Der Anblick des aufgeschlagenen roten Rezeptbuches auf dem Tisch und Mamas Handschrift machten es nicht besser. »… es brauche Entschlossenheit, man könne nicht weiter um den heißen Brei reden, sagte der Sprecher der Progressiven Allianz im Europäischen Parlament.«
Dass ich mich ins Theater verliebt habe, ist eindeutig meiner Mutter zu verdanken.
Er hat mich nie bestärkt.
Sie war es, die mit mir zu Kinderaufführungen ging, sie hat mich bei meinem ersten Schauspielkurs eingeschrieben und mich ermutigt, dieser unbeholfenen Leidenschaft nachzugehen, die sich mit den Jahren mühselig in einen Beruf verwandelt hat. Er hielt das — natürlich — für Zeitverschwendung. Mein Bruder studierte Chemie. Ah! Die Chemie! Ich weiß noch, wie ihm dieses Wort wie ein Bissen Strudel auf der Zunge zerging. Meine Schwester Erziehungswissenschaften, ein für unseren Vater zwar hochgradig schwammiges Fach — keine Lehrgerüste, um die wandelbare Jugend zu stützen, keine Quader, die ewig bleiben würden —, dessen Nutzen ihm jedoch offenbar irgendwie einleuchtete, und sei er nur wirtschaftlich: weniger Kriminalität, weniger Schulverweigerer, weniger Sozialausgaben. Aber Theater? Theater war schön und gut, solange man es den anderen überließ. Man besuchte es. Man machte es nicht selbst. Davon leben, davon leben zu wollen, sicher nicht. Zwar hat er mir das nie gesagt, aber immer gedacht, das weiß ich.
Nur zweimal ist es vorgekommen, dass Papa während meiner Aufführungen nicht auf Reisen war. Ich kann mich an beide Male genau erinnern. Selbst jetzt, Jahre später, fühle ich die verstörte Beklommenheit. Das erste Mal war ich sechzehn, und wir brachten Die Mausefalle auf die Bühne, das zweite Mal, mit einundzwanzig, war ich die Petra Stockmann in Ibsens Ein Volksfeind