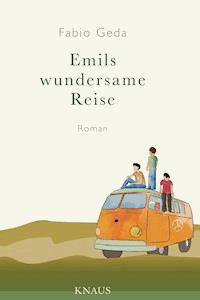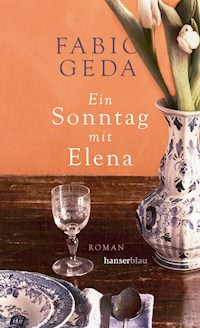3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Suche nach dem richtigen Platz in dieser Welt – ein berührender Roman vom Autor des Bestsellers »Im Meer schwimmen Krokodile«
Der 15-jährige Ercole hat es nicht leicht: Er muss früh lernen, für sich und seine Schwester Asia Verantwortung zu übernehmen. Seine Mutter ist schon vor vielen Jahren ausgezogen, sein Vater ein Alkoholiker, der sich mit dubiosen Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Zusammen mit seiner Schwester bewahrt Ercole mühsam die Familienfassade, damit das Jugendamt nichts merkt. Trotz allem ist er ein zufriedener, unbeschwerter Junge. Besonders als er Viola kennen lernt, die in Ercoles Bauch Schmetterlinge zum Tanzen bringt ...
Bestsellerautor Fabio Geda erweist sich erneut als Meister im Porträtieren von Kindern und Jugendlichen. Ihre kleinen und großen Nöte inspirieren ihn immer wieder zu ganz besonderen Geschichten – emotional, authentisch, unvergesslich.
»Wunderbar leicht erzählt Fabio Geda von den Mühen und dem Staunen eines Teenagers, der die herzzerreißende Suche unternimmt, seinen Platz in der Welt zu finden.« La Stampa
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über das Buch
Ercole musste früh lernen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Zusammen mit seiner Schwester Asia bewahrt er mühsam die Familienfassade, um sich das Jugendamt vom Hals zu halten. Doch die Normalität ist ein fragiles Gebäude, das täglich einzustürzen droht. Als es schließlich geschieht, kann niemand die Lawine aufhalten, auch nicht das Mädchen Viola, das in Ercoles Bauch Schmetterlinge zum Tanzen bringt. Ist es für einen wie ihn nicht vorbestimmt, immer tiefer in Schwierigkeiten zu geraten?
Fabio Geda erweist sich erneut als Meister im Porträtieren von Kindern und Jugendlichen. Ihre kleinen, großen und auch sehr großen Nöte inspirieren ihn immer wieder zu ganz besonderen Geschichten.
Über den Autor
Fabio Geda, 1972 in Turin geboren, arbeitete viele Jahre mit Jugendlichen. Sein Bestseller Im Meer schwimmen Krokodile, der auf einer wahren Geschichte beruht, wurde in über 32 Sprachen übersetzt und machte ihn international bekannt. Im Knaus Verlag sind von Fabio Geda bisher drei Romane erschienen.
FABIO GEDA
Vielleicht wird morgen alles besser
ROMAN
Aus dem Italienischen von Christiane Burkhardt
Knaus
Für Elisa und Riccardo – Schwester, Bruder
1
Ich weiß noch genau, wie ich an dem Morgen, als ich auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums aus dem Lieferwagen stieg und das Gewehr vom Rücksitz nahm, flüchtig zum Wald hinüberschaute und die Sonne wie einen blauen Fleck über der Landschaft aufgehen sah. Es war Oktober, und ich war fünfzehn. Luca schaute in dieselbe Richtung und sagte: »Ich bin müde.« Dabei schob er die Hand unter den Footballhelm und kratzte sich an der Wange. Er klang kein bisschen weinerlich. Luca war am Vortag sechs geworden. Kurz überlegte ich, ihm auch ein Gewehr zu geben, weil zwei auf der Rückbank lagen, aber dann dachte ich, lieber nicht.
»Komm mit!«
Luca gehorchte.
Wir rannten über den Parkplatz zu einer der Lagerhallen. Wir erreichten die Außentreppe. Ich zog ihn hoch, umklammerte dabei seine Hand, damit er nicht ausrutschte, doch mit der anderen musste ich Geländer und Gewehr festhalten. Ich hörte die Polizeisirenen, hörte, wie die Autos mit quietschenden Bremsen vor dem Gittertor hielten, aber nicht, wie die Polizisten ausstiegen, den Lieferwagen durchsuchten und die Lautsprecher des Streifenwagens einschalteten – das nicht. Aber ich hörte, wie mein Name gerufen wurde.
»Ercole«, sagte eine von einem Megafon verzerrte metallische Stimme. »Ercole, komm da raus und mach keinen Unsinn!« Dem Beamten war anzuhören, dass er sich bemühte, höflich zu bleiben, aber in Wahrheit lieber gesagt hätte: »Ercole, Ercole, komm da raus und mach keinen Scheiß«, aber das durfte er nicht, vielleicht weil noch wer dabei war, der sich beschweren würde, falls er dieses Wort benutzte, irgend so ein Gutmensch. Deshalb wiederholte er: »Mensch, Ercole, wir wissen, dass du da drin bist. Leg das Gewehr weg und komm raus.«
Tsss!, dachte ich. Zunächst einmal bin ich gar nicht drin, sondern drauf – oben auf dem Dach. Und außerdem sind Polizisten wirklich komisch: Manchmal führen sie sich total auf – wie damals, als sie meinen Vater verhaftet haben –, und dann haben sie wieder Schiss, weil so ein Gutmensch dabei ist. Ich dagegen hatte kein bisschen Angst vor solchen Wohltätern. Im Gegenteil! Die würden mich niemals kriegen.
»Ercole!«, brüllte nun der Polizist, »verdammt noch mal, hast du mich verstanden, du kleiner Scheißer?«
Ach so, ja, ich heiße übrigens Ercole.
2
Denn die ganze Zeit ist ja Zeit vergangen.
Du kannst mit deinem Herzschlag
keine Zeit totschlagen. Alles verbraucht Zeit.
Bienen müssen sich sehr schnell bewegen,
um still zu stehen.
DAVID FOSTER WALLACE
Seit diesem Tag, an dem ich mit Luca aufs Dach geklettert bin, sind vier Jahre vergangen, ich habe also genug Wasser den Fluss runterfließen sehen, vor allem zwischen der Piazza Vittorio und der Kirche Gran Madre di Dio. Darauf werde ich noch zurückkommen, aber vorher muss ich noch ein paar Kleinigkeiten loswerden, damit man sich ein besseres Bild von der Situation machen kann und versteht, wie ich da oben gelandet bin.
Zunächst einmal bin ich geboren worden. In Turin, im Cenisia-Viertel. Mama hat immer gesagt, dass ich sie an Yoda erinnert habe, als sie mich im Kreißsaal zum ersten Mal sah – nur dass ich etwas mehr Haare hatte. Aber zum Glück habe ich mich weiterentwickelt und könnte heute locker Enrique Iglesias’ Sohn sein. Ich habe viele Sachen und Orte noch nie gesehen, das Polarlicht zum Beispiel, die Wasserung eines Flugzeugs oder ein Livekonzert von Eminem, Erdölplattformen, Gewitter an der Mündung des Catatumbo-Flusses und die meisten Städte dieser Welt. Dafür war ich mit der Schule in Mailand, in Boves und in Pietra Ligure am Meer.
Meine Oma verkaufte Fisch an der Porta Palazzo, und mein Opa liebte Hundekämpfe genauso wie Basilikumgrappa: Ich erinnere mich noch an die Phase, in der er ständig von einem Rottweiler namens Tomba erzählt hat, wie Alberto Tomba, der Skirennläufer aus den Neunzigern. Ich hab nie richtig kapiert, ob er nach ihm benannt war oder so – und ich glaube nicht, dass mein Opa jemals Ski gefahren ist. Meine Oma starb auf dem Großmarkt, wo sie von einem Gabelstapler überfahren wurde: Ich habe sie sehr geliebt, weil sie mir das Zeichnen beigebracht hat, und obwohl ich sie erst im Sarg wiedersah, als ihr das halbe Gesicht fehlte, durfte ich ihr ein Pokémon in die Hand drücken: Squirtle. Und sonst? Na ja, mein Opa hat hin und wieder meinen Pimmel angefasst. Aber nicht so, wie man denken könnte. Es war eher was Technisches: Wie ein Mechaniker, der nachschaut, ob er noch da ist. Keine Ahnung, was aus meinem Opa geworden ist. Seit Mama weg ist, hab ich ihn nicht mehr gesehen.
In dem Sommer, als ich fünfzehn war und mir alles um die Ohren geflogen ist, in dem ich mit Luca abgehauen bin und so, war ich eins sechsundsechzig. Wer sich eine Vorstellung davon machen möchte, wie ich aussehe, dem sei gesagt, dass ich die kleinen Ohren und runden Schultern meines Vaters und die dunklen Augen und langen Wimpern meiner Mutter habe, dazu einen Gesichtsausdruck, der einigen Leuten zufolge so aussieht, als wäre ich ständig verliebt oder würde ein Feuerwerk bestaunen. Aber ich habe mich bloß einmal verliebt. Und das einzige Feuerwerk, das ich kenne, findet am Abend des 24. Juni statt, wenn in Turin San Giovanni gefeiert wird … und mein Geburtstag.
In dem Herbst, als ich in die erste Klasse ging – in dem ich also sechs war und meine Schwester Asia elf –, ist meine Oma wie bereits erwähnt von einem Gabelstapler überfahren worden. Mama hat uns an einem x-beliebigen Tag verlassen, an dem nicht mal schlechtes Wetter war, wie es eigentlich sein sollte, wenn Mütter einen verlassen, sprich bei Regen oder an einem Tag, an dem der Himmel an eine Fischhaut erinnert. Opa ist kurz vor dem Abendessen gegangen, um mit Tombas Besitzer zu reden, und nie mehr wiedergekommen. All das geschah im Laufe einer einzigen Woche. Es war Sonntag, als Papa es merkte. Am Vormittag kam er nach einer auswärts verbrachten Nacht zurück, machte den Kühlschrank auf, nahm die Milch raus, schnupperte daran, um festzustellen, ob sie noch gut war, schenkte sich eine Tasse ein, suchte nach der Packung mit Keksen – es war nur noch einer drin –, setzte sich an den Küchentisch, tunkte den letzten Keks ein, wobei er sich die Finger nass machte, schaute auf und sah in diesem Moment mich sowie Asia an der Tür stehen: ich mit Roxy unterm Arm, dem alten Teddy, der einst meiner Schwester gehört hat, weshalb ich ihn nicht umtaufen durfte, und Asia in einem schwarzen T-Shirt mit dem Aufdruck »Das Beste kommt erst noch«. Da schaute er sich um und sagte: »Wo, zum Teufel, sind bloß alle?«
»Wer?«, sagte Asia.
Der weiche Keks brach und plumpste in die Tasse.
»Eure Mutter?«, sagte Papa und zog fragend die Braue hoch.
»Weg?«, äffte ihn Asia nach.
Es geschah öfter, dass sich die beiden unterhielten, indem sie sich Fragen stellten, die keine waren.
»Wohin?«
»Weißt du das denn nicht?«
Papa verspeiste das Keksstück, das er noch zwischen den Fingern hielt, leckte sie ab, stand auf, wobei er den Stuhl laut über den Fußboden schrammen ließ, und ging ins Schlafzimmer. Der Kleiderschrank stand sperrangelweit offen, er war leer. Es hingen nur noch nackte Kleiderbügel darin. Auf dem Bett lagen nicht zusammenpassende Socken, ein BH und ein Pulli, den ihr die Oma vom Markt an der Porta Palazzo mitgebracht hatte, der ihr aber nach einhelliger Meinung nicht stand. Er war pistaziengrün und mit Papageien und Hubschraubern bedruckt. An der Wand waren die Umrisse eines abgehängten Bildes zu sehen. Papa blieb stumm davor stehen und starrte eine Ewigkeit auf den Schrank. Das weiß ich noch genau, weil ich dringend Pipi musste, aber nicht wegwollte, denn damals, wo ich so viele Leute hatte verschwinden sehen, hatte ich Angst, niemanden mehr vorzufinden, wenn ich von der Toilette käme. Er streckte den Arm aus, um auf die traurigen Überreste zu zeigen, und sagte: »Ich fass es nicht, sie hat auch meine Klamotten mitgenommen.«
»Quatsch!«, sagte Asia, »da sind sie doch.« Sie zeigte mit dem Kinn auf den hintersten Winkel des Schranks.
Papa umrundete das Bett, beugte sich vor und griff nach einer Camouflagehose und einem rosa Hemd mit spitzem Kragen, dessen Brusttasche mit einer Doppelreihe Strasssteine verziert war. Dann schaute er zur Decke hoch und atmete erleichtert auf. »Gott sei Dank!«, sagte er.
Somit blieben wir allein zurück: Papa, Asia und ich. Fest stand, dass wir jetzt zu Hause so viel Platz hatten, dass wir gar nicht wussten, was wir damit anfangen sollten. Wir wohnten im obersten Stockwerk – vierte Etage ohne Lift – in einem vor etwa hundert Jahren für Arbeiter einer nahe gelegenen Fabrik und ihre Familien errichteten Gebäude: Zimmer, Küche, Bad. Asia und ich hatten bisher in einem abgetrennten Bereich geschlafen, hinter einer Wand aus Gipskarton. Dort war gerade genug Platz für unser Stockbett. Opa und Oma, also die Großeltern mütterlicherseits, hatten, solange es sie gab, in der Küche auf dem orangefarbenen Ausziehsofa übernachtet. Wollte man es ausziehen, musste man erst mal den Esstisch und die Stühle vors Küchenbüfett schieben.
Die Wohnung gehörte der Witwe Rispoli, die bei uns immer nur »die Witwe« hieß, ein Gutmensch und Freundin des Pfarrers Don Lino. Sie hatte uns die Wohnung nach meiner Geburt vermietet. Die Witwe besaß so viele Häuser, dass sie gar nicht mehr wusste, wohin damit, und Don Lino hatte sie überredet, nur eine niedrige Miete zu verlangen – so niedrig, dass sie kaum mehr als die Nebenkosten deckte. Denn so ist das Leben, wenn alles gut läuft: voll großzügiger Leute. Um die Witwe glücklich zu machen, brauchten wir Kinder sie nur mit einem Lächeln und einer Zeichnung zu begrüßen, wenn sie kam, um die Miete abzuholen. Die Großeltern plauderten kurz bei einer Tasse Kaffee mit ihr, und Papa gab ihr einen Handkuss – vorausgesetzt, er drückte sich nicht gerade. Es genügte, ihr Gelegenheit zu geben, ob unserer Dankesbezeugungen zu erröten. Um sie dann mit einem schweren Umschlag voller Münzen wieder nach Hause zu schicken, die wir extra sammelten, um ihr zu verstehen zu geben, dass wir gezwungen waren, unser Sparschwein zu schlachten, wenn wir sie bezahlen wollten.
Nachdem Mama und die Großeltern weg waren, blieben nur noch Asia und ich, um sie zu empfangen. Wir duschten. Wir kämmten uns. Wir zogen ein sauberes T-Shirt an. Und antworteten auf die Frage: »Wie geht’s euch, meine Kleinen, kann sich euer Vater überhaupt um euch kümmern, jetzt, wo er ganz alleine ist?« mit Blicken und Schilderungen, die so rührend waren, dass Papa beim Abendgebet der Witwe einen immer höheren Stellenwert bekam.
Um die Traurigkeit zu verscheuchen, die auf uns lastete, seit Mama gegangen war – eine Traurigkeit, die sich anfühlte, als würde ich ein Loch in mir ausheben und müsste tonnenweise Schutt entsorgen, wobei mir Asia ständig im Weg stand, sodass ich monatelang nur noch stolperte (deswegen, aber nicht nur) –, um diese Traurigkeit zu verscheuchen, entfernte Papa die Gipskartonwand, die das Schlafzimmer teilte, und meinte, der ganze Raum gehöre jetzt uns; er werde auf dem Küchensofa schlafen. Na ja, es war nicht ganz dasselbe, wie Mama und die Großeltern nebenan zu haben, aber doch etwas, auf das wir uns konzentrieren konnten. Asia und ich beschlossen, gemeinsam im Doppelbett zu schlafen und das Stockbett Papa zu überlassen, falls er der Küche hin und wieder entfliehen wollte. Ich weiß noch, wie ich dachte, wir können ja jetzt Freunde zum Übernachten einladen, doch irgendwie ist es nie dazu gekommen. Wir hatten keine so engen Freunde, die wir hätten einladen können, ohne dass deren Eltern Erkundigungen über unsere Familie einholten. Und dann war die Antwort immer dieselbe: Wenn wir wollten, könnten wir ja bei ihnen übernachten.
Die Wände teilten wir auf: Asia nahm die hinterm Ehebett und die mit dem Schrank. Sie pflasterte sie mit Fotos aus Kochzeitschriften von Schokosoufflés, ausgehöhlten Broten mit Kichererbsencremesuppe, Auberginen-Cannelloni, Nudeln mit Zucchiniblüten, Ente in Orangensauce, Cassata siciliana und Apfel-Charlotte zu. Schon damals wusste Asia, dass sie einmal Köchin werden wollte. Ich dagegen nahm die Wand hinterm Stockbett und die mit dem Fenster. Darauf zeichnete ich meine Monster.
Von klein auf war ich fest davon überzeugt, dass sich Monster in den Wänden verstecken. Dass sie durch die Ziegelfugen schlüpfen, die elektrischen Leitungen als Lift benutzen und ein Riss in Wand oder Zimmerdecke genügt, um sie ins Haus zu lassen. Und in unserem Zimmer, ja eigentlich überall in der Wohnung, herrschte an Rissen wahrlich kein Mangel. Manchmal hörte ich sie darin rumoren, die Monster, flüstern. Ich starrte auf die Risse – vor lauter Angst, es könnte jeden Moment eine schwarze, schleimige, asphaltähnliche Masse daraus hervorquellen, sich auf den Boden ergießen und zu einem Wesen mit Fangarmen und hundert Augen gerinnen, das anstelle eines Mundes nur einen zahnlosen Schlund aufwies. Denn Wandmonster zerfleischen einen nicht: Wandmonster lutschen einen aus wie ein Bonbon. Sie lutschen einen so lange aus, bis man tot ist.
Deshalb zeichnete ich sie. Um ihnen zu zeigen, dass ich wusste, woraus sie gemacht waren. Denn in der Schule hatte ich gelernt, dass Wissen Macht ist. Ich malte sie direkt an die Wand, damit die Monster ihr Ebenbild sahen, wenn sie mir aus den Ritzen hinterherspionierten. So nach dem Motto: Ich weiß genau, wer ihr seid; ich weiß, dass ihr da seid, und solange ihr bleibt, wo ihr seid, stößt niemandem etwas Schlimmes zu. Wenn ich nachts wahnsinnige Sehnsucht nach meiner Mutter bekam und nicht einschlafen konnte, wenn ich versuchte, mir in Gedanken ihr Gesicht auszumalen und nur ein Ebenbild zustande brachte, das aussah, als hätte man eimerweise Farbe aufs Papier geklatscht, in solchen Nächten verfolgten sich die Monster besonders lautstark in den Wänden. Dann wälzte ich mich zwischen den Laken hin und her, suchte nach Asias Hand und drückte sie, während sie seufzte: »Denk nicht mehr dran, Ercole. Denk einfach nicht mehr dran«, ohne dass ich ihr auch nur das Geringste gesagt hätte.
Aus dieser Zeit könnte ich jede Menge erzählen. Zum Beispiel die Geschichte von dem Fahrrad, das Papa mir zum elften Geburtstag geschenkt hat, denn die ist wirklich schräg. Oder die, als die Lehrerin mich und einen Freund in der Sechsten dabei erwischt hat, wie wir »Echte Männer enthaaren sich nicht« mit Kreide an die Schulwand geschrieben haben, woraufhin sie uns unter Androhung eines Verweises gezwungen hat, alles wieder abzuwischen. Die, als ich mein Schulheft in die Mülltonne geworfen habe, weil die Physiklehrerin einen Vermerk hineingemacht hatte, den ich Asia nicht zeigen wollte, bis ich begriff, dass Asia es so oder so erfahren und sich anschließend erst recht aufregen würde, weil ich jetzt auch noch ein neues Heft brauchte, woraufhin ich die ganze Nacht betete, die Müllabfuhr möge nicht kommen, um morgens rauszurennen und das Heft noch in der Tonne vorzufinden – unter einem Kondom, einem Paar Schuhe und einer Bananenschale. Die Geschichte von Papa, der anfing, sich mit einer Frau zu treffen, die sich blau und grün schminkte – und obwohl das meine Lieblingsfarben sind, muss ich leider sagen, dass sie ihr nicht wirklich standen. Die von dem Schild, das er außen an die Tür hängte, wenn er nicht wusste, wann wir nach Hause kamen, und auf dem stand: »Haut ab!« Die Geschichte, als ich Asia zum Achtzehnten eine Kette aus Glasteilchen geschenkt habe, die ich auf unserem Schulausflug in Pietra Ligure am Meer gefunden hatte. Oder die von der Zeichnung, mit der ich einen Schulwettbewerb gewonnen habe – der Preis bestand in einem Stift und einer Kopie der Menschenrechte. Diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. Ich könnte all das erzählen und noch viel mehr, aber es würde auch nur auf den Tag hinauslaufen, an dem ich mich verliebt habe.
Es geschah eines Nachmittags gegen Ende des Winters, in der neunten Klasse – im Februar, acht Monate bevor ich mit Luca auf dem Dach besagter Lagerhalle landete. An einem Mittwoch, an dem das Licht, nachdem es durch die Wolkenberge gedrungen war, ganz zerknautscht die Erde erreichte. Wenn man sich konzentrierte, konnte man regelrecht hören, wie es knisternd seine ursprüngliche Form zurückgewann. An einem dieser Nachmittage, an denen ich keine Lust hatte, zu Hause zu bleiben, und an dem ich, weil mir nichts Besseres einfiel, den Bus nahm. Das tat ich hin und wieder, tue es manchmal noch heute: Ich steige in irgendeinen Bus und lasse mich mitnehmen. Ich suche mir einen Fensterplatz und schau mir die Stadt an. Geschäfte, Balkone, Verkehr. Ich beobachte die Leute und denke, wie verschieden die Menschen doch sind und wie komplex. Und dass es genau diese Komplexität und Verschiedenheit ist, die sie tatsächlich miteinander verbindet.
Der Bus hatte mich quer durchs Zentrum ans andere Ufer der Dora gebracht, in eine Gegend, in der ich noch nie zuvor gewesen war. Autoabgase hingen in der Luft, bevor sie sich verflüchtigten, Hunde bellten und zogen an ihren Leinen, und Frauen trugen Taschen und Kinder – manchmal fröhlich und gut gelaunt, dann wieder, als wäre es eine Strafe. An einer Ampel ließ ein schwarz gekleideter junger Mann Fackeln rotieren und spuckte Feuer, anschließend ging er mit dem Hut zwischen den Autos herum. Als er an meinem Busfenster vorbeikam, lächelte er mir zu. In diesem Augenblick schaute ich auf und entdeckte hinter ihm, unter den Bäumen der Allee, einen Kiosk aus Gusseisen und Glas – eine Blumenhandlung. Davor stand eine alte Frau mit einem dicken hellblauen Wollschal um den Hals. Sie beugte sich über den Tresen und stellte für eine Kundin einen Strauß zusammen. Und neben der Blumenhändlerin stand sie. Sie war etwa in meinem Alter. Ich weiß nicht mehr, was genau meine Aufmerksamkeit erregte: ihr üppiger roter Haarschopf, die Form ihres Gesichts, ihre schwarze Lederjacke oder alles auf einmal – es geht immer um alles auf einmal. Ich sah, wie sie sich reckte, um nach etwas zu greifen, nach einem Gegenstand an einem Haken, und es kam mir so vor, als würde sie gleich abheben. Die Kundin machte einen Witz, sie lachte, und ich bekam Lust, ebenfalls zu lachen. Vermutlich tat ich es auch, so ansteckend war es: wie Gähnen. Dann sah ich, wie sie die Schere nahm und das Band durchtrennte, mit dem die Blumenhändlerin den Strauß dekorierte.
Wir fuhren weiter.
Ich sprang auf. »He!«, rief ich, »anhalten, ich muss hier raus.« Zu spät. Der Bus fädelte sich in den Verkehr ein, und ich sah, wie sich der Kiosk entfernte, wie sie hinter einem Laster mit der Aufschrift »Die Königin des Büffelmozzarellas« verschwand. Eine Frau stand auf, um sich aufs Aussteigen vorzubereiten, und sagte mir, die nächste Haltestelle sei gleich um die Ecke. Sie musterte mich aus den Augenwinkeln. Ich muss einen merkwürdigen Eindruck gemacht haben, denn sie fragte: »Alles in Ordnung?« Ich nickte lächelnd, hüpfte aber dabei auf und ab, als müsste ich mir gleich in die Hose machen. Kaum öffneten sich die Türen, sprang ich hinaus und sprintete los. An der Kreuzung entdeckte ich den Kiosk auf der anderen Straßenseite wieder: Die Blumenhändlerin leerte eine Vase, und die Kundin war gegangen. Aber nicht sie.Sie saß auf einem von diesen hohen Metallhockern, einer Art Barhocker, und unterhielt sich mit der alten Frau, während sie bunte Papierbogen faltete und in irgendwelche Umschläge steckte. Ich wartete, bis die Ampel auf Grün sprang, und überquerte die Straße, während der schwarz gekleidete junge Mann begann, erneut mit seinen Fackeln zu jonglieren. Ich ging direkt auf den Kiosk zu.
»Hallihallo«, sagte die alte Blumenhändlerin, als sie mich sah. Sie hatte ein extrem breites Lächeln und himmelblaue Augen in der Farbe ihres Schals, wässrig und durch ihre Brillengläser vergrößert.
Sie schaute von den Umschlägen auf und musterte mich, wenn auch wortlos. Ich beobachtete sie aus den Augenwinkeln und antwortete der Blumenhändlerin mit einem Nicken.
»Kann ich dir irgendwie behilflich sein?«
»Ja.«
…
…
»Womit denn?«, fragte die Blumenhändlerin.
Ich sah mich hilfesuchend um. »Mit einer Blume«, sagte ich.
»Oh, na dann bist du hier genau richtig. Wir haben jede Menge davon.«
Sie verzog das Gesicht, als müsste sie ein Lachen unterdrücken, und faltete wieder Papierbogen.
Ich tat, als wenn nichts wäre. »Wie viel kostet das?«, fragte ich.
»Eine Blume?«
»Ja.«
»Das kommt auf die Blumen an«, sagte die Blumenhändlerin todernst, als wäre ich ihr wichtigster Kunde. »Woran hast du denn so gedacht?«
»Die da.« Ich zeigte hinter sie.
»Das sind Chrysanthemen.«
Ich nickte, als wüsste ich, wovon sie redete.
»Musst du damit zum Monumentale?«
»Zum Monumentale?«
Die Blumenhändlerin warf einen vielsagenden Blick auf die gegenüberliegende Mauer.
»Zum Friedhof«, sagte das Mädchen mit den roten Haaren und faltete weiter.
Da sie das Wort an mich gerichtet hatte, sah ich sie an, ließ meinen Blick langsam an ihrer Jacke, dem Reißverschluss und ihrem grünen Rollkragenpullover emporgleiten. Kinn, Lippen, Nase. Sommersprossen. Augen. Braun. Und dann die Haare. Rot. Eine wahre Explosion. Sie war so hinreißend, dass es mir den Atem verschlug. Aber auch ohne Atem hörte ich mich etwas sagen. Nämlich, dass ich klar doch eine Tante auf dem Friedhof liegen habe, eine Tante, die keiner aus meiner Familie leiden könne, weil sie ihr Geld einer Sekte vermacht habe oder so, weshalb niemand ihr Grab pflege, während ich es einfach unmöglich finde, sich an einer Toten zu rächen – bloß weil sie jemand anders ihr Geld vermacht habe. Deshalb wolle ich auch so genau wissen, was diese Blumen kosteten, die Chrysanthemen für die Tante. Weil ich noch nie welche gekauft habe, also Chrysanthemen beziehungsweise überhaupt Blumen.
Die Blumenhändlerin hörte mir aufmerksam zu und nannte anschließend die Preise. Dabei leierte sie Mengen, Zusammenstellungen und andere Details herunter, mit denen ich nicht das Geringste anfangen konnte, bis sie irgendwann verstummte, meinem Blick folgte und aufgrund dessen, was mein Interesse erregt hatte, ihren Namen sagte und Viola bat, sie mir doch zu zeigen, also die Blumen, damit sie in der Zwischenzeit die Abrechnung machen könne. Viola unterbrach ihre Arbeit mit den Umschlägen und machte da weiter, wo die Alte aufgehört hatte – so als wäre es das Normalste von der Welt, einem Gleichaltrigen Friedhofsblumen zu verkaufen. Sie zeigte mir Gerbera, Lilien und anderes Grünzeug, auf das ich nicht weiter achtete, weil ich mich viel zu sehr auf ihre leicht heisere Stimme konzentrierte. Sie sprach das S irgendwie seltsam aus, was mir eine Gänsehaut bescherte. Ich hätte ihr ewig zuhören können!
Als ich zwei Stunden später nach Hause kam, saß Asia in der Küche und rechnete gerade etwas auf einem Blatt Papier aus. Sie nippte an ihrer Teetasse und fragte: »Was ist denn mit dir los?«
Ich lehnte mich an den Türrahmen. »Wieso?«
»Du siehst aus, als hättest du einen Chihuahua vorbeifliegen sehen.«
Ich straffte die Schultern und seufzte.
Asia stellte die Tasse ab und streckte die Beine unter den Tisch. »Los, raus mit der Sprache!«
»Wie alt warst du, als du dich zum ersten Mal verliebt hast?«
»Da war ich noch in der Grundschule.«
»Nein, das meine ich nicht. So richtig verliebt, meine ich.«
»Man verliebt sich immer richtig. Entweder man ist verliebt oder eben nicht.«
Asia war seit ein paar Monaten mit Andrea zusammen, dem Besitzer der Trattoria, in der sie arbeitete, ein blonder Typ um die dreißig, der auf Rugby und Punkrock stand und mir gern kräftig auf die Schulter klopfte. Nach Abschluss der Hotelfachschule hatte Asia eines Tages im Fenster einer Trattoria im Campidoglio-Viertel, ganz in der Nähe unserer Wohnung, einen Aushang gesehen: »Kellnerin in Teilzeit gesucht.« Sie hatte sich vorgestellt und war genommen worden. Sie war zuverlässig und freundlich. Die Gäste ließen sich gern von ihr bedienen, und schon bald rief der Besitzer, Andrea, sie ständig an, damit sie für andere einsprang. Als es eines Nachmittags Probleme in der Küche gab, bot Asia an, auch dort auszuhelfen. Woraufhin sie die Küche nicht mehr verlassen sollte.
»Liebst du Andrea?«, fragte ich.
»Das muss ich erst noch rausfinden. Und du?«
»Nein, ich glaub nicht, dass ich ihn liebe.«
Asia verdrehte die Augen. »Blödmann!«, sagte sie. »Ich will wissen, ob du dich schon mal in jemanden verliebt hast.«
»Heute.«
»In wen denn?«
»Sie heißt Viola.«
Asia legte den Stift weg und drückte den Rücken durch. »Und wo hast du sie kennengelernt?«
»Bei einer Blumenhändlerin.«
»Was hattest du denn bei einer Blumenhändlerin zu suchen?«
»Ich hab sie gesehen und bin hin, um sie um Blumen zu bitten.«
»Du hast Blumen gekauft?«
»Ich hab sie nicht gekauft. Ich hab bloß Erkundigungen eingeholt.«
»Und sonst?«
»Wie sonst?«
»Wie ist sie so?«
Ich schaute zur Decke und suchte nach Worten, ging insgeheim das ganze Wörterbuch durch. Nach längerer Überlegung sagte ich: »Wunderschön.«
»Beschreib sie mir.«
»Keine Ahnung … rote Haare, schwarze Lederjacke, Sommersprossen.«
»Habt ihr euch unterhalten?«
»Sie hat mir was über Blumen erzählt. Sie hat so eine Stimme … Die macht mir Gänsehaut.«
»Und, seht ihr euch wieder?«
»Ich dachte, ich geh wieder zum Kiosk. Gleich morgen. Kannst du mir Geld leihen?«
»Wofür?«
»Bitte!«
»Nein, wofür? Wofür brauchst du das Geld?«
»Für die Blumen. Für die Tante.«
»Welche Tante?«
»Für die, die ihr ganzes Geld einer Sekte vermacht hat.«
…
»Egal, das ist eine lange Geschichte«, sagte ich. »Zehn Euro genügen.«
Asia erhob sich wortlos, suchte in ihrem an der Garderobe hängenden Parka nach dem Geldbeutel, kam zu mir, weil ich es einfach nicht schaffte, mich vom Türrahmen zu lösen, und gab mir den Schein. Unsere Finger hielten ihn länger fest als sonst. Mir fiel auf, dass Asia mich musterte wie einen vertrauten Ort, an den man nach längerer Abwesenheit zurückkehrt. Sie suchte nach winzigen Abweichungen – nach einem Davor und einem Danach. Dann umarmte sie mich. Sie zog mich mit einer Heftigkeit an sich, die mir fremd war. Erst erstarrte ich und ließ sie dann einfach machen, ließ reglos die Arme herabhängen. Ich war gerade in einer Phase, in der ich nicht gern umarmt wurde, schon gar nicht von Familienmitgliedern. Körperkontakt war mir unangenehm. Doch dann gab ich mich ihrer Zärtlichkeit hin und umschlang ihre Taille. Sie duftete nach Patschuli, genau wie Mama – die einzige Spur, die sie in Asias Leben hinterlassen hatte. Ich spürte die Holzkugeln ihrer Kette an meiner Wange. Für einen kurzen Moment fühlte ich mich erwachsen und Kind zugleich. Selbst wenn ich den Rest meines Lebens mit Viola verbringen darf – was mir mit Sicherheit vorherbestimmt ist, dachte ich –, wird Asia trotzdem immer der wichtigste Mensch in meinem Leben bleiben.
Am nächsten Tag kehrte ich zum Kiosk zurück. Ich war noch ein gutes Stück davon entfernt, als ich feststellte, dass Viola nicht da war. Ich wollte die zehn Euro nicht ausgeben, ohne sie zu sehen, und verschwand, noch bevor mich die alte Blumenhändlerin bemerkte. Erst da begriff ich, dass ich fest davon ausgegangen war, Viola arbeitete im Kiosk und ich könnte sie jederzeit wiederfinden. Aber das stimmte gar nicht. Ich wusste nicht mal, in welcher Beziehung sie zur alten Frau stand. Was, wenn sie nur zufällig dort gewesen war? Darauf gewartet hatte, abgeholt zu werden? Vielleicht wohnte sie ja in einer ganz anderen Stadt? Wir hatten uns am Vortag einfach so voneinander verabschiedet, während die Informationen über Lilien und Chrysanthemen zwischen uns in der Luft hingen: »Danke, ich geh jetzt, denk drüber nach und komm dann noch mal zurück.« Natürlich hätte ich die Besitzerin fragen können, aber was sollte ich ihr schon groß sagen? »Hören Sie, würden Sie mir bitte verraten, wann Viola wiederkommt, weil ich beschlossen habe, meiner Tante die Blumen erst zu bringen, wenn sie sie mir verkauft? Die Vorstellung, ihr unverblümt zu erklären, dass ich mich null für die Blumen interessierte, und sie zu bitten, mir mitzuteilen, wo ich Viola finden könne, machte mich ganz nervös. Selbst wenn ich erfahren hätte, auf welche Schule sie ging, was dann? Sollte ich sie etwa vor dem Schultor abpassen? Nein, es war deutlich besser, sie hier wiederzutreffen, darauf zu hoffen, dass sie zurückkehrte. Beim Gedanken, sie könnte nie wieder zurückkommen, wurde mir schwindlig. Nie wieder. Das würde ich nicht überleben. Ich beschloss, eine Woche lang jeden Nachmittag zum Kiosk zu gehen. Wäre sie nach sieben Tagen immer noch nicht aufgetaucht, würde ich die Blumenhändlerin ansprechen.
Ich hatte einen Notizblock zum Zeichnen dabei. Am Freitag zeichnete ich Tauben, Blätter, eine Frau mit Gummistiefeln, parkende Autos, ein Motorrad, Baumwurzeln, noch mehr Tauben. Am Samstag ein kleines Mädchen mit einem Schirm, Tauben, Flaschen, die Tonnen für die Mülltrennung, eine Bank, eine Hand. Am Sonntag Bäume, meine Gedanken, einen Herrn mit Stock und Hut, Tauben, einen Hund und Wind, der Blätter vor sich hertreibt. Am Montag war der Kiosk geschlossen, also ging ich wieder nach Hause. Am Dienstag zeichnete ich meine Füße, den Kiosk, die Blumenhändlerin, die Chrysanthemen, einen Lieferwagen und Tauben.
Bis ich am nächsten Mittwoch im Näherkommen »Hallihallo!« rief.
»Guten Tag«, sagte die Blumenhändlerin.
»Hallihallo«, sagte Viola. An diesem Tag trug sie eine gefütterte Jeansjacke, einen blauen Pulli und eine safrangelbe Mütze, unter der ihre roten Haare wie Flammen hervorzüngelten.
Ich hielt ihnen die zehn Euro hin. »Chrysanthemen und Gerbera, bitte. Für das Grab meiner Tante.«
»Kommt sofort … Viola, reich mir die Gerbera.« Die Blumenhändlerin machte sich an die Arbeit, und es dauerte keine Minute, bis der Strauß fertig war.
Ich nahm ihn und musterte ihn gründlich. Er sah wirklich schön aus. Viel zu schade für ein Grab. Aber das sagte ich natürlich nicht, sondern: »Kann ich Sie etwas fragen?«
»Natürlich.«
»Na ja, ich … Ich kenn mich auf dem Friedhof nicht aus.«
»Gehst du zum ersten Mal ans Grab dieser Tante?«
»Ja.«
»Vielleicht solltest du bei der Friedhofsverwaltung nachfragen. Am Eingang rechts.«
»Vielleicht finde ich es ja intuitiv.«
»Auch eine Möglichkeit«, sagte die alte Blumenhändlerin. »Warum nicht?«
»Glauben Sie daran, dass die Welt der Lebenden mit der der Toten in Verbindung steht?«
Die Blumenhändlerin nahm ihre Brille ab und hauchte die Gläser an. »Ich glaube, dass das Leben mysteriös ist.«
Daraufhin sagte ich: »Mich machen Friedhöfe nervös.«
»Da bist du nicht der Einzige.«
»Vielleicht kann Viola mich ja begleiten?«
…
Das verschlug ihnen die Sprache. Sie wechselten einen Blick, und nach einer Pause, die gefühlt Jahrhunderte dauerte, sagte die Blumenhändlerin: »Ich hab nichts dagegen, aber das muss sie selbst entscheiden.«
Zunächst einmal muss ich gestehen, dass ich, als ich mich Vielleicht kann Viola mich ja begleiten? sagen hörte, also als mir diese Worte herausrutschten und mir wegen ihrer skandalösen Dreistigkeit in den Ohren hallten – so kamen sie mir nämlich vor: skandalös und dreist –, dass ich da dachte: Wow! Nie hätte ich gedacht, so mutig zu sein. Im Grunde fand ich mich eigentlich recht schüchtern. Damals glaubte ich, dass es das Beste ist, unbeteiligt zu tun, ungerührt zu bleiben, während sich die Welt weiterdreht, und andere den ersten Schritt machen zu lassen. Nicht umsonst war mein Lieblingssport Basketball, weil ich den ganz für mich allein auf dem Sportplatz in der Via Braccini ausüben konnte, und zwar wenn alle schon weg waren und nur noch ich da war – Hände, Korb, Ball, Asphalt. Und drum herum die Stadt, vertraut wie die Herausforderung. Das Geräusch des aufprallenden Balls. Von Ball gegen Metall. Von Ball gegen Brett. Aber an diesem Tag fiel mir etwas ein, das ich zu Marcello, dem Besitzer des Caffè Barzagli, gesagt hatte, nämlich dass wir uns Fragen häufig nicht deshalb verkneifen, weil wir niemanden nerven wollen, sondern weil wir Angst vor der Antwort haben. Wenn ich also eine Antwort wollte, musste ich auch eine Frage stellen. Was mich vollkommen verblüffte, war, dass Viola einwilligte. Sie sagte Ja, mit einer unmerklichen Bewegung ihres Halses und sich kräuselnden Lippen. Die Blumenhändlerin putzte ihre Brillengläser mit einem Tuch, und während ihre riesigen, wässrigen Augen wieder ihre normale Größe annahmen, sagte sie nur: »Seid in einer halben Stunde wieder da.«
Anfangs liefen Viola und ich stumm nebeneinanderher. Eine ganze Weile. Dann tauschten wir verlegen ein paar Worte, brachen mitten im Satz ab. Der Friedhof umfing uns mit Schweigen, Blätterrascheln, plätscherndem Wasser und geflüsterten Worten. Die Friedhofswärter mähten das Gras und säuberten die Wege, aber es war, als wären sie gar nicht vorhanden. Die Besucher knieten vor Bildern ihrer Verwandten, staubten sie mit Taschentüchern oder Jackenärmeln ab, zeichneten behutsam Kreuze auf Stirn oder Brust oder schritten über den Kies. Statuen aus Marmor und Granit. Ein Spinnennetz zwischen den Dornen einer Rose.
»Sie ist meine Oma«, sagte Viola mit Blick auf eine Madonna, die Hände und Augen zum Himmel gehoben hatte.
»Du bist Gottes Enkelin?«, erwiderte ich ungläubig.
»Die Blumenhändlerin.«
»Das hab ich schon verstanden.«
»Ich besuch sie jeden Mittwochnachmittag.«
»Deswegen also.«
»Wie?«
»Weil ich dich nicht mehr gesehen habe. In den letzten Tagen, meine ich.«
»Kommst du öfter hier vorbei?«
»Ja. Seit letzten Mittwoch.«
Ein kleines Mädchen lief neben uns her und verschwand hinter einem Familiengrab. Wir hörten, wie der Vater nach ihr rief. Viola wandte den Blick ab und biss sich auf die Unterlippe. Ich wurde nicht recht schlau aus ihr. Sie wirkte in sich gekehrt, aber gleichzeitig frech. Sie schien die ganze Welt erobern zu können, es aber nicht für nötig zu halten. Genau wie ich!, dachte ich. Gleichzeitig war sie ganz anders: der Verbindungspunkt eines Kreises, der sich geschlossen hat.
»Und warum besuchst du sie mittwochs?«, fragte ich.
»Ich weiß nicht, das ist so eine alte Angewohnheit. Seit ich klein bin, gehört der Mittwoch der Oma. Seit sie den Kiosk übernommen hat, helfe ich ihr. Davor hat sie für eine Einrichtungsfirma gearbeitet. Sie ist jetzt in Rente und Witwe. Zu Hause langweilt sie sich.«
»Und du willst auch mal Blumenhändlerin werden?«
»Ach, Quatsch! Aber es gefällt mir, die einzelnen Pflanzen kennenzulernen. Wie heißt denn deine Tante?«
»Das weiß ich nicht mehr.«
»Das heißt, wir suchen ein Grab, von dem du nicht weißt, wo es liegt. Von einer Frau, an deren Namen du dich nicht mehr erinnerst?«
»Wenn ich es sehe, erkenn ich es wieder.«
»Wie denn, wenn du noch nie da warst?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Oh, ich hab deine Intuition vergessen«, sagte Viola.
…
Wir liefen weiter. Ich fragte, auf welche Schule sie gehe.
»Aufs altsprachliche Gymnasium. Aufs Gioberti. Und du?«
»Auf die Berufsfachschule. Plana. Wo wohnst du?«
»Hinter der Gran Madre.«
Ich stieß einen leisen Pfiff aus. »Oben in den Hügeln? Ich mag die Hügel.«
»Ehrlich gesagt steh ich mehr auf den Fluss. Ich rudere. Hast du das schon mal ausprobiert?«
»Noch nie.«
»Das mach ich schon, seit ich klein bin.« Sie schenkte mir ihr typisches Strahlen, das meine Haut zum Prickeln brachte. So etwas hatte ich noch nie erlebt: Was für ein Glück, dass ich mich in ein Mädchen verliebt hatte, das mir Lust machte zu lachen. »Ich liebe ihn – den Fluss, meine ich«, sagte Viola. »Und ich liebe das Rudern. Du weißt schon: auf dem Wasser sein, und das mitten in der Stadt. Dieses Schwappen.«
»Dieses …?«
»Schwappen. Dieses Geräusch, wenn das Wasser ans Boot schlägt. Ganz so, als … Keine Ahnung, so, als würde man von der ganzen Welt hin und her gewiegt. Machst du irgendeinen Sport?«
»Basketball.«
»In einer Mannschaft?«
»Auf dem Sportplatz. Auf dem in der Via Braccini.«
Viola zog die Nase kraus, sie wusste nicht, wo das war.
»In der Via Braccini spielen immer jede Menge Leute«, erklärte ich. »Erwachsene. Filipinos und Chinesen. Die Filipinos und Chinesen sind brutal gut.«
»Und mit denen spielst du?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: