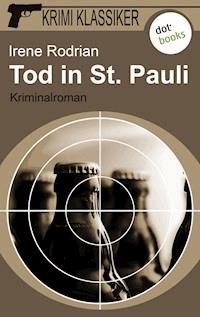3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thalia Bücher GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wenn Frauen in tödliche Gefahr geraten … DIE NETTEN MÖRDER VON SCHWABING: Die Krimiautorin Dora sitzt am Schreibtisch und wartet auf Inspiration. Als sich vor ihrem Fenster jedoch ein Bankraub abspielt, bei dem ein Mensch getötet wird, ist Dora vor Schock wie gelähmt – denn bald darauf stehen die Bankräuber auch vor ihrer eigenen Tür … ...TRÄGT ANSTALTSKLEIDUNG UND IST BEWAFFNET: Anita ist in der Psychiatrie eingesperrt, seit ihr Freund ihr das Leben zur Hölle machte – und sie ihn erschossen hat. Als ihr endlich die Flucht gelingt, hilft ihr ein junges Paar und versteckt sie in seinem Keller. Doch schon bald müssen die beiden erkennen, dass von nun an nichts mehr so sein wird, wie es einmal war … HANDGREIFLICH: Die von ihrem Exmann verlassene und schwer enttäuschte Charlotte fühlt sich endlich wieder lebendig, als sie dem attraktiven Taxifahrer Manfred begegnet. Doch bald fällt ein Schatten auf das Glück: Manfred hat Geldprobleme. Und schließlich muss Charlotte sich fragen, ob er etwas mit den Überfällen zu tun hat, denen seine Kollegen häufiger ausgesetzt sind – und ob sie auch nur ein Opfer ist … Dieser Sammelband enthält des Weiteren auch noch die fesselnden Kriminalromane SCHLAGSCHATTEN und FRISS, VOGEL, ODER STIRB! Diese Krimi-Klassiker werden Fans von Ingrid Noll begeistern!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1023
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
DIE NETTEN MÖRDER VON SCHWABING: Die Krimiautorin Dora sitzt am Schreibtisch und wartet auf Inspiration. Als sich vor ihrem Fenster jedoch ein Bankraub abspielt, bei dem ein Mensch getötet wird, ist Dora vor Schock wie gelähmt – denn bald darauf stehen die Bankräuber auch vor ihrer eigenen Tür …
...TRÄGT ANSTALTSKLEIDUNG UND IST BEWAFFNET: Anita ist in der Psychiatrie eingesperrt, seit ihr Freund ihr das Leben zur Hölle machte – und sie ihn erschossen hat. Als ihr endlich die Flucht gelingt, hilft ihr ein junges Paar und versteckt sie in seinem Keller. Doch schon bald müssen die beiden erkennen, dass von nun an nichts mehr so sein wird, wie es einmal war …
HANDGREIFLICH: Die von ihrem Exmann verlassene und schwer enttäuschte Charlotte fühlt sich endlich wieder lebendig, als sie dem attraktiven Taxifahrer Manfred begegnet. Doch bald fällt ein Schatten auf das Glück: Manfred hat Geldprobleme. Und schließlich muss Charlotte sich fragen, ob er etwas mit den Überfällen zu tun hat, denen seine Kollegen häufiger ausgesetzt sind – und ob sie auch nur ein Opfer ist …
Dieser Sammelband enthält des Weiteren auch noch die fesselnden Kriminalromane SCHLAGSCHATTEN und FRISS, VOGEL, ODER STIRB!
Über die Autorin:
Irene Rodrian, 1937 in Berlin geboren, wurde u. a. mit dem Edgar-Wallace-Preis für ihren Krimi »Tod in St. Pauli« und dem Glauser Ehrenpreis für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Seither hat sie sich mit zahlreichen Bestsellern in einer Gesamtauflage von über zwei Millionen und als Drehbuchautorin (»Tatort«, »Ein Fall für Zwei«) einen Namen gemacht. Irene Rodrian lebt heute in München.
Bei dotbooks erschienen bereits Irene Rodrians Barcelona-Krimis über das Ermittlerinnen-Team Llimona 5 »Schöner sterben in Barcelona«, »Das dunkle Netz von Barcelona«, »Eisiges Schweigen« und »Ein letztes Lächeln« sowie die Reihe »Krimi-Klassiker«, die folgende Bände umfasst: »Tod in St. Pauli«, »Bis morgen, Mörder«, »Wer barfuß über Scherben geht«, »Finderlohn«, »Küsschen für den Totengräber«, »Die netten Mörder von Schwabing«, »Ein bisschen Föhn und du bist tot«, »Du lebst auf Zeit am Zuckerhut«, »Der Tod hat hitzefrei«, »… trägt Anstaltskleidung und ist bewaffnet«, »Das Mädchen mit dem Engelsgesicht«, »Vielliebchen«, »Handgreiflich«, »Schlagschatten«, »Über die Klippen«, »Bei geschlossenen Vorhängen«, »Strandgrab« und »Friss, Vogel, oder stirb«.
Die Webseiten der Autorin: irenerodrian.de und llimona5.com
Die Autorin im Internet: facebook.com/irene.rodrian
***
Sammelband-Originalausgabe November 2024
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Romane, die im Sammelband enthalten sind, finden Sie am Ende dieses eBooks.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Pavel L Photo and Video, Aleksey Matrenin, Yuryi Oleinikov
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-629-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Irene Rodrian
Im Netz der Furcht
Fünf Krimis in einem eBook
dotbooks.
Die netten Mörder von Schwabing
Dora sitzt am Schreibtisch, schaut aus dem Fenster und wartet auf den Kuss der Muse. Irgendwie will die teure Wohnung in München ja bezahlt werden – und als eher mittelmäßig erfolgreiche Krimiautorin verdient man keine Reichtümer. Inspiration – alles, was ihr fehlt, ist Inspiration! Als sich vor ihrem Fenster ein Bankraub abspielt, bei dem ein Mensch getötet wird, ist das für Dora doch etwas zu viel des Guten. Am folgenden Abend steht dann leider immer noch nicht die Muse vor ihrer Tür, sondern die Bankräuber, und Dora findet sich plötzlich in einem handfesten Kriminalfall wieder …
Die Hauptpersonen
Dora Kemperlernt nicht ganz freiwillig den Unterschied zwischen Theorie und Praxis kennen, woran sie nicht ganz unschuldig ist.
Uwe Ebbinghausübt immer Treu und Redlichkeit.
Max LechenmayrJakob LehlFerdinand JaschikVitus Datzmanngreifen zu und bemühen sich dann, nicht ergriffen zu werden.
Kriminalassistent Quirin Hofstetterhört zu und schreibt mit.
Oberinspektor Anton Gerstlist voreingenommen gegen Leute, die voreingenommen sind.
Die Autorin versichert, mit der in diesem Buch geschilderten Autorin nicht identisch zu sein. Letztere ist von ersterer ebenso erfunden worden wie alle anderen Personen der Handlung, die somit zwangsläufig nichts mit realen Ereignissen zu tun hat.
iRo.
Kapitel 1
Ich saß am Schreibtisch und war unproduktiv. Ich sah aus dem Fenster.
So groß war der Hund gar nicht, aber offenbar recht kräftig, denn er zerrte die alte Frau mit beeindruckender Lässigkeit hinter sich her über die Kreuzung. Farbenblind schien er auch zu sein. Die Fußgängerampel stand eindeutig auf Rot. Ein hellblauer VW bremste in letzter Sekunde, die Frau ließ den Hund los, er raste zielstrebig auf die kleine Grünanlage zu, und sie humpelte hastig von dem blauen VW weg. Dem Fahrer war der Motor abgestorben, hinter ihm bildete sich sofort die obligate hupende Autoschlange. Die Frau hatte die Anlage jetzt auch erreicht und wartete, bis ihr Hund die ersten drei Bäume absolviert hatte und zum Sandkasten lief, um sich größeren Vorhaben zu widmen.
Auf Welle Bayern 3 sang einer etwas von sunshine, happy sunshine, aber das weiß man ja, daß die Schlager alle gelogen sind. Die Wolkendecke über den Dächern zog sich auch immer mehr zusammen, und in spätestens einer Stunde würde es schütten. Hoffentlich. Ich arbeite viel lieber, wenn ich drin im Trocknen sitze und draußen die Leute naß werden, als wenn ich mich totschwitzen muß, während die anderen zum Baden fahren. Ich starrte also voller Erwartung hinaus und kaute an meinem Kugelschreiber (macht nicht dick und enthält keine Pflanzenschutzgifte), als das Telefon läutete. Hocherfreut über die Ablenkung nahm ich den Hörer auf.
»Du wolltest dich doch melden!«
Typisch Uwe. Kein »Guten Tag« oder »Wie geht es dir, Schätzchen?«, sondern erst mal ein Vorwurf. »Keine Zeit«, knurrte ich zurück.
»Sitzt du immer noch an dem Buch?« Immer noch war gut, ich hatte noch nicht einmal angefangen.
»Glaubst du, das geht so schnell? Es handelt sich schließlich um ein großes Werk.«
»Ich denk, du schreibst einen Krimi.«
»Kriminalroman«, sagte ich prononciert, aber Uwe ist ein Banause ohne Sinn für Zwischentöne. Er erzählte irgend etwas von einem neuen vielversprechenden Kunden, ich schaute aus dem Fenster. Vor der Bank hielt ein gepanzerter Geldtransporter; zwei Lederjacken mit umgeschnallten Pistolenhalftern trugen Geldsäckchen hinein. Nebenan kam ein Pärchen mit einem Schaukelstuhl aus dem Antiquitätengeschäft, sie ging mit dem schweren Teil vorn, er dirigierte von hinten. Mir fiel prompt die ganze Gedankenkette von unbezahlten Möbelrechnungen, Steuerschulden, Säumniszuschlägen und meinem überzogenen Bankkonto ein. Die Versuchung, Uwe anzupumpen, war groß, aber ich widerstand mannhaft. Kann man als Frau mannhaft …? Na, egal. Ich pumpte Uwe also nicht an, denn er hätte das womöglich als Heiratsversprechen aufgefaßt. Außerdem, als mein Steuerberater und sogenannter fester Freund, wußte er ohnehin genau, daß ich pleite war; da hätte er mir doch von sich aus was anbieten können. Das hätte ich durchaus als positiven Zug gewertet. Aber ich wartete vergeblich. Nach ein paar düsteren Andeutungen und einer letzten Frist von fünf Minuten kniff ich ihm den Faden ab.
»Tut mir leid, aber jetzt muß ich wieder was tun.«
»Können wir uns nicht wenigstens auf eine Tasse Kaffee treffen?«
»Ich sag dir doch, ich hab keine Zeit.«
»Eine halbe Stunde wird doch wohl drin sein!«
Schon der Ton, mit dem er das sagte … Nicht das geringste Einfühlungsvermögen. »Nein, eben nicht. Ich bin da gerade an einer schwierigen Passage.«
»Wenn man was will, dann kann man's auch«, beharrte er.
Und hatte nicht ganz unrecht. Ich wollte nicht.
Sein Ton wurde quengeliger: »Und gestern abend hast du auch keine Zeit gehabt, wie? Mußtest ja arbeiten. Leider hat Gert dich gesehen. In der Grünen 8. Mit so einem Typen, mit dem du reichlich …«
»Das waren Recherchen«, unterbrach ich ihn. »Tschüs.« Ich legte auf.
Zwei Sekunden später läutete es wieder. Ich ließ es läuten. Das fehlte mir gerade noch – Uwes endlose Diskussionen über Eifersucht und Freiheit oder womöglich über Liebe und Treue … Ich riß ein neues Zigarettenpäckchen auf und steckte mir eine an. So ein Kacknest wie Schwabing gibt's auch nicht noch mal. Keinen Schritt kann man machen, ohne daß einen einer dabei sieht und alles weitertratscht. Daß sich so einer wie Gert überhaupt in die Grüne 8 reintraute. Gesehen hatte ich ihn jedenfalls nicht. Okay, zugegeben, ich war auch mit was anderem beschäftigt gewesen. Max hieß er. Ein unheimlich scharfer Typ. Angeblich hatte er schon mal gesessen. Na gut, vermutlich wegen Suff am Steuer. Immerhin hatte es mir ziemlich gestunken, als er so plötzlich verschwunden war. Aber im Moment gab's für mich sowieso nur eins: die dichterische Askese … Ich rückte den Stapel leerer Bogen zurecht.
Dann sah ich wieder aus dem Fenster.
Es tröpfelte schon ein bißchen. Wenn mir doch bloß was einfallen würde. Das heißt, eingefallen war mir ja schon reichlich genug. Ein Klasse-Plot von einem Jungen, den seine Eltern praktisch dazu zwingen, sie zu ermorden, eine wunderschöne Parabel für Täter und Gesellschaft. Aber die Geschichte haben und sie hinschreiben sind zwei Paar Stiefel. Ich schielte nach dem Kalender. Schon der 20.! Und der endgültige Termin war … Nur nicht dran denken. Entspannen, lockern. Ich zog ein Blatt in die Schreibmaschine und schaltete sie an. Sie surrte aggressiv. Ich knipste sie wieder aus und starrte aus dem Fenster.
Vor der Bank hielt ein grüner Peugeot. Die Türen auf der rechten Seite gingen auf, drei Männer stiegen aus und sahen sich um. Kein Wunder, der Wagen stand im Halteverbot. Der Fahrer war sitzengeblieben und schien den anderen nachzusehen, als sie auf die Glastüren der Bank zugingen. Sie trugen so eine Art Wollmützen, was bei dem Wetter ein bißchen seltsam aussah, und einer hielt einen dicken Regenschirm im Arm. Sie drückten die Türen auf und gingen hinein. Natürlich waren das keine Mützen gewesen, sondern Masken. Und der Regenschirm war eine Maschinenpistole – wozu geht man denn ins Kino? Und vermutlich waren sie eben dabei, drin alles niederzumähen und eine Million einzusacken oder zwei. Was mußten diese Banken sich auch so breitmachen. Schon diese protzige Leuchtschrift: BANKHAUS FISCHER. Vor einem halben Jahr war in dem Haus noch eine Buchhandlung gewesen, aber Banken können ja bekanntlich mehr Miete zahlen, wenn sie nicht gleich das ganze Viertel aufkaufen. Hübsche Vorstellung, wie ihnen da jetzt ihre Heilige Kuh entrissen wurde … Ich steigerte mich immer mehr in die Szene rein und malte sie mir in Supercolor-Breitwand aus: die dezente Eleganz der Schalterhalle mit dem teakholzgetäfelten Tresen und den schwarzledernen Sesseln, die entsetzten Gesichter der Bankheinis und die kühnen Gestalten der Outlaws, die sich mit Entschlossenheit und notfalls mit Gewalt ihren Anteil am Bruttosozialprodukt … Robin Hood. Rinaldo Rinaldini. Der Schinderhannes.
Der grüne Peugeot stand immer noch da. Komische Nummer mit drei Dreiern hinten.
Schade. Ich seufzte. In Wirklichkeit passiert so was immer nur woanders. Aber garantiert nie unter den Fenstern von Deutschlands größter, wenn auch ärmster Kriminalautorin. Auf Welle Bayern 3 sang mittlerweile good old Satchmo, und draußen fing es endlich an zu regnen.
Die Glastür der Bankfiliale wurde aufgestoßen, und die drei Typen stürzten heraus. Sie hatten Tragetüten bei sich. Einer stolperte, die anderen rannten fast über ihn drüber, rissen die Türen des Peugeot auf, warfen die Tüten hinein und hechteten hinterher. Der dritte rappelte sich auf und riß sich etwas vom Gesicht – tatsächlich eine Maske! –, warf seinen Regenschirm in den Wagen – es war eine Maschinenpistole! – und sprang auch hinein. Die Alarmsirene heulte auf, und der Peugeot fuhr an, bevor die letzte Tür ganz geschlossen war, und hinterließ nichts als eine blaue Auspuffwolke.
Zwei Männer kamen aus der Bank gerannt und fuchtelten mit der Armen; Passanten blieben stehen oder liefen hin. In kurzer Zeit hatte sich vor dem Bankeingang ein Menschenauflauf gebildet.
Ich saß da und glotzte. Das war keine Einbildung, kein Krimi, kein Film. Das war real. Das war wirklich passiert. Und direkt unter meinem Fenster, vor meinen Augen. Ich zündete mir eine neue Zigarette an. Die Flamme des Feuerzeugs zitterte. Ich hätte gern etwas getrunken, aber ich hatte Angst aufzustehen, die Szene auf der Straße auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. In meinem Kopf sprangen die Gedanken wie aufgescheuchte Kaninchen umher. Ich mußte etwas tun. Ich war Zeuge eines Banküberfalls geworden. Oder, um genau zu sein, Zeuge der Flucht. Vier Täter, ein grüner Peugeot und eine Nummer, die auf 333 endete. Was tut man in so einem Fall? Blöde Frage: Man ruft die Polizei an und meldet, was man gesehen hat. Das Telefon stand rechts neben dem Papierstapel. Notruf 110 …Ich stand auf, rannte in die Küche, riß die Wodkaflasche aus dem Kühlschrank, schnappte mir ein Glas und saß schon wieder am Schreibtisch.
Die Menschenmenge quoll inzwischen schon über den Bürgersteig, wurlte hin und her, fror plötzlich fest, als hätte jemand den Film angehalten. Dann hörte ich das Martinshorn auch und sah fast gleichzeitig die beiden Funkstreifenwagen in die Franz-Josef-Straße einbiegen. Uniformierte sprangen heraus und quetschten sich durch die Menge zu den Glastüren hin.
Ich nahm einen zu großen Schluck und mußte husten. Wenn das jetzt meine Bank wäre, und wenn sie Pleite machen würde, und wenn ich dann … Blödsinn. Die sind doch versichert.
Und wenn jemand verletzt worden ist?
Ich begann zu frieren, und gleichzeitig brach mir der Schweiß aus. Es war, als ob ich für einen Sekundenbruchteil jede einzelne Pore meiner Haut spüren könnte. Ich stellte das Wodkaglas ab, es schwappte über. Wenn sie geschossen hatten … Wenn sie womöglich einen Menschen getötet … Ich mußte anrufen.
Ich saß regungslos da.
Ich brachte es nicht fertig. Die Polizei anrufen, die Autonummer melden … Denunzieren. Denn etwas anderes war es doch nicht. Was passiert war, war passiert – ich konnte daran nichts mehr ändern. Wenn ich jetzt anriefe, würde ich mich um keinen Deut anders verhalten als diese überschlauen kleinen Jungen oder die alten Rentner in den Fernsehkrimis, die sich immer zufällig alle Autonummern aufschreiben und dann eifrig melden … Ich hasse Denunzianten. Und ich habe in meinen Büchern immer Partei ergriffen für Leute wie diese vier, die die Bank überfallen hatten. Na ja – Partei ergriffen … Es gibt ja Verlage, die drucken so was nicht. Also, ich habe immer Verständnis für sie gezeigt.
Aber dies war kein Buch, und es war auch kein Fernsehfilm. Mit aufjaulendem Sirenenton raste ein Krankenwagen vom Malteser Hilfsdienst die Friedrichstraße herunter und hielt hinter den Funkstreifenwagen. Die Menge wandte sich von den Schaufenstern ab und den beiden weiß-gekleideten Sanitätern zu, die mit einer Bahre auf die Tür zugingen. Der schmale Weg, der sich vor ihnen öffnete, schloß sich hinter ihnen sofort wieder. Weitere Polizeiautos kamen, spuckten blaue Uniformen aus, die die Menge zurückdrängten und sich über den Habsburger Platz verteilten. Dann kam ein BMW ohne Polizeiaufschrift und Sirene; zwei Männer in Zivilanzügen gingen in die Bank. Gleich darauf hielt ein weißer Mercedes, und ein Chauffeur mit Mütze riß den Schlag auf für einen dicken Typ in Nadelstreifen. Die Blauen hatten Mühe, die Menge zurückzuhalten. Es war genauso wie im Fernsehen. Alle waren sie da, die Streifenbeamten, die Kripo und der Bankdirektor.
Ich hätte runtergehen und dort mit den Kripo-Leuten reden können. Das wäre doch ein Clou gewesen: Bekannte Kriminalautorin liefert der Polizei den entscheidenden Hinweis. Agatha Christie in voller Aktion. Schlagzeilen in der Presse. Doppelte Auflagen für meine Bücher, Einladung zu diversen Talk-Shows. Ich lachte hysterisch vor mich hin, nahm noch einen Schluck aus dem Glas, merkte, daß mir schlecht war und daß auch der Wodka nichts half.
In die Menge hinter dem Polizeikordon kam Bewegung. Die Sanitäter kamen aus der Bank. Auf der Bahre lag eine regungslose Gestalt. Ich sprang auf und beugte mich vor. Sie war mit einem Tuch zugedeckt. Ich versuchte zu erkennen, ob das Tuch über den Kopf gezogen war oder nur bis zum Hals, aber der eine der beiden Sanitäter versperrte mir die Sicht, und dann war die Bahre schon im Wagen, der gleich darauf mit heulender Sirene davonraste. Einer der Polizisten schien genau zu meinem Fenster heraufzuschauen. Schuldbewußt wich ich zurück.
Der Polizist schaute immer noch herauf. Sie schauten alle herauf.
Ich ging rückwärts zur Wohnzimmertür, auf den Flur hinaus und ins Bad. Verrammelte die Tür meiner zwei mal zwei Meter großen Oase der Sicherheit, stützte mich auf das Waschbecken und drehte den Wasserhahn auf. Das kalte Wasser half ebensowenig wie der Wodka. Mein Spiegelbild beobachtete mich voller Verachtung.
Der Mann oder die Frau auf der Bahre war verletzt. Schwer verletzt. Vielleicht sogar tot. Wie wäre es verlaufen, wenn ich gleich bei der Polizei angerufen hätte? Gleich, als die drei Männer aus dem grünen Peugeot ausstiegen? Ich bemühte mich herauszufinden, woran ich mich wirklich erinnerte, was ich tatsächlich gesehen und was ich in meiner Phantasie dazugedichtet hatte. Ich konnte es nicht mehr unterscheiden …
Was hätte mir denn schon groß passieren können, wenn es harmlose Männer gewesen wären? Vielleicht hätte ich mich lächerlich gemacht, schön. Na und? Aber die Männer waren nicht harmlos. Und wenn die Polizei rechtzeitig gekommen wäre, hätte …
Hätte. Wäre. Hätte.
Möglicherweise hätte es ja auch gerade dann eine Riesenschießerei gegeben … Ich sank auf den Rand der Badewanne. Wenn du jetzt anrufst, fragen sie dich, warum du so lange gewartet hast. Verhöre. Protokolle. Mißtrauen. Scherereien … Ich stand auf und ging wieder ins Wohnzimmer hinüber. Das Radio spielte immer noch seine makabre Begleitmusik für einen Film, der kein Film war. Ich wollte es gerade ausschalten, als die Durchsage kam.
Vor etwa zehn Minuten wurde am Habsburger Platz eine Filiale des Bankhauses Fischer überfallen. Die drei Täter waren maskiert und mit einer Maschinenpistole bewaffnet. Ein Bankangestellter wurde getroffen und schwer verletzt. Das Fluchtauto ist ein grüner Volvo oder Fiat mit einem Münchner Kennzeichen, der in Richtung Leopoldstraße entkommen konnte. Die Autonummer beginnt vermutlich mit MO oder NO. Wer hat dieses Auto gesehen oder etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen …Tralala. Musik.
Ich schaltete das Radio aus. Volvo oder Fiat! Es war ein grasgrüner Peugeot 504 mit der Nummer M–M(N?) O-333! Ich nahm den Telefonhörer auf und wählte die eins.
In diesem Augenblick läutete es an der Tür.
Ich saß an meinem Schreibtisch, den Telefonhörer in der linken Hand, den rechten Zeigefinger noch in der Eins. Es läutete wieder, schrill und fordernd. So kam es mir jedenfalls vor. Ich legte den Hörer auf und schob meinen Stuhl zurück. Es läutete wieder, zweimal. Ich sprang hoch, lief zur Tür und riß sie auf. Davor standen zwei Streifenpolizisten in schwarzen Lederjacken. Ich sah zwei glatte Kindergesichter unter Uniformmützen, der eine hatte längeres Haar und einen schütteren Bart.
»Grüß Gott! Sind Sie …« Er beugte sich zu meinem Türschild hinunter und richtete sich wieder auf: »Frau Dora Kemper?«
Ich nickte nur, starrte ihn an, das glatte Leder, die martialische Pistolentasche an seiner Hüfte.
»Entschuldigen Sie, aber Ihre Wohnung geht doch auf die Franz-Joseph-Straße hinaus, oder?«
Wieder nickte ich stumm, unfähig etwas zu sagen oder mich auch nur zu rühren.
»Haben Sie etwas beobachtet?«
»Bitte?« Es war nicht mehr als ein unverständliches Krächzen. Ich räusperte mich und sagte noch einmal: »Bitte?«
»Die Bank ist überfallen worden!« Seine Stimme klang jetzt schärfer, sein Gesicht hatte nichts Kindliches mehr. »Dürfen wir mal kurz reinkommen?«
Sie warteten meine Antwort nicht ab, sondern schoben sich an mir vorbei in den Flur. Ich schloß die Tür automatisch und trottete hinter ihnen her. Sie schauten in die Küche, die auf den Hof hinausgeht, kamen ins Schlafzimmer, das zur Friedrichstraße hin liegt, und standen im Wohnzimmer. Bewegten sich sicher auf meinen Schreibtisch zu und die hohen Fenstertüren, durch die man die ganze Kreuzung und den vorderen Teil der Grünanlage überblicken kann. Die Menschenmenge hatte sich zerstreut, aber vor der Bank parkten immer noch die Funkstreifenwagen, und neben den Glastüren standen zwei Polizisten.
»Was haben Sie gesehen?« Der zweite Polizist, der bis jetzt noch nichts gesagt hatte, drehte sich plötzlich zu mir um.
Nichts, dachte ich in panischer Angst und merkte gleichzeitig, daß ich es laut gesagt hatte. »Nichts. Ich war nicht da.«
»Sie waren nicht in der Wohnung?«
Das war wieder der erste. Ich glaube, seine Stimme klang gleichgültig und fast desinteressiert, aber mir kam sie bohrend und bedrohlich vor. Ich schüttelte den Kopf, schluckte.
»Nein. Ich meine, in der Wohnung war ich schon; ich war nur nicht hier. Ich war in der Küche, ich … Ich wollte mir gerade einen Kaffee …« Die Worte verschwammen ineinander, ich hustete und fügte dann etwas lahm hinzu: »Ich hab die Sirene gehört, aber da war nichts mehr zu sehen. Tut mir leid.«
Der Polizist nickte, zuckte die Achseln und ging in den Flur hinaus. Der andere schaute mich an, schien noch etwas sagen zu wollen, folgte aber dann dem ersten. Bevor ich die Tür hinter ihnen schloß, sah ich noch, daß sie bei der Wohnung gegenüber läuteten.
Das erste, was ich spürte, war eine ungeheure Erleichterung. Sie hatten es geschluckt; sie waren gegangen. Ich war raus aus der Sache. Sie machten ihre Befragungen weiter, reine Routine. Irgendjemand hatte vielleicht mehr gesehen … Dann begann ich wieder klarer zu denken.
Ich hatte gelogen. Ganz eindeutig gelogen.
Jetzt hatte ich nicht nur geschwiegen, nein – ich hatte gelogen. Der Vorwurf, den man mir jetzt machen konnte, war nicht nur: Warum haben Sie das nicht sofort gemeldet?, sondern: Warum haben Sie eine falsche Aussage gemacht?
Ja, verdammt nochmal – warum eigentlich?
Ich setzte mich aufs Sofa, um nicht dauernd aus dem Fenster schauen zu müssen. Angst, weil ich mich nicht gleich gemeldet hatte? Angst vor den Polizisten? Ich hatte kaum je mit Polizisten zu tun gehabt. Die Leute auf meinem Revier, bei denen ich meinen Paß verlängern ließ, der Weißmantel auf der Kreuzung, wenn die Ampel ausgefallen war, ein Strafmandat wegen falschen Parkens … Einmal war ich in eine Studentendemonstration reingeraten, aber die war ganz friedlich abgelaufen … Viel deutlicher kannte ich die Polizei aus Zeitungsberichten und Fernsehübertragungen. Das waren Männer, die mir Angst machten. Weil sie eine anonyme Gewalt verkörperten. Den Staat. Weil sie fortwährend etwas beschützten, so kam es mir vor; Marionetten an der Strippe irgendwelcher Vorschriften. Und was beschützten sie? Die Bürger? Die Gesellschaft? Oder nur eben diesen Staat, der auch die Vorschriften erließ? Du bist ein Bürger, habe ich mir oft gesagt. Du bist ein Glied dieser Gesellschaft. Es paßt dir verschiedenes nicht an diesem Staat, an dieser Gesellschaft – schön. Aber … Und an diesem Punkt verirren sich dann meine Gedanken, und die Polizisten aus dem Fernsehen, die, die mir Angst machen, die schieben sich dann irgendwie vor die harmlosen Paßverlängerer auf dem Revier, von denen vielleicht der eine oder andere auch etwas gegen diesen Staat, gegen diese Gesellschaft haben könnte … Es ist sehr kompliziert. Auf alle Fälle, mein Verhältnis zum Freund und Helfer ist ein gebrochenes.
Aber das alles war keine Erklärung für meine kopflose, hysterische, idiotische Reaktion. Ich stand mir selbst etwas ratlos gegenüber. Ratlos und ein wenig mißtrauisch. Schließlich gab ich mir einen Ruck und schaltete das Radio wieder ein.
Die nächste Durchsage kam eine halbe Stunde später: Das Auto, das vermutlich bei dem Banküberfall am Habsburger Platz als Fluchtwagen diente, ist gefunden worden. Es handelt sich um einen laubgrünen Peugeot 504 mit dem Kennzeichen M – NO 333. Der Wagen, der als gestohlen gemeldet ist, stand unverschlossen in der Nikolaistraße. Es ist anzunehmen, daß die Täter ihn dort kurz nach dem Überfall gegen ein anderes Fahrzeug ausgetauscht haben. Wer hat etwas beobachtet? Jede Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen. Ich ließ mich auf den Schreibtischstuhl fallen.
Alles okay.
Ich hätte gar nichts tun können. Selbst wenn ich die Polizei angerufen hätte – es wäre viel zu spät gewesen. Die Männer hatten längst in einem anderen Auto gesessen – und damit ging mich die Sache nichts mehr an … Ich merkte plötzlich, daß ich Hunger hatte. Ich ging in die Küche, um mir ein Brot zu schmieren … Jetzt würden sie weitermachen: Spuren sichern, Projektile untersuchen, Täterbeschreibungen sammeln … Vielleicht hatte ja wirklich jemand was gesehen in der Nikolaistraße. Da ist zwar wenig Verkehr, aber schließlich stehen auch dort Häuser, in denen Leute wohnen und aus dem Fenster schauen. Obwohl … Ich biß in das Brot und stellte mir die Nikolaistraße vor. Verdammt schlau ausgewählt. Das erste Grundstück war nur ein verwilderter Garten; dann kam ein Haus mit lauter Büros, in denen Vorhänge vor den Fenstern hingen, damit die Sekretärinnen nicht von ihren Schreibmaschinen abgelenkt wurden; dann eine leerstehende Ruine, für die das Amt für Denkmalspflege nach Spendern suchte, und schließlich noch ein verödetes Grundstück. Und auf der anderen Seite alte Häuser, bei denen die Fenster so hoch lagen, daß man bestenfalls das Haus von gegenüber sehen konnte, nicht aber die schmale Straße unten.
Mein Hunger war weg. Ich legte das angebissene Brot hin, ging ins Wohnzimmer hinüber, setzte mich, stand wieder auf, lief herum und wußte nicht, was ich tun sollte, um dieses miese Gefühl in meinem Magen wegzukriegen.
Kapitel 2
Zwei Stunden später war mir das ganz gut gelungen. Ich hatte den fünften Wodka getrunken und kam allmählich in so eine euphorische Mir-kann-keiner-Stimmung. Bayern 3 hatte noch zwei kurze Meldungen gebracht. Der angeschossene Bankangestellte war der Kassierer, er lag im Schwabinger Krankenhaus, schwebte zwar in Lebensgefahr, lebte aber noch. Die Beute betrug etwas über hunderttausend Mark, und von den Tätern fehlte jede Spur. Die Beschreibungen waren ungenau, aber es sah so aus, als handle es sich um junge Männer. Zwei waren ziemlich groß, einer etwas kleiner; alle drei hatten alte Jeans angehabt, dunkle Pullover und bunte mexikanische Strickmützen, die das Gesicht bedecken und nur Mund, Nase und Augen freilassen. Nur einer Kundin war etwas Besonderes aufgefallen: Einer der drei Männer hatte nur Sandalen angehabt, und seine Füße waren schmutzig gewesen … Die Bevölkerung wurde zur Mithilfe aufgefordert.
Ich konnte das Ganze schon wieder mit Distanz sehen, wie etwas, das man morgens mit einer Mischung aus Teilnahme und Faszination in der Zeitung liest.
Draußen regnete es zwar nicht mehr, aber die Wolkendecke war zusammenhängend und dunkel. Ich knipste die Schreibtischlampe an und wählte Uwes Nummer. Ich hatte Lust, mit jemand zu reden, essen zu gehen oder auch nur ein Bier zu trinken … Als er sich meldete, legte ich wieder auf. Er hat so eine unangenehm bohrende Art, er würde in zehn Minuten alles aus mir herausgefragt haben und mir dann monatelang Vorwürfe machen. Ich überlegte, wen ich sonst noch anrufen könnte, aber mir fiel niemand ein, der neutral genug war, um nicht nachzufragen warum, und doch lieb genug, um auch ohne Erklärungen Anteil zu nehmen. Ich sah im Fernsehprogramm nach, aber da war auch nichts, was mich vom Stuhl riß. Als es an der Tür läutete, betrachtete ich es als Wink des Schicksals und ging gutgelaunt hinaus, um aufzumachen.
Meiner guten Laune ging schlagartig die Luft aus.
Draußen standen drei Männer. Der vorderste war etwa fünfzig Jahre alt und untersetzt; er trug einen einfachen Trenchcoat mit speckigem Kragen. Er hatte ein rötliches Kugelgesicht mit grauem Haarkranz und schwarzem Seehundschnauzer. Mit einer Bewegung, als zauberte er ein Kaninchen aus einem Zylinder, hielt er plötzlich eine Plastikhülle in der Hand, ließ sie vor meiner Nase aufklappen und schnurrte mit erstaunlich sanfter Stimme: »Oberinspektor Gerstl, Referat eins … Können wir Sie einen Augenblick sprechen?«
»Was gibt es?« Ich blieb in der Tür stehen.
Der zweite war vielleicht Mitte zwanzig, auch nicht sehr groß, aber hager, und trug helle Leinenhosen und eine blaue Nappajacke über einem indischen Streifenhemd. Er war blond und braun gebrannt und machte, nachdem ich ihn eine Zeitlang angestarrt hatte, eine angedeutete Verbeugung. »Hofstetter, Kriminalassistent.«
»Es handelt sich um den Banküberfall«, sagte Gerstl. Er sprach bayrisch, benützte aber Diktion und Syntax des Hochdeutschen, was seiner Ausdrucksweise etwas seltsam Gespreiztes gab.
»Aber ich habe doch nichts gesehen!« sagte ich und ergänzte etwas aggressiv: »Das habe ich den beiden Beamten schon gesagt.«
Gerstl schaute mich mit schwarzen Dackelaugen an, als warte er noch auf weitere Erklärungen. Das war kein Polizist. Das war einer aus dem Fernsehen. Und der andere genauso. Sie stammten aus einem Film, und ich spielte auch nur eine Rolle. Es war vollkommen anders als mit den beiden Lederjacken … Mein Blick fiel auf den dritten Mann. Er hielt sich im Hintergrund, fast, als wolle er nicht bemerkt werden. Er war sehr jung, höchstens zwanzig, trug einen verblichenen Jeansanzug, der aus allen Nähten zu platzen schien, und schulterlanges Haar.
»Gehört der auch zu Ihnen?« fragte ich. Der Typ drängelte sich vor, ehe Gerstl antworten konnte.
»Ich bin von der Presse. Schneider. Ich mach den Bericht. Sie sind doch Dora Kemper, die Krimiautorin?«
Die Tür der Nachbarwohnung öffnete sich einen Spalt.
»Kommen Sie rein«, sagte ich zu Gerstl, trat zur Seite und knallte dem dritten die Tür vor der Nase zu.
»Reporter!« meinte Gerstl verächtlich und steuerte mit nachtwandlerischer Sicherheit auf das Wohnzimmer zu, während Hofstetter alle anderen Türen aufmachte und in die Räume schaute. Alberne Phrasen schossen mir durch den Kopf, wie Darf ich Ihnen etwas anbieten? oder Nehmen Sie doch bitte Platz! und überschnitten sich mit anderen: Haben Sie überhaupt einen Haussuchungsbefehl? Mein Verstand sagte mir ganz klar, daß da irgend etwas nicht stimmte. Die Männer waren echt, und sie waren von der Kripo. Oberinspektor. Der machte garantiert nicht noch einmal die gleiche Routineshow, die schon die Uniformierten abgezogen hatten. Er kam nur zu mir, dieser Gerstl. Und das bedeutete Gefahr. Aber die Angst und die Panik von heute mittag hatte ich so nachhaltig in die Flucht geschlagen, daß es mir jetzt schwerfiel, mich mit dem in Verbindung zu bringen, was da passierte.
Gerstl war neben meinem Schreibtisch stehengeblieben und schaute nachdenklich aus dem Fenster. »Schöne Aussicht haben Sie hier«, sagte er.
Unten brannten die Straßenlaternen, die Schaufenster waren hell erleuchtet, und Neonröhren schrien bunt und lautlos MÖBEL … PENSION … und natürlich BANKHAUS FISCHER.
»Vielleicht ein bißchen viel Verkehr …« Gerstl drehte sich zu mir um, lächelte. »Na ja, ich wohn auch mitten in der Stadt; man gewöhnt sich dran.« Er blickte auf den Schreibtisch, nahm versonnen ein leeres Blatt Papier hoch. »Hier arbeiten Sie also … Hübsch, hübsch.«
Meine Distanz begann abzubröckeln. Hinter mir schlich Hofstetter ins Schlafzimmer, ins Gästezimmer, schaute sich um, kam zurück. Ich konnte ihn nicht im Auge behalten, wenn ich Gerstl ansah. Der nahm jetzt einen kleinen Elfenbeinbuddha hoch, drehte ihn zwischen den Fingern und setzte ihn wieder hin. Ich sah meinen Schreibtisch plötzlich mit seinen Augen. Zweiteilig, massiv Eiche, rot gebeizt. Unheimlich schick. Oder unheimlich protzig. Jedenfalls sah er genauso teuer aus, wie er gewesen war.
Gerstl drehte sich um, stelzte über den Teppichboden zur Wand, als wate er durch kniehohes Seegras, und blieb vor dem Hundertwasser stehen. »Wirklich hübsch …« Er trat einen Schritt zurück. »Obwohl ich davon nichts verstehe.« Das war klar genug. Allein der schmale silberne Rahmen hatte 98 Mark gekostet. Gerstls Blick taxierte die Bücherwand, die Ledercouch, den englischen Ohrensessel, den Empire-Sekretär und die beiden Brücken. »Das hätte ich nicht gedacht …« Er nahm ein Buch aus dem Regal und blätterte drin herum: » … daß man soviel Geld verdient mit so was.«
»Mit was denn?« Irritiert versuchte ich über seine Schulter nach dem Buch zu spähen, das er in der Hand hielt. Die Geschichte der französischen Revolution.
Er stellt den Band zurück und zog das Elend des Liberalismus heraus.
»Mit diesen Krimis. So wie Sie sie schreiben. Das hätte ich nicht gedacht.« Er schob das Buch wieder ins Regal, drehte sich zu mir um, grinste plötzlich und ließ sich in den Ohrensessel fallen. »Ich darf doch, oder?«
Hofstetter baute sich jetzt auch vor dem Bücherregal auf und studierte die Rücken, als suche er nach der Mao-Bibel oder nach Lenins gesammelten Werken. Okay, das wars also.
Ich blieb ostentativ stehen. »Hoffentlich sitzen Sie bequem?«
»Ja, das schon. Vielen Dank.« Gerstl kramte umständlich in seinen Taschen herum, brachte eine Zigarre zum Vorschein und machte sich umständlich daran, sie abzuschnipseln und in Brand zu setzen. »Stört Sie doch hoffentlich nicht?« erkundigte er sich, als sie endlich brannte.
»Vielleicht Sind Sie so freundlich und sagen mir, was Sie eigentlich von mir wollen!« Ich baute mich vor ihm auf.
Aber er schien nur mit seiner Zigarre beschäftigt, die offenbar nicht so zog, wie er das gern gehabt hätte. »Tja«, paffte er, ohne aufzusehen, »wissen Sie … Also, das ist schon so eine Geschichte mit dem Verhältnis von Polizei und Bevölkerung …« Ein leises Schmatzen, dann eine dicke Rauchwolke. »Das ist halt nicht mehr so, wie es früher einmal war.« Versonnener Blick durch mich hindurch in die Ferne. »Da galt man noch was als Polizist. Da hatte man noch ein Ansehen. Aber heutzutage …« Die Dackelaugen kehrten aus der Vergangenheit zurück und richteten sich wieder auf mich: »Heutzutage, da rufen sie einen ja nur noch, wenn sie einen brauchen. Und manchmal sogar nicht einmal dann.« Auf einmal sah er aus wie eine Bulldogge. Eine Bulldogge mit Dackelaugen.
Ich ließ mich auf den Schreibtischstuhl fallen – der merkte ja doch nichts. »Sind Sie schon mal auf die Idee gekommen«, fragte ich, »daß die Polizei nicht ganz unschuldig sein könnte?«
»Nicht die Polizei!« Er schüttelte den Kopf. »Also von Ausnahmefällen mal abgesehen, ja … Nein: Die Zeiten, die sind schuld! Das hat's doch früher nicht gegeben, daß so ein Gauner mit einer Maschinenpistole in eine Bank reingeht und die Leute umlegt – jedenfalls nicht bei uns … Und die anderen, die stehn dabei und schaun zu und keiner tut was …« Er untersuchte seine Zigarre. »Nicht einmal die, denen gar nichts passieren kann, weil sie sicher in ihren Häusern sitzen.«
Ich starrte auf seine Hände; er trug einen Siegelring am kleinen Finger. Er meinte mich, das war mir klar. Trotzdem kam mir das ganze Gespräch eher wie eine Diskussion über ein allgemeines Thema vor; unter Kollegen, sozusagen … Ich hasse Denunzianten. Aber noch mehr hasse ich Leute, die ein Verbrechen geschehen lassen, die tatenlos zusehen, wie jemand erschlagen oder erstochen wird, ohne etwas zu unternehmen; die Gaffer, die sich hinterher um das Opfer drängen und nicht einmal die Ambulanz durchlassen … Ich war mir nicht ganz klar darüber, wo ich mein Verhalten einordnen sollte, aber daß es mies gewesen war, mies und falsch, stand außer Frage. Ich machte den Mund auf, um ihm alles zu sagen. Er ließ mir keine Zeit dazu.
»Ja, Sie!« knurrte er. »Sie und Ihresgleichen!«
Ich machte den Mund wieder zu. Er legte die Zigarre in den Aschenbecher und beugte sich vor:
»Ich kenne Ihre Bücher. Und ich mag sie nicht. Es ist ja heute üblich, daß man sich mehr um den Mörder kümmert, als um das Opfer … Nichts dagegen!« Er hob abwehrend beide Hände: »Das ist sehr ehrenhaft … Aber, wenn Sie gleichzeitig die Polizei als einen Haufen dümmlicher Idioten und hirnloser Schläger hinstellen, dann geht das einfach zu weit.«
»Aber das ist doch …« begann ich.
Er ließ mich nicht aussprechen. »Das sind genau diese Bücher und Artikel, die uns in Verruf bringen, die uns die Arbeit so schwer machen … Bullen!« Er nahm seine Zigarre auf, streifte die Asche ab und legte sie wieder hin. »Denen geht man aus dem Weg. Denen sagt man nichts; die lügt man an. Und das ist dann auch noch schick!«
Hinter mir putzte sich Hofstetter geräuschvoll die Nase. Gerstl schaute irritiert zu ihm hin.
»Setz dich hin, Hofstetter! Das macht mich nervös.«
Hofstetter verstaute umständlich sein Taschentuch und hockte sich auf eine Stuhlkante. Gerstl sah ihm dabei zu, schien den Faden verloren zu haben, nahm seine Zigarre und rollte sie zwischen den Fingern. Als er wieder sprach, klang es wieder ruhig und sanft.
»Ihr wollt alle das System verändern. Davon redet ihr doch dauernd, oder? Und bei der Polizei, da fängt man an; die kann man so schön lächerlich machen …«
»Hören Sie, ich habe in keinem meiner Bücher …«
Wieder unterbrach er mich. »Aber noch haben wir dieses System! Und es ist das beste, das wir je hatten. Und solange wir es haben, gehört die Polizei dazu – verstehen Sie? Sie wird gebraucht; sie ist notwendig … Oder wären Sie vielleicht anderer Meinung, wenn Sie da liegen würden, im Schwabinger Krankenhaus, mit einer Kugel im Bauch?«
»Was hat denn das damit zu tun?« fuhr ich auf. »Das ist doch kein Argument! Sie kommen hier rein, schnüffeln in meinen Büchern rum, schmeißen mich mit irgendwelchen Terroristen in einen Topf und entschuldigen dann die Brutalität der Polizei mit den Methoden der Verbrecher … Sie machen das Ei zur Henne! Das ist natürlich einfach. Man unterdrückt jemand so lange, bis er sich endlich wehrt, und dann schreit man nach der Todesstrafe …« Ich merkte, daß ich ungeschickt argumentierte, daß ich über das Ziel hinausschoß, weil ich mich provozieren ließ von diesem … von diesem Bullen.
»O nein!« Der Bulle lächelte plötzlich. »Todesstrafe! Tz, tz, tz …« Er saugte friedlich an seiner Zigarre. Dackelblick: »Ich verlange doch nichts Unbilliges. Ich tue hier doch lediglich meine Pflicht. Meinen Job, für den ich bezahlt werde …« Verstärktes Grinsen: »Von Ihren Steuergeldern, unter anderem.« Das Grinsen erlosch. »Ich verlange nur eine Aussage. Eine Augenzeugenaussage betreffend einen bewaffneten Banküberfall, bei dem ein Mann angeschossen wurde … Wissen Sie eigentlich, wie das ist? Wir sind hingefahren; der Mann lag noch da. Er hat geschrien … Haben Sie eine Ahnung, was das ist, so ein Bauchschuß? Es blutet ja gar nicht so sehr. Aber grauenhafte Schmerzen … Ein paar Kunden waren dabei, unter ihnen eine Frau mit einem kleinen Kind. Das Kind hat auch geschrien. Es konnte nicht mehr aufhören. Es hat immer nur den Mann angestarrt, der am Boden lag … Vielleicht wird er sterben, der Mann. Er hat auch zwei Kinder. Und die Männer, die geschossen haben, und für die Sie ja soviel Verständnis haben, die sind entkommen. Mit dem Geld. Und mit der Waffe. Und keiner kann wissen, wann sie sie wieder benützen. Und deshalb müssen wir sie vorher finden. Und dazu brauchen wir Hilfe!« Er drückte die halbverrauchte Zigarre aus, zerquetschte sie zu einem braunen Krümelhaufen. »Wir haben in allen umliegenden Häusern nachgefragt. Die meisten Anwohner waren nicht zu Hause. Immerhin haben wir erfahren, daß noch ein vierter Mann beteiligt war, der Fahrer, und daß sie ein grünes Auto hatten, und die ersten Buchstaben des Kennzeichens. Inzwischen wissen wir einiges mehr. Und wir werden noch mehr erfahren …« Die Dackelaugen wurden schmal: »Von Ihnen.«
»Ich weiß nichts!« Es kam hastig, und es klang nicht sehr überzeugend.
Er lächelte wieder. »Ich weiß, Sie halten Polizisten für dämlich. Aber ab und zu ist auch mal ein anderer drunter. Zum Beispiel der, der Sie befragt hat … Wissen Sie, eine so große Leuchte braucht man da gar nicht zu sein. Menschenkenntnis, das ist alles. Und das lernt man, wenn man täglich mit Menschen zu tun hat. Menschen, die Angst haben, die lügen, die etwas verbergen wollen … Und Sie haben gelogen!«
Ich schwieg, weil ich meiner Stimme nicht traute. Er nickte bestätigend.
»Einfache Leute, die haben oft Angst vor der Polizei – ebenso wie vor dem Chef oder vor dem Gerichtsvollzieher … Aber Sie? Sie haben Geld; Sie sind gebildet. Wenn Sie also nervös werden, stottern, sich versprechen oder überlange Erklärungen abgeben, dann hat das einen anderen Grund. Dann sieht das für mich jedenfalls so aus, als hätten Sie etwas zu verbergen. Und ich möchte gerne wissen was.«
»Ich habe nichts …« Ich merkte, daß ich nah dran war, mich zu entschuldigen, mich zu rechtfertigen. Ich wurde wütend. Wütend auf mich, auf dieses hinterhältige Dackelgesicht und auf das blonde Lauschohr. Ich wurde so wütend, daß ich am liebsten geheult hätte. Ich stand auf. »Ich habe nichts zu sagen.«
»Auch recht.« Er stemmte sich schnaufend aus dem Sessel hoch, nickte Hofstetter zu. »Zeit haben wir ja genug …« Sie gingen zur Tür. » … und Geduld auch.«
Als ich die Tür hinter ihnen zumachte, sah ich durch den Spalt den Reporter, der draußen auf sie wartete und sich gleich auf sie stürzte.
Ich rannte ins Wohnzimmer zurück, drehte meine Stereoanlage voll auf und legte Nat Adderlys Sermonette auf, eine Nummer, mit der ich immer und unfehlbar happy werde. Diesmal nicht. Diesmal machte sie mich nervös. Ich tigerte durch die Wohnung, schluckte zwei Valium und trank eine halbe Flasche Volkacher Kirchberg, eine tödliche Mischung. Dann sah ich im Fernsehen einem amerikanischen Detektiv zu, der glatzköpfig und bonbonlutschend die größte Gang von ganz Manhattan an die Wand nagelte, und rauchte dabei ein Päckchen Zigaretten weg. Alles hatte ich verhunzt, aber auch alles. Nicht nur, daß ich mich entschlußkräftig und einsatzfreudig wie ein paralysiertes Kaninchen gezeigt hatte, daß ich vor zwei harmlosen Streifenbullen das große Zittern bekommen hatte – nein, ich hatte es doch tatsächlich fertiggebracht, mich von einem schnauzbärtigen Bierdeckelkommissar mundtot machen zu lassen. Das war nun beinahe schon wieder komisch. Ich sah mich noch vor ihm stehen und mit beherrschter Miene Ich habe nichts zu sagen! sagen … Schade, daß ich nicht so richtig drüber lachen konnte.
Dann war der Krimi zu Ende. Auch die folgende Diskussion mit führenden Politikern war nicht sonderlich dazu angetan, mein Glücksgefühl zu steigern. Also schaltete ich die Kiste in einem Anfall von Heroismus aus und ging mit einem Krimi von der Konkurrenz ins Bett.
Ich schlief leicht und unruhig, wälzte mich herum, schwitzte unter dem dünnen Laken, träumte von Maschinengewehrgarben und schnauzbärtigen Mördern, hörte das Grölen von Betrunkenen auf der Straße und das Klappen von Autotüren. Das metallische Knirschen schien auch zu einem Traum zu gehören.
Ich drehte mich auf die andere Seite und merkte, daß ich wach war, daß ich nicht träumte. Ich bewegte mich nicht. Alles war still. Das einzige Geräusch in der Wohnung war das Ticken meines Weckers. Ich konzentrierte mich auf die Leuchtziffern. Es war dreiviertel drei. Ein einzelnes Auto fuhr durch die Straße. Die Uhr tickte in einem anderen Rhythmus als mein Herz. Ich mußte aufs Klo. War zu müde, um aufzustehen. Und zu wach, um wieder einzuschlafen.
Etwas knackte.
Laut und deutlich. Das war weder ein Traum noch Einbildung. Ich zog das Laken bis ans Kinn hoch. Das Regal, dachte ich. Das Holz. Es arbeitet noch. Ist doch logisch. Metallisch? Durch die Vorhänge kam ein bläulicher Streifen Neonlicht herein. Ich schloß die Augen und versuchte mich zu entspannen, tief und gleichmäßig zu atmen, mußte husten und war wieder wach … Zwischen drei und fünf Uhr früh ist die einzige Zeit in Schwabing, in der es fast völlig ruhig ist. Ich wohne seit Jahren hier. Natürlich, tagsüber ist es laut – Mopeds, Autos, Busse. Aber ich mag das; ich höre den Lärm gar nicht mehr … Vielleicht war es nur die Stille, die mich aufgeweckt hatte. Ich drehte mich auf die andere Seite und rollte mich eng zusammen. Dann hielt ich die Luft an. Ich spürte es ganz deutlich.
Ich war nicht allein im Zimmer.
Ich riß die Augen auf. Das untere Stück von dem blauen Neonlichtstreifen war verschwunden. Das obere Ende war noch da, knapp ein Meter. Wenn meine Wohnung zweieinhalb Meter hoch ist, dann fehlten etwa einsachtzig. Die Größe eines Mannes. Ich schrie nicht, ich schnaufte nur auf.
»Nicht schreien!« sagte eine Männerstimme. Sie kam nicht von dem Fenster mit dem unterbrochenen Lichtstreifen, sie kam von hinten. Diesmal schrie ich.
Stimmen. Trampeln. Meine Wohnung schien voller Männer zu sein. Ich spürte, wie sich die Matratze senkte und eine Hand nach meinem Kopf tastete. Licht flammte auf, und schwielige Finger preßten sich auf meinen Mund. Ich bekam keine Luft, das Gesicht über mir schien nur aus Weiß zu bestehen, weiße, hervorquellende Augen und weiße Zähne. Ich wand mich, packte die Finger mit beiden Händen und schlug mit den Füßen aus. Ich erwischte den kleinen Finger, versuchte ihn zu verdrehen, hörte einen unterdrückten Aufschrei und konnte wieder atmen. Schuhe sprangen auf mein Bett, Sandalen mit nackten schmutzigen Zehen drin, eine neue Hand kam auf mich zu. Sie umspannte ein Messer. Es war, als würde die Klinge aus dem Fleisch herauswachsen. Schmal und spitz.
»Nein!« flüsterte ich. »Bitte nicht … Bitte … Ich … Ich bin ganz ruhig …«
Das Messer blieb dicht vor meinem Gesicht stehen.
»Laß sie!« Eine andere Stimme. Ich hatte das Gefühl, sie schon einmal gehört zu haben.
Das Messer wich ein paar Zentimeter zurück. »Kein Ton – hast du mich verstanden?«
Ich nickte stumm.
Dann wieder die andere Stimme: »Sie wird nicht mehr schreien. Laß sie los!«
Der Daumen der Hand bewegte sich, die Klinge schnappte in die Hand zurück. Ich sah zum Fenster hinüber, von wo die andere Stimme gekommen war. Weiß Gott – den kannte ich wirklich: Groß und hager, Afro-Locken, dunkle Augen, breiter Mund; Jeans, weißes T-Shirt, verschlissenes Lederwestchen: Max. Der Typ aus der Grünen 8.
Er grinste. »Tut mir ja fast leid, daß ich gestern abgehauen bin. Scheint so, als wäre mir da einiges entgangen.« Ich sah an mir herunter. Ich war nackt; bei dem Gestrampel hatte sich das Laken unter mir verkrumpelt. Ich versuchte es wieder hochzubekommen, mühte mich ab, drehte und wand mich, verhedderte mich nur noch mehr. Sie lachten. Endlich hatte ich es geschafft, deckte mich bis oben hin zu und kroch an die Wand zurück.
»Was wollt ihr?«
Sie hörten auf zu lachen. Sie standen an meinem Bett und starrten mich an. Es waren vier. Max, dann der mit den weißen Zähnen und den Basedowaugen, der Kleine mit dem Messer und noch einer mit einem Vollbart und den Samtaugen eines Landpfarrers im Kino.
»Erst mal was zu trinken«, sagte Basedow. »Dann sehen wir weiter.«
»Hol selber was!« Max wies mit dem Kopf zur Zimmertür; Basedow ging hinaus, klapperte in der Küche herum und kam mit zwei Weinflaschen und einem Korkenzieher zurück.
»Bier war keins da«, sagte er entschuldigend und machte sich an den ersten Korken.
Ich sah das Etikett. Er hatte den Iphöfer Kronsberg erwischt, Optima Beerenauslese und noch dazu einen 70er. Irgend etwas platzte bei mir. Ich riß ihm die Flasche aus der Hand. »Wenn du Bier willst, geh auf den Balkon. Da steht ein ganzer Kasten!«
Er glotzte mich verblüfft an, hielt den Korkenzieher wie eine Pistole auf mich gerichtet. Ich nahm ihn ihm weg und machte die Flasche selber auf. »Gläser sind im Wohnzimmerschrank.«
Max stieß sich vom Fenster ab, ging ins Wohnzimmer und kam mit zwei gewölbten Weinkelchen zurück.
»Wieso nur zwei?« maulte Basedow.
»Weil ihr zu blöd seid für so einen Wein.«
Max nahm mir die Flasche ab, schenkte ein und hielt mir ein Glas hin. Basedow brummelte noch ein bißchen, brachte aber dann drei Bierflaschen herein, die beim Öffnen überschäumten. Die drei hockten sich auf den Teppich neben mein Bett, Max auf die Kante. Ich saß in mein Laken gewickelt, so weit von ihm weg wie möglich. Der Wein paßte nicht so ganz zu der Situation und ich schmeckte auch nicht viel mehr, als daß er kühl und naß war. Max hingegen schien ihn mit äußerstem Genuß zu trinken; er schnupperte mit der Nase über den Glasrand, nahm einen vorsichtigen Schluck, kaute drauf herum, ließ ihn tröpfchenweise in die Kehle rinnen und verdrehte die Augen. Wenn es nicht gegen meine kulinarischen Prinzipien verstoßen hätte, wäre ihm mein volles Glas mitten ins Gesicht geflogen.
»Kann mir jetzt vielleicht mal einer von euch erklären, wie ich zur Ehre dieser entzückenden Spontanparty komme?«
Samtauge hob seine Bierflasche und lächelte. »Herzlichen Dank für die Einladung.«
»Ich hör wohl nicht richtig … Einladung? Verschwindet, los! Und zwar sofort.«
»Das hab ich dir doch gleich gesagt!« giftete der mit dem Messer, zu Max gewandt. »Sie macht Zicken. Scheiße!«
Max hörte auf, mit dem Wein zu gurgeln, schluckte runter und goß sich nach. »Sie war bis jetzt okay, und sie wird's auch bleiben.« Er sah mich an. »Sie hat nur einen Schreck gekriegt. Stimmt's?« Er streckte eine Hand aus, als wollte er mich berühren.
Ich wich aus. »Seid ihr besoffen, oder soll das ein Witz sein?«
»Mann, Mutter!« Basedow hatte seine Flasche leer und stand auf. »Wir wollten uns doch nur bei dir bedanken!« Er ging wieder auf den Balkon.
Ich rutschte vorsichtig mit meinem Laken zu dem Bord hinüber, wo meine Zigaretten lagen. »Oder habt ihr gespritzt?«
»Was hab ich gesagt?« keifte der Messerheld.
Max beachtete ihn nicht; er stellte sein Glas ab und kramte ein Streichholzheftchen hervor, um mir Feuer zu geben. »Nix. Wir sind völlig klar. Wir wollen uns bei dir bedanken und uns deiner … Na, sagen wir: deiner weiteren Loyalität versichern.«
Basedow kam mit dem ganzen Bierkasten vom Balkon herein. »Ich sag euch, die hatte aber auch einen Logenplatz hier!«
Der Rauch kratzte mich in der Kehle, und ich hustete. Das, was da so nebelhaft in meinem Hirn hochkroch, gefiel mir überhaupt nicht. Aber schon kein bißchen. Ich schüttelte nur den Kopf. »Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst.«
»Davon, daß du nicht gesungen hast, Mutter.« Basedow hielt die Flasche schräg, und das Bier schäumte auf den Teppich. »Das hätte dir doch keiner zugetraut. Der Maxl hat zwar immer schon gesagt, daß dir die Bullen auch stinken, aber so was schreiben und dann auch tun, ist ja nicht dasselbe. Find ich eben gut.« Er trank. »Obwohl wir ganz schön erschrocken sind, zuerst.«
Samtauge lächelte und zog eine Abendzeitung aus der Tasche. Hypnotisiert griff ich danach. Es war die Ausgabe von morgen, die in den Kneipen immer schon nachts verkauft wird. Der überfette Aufmacher war nicht zu übersehen: 100 000 MARK BEUTE Ausrufezeichen. Darunter kaum kleiner: DREISTER BANKÜBERFALL IN SCHWABING – KASSIERER SCHWEBT IN LEBENSGEFAHR. Danach, immer noch viel zu dick, um unauffällig zu sein: BEKANNTE KRIMIAUTORIN ZEUGE DES VERBRECHENS Fragezeichen. WARUM SCHWEIGT SIE Fragezeichen. Noch etwas kleiner: Die Polizei verschanzt sich hinter dunklen Andeutungen …Das Kleingedruckte flirrte vor meinen Augen. Der Hergang wurde kurz angerissen, Oberinspektor Gerstl genannt; der war es auch, der sich hinter Andeutungen verschanzte, als die Frage auf die bekannte – haha! – Krimiautorin kam, von deren Fenster aus man den Eingang der Bank genau im Blickfeld … Und so weiter. Mein Name wurde auch genannt, aber es war nicht ganz die Art Publicity, auf die ich Wert lege. Weiter auf Seite 10 …Die Zeitung rutschte mir aus der Hand, fiel auf die Zigarette, Asche bröselte auf das Bett.
»Aber ich … Ich hab doch überhaupt nichts gesehen!« stammelte ich.
Vier Gesichter sahen mich ausdruckslos an.
»Ehrlich! Ich schwör's euch. Ich hab nichts gesehen!«
Sie schwiegen. Samtauge knabberte an den Fingernägeln, Basedow öffnete versonnen die dritte Bierflasche, und der Kleine spielte nervös mit seinem Messer. Schnapp auf, schnapp zu. Nur Max bewegte sich nicht. Er starrte mich an.
»Das versteh ich nicht«, sagte er endlich. »Wieso kneifst du plötzlich? Du hast uns gesehen, und hast die Schnauze gehalten. Das war okay. Jetzt geht's nur darum, daß du das auch in Zukunft tust.«
»Aber, daß ihr das wart …« Ich mußte mich räuspern. »Daß ihr … Das hab ich doch wirklich nicht gesehen!«
»Was sag ich?« Schnapp auf – schnapp zu. »Zicken!«
Max winkte ab, ohne den Messerhelden anzusehen. »Meinst du das echt?« Er runzelte die Stirn. »Daß du nichts gesehen hast?«
»Der Oberbulle war anderer Meinung«, warf Basedow dazwischen.
Ich drückte die Zigarette aus. »Ich hab den grünen Peugeot gesehen. Ich hab vier Männer gesehen, die Masken auf dem Gesicht hatten und damit weggefahren sind. Das war alles.«
»Und ich hab mir die Maske kurz vor dem Einsteigen runtergerissen«, sagte Max leise, »und da hast du mich erkannt.«
Ich konnte nichts sagen. Das war also Max gewesen. Der mit der Maschinenpistole. Der, der geschossen hatte … Meine Hände verkrampften sich, das leere Weinglas rollte über das Laken.
Max nahm es hoch, füllte es und gab es mir zurück. »Los, trink!« Ich trank automatisch. Er nahm mir das Glas wieder ab. »Warum hast du das nicht dem Bullen gesagt!«
»Ich weiß selber nicht«, murmelte ich müde. Aber ich wußte gar nicht, was ich da sagte. Meine Gedanken kreisten nur um eines: GEFAHR! Es waren die Bankräuber. Diese vier netten Typen aus der Grünen 8, diese originellen Boys aus dem Untergrund, die mich jetzt anstarrten, die mich beobachteten, die mich belauerten. Sie waren bei mir eingebrochen, und einer von ihnen hatte ein Messer dabei … Dieser Max, der etwas von Wein verstand und auf einen Menschen geschossen hatte … Ich durfte mir nichts anmerken lassen. Ich mußte ruhig bleiben. Mit ihnen reden. Sie überzeugen … Ich holte Luft: »Weil ich die Bullen nicht mag. Weil mir dieser Gerstl blöd gekommen ist. Weil ich noch nie einen denunziert habe.«
»Und das sollen wir glauben!« Der Messerheld lachte.
Es war ein ziemlich unangenehmes, ein böses Lachen. Ich hätte gern eine Decke oder sonstwas Festeres gehabt. Basedow und Samtauge sahen abwartend zu Max hin, der nachdenklich an seinen Fingerknöcheln nagte.
»Das ist auch jetzt egal«, meinte er nach einiger Zeit, »Ob sie uns erkannt hat oder nicht, jetzt kennt sie uns.« Der Kleine mit dem Messer sprang auf; Max hielt ihn durch eine Handbewegung zurück: »Mach jetzt keinen Scheiß!«
»Aber sie spinnt doch!« Seine Stimme schrillte. »Sie lügt doch wie gedruckt. Irgendwas hat sie gequatscht. Die Bullen haben was gerochen … Die hält doch nie dicht!«
»Wir müssen uns eben was ausdenken.« Max rutschte ein Stück zu mir her, legte seine Hand auf mein Knie. »Ich mag dich. Ehrlich, du bist ganz mein Typ. Ich steh auf Intellektuelle. Vor allem …« Er grinste: » … wenn sie langbeinig sind und auch sonst so aussehen wie du. Ich würd gern mit dir schlafen … Ich mein, es würde mir verdammt stinken, wenn mit dir was passiert. Verstehst du?«
Ich verstand sehr gut. Der mit dem Messer hätte mich am liebsten umgelegt, Basedow wäre das auch lieb gewesen, solange er's nicht selber tun mußte; Samtauge würde vielleicht für mich beten, und der einzige, der wenigstens teilweise auf meiner Seite zu stehen schien, war der am meisten Bedrohte – der, der geschossen hatte … Aber sie konnten das alles doch nicht ernst meinen! Das war doch unmöglich. Sie saßen hier um mich herum in meinem Schlafzimmer und tranken mein Bier und meinen Iphöfer Kronsberg. Das konnten doch keine Mörder …
»Ich werde nichts sagen.« Ich legte alle Überzeugung in meine Stimme. »Ich schwör's euch – von mir erfährt keiner was.« Ich lauschte auf den Nachhall meiner Worte und hörte selber, wie dünn sie klangen. Wie ein aufgesagter Text aus einem Fernsehkrimi … Und genauso überzeugend wirkten sie auch.
Max zog seine Hand zurück. »Das langt leider nicht. Sogar wenn du es wirklich ernst meinst – das langt nicht. Deine Bücher sind zwar lieb und nett, aber mit der Wirklichkeit haben sie nicht so viel zu tun.« Er schnippte mit den Fingern. »Freut mich ja auch immer zu lesen, wie blöd die Bullen sind. Das dumme ist nur, von ihren Methoden hast du keinen blassen Schimmer. Und dieser Gerstl, der so aussieht, daß man ihm ein Bier bezahlen möchte – das ist ein ganz Scharfer. Der gibt nicht so leicht auf. Der wird immer wiederkommen. Und dann wirst du eines schönen Tages so weich sein wie eine überreife Zwetschge. Und das Risiko würden wir gern vermeiden.«
»Hab ich doch gleich gesagt!« Schnapp.
»Du hältst dich raus.« Max machte eine Bewegung, als wollte er ihn schlagen; der Kleine duckte sich. »Du hast sie wohl nicht mehr alle, was?« Max sprach plötzlich scharf. »Reicht dir einer noch nicht? Tu dein Scheißmesser weg, oder ich schlitz dich mal eben kurz damit auf, du Arsch!« Eine Sekunde lang sah es so aus, als wolle sich der Kleine auf Max stürzen; dann wandte er sich ab, ließ die Klinge zurückspringen und schob das Messer in die Tasche. Max fuhr sich mit den Händen durch das Haar, kratzte sich am Kopf. »Wir müssen uns was ausdenken, womit wir sie in der Hand haben. Etwas, das sie zwingt, durchzuhalten.«
»Wie wär's denn …« Samtauge nickte mir freundlich zu: »Wenn wir ihr einfach einen Teil von dem Geld geben? Dann ist sie beteiligt.«
»Geht nicht«, meinte Max nach kurzem Überlegen. »Das Geld ist heiß. Wir wissen nicht, ob sie womöglich die Nummern von den Scheinen haben … Ich glaub's zwar nicht – zu umständlich. Aber vorläufig müssen wir alle die Finger davon lassen. Und später irgendwo im Ausland … Im Augenblick ist es so, als ob wir das Geld nicht hätten. Also können wir ihr auch nichts davon geben. Logo?«
»Scheißspiel!« murmelte der Messerheld. Ich hatte nicht den Eindruck, daß er bedauerte, mir nichts von der Beute abgeben zu können.
»Ja dann …« Basedow hob ratlos die Schultern.
»Augenblick mal … Die Idee war ja prima, im Grunde …« Max grinste plötzlich. »Klar! Wir brauchen ihr gar kein Geld zu geben!« Er wandte sich zu mir. Er strahlte. Er nahm meine beiden Hände und sah aus, als wollte er mir einen Heiratsantrag machen. »Paß auf, Schätzchen – wir machen das so: Du hast auch weiterhin nichts gesehen, und wir sind lieb und nett. Sollten die Bullen dummerweise aber trotzdem auf uns kommen, dann sagen wir einfach aus, daß du mitgemacht hast. Du hast das ganze Ding ausbaldowert. Du sitzt hier in deiner Terrassenwohnung direkt über der Bank; du kannst genau sehen, wann die aufmachen, wie lange abends noch Licht brennt, wann die Geldtransporter kommen – und so weiter, und so weiter … Du hast dir schon zweimal in deinen Krimis so was ausgedacht, und du stehst auf Typen wie wir. Du wolltest selber auch mal mitmachen … Na?Klingt das überzeugend?«
Ich brachte keinen Ton heraus. Das war auch nicht nötig. Max sah mein Gesicht und wußte, daß er mich hatte. Er griff sich mein Zigarettenpäckchen, zündete eine an und schob sie mir zwischen die Lippen. »Unsere kleine Friedenspfeife …« Er nahm die Zigarette wieder an sich, rauchte und sah mir dabei in die Augen. Es war tatsächlich etwas ganz Ähnliches wie ein Heiratsantrag geworden.
»Die Idee ist gut«, sagte Samtauge langsam. »Sie ist sogar hervorragend … Ich denke, es ist an der Zeit, daß wir uns vorstellen. Von jetzt an kann sie gar nicht genug wissen.« Er stand auf, verbeugte sich vor mir. »Ich bin der Datzmann Vitus, den Lechenmayr Maxl kennst du schon. Der da –« er wies auf den Kleinen mit dem Messer – »das ist der Jaschik Ferdinand genannt Ferdi; und der« –er deutete auf Basedow – »ist der Lehl Jakob, und alle nennen ihn Dschako.«
Basedow-Dschako zeigte mir seine weißen Zähne, was bei ihm vermutlich ein Lächeln ersetzte.
»Der sollte sich mal die Füße waschen«, sagte ich, »oder Socken anziehen. Sonst erkennt ihn noch einer.«