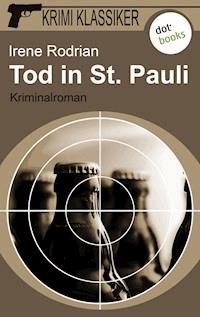2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Krimi-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Eine gescheiterte Ehe und ein Junge, der zu allem bereit ist, um seine Familie zu retten: Irene Rodrians „Bei geschlossenen Vorhängen“ jetzt als eBook bei dotbooks. Als der 12-jährige Thomas erfährt, dass sein Vater eine Affäre hat, bricht für den Jungen eine Welt zusammen. Von seinem besten Freund Axel weiß er genau, wie es sich anfühlt ein Scheidungskind zu sein. So setzt er alles daran, die Trennung seiner Eltern zu verhindern. Und die Versöhnung scheint zum Greifen nah. Doch dann verliebt sich Thomas‘ Mutter in einen anderen Mann und dieses Mal ist ihr Sohn zu allem bereit, um die Familie zusammenzuhalten – auch wenn dies bedeutet, dass jemand sterben muss … Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Bei geschlossenen Vorhängen“ von Irene Rodrian. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als der 12-jährige Thomas erfährt, dass sein Vater eine Affäre hat, bricht für den Jungen eine Welt zusammen. Von seinem besten Freund Axel weiß er genau, wie es sich anfühlt ein Scheidungskind zu sein. So setzt er alles daran, die Trennung seiner Eltern zu verhindern. Und die Versöhnung scheint zum Greifen nah. Doch dann verliebt sich Thomas‘ Mutter in einen anderen Mann und dieses Mal ist ihr Sohn zu allem bereit, um die Familie zusammenzuhalten – auch wenn dies bedeutet, dass jemand sterben muss ...
Über die Autorin:
Irene Rodrian, 1937 in Berlin geboren, erhielt für ihren Roman Tod in St. Pauli 1967 den begehrten Edgar-Wallace-Preis. Seither hat sie sich mit zahlreichen Bestsellern in einer Gesamtauflage von mehreren Millionen und als Drehbuchautorin (Tatort, Ein Fall für Zwei) einen Namen gemacht. Irene Rodrian lebt heute in München.
Bei dotbooks erschienen bereits Irene Rodrians Barcelona-Krimis über das Ermittlerinnen-Team Llimona 5 (Meines Bruders Mörderin, Im Bann des Tigers, Eisiges Schweigen und Ein letztes Lächeln) sowie die Reihe Krimi-Klassiker, die folgende Bände umfasst:
Tod in St. Pauli
Bis morgen, Mörder
Wer barfuß über Scherben geht
Finderlohn
Küsschen für den Totengräber
Die netten Mörder von Schwabing
Ein bisschen Föhn und du bist tot
Du lebst auf Zeit am Zuckerhut
Der Tod hat hitzefrei
… trägt Anstaltskleidung und ist bewaffnet
Das Mädchen mit dem Engelsgesicht
Vielliebchen
Schlagschatten
Handgreiflich
Über die Klippen
Die Autorin im Internet: www.irenerodrian.com und www.llimona5.com
***
Neuausgabe September 2014
Copyright © der Originalausgabe 1988 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Tanja Winkler, Weichs
Titelbildabbildung: © Artem Furman - Fotolia.com
ISBN 978-3-95520-724-3
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Bei geschlossenen Vorhängen an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Irene Rodrian
Bei geschlossenen Vorhängen
Kriminalroman
dotbooks.
1 THOMAS
»Ich würde ihn töten.«
Ich konnte nur seinen Rücken sehen. Nach vorn über die Fernbedienung gekrümmt. Er weinte. Ich sollte das nicht merken, aber sein Schnaufen und das Zucken der Schultern verrieten ihn. Axel war mein Freund. Mein bester Freund, glaube ich. Eine tolle Freundschaft, wenn man sich nicht mal traut vor dem anderen zu heulen. Ich streckte die Hand nach ihm aus, er wich zurück, als hätte er die Bewegung gespürt. Ich faßte an ihm vorbei in die Schüssel mit den alten Weihnachtsplätzchen und erwischte ein Vanillekipferl. Es schmeckte ranzig.
»Ich mein das so, wie ich es sage. Ich würde ihn umbringen. Ehrlich.«
Axel schwieg noch immer. Ich trank einen Schluck Cola, um den ranzigen Geschmack loszuwerden, das Cola war warm.
Der behaarte Obermamulle griff sich einen der abgeschlagenen Köpfe und spaltete ihn mit einem Säbelhieb. Dann schmatzte er dran rum und gab die Hirnschale wie eine halbe Kokosnuß an die anderen Mamullen weiter. Sie grunzten und rollten mit den Augen, und alles war rot von Blut. Es war so primitiv gemacht, daß man die simple Mechanik erkennen konnte. Nicht mal die Mundbewegungen waren synchron, und die Musik war der letzte Schrott. Axel hatte auch bessere Cassetten, aber er hatte heute einfach die erstbeste reingeschoben, es war egal.
»Hast du nie daran gedacht?«
Axel sagte nichts, nur das Zucken seiner Schultern verstärkte sich. Er hatte mich angerufen, und ich war hergekommen. Weil ich sein Freund war. Und jetzt saß ich hier und konnte nichts tun, um ihm zu helfen. Ich rutschte langsam zu ihm hinüber und packte ihn an der Schulter, bevor er mir wieder ausweichen konnte. »Du mußt es dir doch mal überlegt haben«, sagte ich leise, »wenn er tot wäre, dann wäre alles wieder wie vorher.«
Der Film war zu Ende, und erstmal war Axel damit beschäftigt, die Cassette auf Rücklauf zu stellen. Wir starrten auf den leeren Bildschirm und hörten dem Schnarren zu.
»Es ist ja nicht der erste«, sagte er schließlich, und ich hätte ihn fast nicht verstanden. Er sah mich immer noch nicht an. »Es hat viele gegeben, sagt mein Vater. Ein ganzes Regiment. Ich hab davon nichts gemerkt. Das waren Freunde, hab ich gedacht. Onkel Rüdiger oder Onkel Karsten. Und Herr Niebur. Alle.« Er krümmte sich wieder nach vorn und heulte. Laut diesmal mit Schluchzern und kleinen Schreien wie ein Tier. Ich nahm die Cassette raus, schaltete den Fernseher ab und legte eine Rockplatte auf. Volle Lautstärke. Die Wohnung hallte hohl, Axels Vater hatte fast alle Möbel mitgenommen.
Wir hörten die Wohnungstür nicht und erschraken, als plötzlich die Tür von Axels Zimmer aufging, und das Licht vom Flur hereinfiel. Ein breiter gelber Streifen, und in der Mitte der runde Schatten von Axels Mutter.
»Was treibt ihr zwei denn da im Dunkeln?« Sie knipste das Oberlicht an und lachte, aber es klang verlegen und nicht so, als würden wir sie wirklich interessieren. Ich stand auf und begrüßte sie, um sie einen Moment lang von Axel abzulenken. Als ich mich umdrehte, hatte er sich gefangen. Er stand mit völlig unbewegtem Gesicht hinter mir und lächelte sie an.
»Wir haben uns nur ein paar Filme angesehen.«
»Das ist nett. Bleibst du zum Essen, Tommy?« Sie wandte sich wieder ab und hängte ihre Jacke in der Garderobe auf. Axel sagte nichts. Er wollte, daß ich blieb, und seine Mutter wollte es auch. Dann wären sie nicht allein am Küchentisch. Sie saßen jetzt immer am Küchentisch. Im Wohnzimmer gab es nur noch die Blumen im Fenster und den Teppichboden.
»Ich würd gern«, log ich, »aber meine Eltern erwarten mich. Wir bekommen heute noch Besuch.«
»Na, dann ein andermal«, sie verschwand in der Küche und ließ mich mit Axel allein. Axel schwieg. Er wußte genausogut wie ich, daß wir heute keinen Besuch bekamen. Jedenfalls keinen, bei dem ich dabei sein mußte. Er sah mich nicht an, ich konnte den Vorwurf auch so spüren. Du läßt mich im Stich. Wir hatten es nicht ausdrücklich verabredet, aber es war klar gewesen, daß ich bei ihm übernachte. Ich zog meinen Anorak an, wickelte mir den Schal um den Hals und machte die Wohnungstür auf. Sah zu ihm zurück. Er stand unbeweglich in der Tür zu seinem Zimmer, dem einzigen, in dem es noch alle Möbel gab.
»Sorry«, sagte ich. Und damit meinte ich nicht so sehr, daß ich ihn verließ, sondern daß mir keine bessere Erklärung einfiel. Ich wollte nur weg, und er wußte das.
Es war kalt draußen nach der überheizten Wohnung, und ich fror. Ich rannte ein Stückchen, aber die Moonboots waren zu klobig, es machte keinen Spaß. Die Straße war leer, auf beiden Seiten Mietshäuser und die Mauer der parkenden Autos. Der Schnee war zu einem grauen Matsch flachgefahren. Zum ersten Mal fiel mir auf, wie ärmlich die Gegend wirkte. Es gab keine Bäume, keinen Platz, der die Eintönigkeit einmal auflockerte und kein Haus, das aus der genormten Reihe ausbrach. Nicht einmal Läden gab es. Im Sommer stand hier die Hitze, und im Winter wurde es hier nie richtig weiß. Grau. Ich hatte noch nie darüber nachgedacht. Wenn ich zu Axel ging, dann dachte ich an alles mögliche, nur nicht an Häuser und Straßen. Es war eine billige Gegend und eine billige Wohnung. Ich glaube, sie war wirklich billig, eine Sozialwohnung, in die sie eingezogen waren, als Axels Vater noch wenig verdiente. Sie waren nie ausgezogen, auch als sie einen Haufen Geld hatten, mehr als meine Eltern. Sie steckten das Geld in Reisen und in die Einrichtung. Und in Geschenke für Axel. Seine Mutter hatte keinen Beruf. Ich überlegte, wovon sie in Zukunft leben würde. Vielleicht von so einem Onkel Rüdiger oder Karsten. Die hatte ich nie gesehen, nur den Herrn Niebur. Er war Steuerberater und hatte sein Büro im selben Haus. Er sah langweilig aus, aber er war bestimmt zehn Jahre jünger als Axels Mutter. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Mit keinem Mann. Ich mochte Axels Mutter, so ist das nicht. Sie war eine große, schwerfällige Frau mit einer Stimme wie ein Kanarienvogel. Pieps-pieps. Aber sie konnte super kochen, und ihre Schokoladentorte war absolut konkurrenzlos. Und sie kümmerte sich nie um unseren Kram. Ich versuchte, sie mir nackt vorzustellen. Vor Jahren mal hatte sie uns mit ins Olympiabad genommen, da hatte ich sie im Badeanzug gesehen. Ich konnte mich nicht erinnern. Meine Güte, Axels Mutter, das war doch keine Frau. Das war Axels Mutter. Ich kapierte das nicht. Aber es stimmte ja wohl. Sie hatte einen Liebhaber, oder auch mehrere. Und Axels Vater ließ sich scheiden. Und Axel hockte in seiner halb ausgeräumten Dreizimmerwohnung und heulte sich blind.
Ich sah vor mir das blaue U-Bahnschild und rannte erleichtert die Treppen hinunter. Der Bahnhof war leer und zugig, ich kickte eine leere Zigarettenschachtel auf die Gleise. Es war die Kälte, ich trat gegen eine Bank und gegen den Papierkorb. Er bekam eine Delle, und ich trat noch mal zu. Die erste Schraube löste sich, grüner Lack platzte ab. Schon allein dieses widerliche Kotzgrün, ich trat noch mal rein. Diesmal mit der Ferse. Es war ein gutes Gefühl. Die Bahn kam, und ich stieg gleich vorne ein.
Ein kurzer Blick ins Abteil, aber es gab nichts, was ich nicht schon von draußen gesehen hatte. Ein alter Penner und ein versorgter Twen. Ich blieb gleich bei der Tür stehen. Sobald wir im Tunnel waren, stand ich da allein mit meinem Spiegelbild. Ich fand das gut. Silberne Moonboots, schwarze Thermojeans, silbergraues Sweatshirt mit der dicken silber-weißen Super-Bowl drauf und ein weißer langer Lesezeichenschal. Kurzhaarangora; fühlte sich fast an wie Kaschmir. Nur der Anorak war blöd. Feuerwehrrot mit blauen Steppnähten. Das sah echt bescheuert aus. Zu klein war er auch. Ich war gewachsen. Allein im letzten Halbjahr drei Zentimeter. Aber das reichte noch nicht. Jetzt war ich immer noch keine einssechzig. Ein Meter und siebenundfünfzig. Und erst bei einsfünfundsechzig gabs die Lederjacke. Die absolute Rockerjacke. Nappa schwarz mit wattierten Schultern und gesteppten Seitennähten. Jede Menge Taschen, Bund auf der Hüfte, Metallknöpfe. Ich wußte genau, wie sie aussah, wie ich in der Jacke aussah. Erwachsen, cool, männlich. Beim Scheidplatz stieg der Twen aus und zwei alte Weiber ein. Sonntag abend, tote Hose. Am Bonner Platz war schon mehr los. Eine Gruppe besoffener Soldaten mit Tröten und Fußballfähnchen. Hatten sich wohl verfahren. Einer rempelte mich an und schaute mir ins Gesicht. Ich zeigte ihm meine Vampirzähne, und er wandte sich ab, ging zu den anderen, sie machten den Penner an.
Ich schaute nicht hin. Ich sah weiter auf die dunkle Scheibe, aber ich konnte sie beobachten. Wie sie den alten Mann rumschubsten und über ihn lachten. Der, der mich angerempelt hatte, schien älter als die anderen. Vielleicht auch nur, weil er zu fett war. Groß, breit und fett. Ich hatte mir die Haare extra kurz schneiden lassen, aber wegen diesem Scheißanorak hielten sie mich manchmal für ein Mädchen. Der Kerl war widerlich. Die Haare kringelten sich in verschwitzten Löckchen über seiner Stirnglatze. Ich stellte mir vor, wie ich rüberging, ihn an der Schulter packte und quer durch den ganzen Waggon schleuderte. Laß den alten Mann in Ruhe, sagte ich dabei. Einer der anderen Soldaten wollte seinem Freund helfen, ich schlug ihn nieder. Der Penner lächelte mich dankbar an und fingerte einen alten Goldtaler aus seiner zerschlissenen Jacke. Seine Hände steckten in kuppenlosen Wollhandschuhen, und die Nägel waren braun und gewölbt wie Horn. Ich drehte mich weg.
Am Feilitzschplatz ging immer der Punk ab. Da standen sie rum, stiegen in Pulks ein und aus, einer spielte Trompete, zwei küßten sich. Vier schwarze Sheriffs schlichen paarweise herum und verbreiteten Terror. Einer von ihnen war eine Frau. Hager und lang wie ein Mann mit flachem Arsch und blondem Pony unter der Mütze. Die Soldaten rempelten sich gegenseitig auf ein Sheriffspärchen hin, aber die lachten nur. Ich war sicher, das andere Paar, das mit der Frau, hätte anders reagiert. Sie hatten Pistolen und Schlagstöcke. Alles in Schwarz. Ich wäre gern ausgestiegen, ein bißchen durch die Straßen gestreift; ein Cola am Stand, eine Pizza aus der Hand. Ich hatte es nicht weit heim, die paar Ecken hätte ich zu Fuß gehen können.
Die Bahn fuhr wieder an. Ich stand jetzt zwischen einer Gruppe Studenten eingekeilt. Es gab genug Platz, aber sie mußten direkt bei der Tür stehen bleiben. Keilten mich ein mit ihren Ärschen und ihrem öligen Kneipengeruch. Ich wollte groß sein. Ober ihnen allen. Ich blieb stehen, obwohl ich mich sonst immer durchboxe, damit ich wenigstens am Fenster stehe. Bei der Giselastraße stieg ich aus.
Im MacDonalds war es rappelvoll. Ich sah kurz durch die beschlagenen Scheiben hinein. Ein paar Mädchen aus der achten, keiner, den ich kannte. Ich ging ein Stück die Straße hinauf, an den Schaufenstern vorbei, an Büchern, Platten, Jeans und Hemden, an glitzernden Lampen und bunten Reklamen. Die Tür zu der Disco, die sie letzte Woche wegen Rauschgift geschlossen hatten, trug noch das amtliche gelbe Siegel. Ich war wieder in Schwabing.
Ich überquerte die Leopoldstraße genau al punto. Wo sie von beiden Seiten angerast kommen wie die Irren. Wo sie an die grüne Welle glauben. Wo sie denken, daß sie die Straße für sich allein haben. Das erfordert höchste Konzentration. Nicht einfach losrennen. Dann ist uranschneller hin als man denken kann. Stehenbleiben, genau beobachten, die richtigen Wagen mit den richtigen Fahrern genau einschätzen. Ich nahm mir einen Porsche mit Altplayboy als Einstieg. Vor ihm war ein Audi, direkt dahinter fetzte ich raus auf die Straße. Der Porsche reagierte prompt, auf der zweiten Spur war ein Taxi, der Fahrer fand noch Zeit zum Hupen, die zweite Spur war dann einfach. Nur leicht diagonal mit der Fahrtrichtung. In der letzten Sekunde erwischte mich fast noch so ein Honda mit der Stoßstange. Knallrot metallic, und die Mutter da drin schien vergessen zu haben, wo die Bremse sitzt. Die sind gefährlich. Die und die ganz alten. Aber in der zweiten Reihe kann man sich keinen mehr aussuchen, da ist es halt Risiko.
Ich ging in die Ohmstraße hinein, und es war, als hätte ich eine andere Welt betreten. Es war ruhig, auf den Hecken der Vorgärten lag noch weißer Schnee und hinter den Fenstern leuchtete die Wärme goldgelb und nicht flimmernd blau. Ich blieb vor unserem Haus stehen und atmete ein. Das war meine Straße, mein Haus.
Ich war hier geboren, in den Kindergarten gegangen und mit Blaulicht und offenem Blinddarm ins Schwabinger Krankenhaus gefahren worden. Hier hatte ich meinen ersten Zahn verloren und nie wiedergefunden. Hier kannte ich alle Geräusche und Gerüche. Das schmiedeeiserne Tor war geölt worden, es schrie nicht mehr, wenn man es aufzog. Ich war jetzt groß genug, um den Arm durch das Gitter zu stecken und den Knauf zu drehen. Mit fünf hatte ich geglaubt, daß ich alles auf der Welt erreicht haben würde, wenn ich nur erst den Knauf drehen konnte.
Ich ging über den breiten Kiesweg nach hinten zum Seiteneingang. Es war ein ockergelbes Jugendstilhaus mit weißen Rankenornamenten an den Fenstern. Reiche Kaufleute hatten es früher mal bewohnt, damals waren die Gärten noch größer gewesen. Aber es gab auch jetzt noch einen Haufen Bäume und Büsche. In den unteren drei Stockwerken hatte eine Filmproduktion ihre Büros und Schneideräume, das oberste Stockwerk gehörte uns.
Hinter dem Haus war es wunderschön. Die kahlen Bäume hatten Schneehäubchen, dahinter sah man die im Sommer verborgenen Nachbarhäuser mit ihren erleuchteten Fenstern, die Geräusche der Straße waren fern und gedämpft. Ich pfiff leise und wartete.
Nichts.
Ich sah zu unseren Fenstern hoch. Sie waren dunkel, zumindest in der Küche brannte kein Licht. Ungewöhnlich. Ich pfiff noch einmal, rief leise. »Toffee, komm!« Hinter mir raschelte etwas und ich fuhr herum. Die fette schwarzweiße Katze von nebenan. Glotzte dümmlich und zeigte ihre rosa Zunge vor. Es sah aus als würde sie hämisch grinsen.
Erst da hatte ich Angst.
Oder ich merkte erst da, daß ich Angst hatte. Nicht diese ganz normale Angst vor irgend etwas, sondern eine Angst, die man nicht erklären kann. Wenn man nachts schweißgebadet aufwacht und genau weiß, daß es nur ein Traum war. Weil man schon beinah dreizehn ist und nicht mehr an Gespenster glaubt.
Ich fand den Schlüssel nicht gleich. Läutete Sturm. Nichts. Ich hatte den Schlüssel in der Hand, er fiel mir aus den kalten Fingern in den Matsch, und ich mußte ihn aus dem Kies rausfischen. Endlich. Ich schloß auf und rannte die Treppen hinauf. Breite, in der Mitte durchgetretene Eichenbohlen. Dunkelgewachst und höllisch glatt. Das Holzgeländer lag rund und warm in der Hand. Wenn keiner zuschaute, rutschte ich drauf runter. Ich versuchte zu pfeifen, aber ich hatte keine Luft mehr. Noch ein Stockwerk. Bei den Filmfritzen wurde manchmal noch bis spät in die Nacht gearbeitet, aber meistens gehörte uns das Haus am Abend und am Wochenende ganz allein. Das Licht ging aus.
Ich blieb stehen und wartete. Atmete ruhig, um die Panik zu bekämpfen. Meine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit und ich sah den grünlich leuchtenden Lichtschalter neben einer der Türen. Ich war allein in dem Haus. Ich ganz allein in einem riesigen, dunklen Haus. Es war sinnlos, das Licht wieder anzuknipsen. Besser war es schon, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann hatte man bessere Chancen. Wenn sie kamen. Und sie kamen bestimmt. Ich konnte sie schon riechen. Von unten, wo sie die Tür verriegelt hatten. Tabak, Staub und Bohnerwachs. Auch ein Hauch von Putzmittel. Ich schaltete das Licht wieder ein, um nicht geblendet zu werden, wenn sie dieselbe Idee hatten. Mein Vater war fast einsneunzig. Der hätte die Lampe abdrehen und die Glühbirne lockerschrauben können. Ohne Leiter. Aber der war nicht da.
»Brummer!« Ich hatte geschrien ohne es zu wollen. Als das laute, fast hysterische Bellen mir antwortete, hätte ich mir vor Erleichterung fast in die Hose gemacht. Ehrlich, ich glaube, ein paar Tropfen gingen da voll ab in die karierte Juniorjockey. Ich heulte, suchte mit dem Schlüssel nach dem Schlüsselloch, während Brummer von innen fast die Tür durchkratzte. Dann war ich endlich drin und fiel Brummer um den Hals wie der Junge im Fernsehen seinem Lassie.
Dann merkte ich, daß es dunkel war.
Unsere Wohnung war riesig. Sechs Zimmer und eine große Wohnküche. Eine Speisekammer und ein richtiges Schrankzimmer, eine große Dachterrasse und ein Küchenbalkon. Vom Treppenhaus kam man direkt in die quadratische Diele, über der sich der Himmel wölbte, wie meine Mutter das ausdrückte. Im Dach war ein halbrundes Oberlicht. Im Sommer konnte man nachts die Sterne und den Mond sehen, jetzt lag Schnee drauf, dunkel glitzernd. Das einzige, was ich sah, war mein eigenes fahles Spiegelbild. Neben dem Bad brannte die kleine Nachtlampe.
Ich hätte aufstehen müssen, um das Flurlicht anzuknipsen. Ich blieb hocken, einen Arm um Brummer geschlungen, das Gesicht in seinem kurzen Fell. Es roch ein bißchen muffig, offensichtlich hatte ihn heute noch niemand mit runtergenommen. Brummer war eine Mischung aus Dogge und Schäferhund. Er sah aus wie eine Hyäne, groß, schlank und golden gefleckt. Mit gerunzelter Stirn und schmelzenden Bernsteinaugen. Verschmust und liebebedürftig und fähig, vierzehn Stunden am Tag durchzupennen. Das war die Dogge. Der Schäferhund in ihm war unberechenbar und hatte die Haftpflichtversicherung schon einen Haufen Geld gekostet. Brummer kam aus dem Tierheim und hatte eine böse Kindheit hinter sich. Bei uns wurde er geliebt, aber nie richtig erzogen oder gar dressiert. Wir waren seine Herde, ich war der Boß. Für mich hätte er sein Leben gegeben.
Die Angst verging nicht. Im Gegenteil, sie wuchs. Fraß mich, machte mich hilflos und unfähig zu jeder Entscheidung.
Es war blöd, sich in einer dunklen Wohnung zu fürchten. Meine Eltern waren oft unterwegs, und ich war es von klein auf gewöhnt, allein zu sein. Eine kleine Pelzschnauze stubste gegen meine freie Hand, und ein runder Katzenkopf schob sich unter die Finger. Toffee, der größte Kater aller Zeiten, noch vor Garfield. Ich kraulte ihn, bis er vor Wonne schnurrte. Brummer leckte mir über das Gesicht. Sie wollten mich trösten. Sie waren meine Freunde. Ich stand auf. Gegen meine Angst waren sie machtlos.
Ich ging langsam den Gang entlang, machte überall Licht. In der Küche, im Bad, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, in meinem Zimmer. Ich zögerte. Ich fand, es war das schönste Zimmer. Mit einem Erker zur Straße runter, einem begehbaren Extraabteil unter der Dachschräge und einem Kajütbett wie in einem echten Schiff. An einer Wand waren bis oben hin Regale mit Büchern, auf der anderen Seite stand meine Werkbank und das Gestell mit den Puppen. Sie waren überall, hingen von der Decke und an den Wänden, einige von ihnen schliefen, einige waren nur träge, das waren sie von Anfang an. Wenn man Puppen macht, merkt man ziemlich früh, ob sie lebendig werden oder träge. Sie beginnen schon bei der Arbeit, ihren Charakter zu entwickeln und zu zeigen. Eine meiner allerersten Puppen zum Beispiel, ein Kasperl mit krummer Nase, der hatte magische Kräfte. Ich hatte ihn mit sieben oder acht gemacht, den Kopf noch aus Fimo und das Kleid wie einen Handschuh, ich kam heute kaum noch mit den Fingern rein. Aber seine tief liegenden Augen unter buschigen Brauen leuchteten im Dunkeln und sein spöttisch verzogener Mund zeigte, daß er mehr wußte als er sagte. Er hatte mir schon oft geholfen. In der Schule oder beim Volleyball. Später dann hatte ich Marionetten gemacht, da hatte ich mich zu sehr auf die Mechanik konzentriert, da waren ein paar langweilige dabei. Oder einfach nur schöne. Im Moment arbeitete ich gerade an Monty, dem Monster. Manche Puppen, vor allem die trägen, sagen erst ganz spät, wie sie heißen, andere wieder unheimlich früh. Fast noch bevor sie als Puppen zu erkennen sind. So war es bei Monty. Inzwischen hatte er schon einen runzligen Schädel und bewegliche Lider über grün irisierenden Augen. Aber ich kam mit der Elektronik nicht zurecht. Irgendwo hatte ich da in seinem Inneren einen Fehler gemacht, irgendein Kontakt war falsch. Monty lebte, aber er konnte sich noch nicht richtig bewegen. Das nahm er mir übel. Ich vermied es, zu ihm hinzusehen.
Dann hörte ich das Geräusch.
Eine Art Husten, dann ein leichtes Knarzen, dann war es wieder still. Es kam aus seinem Zimmer. Ich rannte hinüber und riß die Tür auf.
Sie lagen nebeneinander auf dem Fußboden. Mein Vater und meine Mutter. Sie hatten vor sich so eine Art Kasten mit Kurbel, der von innen durch eine Kerze erleuchtet wurde. Bilder huschten vorbei, bewegten sich hölzern, ein Mann, eine Frau in langen Röcken. Sie drehten sich zu mir herum und lachten. Ich machte schnell die Flurtür zu, damit es wieder dunkel wurde und hielt Brummer und Toffee fest, die sich beide auf die Laterna Magica stürzen wollten.
»Wir haben sie auf dem Flohmarkt gefunden«, sagte mein Vater, es klang fast verlegen. Meine Mutter rutschte auf die Seite und machte Platz für mich, Brummer und Toffee.
»Es war als Geschenk für dich gedacht«, sagte sie, »aber dann haben wir angefangen, selber damit zu spielen. Wie spät ist es?«
Ich antwortete nicht. Es war nicht mehr nötig. Alles war wieder gut. Ich lag da in der Wärme, und die Wohnung war nur deshalb dunkel, weil meine Eltern zusammen mit dem Urvater des Films spielten. Der Mann in Frack und Zylinder verbeugte sich vor der Dame im langen Rock. Sie liebten sich. Sie gehörten zusammen. Sie lagen hier auf dem Teppich nebeneinander und ich war zwischen ihnen. Ich war dabei. Die Dunkelheit war nicht mehr gefährlich, sie war warm und sicher wie das innere einer Höhle. Ich weinte vor Erleichterung.
2 SUSA
Es war dieser herrliche Zustand zwischen Schlaf und Wachsein. Ich schlief noch, war aber wach genug, um es schon zu genießen. Der Wecker hatte noch nicht geläutet, ich hatte noch Zeit. Ich rutschte in die Bettmitte hinüber und schob meinen Hintern in die schlafwarme Kuhle von Gunthers Körper. Er grunzte im Traum und legte mir seinen haarigen Arm um den Bauch.
Ich spürte ein vages Gefühl der Vorfreude. Der Tag war positiv belegt. Etwas Kaltes berührte meine Hand. Brummer saß auf meiner Bettseite und wartete. Er hatte die Bewegung beobachtet und wollte verhindern, daß ich wieder einschlief. Ich machte vorsichtig ein Auge auf und sah ihn an. Er legte den Kopf schief und erwiderte meinen Blick voll herzinniger Liebe. Ein Mann oder ein Kind ist eine Sache, aber die Liebe deines Hundes ist nun mal was ganz anderes. Für Brummer war ich der Mittelpunkt der Welt. Ich gab ihm sein Futter. Natürlich versuchten Gunther und Tom dauernd, ihn zu bestechen, steckten ihm Würstchen oder Kuchenstücke zu, wenn ich nicht aufpaßte. Aber das tägliche und regelmäßige Essen, das kam von mir, ich war sein Leithund. Ich legte ihm die Hand um die Schnauze und beutelte ihn ein bißchen. Er schob den Kopf unter die Bettdecke und stubste mich am Knie. Ich kicherte, Gunther fühlte sich angesprochen und zog mich näher zu sich ran.
Mir fiel wieder ein, was heute alles los war. Meine Übersetzung war endlich fertig. Es war eine reichlich mühsame Angelegenheit gewesen. Ein unbekannter Autor aus Chile, der jetzt im Zuge eines neuen Interesses an Südamerika verlegt und übersetzt wurde. Er schilderte die Verhältnisse seiner Heimat sehr subjektiv und eindringlich, aber er konnte nicht schreiben. Ich war ständig in Versuchung, ihn zu verbessern, eine Todsünde für jeden Obersetzer. Ich mußte versuchen, die naive und unreflektierte Direktheit seiner Sprache ins Deutsche mit hinüberzubringen, nur so konnte ich seine absolute Ehrlichkeit glaubhaft machen. Ich hatte das Gefühl, daß mir das gelungen war. Zweihundertachtzig Seiten, heute mußte ich sie noch einmal durchlesen, korrigieren und fotokopieren. An den Verlag schicken und auf die zweite Hälfte meines Honorars warten. Zweieinhalbtausend Mark, äußerst erfreulich. Ich reckte mich, Brummer knabberte an meinem Finger. Und außerdem war Freitag, keine Schule. Ich gab Kurse an der Volkshochschule, Spanisch und Englisch. Ein angenehmer Job, weil die Leute, die hinkamen, wirklich lernen wollten. Auch, wenn sie oft von ihrer Tagesarbeit zu erschöpft waren, oder auch vollkommen unbegabt für Sprachen. Brummer zog seinen Kopf unter der Decke hervor und knurrte unwillig. Genug geschmust, hieß das, los Weib, an deine Pflicht. Er legte den Kopf zurück, Nummer Sterbendes Reh. Ich legte Gunthers Arm zur Seite.
In der Küche stand noch das Geschirr von gestern abend. Es roch nach Knoblauch und gebackenem Käse. Ich gab Brummer sein Hundefutter und füllte frisches Wasser in seine Schüssel. Räumte den Tisch ab, deckte ihn für das Frühstück und stellte die Kaffeemaschine an. Der frühe Morgen war nicht gerade meine beste Zeit, und wenn Thomas nicht in die Schule müßte, könnte ich eine Stunde länger schlafen. Gunther mußte erst um neun in seinem Verlag sein, und wenn er später kam, sagte auch keiner was. Ich gähnte und sah Brummer beim Hinunterschlingen seiner PALstückchen zu. Die Faschingsparty. Jetzt fiels mir wieder ein. Heute abend wollten wir aufs Weiße Fest. Zusammen mit Hilde, Robert, Margot und Ernst. Vermutlich kam auch noch Helmut, lustig wurde es bestimmt. Ich begann, True Love vor mich hinzusummen und ging hinüber in das Zimmer von Thomas.
Er lag auf dem Bauch, Toffee wie einen Hermelinschal um den Hals geschlungen. Ich blieb stehen. Ich blieb vor seinem Bett stehen. Wie immer, wenn ich ihn so schlafen sah, hatte ich einen Knödel im Hals. Mein Sohn. Er hatte ein schmales, feines Gesicht, volle Lippen und große tiefblaue Augen mit den längsten Wimpern der Welt. Sein Haar war dunkelblond, dicht und unvorstellbar weich. Ich mochte diese Kurzhaarmode nicht, ich hätte es lieber gehabt, wenn er die Haare länger getragen hätte, aber ich verstand auch, daß er nicht wie ein Mädchen aussehen wollten. Ich hatte als Kind nie kurze Haare haben dürfen und sehr darunter gelitten. Ich berührte leicht seine Wange, streichelte sein Gesicht, fuhr ihm über das Ohr und durch das Haar.
»Aufstehen, Tom-Tom«, sagte ich leise, »das Abenteuer lockt.« Er bewegte sich, drehte sich langsam auf den Rücken, überrollte Toffee dabei, was den aber nicht zu stören schien. »Es ist zehn nach halb«, sagte ich noch. Er schlug die Augen auf. Lächelte.
»Die Schule ein Abenteuer zu nennen, ist der reine Sadismus.«
»Hast du heute irgend etwas Unangenehmes?«
»Die Schule an sich und als Institution ist unangenehm. Um's mal ganz zurückhaltend auszudrücken.« Er machte noch immer keine Anstalten, aufzustehen. Ich zerrte Toffee unter ihm hervor und setzte ihn auf den Boden. Sofort sprang er wieder zu Tom ins Bett. Tom packte ihn und zog ihn mit unter die Decke. Irgendwann einmal hatte ich versucht, das zu verhindern. Katzen gehören nicht ins Bett. Ich hatte die Tür zugeschlossen und Toffee sogar einmal mit Wasser bespritzt. Thomas hatte ihn heimlich wieder reingelassen, und beide hatten drei 'rage nicht mehr mit mir gesprochen. Ich ging in die Küche.
Das morgendliche Wecken war eigentlich nicht notwendig. Thomas wachte immer rechtzeitig auf und kümmerte sich um seine Sachen. Im Gegensatz zu anderen Müttern mußte ich ihm auch nie bei Schularbeiten helfen, er machte alles allein, er war intelligent und kam problemlos mit. Kein Einserschüler, aber sicher und ohne jede Anstrengung zwischen zwei und drei. Hilde und Margot beneideten mich darum, und ich wiederum stand ihrem ständigen Schuljammer etwas hilflos gegenüber.
Thomas war immer schon anders als andere Kinder gewesen. Reifer, selbständiger. Als er mit drei in den Kindergarten kam, konnte er sich als einziger schon allein anziehen. Selbst Latzhosen und Schnürschuhe. Mit vier fuhr er zum erstenmal allein Straßenbahn. Er mußte zwanzig Minuten laufen, um zur Haltestelle zu kommen. Gunther hatte ihn einmal mitgenommen in sein Büro nach Nymphenburg. Thomas fuhr die ganze Strecke dreimal, immer bis zur Endhaltestelle und zurück. Als die Polizei ihn schließlich mit Blaulicht bei uns ablieferte, waren Gunther und ich einem Herzinfarkt nah, Thomas strahlte vor Glück und verstand nicht, wieso wir uns so aufgeregt hatten. Er kannte sich doch aus. Schließlich und endlich.
Er hatte auch nie eine alberne Kindersprache. Er sprach spät. Wir begannen schon, uns Sorgen zu machen, und Hilde wollte uns unbedingt zu einem Therapeuten schicken. Und dann redete er plötzlich, von einem Tag auf den anderen. In ganzen Sätzen, mit Imperfekt und Konjunktiv. Er kam in die Küche. Schwarz und silbern. Er liebte schwarz, und es stand ihm gut. Sein Körper war noch schmal und knabenhaft, aber die Schultern begannen, breiter zu werden, und seine Füße und Hände hatten die kindlichen Proportionen schon überschritten.