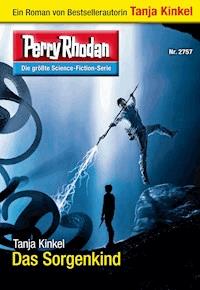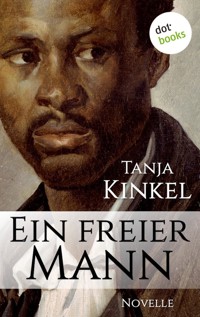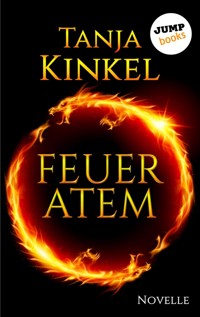9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die junge Amy Robsart am 8. September 1560 tot aufgefunden wird, ist ganz England überzeugt, den Mörder zu kennen – -ihren Ehemann Robert Dudley, Günstling von Elizabeth I., der sich Hoffnungen auf die Hand der Königin macht und seine Gattin loswerden musste. Dieser Verdacht bringt nun jedoch nicht nur Robert, sondern auch Elizabeth, die ihn aufrichtig liebt, in Gefahr, da ihr Machtanspruch noch längst nicht gefestigt ist. Was aber geschah wirklich in jenem Haus in Oxfordshire – und welche Geheimnisse hat die Frau, die wie keine andere im Schatten der Königin stand, mit ins Grab genommen? Thomas Blount, Dudleys engster Vertrauter, und Kat Ashley, die Gouver-nante der Königin, müssen alles daransetzen, so schnell wie möglich die Wahrheit zu finden. Doch sie haben beide Schuld auf sich geladen, von der niemand etwas ahnt … Im Schatten der Königin von Tanja Kinkel: als eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Tanja Kinkel
Im Schatten der Königin
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als am 8. September 1560 eine junge Frau tot am Fuße einer Treppe aufgefunden wird, ist ganz Europa überzeugt, den Mörder zu kennen: ihren Ehemann Robert Dudley, Favorit von Elizabeth I., der sich berechtigt Hoffnungen auf die Hand der Königin macht. Musste er deswegen seine Frau loswerden? Dieser Verdacht bringt auch Elizabeth in Gefahr, denn noch ist ihr Thronanspruch nicht gefestigt. Was aber geschah wirklich in jenem Haus in Oxforfshire – und welche Geheimnisse hat die Frau, die wie keine andere im Schatten der Königin stand, mit ins Grab genommen?
Die Zeit, in der das britische Empire entstand.
Eine Welt voller Machthunger und Geheimnisse.
Zwei Frauen, die um ihr Glück kämpfen.
Inhaltsübersicht
Anmerkung der Autorin:
Zeittafel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
ERSTES ZWISCHENSPIEL
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
ZWEITES ZWISCHENSPIEL
Kapitel 7
Kapitel 8
DRITTES ZWISCHENSPIEL
Kapitel 9
Kapitel 10
VIERTES ZWISCHENSPIEL
Kapitel 11
Kapitel 12
FÜNFTES ZWISCHENSPIEL
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
SECHSTES ZWISCHENSPIEL
Kapitel 17
SIEBTES ZWISCHENSPIEL
Epilog
Nachwort der Autorin
Bibliographie
Stammbäume der Familien Tudor, Dudley und Blount
Anmerkung der Autorin:
Bitte wundern Sie sich nicht, dass ich in diesem Buch durchgehend auf die in Deutschland üblichen Schreibweisen »Mylady« und »Mylord« verzichte und stattdessen »my lady« und »my lord« verwende. Ich möchte mich bewusst an der englischen Schreibweise orientieren. Auch bei den Namen habe ich die englische Form vorgezogen: »Elizabeth« statt »Elisabeth«, »Henry« statt »Heinrich«, »Mary« statt »Maria«.
Tanja Kinkel
Zeittafel
1509 Henry VIII. heiratet seine erste Ehefrau, Katharina von Aragon.
1516 Geburt von Katharinas Tochter Mary.
1533 Henry VIII. lässt sich von Katharina von Aragon scheiden, um Anne Boleyn zu heiraten; dies führt zum Bruch mit der römisch-katholischen Kirche. Im selben Jahr wird Anne Boleyns Tochter Elizabeth geboren.
1536 Hinrichtung von Anne Boleyn. Elizabeth wird für illegitim erklärt.
1537 Geburt von Edward, dem Sohn Henrys VIII. mit seiner dritten Ehefrau, Jane Seymour.
1542 Hinrichtung von Henrys VIII. fünfter Ehefrau, Catherine Howard.
1544 Auf das Bestreben seiner sechsten und letzten Ehefrau, Catherine Parr, setzt Henry VIII. Elizabeth wieder in die Thronfolge ein.
1547 Henry VIII. stirbt; Thronfolger wird sein noch minderjähriger Sohn Edward, dem ein zehnköpfiger Thronrat zur Seite steht, der vorerst die Regierungsgeschäfte wahrnehmen soll. Zu den wichtigsten Mitgliedern des Rates gehört John Dudley.
1553 Edward stirbt. John Dudley bringt Jane Grey, Großcousine der Prinzessinnen Mary und Elizabeth und Ehefrau seines Sohns Guildford, auf den Thron. Viele Mitglieder des Hofstaates, Teile des Heeres und vor allen Dingen das englische Volk sind nicht bereit, dies zu akzeptieren.
Nach nur neun Tagen wird Jane gestürzt; sie wird, so wie John und Guildford, hingerichtet. Mary wird zur Königin gekrönt. Sie will das Land mit aller Gewalt in den Schoß der römisch-katholischen Kirche zurückführen, was ihr die Beinamen »die Katholische« und »die Blutige« einbringt.
1558 Mary I. stirbt kinderlos. Elizabeth wird zur Königin gekrönt.
Kapitel 1
Montag, 9. September 1560
Gott vergebe mir, aber das Erste, was ich dachte, als Robin Dudley mir sagte, seine Gemahlin sei tot, war: Warum jetzt?
Für mich und die Meinen war es eine gute Zeit, und eine, auf die wir lange hatten warten müssen. Seit meine Base Jane vor vierzig Jahren John Dudley geheiratet hatte, waren wir miteinander im Rad der Fortuna gefangen gewesen und hatten uns nicht mehr lösen können, ganz gleich, ob es uns hoch oder abwärts trug.
Ich wurde an Janes Hochzeitstag geboren, und sie hat das immer als Grund gesehen, sich wie eine Patin um mich zu kümmern. Da meine eigene Mutter von Fehlgeburt zu Fehlgeburt immer schwächer wurde und starb, noch ehe ich acht Jahre alt war, gab es lange Zeit niemanden, der für mich so wichtig war wie Jane.
Es gab einen Lehrer, John Ferlingham, der mich bis aufs Blut quälte. Es bereitete ihm offensichtlich Spaß, bei jedem noch so kleinen Fehler, den ich im Unterricht machte, seinen Rohrstock auf meinem nackten Hintern tanzen zu lassen. Doch schlimmer als der Stock war es, seine Hände auch dort zu spüren. Ich wusste damals noch nichts davon, dass manche Männer es auch mit Jungen treiben wollten, aber mir war klar, dass irgendetwas nicht stimmte. Sosehr ich es auch versuchte, ich fand keine Ausrede, die mich davor schützte, nach der Schule zu ihm zu gehen, um meine Gebete mit ihm zu sprechen, wie er das wünschte. Mein Vater bemerkte nichts; eine Tracht Prügel zur rechten Zeit habe noch niemandem geschadet, so lautete seine Überzeugung, die er noch von seinem Urgroßvater hatte, der über Jahrzehnte Sheriff von Shropshire gewesen war. Ich wäre damals lieber gestorben, als ihm einzugestehen, dass ich nicht Angst vor den Schlägen hatte, sondern vor den Händen des Lehrers an meinem Arsch. Jane dagegen gab sich nicht damit zufrieden, meine wirkungslosen Ausreden als kindliche Bockigkeit abzutun. Es gelang ihr, die Wahrheit aus mir herauszulocken.
»Das, was er tut, ist Unrecht«, sagte sie mit ernster Stimme.
Ich spürte, dass ich den Tränen nahe war. »Ich … ich kann nichts dagegen tun.«
»Nun, Tom, nicht jedes Unrecht kann aus der Welt geschafft werden – aber das heißt nicht, dass man es nicht versuchen muss.«
Mein Vater konnte sich keinen persönlichen Lehrer leisten, das wusste Jane, und ihr war auch klar, dass er ein Angebot ihrerseits, für einen Lehrer zu zahlen, nicht angenommen hätte; mein Vater war ein stolzer Mann. Ihr war auch bewusst, dass er mir nie verziehen hätte, wenn sie mit mir zu einer Amtsperson gegangen wäre; er hätte es als den Versuch seines Sohnes gesehen, sich mit einer besonders abenteuerlichen Lüge vor dem Unterricht zu drücken und Schande über seinen Namen zu bringen. Also brachte Jane einen gelehrten Schützling ihres Gemahls dazu, sich in meinem Heimatort Kidderminster niederzulassen und der Gemeinde seine Dienste als zweiter Lehrer anzubieten. Dann gab sie mir einen Rat bezüglich Master Ferlinghams.
Nachdem ich sein Haus über viele Abende beobachtet und durch das Fenster gesehen hatte, was er dort mit anderen Jungen tat, lief ich zum nächsten erreichbaren Mitglied des Stadtrats und bat ihn, meine Base Jane bei Mr.Ferlingham zu treffen, just zu dem Zeitpunkt, als der sich am kleinen Nick zu schaffen machte. Mr.Ferlingham hat das nicht lange überlebt.
Das Gefühl, sich durch eigenes Handeln gegen ein Unrecht wehren zu können, war weit befriedigender als die Aussicht, nicht länger von Ferlingham verprügelt zu werden. Damals schwor ich mir, meiner Base Jane immer zu helfen, sollte sie jemals in Not geraten, koste es, was es wolle.
Nicht, dass es in meiner Jugend danach aussah, als ob Jane meine Hilfe je brauchen würde. Ihr Gemahl war zwar der Sohn eines hingerichteten Verräters, aber er arbeitete sich Schritt für Schritt an die Spitze des Königreichs hoch: John Dudley zeichnete sich auf dem Feld und zur See aus, fand mit viel Geschick die richtigen Förderer zur richtigen Zeit – von Kardinal Wolsey über Thomas Cromwell bis zum König selbst – und wurde schließlich zum Herzog von Northumberland und mächtigsten Mann im Königreich.
Der einzige Kummer, den Jane in dieser Zeit hatte, war, dass nicht alle ihrer dreizehn Kinder überlebten. Anders als meine eigene Mutter erholte sie sich jedoch sehr schnell von jeder Geburt. Trotz der sieben Kinder, denen es gelang, heranzuwachsen, fand sie auch immer noch Zeit für mich. »Du bist eigentlich mein Ältester, Tom«, pflegte sie zu sagen. Als ich erwachsen war, sorgte sie dafür, dass ihr Gemahl mir eine Stelle in seinem Haushalt gab. Zu diesem Zeitpunkt wusste jeder in ganz England, wer John Dudley war, und mein eigener Vater in Kidderminster sonnte sich im Glanz der Verwandtschaft. Ich nahm ihm das damals fast ein wenig übel, hatte er doch nichts getan, um seinerseits zum Aufstieg unserer Familie beizutragen. Für mich, das nahm ich mir fest vor, sollte das anders sein. Ich würde mir meinen Platz an der Sonne verdienen. Wenn John mich förderte, dann sollte es nicht nur geschehen, um seiner Gemahlin einen Gefallen zu tun, sondern weil ich ihm durch harte Arbeit unentbehrlich geworden war.
Das ging so lange gut, bis John vor sechs Jahren versuchte, die Thronfolge zu bestimmen. Er verlor seinen Kopf, und seine Familie stürzte mit ihm.
Es war das Jahr 1554. Johns Söhne warteten im Tower darauf, das gleiche Schicksal zu erleiden wie ihr Vater. Ich hatte Glück, selbst nicht als Verräter im Kerker zu sitzen, aber meinen Besitz war ich dennoch los, und meiner Base Jane erging es noch übler: Sie verlor mit dem Tod ihres Gemahls sämtliche Güter und verbrachte ihre Zeit damit, mittellos nach Fürsprechern bei Hofe zu suchen, um wenigstens das Leben ihrer Söhne zu retten.
Ich hätte damals nach Worcestershire zurückkehren können, zu meiner Gemahlin Margery und dem Kind, das sie erwartete, denn Margerys Mitgift hatte die Krone nicht eingezogen. Aber Jane brauchte mich. Wann, wenn nicht in dieser dunklen Stunde, war die Zeit gekommen, um ihr dafür zu danken, dass sie mir geholfen hatte, ein Mann zu werden, den andere achteten, und der sich selbst achten konnte? So viele der Schranzen, die sich in den letzten Jahren um John Dudley geschart hatten, waren verschwunden, und Jane musste jeden Morgen mit der Furcht erwachen, dass der beginnende Tag der letzte für ihre verbliebenen Söhne sein könnte; Guildford, der Jüngste, hatte schon für den Ehrgeiz seines Vaters mit seinem Kopf bezahlt.
Also blieb ich an der Seite meiner Base und versuchte, ihre unerschütterliche Hoffnung zu teilen, während sie von einem Höfling nach dem andern abgewiesen wurde, Tag auf Tag, immer wieder. Es lag nicht nur an den Feinden, die sich John Dudley durch seinen raschen Aufstieg gemacht hatte. Sich bei der neuen Königin für die Witwe und die Söhne des Mannes einzusetzen, der sein Bestes getan hatte, um zu verhindern, dass sie auf den Thron kam, bedeutete, viel für nichts zu riskieren, denn dass ein Dudley unter Mary Tudor je wieder zu Ansehen und Ehren kam, war wirklich nicht zu erwarten.
Jane pflegte damals vor jedem vergeblichen Bittgang die Namen ihrer lebenden Söhne zu murmeln wie ein Gebet – Ambrose, John, Robin und Henry. Als sie erfuhr, dass John im Tower an einem Fieber dahinsiechte, das ihn noch vor dem Henker vom Leben in den Tod befördern würde, brach sie zusammen und weinte in meinen Armen. Da ich meine Base während meines ganzen Lebens nie anders als stark erlebt hatte, fühlte ich mich einen Moment lang, als hätte sich die Welt von unten nach oben gekehrt und der Boden unter meinen Füßen aufgetan, um uns alle zu verschlingen.
»My lady«, sagte ich schließlich zu ihr, absichtlich so formell wie möglich, um ihr Selbstbewusstsein wieder zu stärken, denn ihr Titel als Herzogin von Northumberland war eines der wenigen Dinge, die Jane nicht genommen worden waren, »wenn kein Engländer Euch helfen will, dann sollten wir es mit einem der gottverfluchten Spanier versuchen.«
Jane sah mich ausdruckslos an.
»Die Spanier, my lady, sind schließlich nicht nur hier, um uns mit ihrer Arroganz den letzten Nerv zu rauben, sondern als Teil der Gefolgschaft des Prinzgemahls gewissermaßen Gäste in unserem Land«, erinnerte ich sie.
Sie verstand, und das rief ihre Lebensgeister zurück. »Darum brauchen sie um keine eigenen Güter zu fürchten, wenn sie für uns sprechen«, vollendete Jane meinen Satz.
»Außerdem weiß doch jeder, dass die Königin Wachs in Philipps Händen ist. Vielleicht gilt das auch für die Edelleute aus seinem Gefolge.«
Jane legte mir ihre Finger auf die Lippen und sagte mir, ich sollte nicht so respektlos von der Königin sprechen, aber sie hörte auf mich. Nach einer Woche, in der sie jeden spanischen Edelmann und jede spanische Hofdame aufsuchte, die sich in unserem Land herumtrieben, weil ihr Prinz unsere Königin geheiratet hatte, zeigte sich das Schicksal endlich wieder etwas gnädiger. Das Schicksal – und das Interesse der Spanier an Informationen, mit denen sie ihren portugiesischen Rivalen eins auswischen konnten. Ich übergab meiner Base daher einige Briefe über die Nordostpassage nach China und Indien, die mir John Dudley während der letzten Wochen an der Spitze des Kronrats überlassen hatte, weil er zu beschäftigt damit war, seinen Staatsstreich vorzubereiten. Meine Aufgabe war es gewesen, Geldgeber für eine Gesellschaft zu finden, die bereit waren, für die Suche nach diesem Seeweg Summen in beträchtlicher Höhe zur Verfügung zu stellen, um mehrere Schiffe auszurüsten.
John der Jüngere starb zwar dennoch in der Gefangenschaft am Fieber, ehe die Spanier auf unseren Vorschlag eingingen, aber für Ambrose, Robin und Henry war es noch nicht zu spät. Sie wurden freigelassen. Allerdings nicht ohne Bedingungen.
Binnen kurzem sollte ich mich gemeinsam mit ihnen im französischen Schlamm vor St. Quintin wiederfinden, wo sechstausend Engländer für Philipp von Spanien fochten. Manchmal träume ich noch heute davon, und es sind keine guten Träume. Ich tat damals mein Bestes, um nicht nur meine eigene Haut zu retten, sondern auch auf Janes Jungen achtzugeben. Das war ich ihr schuldig.
Janes so lange Jahre unerschütterliche Gesundheit war dahin; die Freude, ihre Söhne frei zu sehen, währte nur kurz, und die Angst, sie gleich wieder durch den Krieg zu verlieren, zehrte an ihr. Sie konnte sich von uns allen nur auf dem Krankenbett verabschieden. Margery war aus Kidderminster gekommen, um sie zu pflegen, und gradlinig, wie es ihre Art ist, sagte sie mir, ihrer Meinung nach stünde es nicht gut um Jane. »Sie ist alt genug, um deine Mutter zu sein, Tom«, schloss sie. »Ich glaube, das vergisst du manchmal.«
»Wenn es ihr so schlechtgeht, dann sollte ich bleiben«, überlegte ich.
Margery schüttelte den Kopf. »Was, und die Jungen alleine nach Frankreich gehen lassen? Dann sinkt sie mit Sicherheit bereits morgen vor Sorge ins Grab. Wenn zudem einer von ihnen in Frankreich stirbt, dann wirst du für den Rest deines Lebens glauben, du hättest es verhindern können. Ich kenne dich, Tom.«
Hoffte ich insgeheim trotzdem, Jane würde mich bitten, bei ihr zu bleiben? Doch es ist müßig, darüber nachzudenken; sie drückte meine Hand und flüsterte, wie zu den Zeiten ihrer Bittgänge, die Namen ihrer noch lebenden Söhne vor sich hin. Ambrose, Robin, Henry. Da wusste ich, dass Margery recht hatte.
»Ich werde mich um sie kümmern«, versprach ich ihr, und Jane lächelte.
»Das weiß ich. Du bist doch mein Ältester«, murmelte sie. Dieses Lächeln ist es, was mir von ihr am besten in Erinnerung geblieben ist. Wie sich später herausstellte, hatte ich sie an jenem Tag zum letzten Mal gesehen, denn sie starb, während wir in Frankreich kämpften, und nach meiner Rückkehr fand ich nur noch ihr Grab vor. Wenigstens hat sie nie erfahren, dass ich einen weiteren ihrer Söhne verloren habe.
Ambrose, Robin und Henry waren zu jung, um mit ihrem Vater auf dem Feld gewesen zu sein, wie das bei mir der Fall gewesen war, obwohl sie natürlich wie die meisten jungen Edelleute bereits in Turnieren gefochten hatten. Doch die lange Zeit im Tower hatte sie Kraft und einen Teil ihrer Behendigkeit gekostet. Ein Feldzug bietet keine Gelegenheit, um beides wieder zurückzugewinnen, ehe es ernst wird. Ambrose, der nunmehr Älteste, focht immerhin bedachtsam; Robin und Henry schienen beide beweisen zu wollen, dass dem Henker entkommen zu sein ihnen Unsterblichkeit verliehen hatte. Vielleicht waren es aber auch die höhnischen Bemerkungen von Seiten ihrer Kameraden über die Feigheit ihres Vaters, die sie vorantrieben. John hatte am Ende versucht, durch den Übertritt zum Katholizismus sein Leben zu retten, obwohl es doch die ganze Rechtfertigung für seinen Eingriff in die Thronfolge gewesen war, dass er keine Katholikin auf Englands Thron sehen wollte. »Heute hier, morgen dort, aber nie da, wenn man auf sie zählt«, so spottete mehr als einer im Heer, »so sind die Dudleys.« Oder: »Was ist der Unterschied zwischen einem Wurm und einem Dudley? Aus dem Dreck kommen beide, aber der Wurm hat mehr Rückgrat!«
Ambrose stellte sich taub, Robin fing Streit mit den Betreffenden an, und Henry, Henry meldete sich freiwillig, um in St. Quintin in vorderster Front zu stehen. Als ich das hörte, schnappte ich mir seinen Befehlshaber und schrie etwas davon, dass Henry einfach nur jung und dumm war und auf keinen Fall so eingesetzt werden dürfte. »Das gilt für die meisten in diesem Heer«, sagte der Spanier unbeeindruckt. »Und wer glaubt Ihr zu sein, dass Ihr Euch diesen Ton herausnehmt? Ich glaube, es wird Euch guttun, zusammen mit Eurem jungen Vetter zu stehen. Euch und seinen Brüdern. Dann lernt Ihr vielleicht, was für ein Privileg es für die Überbleibsel eines toten ketzerischen Verräters ist, ihre Schande im ehrenhaften Dienst für die heilige Sache wiedergutmachen zu dürfen.«
Die Erinnerung an jenen Tag ist noch so lebendig in mir, als wäre er erst gestern gewesen, und ich wünschte, es wäre nicht so. Das Wetter war schlecht bei St. Quintin; in der Nacht hatte es wie aus Eimern geregnet, und noch der Morgen war diesig, feucht und kalt. Pferde und Männer stakten knietief durch den Schlamm, während ich Henry nicht zum ersten Mal den Kopf wusch ob seiner Tollkühnheit, die uns alle das Leben kosten konnte.
»Unsinn, Vetter Blount«, sagte er übermütig, »es wird alles gut werden. Wir kehren als Helden zurück!« Er preschte zum Flaggenträger und griff sich die Flagge. »Für England!«, rief er und hielt sie hoch. »Für Sankt Georg!«
»Er ist verrückt«, entfuhr es Ambrose entgeistert.
»Nein, er hat recht«, sagte Robin heftig und machte Anstalten, sich zu Henry zu gesellen. Ich schaffte es gerade noch, seinen Arm zu packen.
»Lass mich los«, rief er aufgebracht – und in diesem Moment hörten wir das Donnern. Die ersten Kanonenkugeln schlugen in unserer Nähe ein.
Keiner von uns hat Henry schreien hören. Er hatte nicht mehr die Zeit dazu.
Henry wurde direkt getroffen, und anschließend blieben nur noch Fetzen von ihm. Dafür schrie sonst eigentlich jeder, weil die Franzosen mit ihrem Angriff schneller als erwartet begonnen hatten. Die feuchte, kalte Luft dröhnte vom Gebrüll unserer Männer, die fluchten, wirre Befehle zu geben versuchten oder nach ihren Vätern und Müttern schrien. Schon nach wenigen Augenblicken roch es wie in einem Schlachthaus.
Nach der Schlacht bestand Robin zuerst darauf, dass Henry noch am Leben war. »Die Kugel ist nur in seiner Nähe eingeschlagen, und dadurch wurde er fortgeschleudert«, beharrte er. »Henry ist bewusstlos und liegt irgendwo unter den Leichen. Wir müssen ihn finden.«
»Rob, er ist tot«, sagte Ambrose tonlos und wischte sich mit der Hand über das Gesicht. »Wir haben doch gesehen, dass …«
»Nichts haben wir gesehen!«, wies Robin den Einwand scharf zurück. »Er ist nur fortgeschleudert worden und wartet darauf, dass wir ihn finden. Oder er ist in französischer Gefangenschaft.«
»Wir werden ihn suchen«, sagte ich begütigend, »und finden, so oder so.« Natürlich wusste ich, dass Ambrose recht hatte. Jane, dachte ich, Jane, verzeih mir. Margerys Brief über ihren Tod war erst am Vortag eingetroffen. Ich hatte es den Jungen noch nicht gesagt, weil ich es selbst nicht wahrhaben wollte. Und nun hatte ich mein letztes Versprechen an sie nicht einhalten können.
Wir waren beileibe nicht die Einzigen, die auf dem Schlachtfeld nach Leichen suchten; einige Männer hatten gesehen, was mit Henry passiert war, und so ernteten wir verwunderte Blicke, doch keinen Hohn. Dann fand Ambrose eine Hand, nichts als eine Hand, mit einem Ring, den wir alle erkannten. Wie alle Dudley-Söhne hatte Henry jung geheiratet, in den Zeiten, als John Dudley der erste Mann im Königreich gewesen war, und seine Gattin, Lady Audley, hatte ihm diesen Ring geschenkt, der eigentlich der Siegelring ihres Vaters gewesen war; die Brüder hatten Henry deswegen immer geneckt. Ambrose fiel auf die Knie und begann, sich die Seele aus dem Leib zu würgen; ich muss gestehen, dass auch meine Knie weich wurden. Robin dagegen stand ganz einfach neben mir und sagte: »Das beweist noch gar nichts. Es ist nur die Hand. Man kann den Verlust einer Hand überleben.«
Janes Tod, Henrys Tod und das ganze Elend schlugen über mir zusammen, und mir riss der Geduldsfaden. Ohne darüber nachzudenken, hob ich meine Hand und schlug Robin ins Gesicht, nicht mit der Faust, sondern mit der geöffneten Handfläche, wie man es bei einem Kind tut. »Wach auf«, schrie ich. »Dein Bruder ist tot.« Ich bin nicht stolz darauf; es war das Einzige, was ich tun konnte. Plötzlich beneidete ich Ambrose, der seiner Übelkeit wenigstens Ausdruck verleihen konnte.
Robin starrte mich an. »Nein«, sagte er dann unbeirrt, »nein, ich werde ihn finden. Du wirst sehen.« Er wandte sich von mir ab und begann, weiter das Schlachtfeld abzusuchen.
Ich schickte Ambrose in das Zelt zurück, das wir alle teilten, und folgte Robin.
Wir fanden kaum genügend Überbleibsel für ein christliches Begräbnis. Henrys Kopf gehörte nicht dazu. Bei manchen Gliedmaßen war ich mir nicht sicher, ob sie ihm gehört hatten, und ich vermutete, dass Robin es auch nicht war. Aber nachdem er sich eingestehen musste, dass es keine Hoffnung mehr für Henry gab, bestand er darauf, dass es sich bei dem, was wir fanden, um den Oberarm, um die Füße, um das Bein seines Bruders handelte.
»Meine Mutter«, begann er, und sein starrer Gesichtsausdruck machte mir mehr Sorgen, als es Ambrose’ offener Zusammenbruch getan hatte, »meine Mutter hätte gewollt, dass Henry ein ordentliches Begräbnis bekommt.«
Es lag mir auf der Zunge, ihm die Wahrheit über Jane zu sagen, da fiel mir auf, dass er in der Vergangenheitsform von ihr gesprochen hatte, und ich begriff, dass er bereits wusste, was geschehen war.
»Woher …«
»Du bist nicht der Einzige, der Briefe aus England bekommt, Vetter«, sagte Robin, und die steinerne Haltung, in die er sich seit Beginn der Schlacht geflüchtet hatte, begann endlich etwas aufzubrechen, als er einen blutbefleckten Hut, der tatsächlich Henrys gewesen sein konnte, vom Boden auflas. Er hielt ihn in den Händen, und ich konnte sehen, dass er wiederholt schluckte, als versuche er mit Gewalt, Tränen zu unterdrücken. Ich dachte daran, wie ich vor meinem Vater nie hatte Schwäche zeigen wollen. Aber wenn es je einen Zeitpunkt gab, an dem mein zwölf Jahre jüngerer Vetter einen Anspruch darauf hatte, vor Gott und den Menschen einmal keine Stärke zeigen zu müssen, dann jetzt. Ich wusste nur nicht, wie ich das zum Ausdruck bringen konnte, ohne die falschen Worte zu gebrauchen und ihn womöglich zu kränken.
»Ich glaube«, sagte ich stattdessen mit einem Blick auf den Hut, »wir haben nun genug gefunden, Vetter.«
Er nickte stumm.
Robin und ich legten das, was von Henry übrig war, in einen Sarg und hörten wenig später einen spanischen Pfaffen um Gottes Segen für ihn bitten. Danach nahm ich, was ich an Geld hatte, und ging mit Robin in den nächstgelegenen Ort. Dort liebte man zwar weder Engländer noch Spanier, aber sehr wohl klingende Münze; ich besorgte uns Branntwein und zwei Mädchen. Gewiss, Katholiken wie Protestanten sind sich einig, dass unser Herr den Ehebruch verdammt, aber meine eigene Auslegung war immer, dass dies nicht für Männer gilt, die ihre Gattin monatelang nicht zu Gesicht bekommen, und gewiss nicht für Soldaten. Sich im warmen, willigen Körper einer Frau zu verlieren, schafft Vergessen wie kaum etwas anderes, und für mich stand an jenem unseligen Tag fest, dass Janes Sohn und ich dringend Vergessen brauchten. Und sei es nur eine Stunde lang.
In besseren, glücklicheren Zeiten war es einmal an mir gewesen, Robin und seinen Brüdern Ratschläge über Frauen zu erteilen. Als Henry das Mädchen, durch dessen Ring wir heute seine Hand wiedererkannt hatten, schwängerte und im Schnellverfahren heiraten musste, war John Dudley mit dem Coup gegen Edward Seymour beschäftigt gewesen und hatte mich gebeten, dafür zu sorgen, dass seine Söhne ihm keine solchen Streiche mehr spielten. Ich hatte John den Jüngeren, Ambrose, Robin und Guildford zur Seite genommen und ihnen erklärt, dass ein Mann, der seinen Verstand beisammen hatte, niemals ein Verhältnis mit einem unverheirateten Mädchen anfing. »Der Apostel Paulus meinte, es ist besser zu heiraten, als zu brennen«, hatte ich gesagt, »aber er war nicht verheiratet, und ein Heiliger ist ohnehin nicht von dieser Welt. Wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt: Wenn man das Feuer nicht kontrollieren kann, so rät es sich doch, den Brand in ein sicheres Gefilde zu lenken.«
Die Jungen, allesamt noch Jahre davon entfernt, als Männer zu gelten, aber durchaus alt genug, um Dummheiten zu begehen, hatten mich großäugig angestarrt und gefragt, wer denn als »sicher« bezeichnet werden könne.
»Erzählt Eurer Mutter nie, was ich jetzt sage«, hatte ich erwidert, »aber die sicherste Frau ist immer eine verheiratete Frau. Wenn ihr vorsichtig vorgeht und nicht mit der Affäre herumprahlt, dann müsst ihr nicht fürchten, sie in Schande zu stürzen, weil kein Mensch etwas von der Sache erfährt. Wenn sie schwanger wird, dann freut sich der Gatte über einen neuen Erben, und ihr müsst nicht für das Kind aufkommen. Außerdem hat eine solche Frau keine Krankheiten, während man bei einer Hure nie sicher sein kann.«
Es wäre anständiger gewesen zu sagen, dass sie gefälligst ihren Hosenlatz geschlossen halten sollten, bis ihr Vater sie verheiratet hätte, aber dergleichen wäre ihnen zum einen Ohr hinein- und zum anderen wieder herausgegangen. So zumindest hatte ich es empfunden, als mein Vater mir diese Predigt hielt.
Damals schien der erboste Vater einer unverheirateten Tochter die größte Gefahr zu sein, die einem von Janes Söhnen drohen konnte. Nun hatte Guildford der Henker geholt, Henry war tot, Ambrose zusammengebrochen, und Robin und ich konnten noch von Glück sagen, wenn ein paar Französinnen uns halfen, die Nacht zu überstehen, ohne verrückt zu werden.
An den Namen des Mädchens, wenn sie ihn mir denn verriet, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß noch, dass sie flachsfarbenes Haar und einen Leberfleck über dem Bauchnabel hatte, und dass ich den Gestank der Leichen und des getrockneten Blutes in ihren Armen nicht mehr roch, sondern den gesunden, milchigen Schweiß einer Frau; den Duft des Lebens, nicht des Todes.
Robin war mit seinem Mädchen bereits fertig oder hatte noch nicht angefangen, als ich wieder in den Schankraum kam; auf jeden Fall saß sie neben ihm, während er aus seinem Becher trank. Sein Gesicht war leicht gerötet, er trug sein Wams nicht mehr, und man konnte sehen, dass etwas von dem Blut dieses Tages einen Weg auf das Hemd darunter gefunden hatte.
»Guildford ist in St. Peter ad Vincula beerdigt«, sagte er abrupt, als ich mich zu ihm setzte. »Der Kapelle im Tower. Als sie ihn holten, sagte er zu uns anderen, er hoffte, er müsse noch lange auf uns warten. Glaubst du, Henry ist jetzt bei ihm?«
»Das weiß Gott allein«, sagte ich müde.
»Meine Mutter ist es bestimmt. Obwohl sie die Einzige in der Familie sein dürfte, die ein Anrecht hat, geradewegs ins Paradies zu kommen. Aber ich – ich kann mir nicht vorstellen …« Er ließ den Kopf sinken, seine Stimme wurde brüchiger, obwohl er sie immer noch zum Gehorsam zwang. »Ich kann mir nicht denken, dass sie ohne ihre Kinder zur Rechten Gottes sitzen wollte.«
»Deine Mutter würde lieber das Fegefeuer in Kauf nehmen, als ohne ihre Kinder zu sein«, bestätigte ich und dachte an Jane, meine Base Jane, die in allem, was zählte, auch meine Mutter gewesen war. Robin hatte ihre Augen geerbt, was ihn, zusammen mit dem dunklen Haar seines Vaters, immer wie einen Südländer aussehen ließ, mehr als so manchen Spanier, den ich kannte. Ich versuchte, mir nicht vorzustellen, wie es sich anfühlen würde, auch noch ihn und Ambrose unter die Erde zu bringen; in jener Nacht schien es, als gäbe es nur Unglück für uns alle. Dann schaute Robin erneut auf, und ich konnte sehen, dass etwas von der Jungenhaftigkeit, die er bis zu diesem Zeitpunkt noch gehabt hatte, verschwunden war. Zum ersten Mal konnte man ihm jedes Jahr seiner über zwei Jahrzehnte anmerken.
»Vetter Blount«, sagte er und schob die Hand des Mädchens zurück, die ihm unter das Hemd fahren wollte, »so etwas wird nie wieder geschehen.«
Es war eine jener Feststellungen, die man macht, wenn man zu viel getrunken hat, und die nüchtern betrachtet keinen großen Sinn ergeben. Jeder Mensch schuldet Gott einen Tod, und ob sein Bruder, seine beiden Schwestern, meine Gemahlin und mein gerade geborener Sohn nun alle hundert Jahre alt wurden oder morgen von uns gingen, sterben würden sie, ganz wie er und ich auch. Aber ich war selbst erschöpft, gebrochen und durchwärmt von Branntwein und dem Mädchen, das in meinen Armen gelegen hatte, und in diesem Zustand verstand ich, was er meinte. Es waren nicht nur die Todesfälle; es war der Umstand, dass die Familie so tief gestürzt war. Jane hätte niemals in die Bedrängnis kommen dürfen, um das Leben ihrer Söhne betteln zu müssen und als Frau eines hingerichteten Verräters auf ihre Verwandten angewiesen zu sein, was ein Dach über dem Kopf und Krankenpflege betraf, weil sie sich keinen Arzt mehr leisten konnte.
»Nun, dein Vater ist tot«, gab ich zurück, gerade noch nüchtern genug, um nicht fortzufahren, dass John Dudley uns durch seinen Ehrgeiz erst zu Verrätern an der Krone gemacht und damit die Folgen heraufbeschworen hatte; es war auch so klar, worauf meine Bemerkung zielte, und seine Söhne hatten schon oft genug gehört, wie andere Menschen ihren Vater in die Hölle wünschten. An jedem anderen Tag hätte ich darum auch die Bitterkeit unterdrückt und mir eingestanden, dass ich John bereitwillig genug gefolgt war, solange er Erfolg hatte. Ja, er hatte sein Versprechen, uns alle auf den Gipfel der Macht zu führen, nicht erfüllt – so wie ich nicht in der Lage gewesen war, mein Versprechen Jane gegenüber zu halten und ihre Söhne zu beschützen, alle ihre Söhne. Gegen wen sollte ich also den größeren Groll hegen?
»Mein Vater«, sagte Robin, und die Bitterkeit, die in mir brannte, fand sich auch in seiner Stimme, »hat die schlimmste Art von Verrat begangen – Verrat ohne Erfolg. Sonst würde man ihn nämlich als Retter des Landes preisen. Aber die Dudleys werden wieder aufsteigen, sie werden sicherer und mächtiger werden, als sie es zu Lebzeiten meines Herrn Vaters je waren, das schwöre ich dir bei allem, was mir heilig ist.«
Mir lag auf der Zunge, ihn darauf hinzuweisen, dass all das Ansehen und die Macht seinen Vater nicht gerettet, sondern nur auf den Pfad geführt hatte, der seinen Tod, den Tod von Guildford, Henry und John dem Jüngeren und die ganze jetzige Misere erst ermöglichte, aber ich konnte es nicht aussprechen. Und ich wollte es auch nicht. Der Mensch braucht Hoffnung, ich so gut wie er. Ich dachte an meine eigene Familie daheim und fragte mich, ob sie mich wohl dereinst verfluchen würde, weil ich unsere Geschicke so fest an die Familie eines geköpften Verräters geknüpft hatte. Dann erinnerte ich mich daran, dass wir sehr gut alle tot hätten sein können, ich so gut wie Robin, hingerichtet genau wie Janes Gatte und ihr jüngster Sohn oder in Stücke gerissen wie der arme Henry. Aber wir waren nicht tot, sondern am Leben. Dafür musste man Gott dankbar sein und etwas daraus machen.
»Du hast uns immer treu zur Seite gestanden«, sagte Robin, als stünden mir meine Gedanken auf der Stirn geschrieben, »doch wenn es dich zurück nach Worcestershire zieht, würde ich das verstehen. Jetzt, wo du für ihren Gatten gefochten hast, wird die Königin dir gewiss etwas Land zurückgeben, und du und die deinen könnten dort in Frieden leben.«
Es wäre an seinem Bruder Ambrose gewesen, als dem Ältesten und daher neuen Oberhaupt der Familie, mich entweder zu bitten zu bleiben oder mir mitzuteilen, ich könne gehen. Robin war nie mehr als der mittlere Sohn gewesen, weder der zukünftige Erbe seines Vaters noch das verwöhnte Nesthäkchen. Als John Dudley einen seiner Söhne mit dem Mädchen verheiratete, das er zur Königin von England machen wollte, da war es Guildford gewesen, nicht Robin. Was Jane betraf, so bestand sie darauf, keine Lieblinge zu haben und alle ihre Kinder gleich zu lieben, aber insgeheim war ich davon überzeugt, dass Henry ihr Favorit war.
Ein mittlerer Sohn in einer großen Familie muss immer ein wenig aufgeweckter, schneller, besser als die anderen sein, um überhaupt aufzufallen. Es hätte mich also nicht wundern sollen, dass Robin derjenige der Dudleys sein würde, der sich in der Stunde der Niederlage und des tiefsten Verlustes aufraffte und begann, Pläne für die Zukunft zu machen. Die Frage war nun, ob ich ihm dabei folgen wollte.
Er hatte recht. Nach meinem Kriegsdienst hier hatte ich gute Chancen, mein Land wieder zu bekommen und nicht mehr von Margerys Mitgift leben zu müssen. Ich konnte nach Hause gehen und den Rest meiner Tage in Kidderminster verbringen, mit ihr und unserem Kind, und ganz gleich, ob es Robin nun gelingen würde, die Dudleys wieder zu Glanz und Macht zu bringen, oder ob er sich nur ein Todesurteil einhandelte, es würde weder mein Verdienst noch meine Schuld sein. In diesem Moment, an dem knarrenden Holztisch in einem wenig ehrenhaften Gasthof in Frankreich, bot sich mir die einmalige Chance, die Geschicke der Blounts endgültig von denen der Dudleys zu trennen.
Janes Stimme klang mir im Ohr, wie sie die Namen ihrer Söhne rezitierte und mich ihren Ältesten nannte. Kidderminster fiel mir ein, und wie in den zehn Jahren vor Johns Tod jede Heimkehr einem Triumphzug geglichen hatte, während dieser Tage jeder sehr vorsichtig war, wenn er mit uns sprach. Hoffnung, dachte ich, jeder von uns braucht Hoffnung und das Gefühl, nicht allein zu sein. Ich schaute auf Janes Sohn, dem ich nach dem Tod seines Bruders nicht mehr als Branntwein und ein Schankmädchen gegeben hatte.
Mit dem Geschmack von Niederlage und französischem Branntwein im Mund sagte ich, und gebrauchte zum ersten Mal ihm gegenüber die respektvolle Anrede, die einem höhergestellten Mann gebührt, obwohl er durch den Tod seines Vaters allen Rang verloren hatte und wir gleichgestellt waren: »Ihr seid einer der Meinen … my lord. Wie kann ich in Frieden leben, solange Ihr das nicht tut?« Ich musste einmal schlucken und fügte schnell hinzu: »Außerdem, wenn ich in Worcestershire sitze, während Ihr bei Hofe ein großer Mann seid, werde ich keinen Frieden haben, sondern nichts als Ärger in mir spüren, weil ich das verpasse.«
»Danke für dein Vertrauen, Vetter«, sagte Robin. Dann legte er seinen Kopf auf den schmutzigen Holztisch einer miserablen französischen Schenke und weinte um seine toten Brüder, um seinen Vater, seine Mutter, und ich weinte mit ihm.
Robin und ich sprachen später nie mehr über das, was an jenem Abend passiert war. Aber von diesem Zeitpunkt an ging es tatsächlich bergauf, in kleinen Schritten, zugegeben, aber immer bergauf. Weder er noch Ambrose noch ich selbst wurden in Frankreich verwundet, was auch daran lag, dass Robin und ich unser Talent dafür entdeckten, einander den Rücken zu decken. Als wir das nächste Mal in ein Hurenhaus gingen, war es nicht, um Vergessen vor Trauer und Entsetzen zu suchen, sondern, um zu feiern, dass Königin Mary uns wegen des Dienstes in Frankreich von begnadigten Verrätern wieder zu freien Männern von Rang erhoben hatte. Die französische Dirne, die wir dort trafen, ist mir nicht nur in Erinnerung geblieben, weil sie wirklich hinreißend aussah, sondern auch, weil sie von Robin zu mir schaute und dreist erklärte, wir sollten doch gleich zu zweit zu ihr kommen, denn englische Männer hätten nun einmal einzeln nicht die Ausdauer für eine Frau wie sie. Zuerst war ich gekränkt und drauf und dran, auf dem Absatz kehrtzumachen, aber Robin brach in Gelächter aus. »Sie hat recht, Thomas, sie hat recht«, stieß er zwischen zwei Salven hervor, und erst als ich mich anstecken ließ, wurde mir bewusst, wie lange es her war, dass einer von uns beiden über sich selbst hatte lachen können.
Kapitel 2
1557
Nach unserer Rückkehr nach England starb der alte Robsart, der Vater von Robins Gemahlin Amy, und da dieser sich nicht an John Dudleys Umtrieben beteiligt und mein Vetter sich gerade erst Königin Marys Begnadigung verdient hatte, wurde Robin erlaubt, die Robsart-Güter in Norfolk zu übernehmen. Nur noch selten hörte ich, wie ihn jemand außerhalb der Familie mit seinem Jungennamen ansprach; stattdessen wurde der neue Aufstieg des Robert Dudley mit gespannter Erwartung und der typischen Mischung aus Missgunst und berechnender Freundlichkeit beobachtet. Für mich als seinen neuen Verwalter bedeuteten die Ländereien eine Menge Arbeit und eine Menge Herumreisen, aber auch sichere Einkünfte.
Recht schnell bedeutete es auch einen Streit, denn Robin setzte sich in den Kopf, etwas von seinem neuen Land zu verkaufen, und wollte mir zunächst nicht sagen, wofür das Geld bestimmt war: »Du musst darüber nur eins wissen, Vetter«, sagte er. »Die Erlöse werden nicht für die anderen Güter zur Verfügung stehen.« Seine Gemahlin glaubte mir meine Unwissenheit nicht, befahl mir, ihr die Wahrheit zu sagen, und war mehr als verärgert, als ich darauf beharrte, nichts über den geplanten Verwendungszweck des Geldes zu wissen. Amy war meist fröhlichen Gemüts, aber wenn der Ärger sie packte, dann ließ sie es jeden in ihrer Umgebung spüren. Schließlich teilte Robin ihr und mir die Wahrheit mit; ich glaube heute noch, dass er mich dabeihaben wollte, um einen Ehestreit in Grenzen zu halten. Der alte Robsart mochte kein hochadliger Herr gewesen sein, aber er hatte seiner Tochter eine gute Erziehung ermöglicht, und ehelicher Zwist vor Dritten ziemte sich nicht, das wusste sie.
»Das Geld ist für die Prinzessin Elizabeth bestimmt«, sagte Robin zu Amy, und sie runzelte die Stirn. Auch mir wurde flau im Magen. Die Prinzessin war eine mögliche Thronfolgerin, gewiss, und da es immer unwahrscheinlicher wurde, dass Königin Mary, ihre Schwester, je ein Kind gebären würde, konnte man durchaus auf ihre Thronbesteigung setzen. Königin Mary und Prinzessin Elizabeth waren die letzten lebenden Tudors; es gab sonst niemanden mehr, der einen direkten Anspruch auf die Krone vorweisen konnte. Henry hatte in seinem Testament zwar verfügt, dass ihre Base Jane Grey die nächste Erbin nach seinen eigenen Kindern werden sollte, doch nachdem sie von John Dudley widerrechtlich für neun Tage zur Königin gemacht worden war, hatte Mary sie hinrichten lassen. Auch die Prinzessin Elizabeth war bereits wegen angeblich versuchten Thronraubs im Tower gefangen gewesen, zur gleichen Zeit, als die Dudley-Brüder ihres Vaters wegen dort einsaßen. Außerdem pfiffen es die Spatzen von den Dächern, dass die Königin ihre junge Halbschwester hasste. »Und wen wundert das?«, pflegte meine Gemahlin Margery zu sagen. »Königin Mary hat ihre Mutter und ihre Kindheit durch Lady Elizabeths Mutter verloren.« Wenn Mary zu Ohren kam, dass die gerade erst begnadigten Dudleys Elizabeth unterstützten, dann konnten wir uns alle wieder mittellos im Dreck wiederfinden, oder, Gott bewahre, erneut des Verrats angeklagt.
»Elizabeth hat ein gutes Gedächtnis«, sagte Robin entschieden, »und sie hat noch nie einen Freund im Stich gelassen. Wenn sie erst Königin ist, wird sie nicht vergessen, wer ihr zur Seite stand. Ich kenne sie.«
Amy biss sich auf die Lippe und schaute mich mit ihren schönen, ausdrucksstarken Augen beschwörend an. Ob sie nun wünschte, ich möge mich zurückziehen, oder vielmehr, dass ich blieb und als Erster über die Gefahr sprach, in die Robin sich und die Seinen brachte, damit sie es nicht tun musste, weiß ich bis heute nicht zu sagen.
»Ich kenne sie«, wiederholte Robin, und ich dachte daran, wie stolz meine Base Jane darauf gewesen war, dass Robin, Guildford und ihre Schwestern Kate und Mall mit dem Prinzen Edward, der Prinzessin Elizabeth und Lady Jane Grey unterrichtet werden durften; John Dudley hatte dem alten König die Erlaubnis abgeschmeichelt, als er Mitglied des Kronrats wurde, und natürlich geplant, dass die Kinder freundschaftliche Bande knüpften.
Es war ihm vor allem um den jungen Edward gegangen; keiner hatte damals ahnen können, dass dieser so früh sterben würde, statt England für ein paar Jahrzehnte zu regieren. Doch mehrere Eisen im Feuer schadeten niemandem, und John wollte so viele Mitglieder der Familie Dudley wie machbar an so viele Mitglieder der königlichen Familie wie möglich binden. Vier eigene Kinder und drei mögliche Thronfolger erhöhten für ihn die Hoffnung auf Erfolg in der nächsten Generation beträchtlich.
»Die Lady Elizabeth«, sagte Amy Dudley schließlich, als ich weder den Raum verließ noch gegen den Plan sprach, »hat gewiss reichere, begütertere Freunde, die ihr zur Seite stehen können, wenn sie Geld benötigt. Nun, vielleicht nicht mehr so viele Freunde wie früher, jetzt, wo viele von ihnen hingerichtet worden sind, weil sie eine Königin Elizabeth wollten und ihr Aufstand niedergeschlagen wurde. Mein liebster Gemahl, du bist mir endlich aus großer Gefahr wiedergeschenkt worden. Heißt es da nicht Gott versuchen, wenn du dich erneut in Gefahr begibst? Die Königin wird nicht Freundschaft in einer solchen Leihgabe an ihre Schwester sehen, schon gar nicht, wenn sie vom Sohn John Dudleys kommt.«
»Die Königin wird nie davon erfahren«, sagte Robin unbeirrt. »Es ist eine Investition in die Zukunft.« Dabei schaute er nicht zu Amy, sondern zu mir. »Hab Vertrauen.«
Der einzig sichere Weg in die Zukunft, da war seine Gemahlin ganz im Recht, lag darin, sich auf dergleichen Glücksspiele mit den Mächtigen nicht mehr einzulassen. Doch das war nicht der Weg, der an die Spitze führte. Seit jenem Tag in Frankreich hatte ich nicht daran gezweifelt, dass Robin meinte, was er sagte, als er geschworen hatte, das Rad der Fortuna erneut zu erklimmen, und damals hatte ich geschworen, an seiner Seite zu bleiben. Es ging nicht an, sich jetzt zurückzuziehen, bei der ersten Gelegenheit, meine Treue zu beweisen, und so erwiderte ich:
»Ich habe Vertrauen, my lord. Doch weiß ich, dass Vertrauen und Vorsicht das beste aller Paare bilden, und so bitte ich Euch, mich dafür sorgen zu lassen, dass Euer Geld die Prinzessin erreicht. Niemand außer ihr wird je wissen, von wem es stammt.«
Damit hoffte ich, nicht nur mein eigenes Gemüt zu beruhigen, sondern auch das der Lady Amy, aber der Blick, den sie mir zuwarf, machte klar, dass sie sich auch von mir verraten fühlte. Es berührte mich eigenartig. Ich schuldete ihr nur als Robins Gemahlin Loyalität; sonst gab es keine Bande zwischen den Blounts und den Robsarts. Ehe ich mit Robin aus Frankreich wiederkehrte, hatte ich sie nur auf ihrer Hochzeit und gelegentlich auf Reisen gesehen. Also war es völlig unverständlich, dass sie geglaubt hatte, ich würde für sie und gegen ihren Gatten Partei ergreifen, selbst, wenn ich ihre Meinung teilte. Doch genau davon musste sie überzeugt gewesen sein; anders war ihr Blick nicht zu erklären, noch die verletzte Art, mit der sie den Kopf abwandte und den Raum verließ.
Ich schaute Amy nach und ertappte mich dabei, wie ich dachte, dass ein Anflug von Zorn ihr stand. Bei ihrer Hochzeit war sie ein äußerst hübsches junges Ding gewesen, aber in ihrer ständigen Fröhlichkeit zu kindlich für meinen Geschmack und überdies weit mehr an höfischen Festen interessiert als daran, allen Verwandten der Dudleys die Ehre zu erweisen. Jetzt war sie eine erwachsene Frau; der Ärger hatte Farbe auf ihre Wangen gelegt, und die Art, wie sie den Kopf zurückwarf, als sie ging, straffte ihre Brüste und zeigte, was für eine gute Figur sie hatte …
»Du hast Erfahrung in der Ehe, Vetter«, riss Robin mich aus meinen Gedanken. »Was tust du, wenn Margery dir grollt und du doch überzeugt bist, das Richtige zu tun?«
Der Name meiner Gattin fiel zur rechten Zeit. Ich bin ein Mann wie andere auch und müsste lügen, wenn ich sagte, dass ich seit unserer Rückkehr aus Frankreich keinem anderen Weib als Margery mit Wohlgefallen nachgeblickt hätte. Aber es bestand doch ein großer Unterschied darin, hin und wieder einem Schankmädchen, einer Kammerzofe oder gar deren Herrin nachzublicken oder sich unangemessene Gedanken über die ehrsame Gattin eines Verwandten zu machen. Amy war von einem Mädchen zu einer schönen jungen Frau geworden, sicher; das sollte in mir bestenfalls einen gewissen onkelhaften Stolz hervorrufen.
»Ich bete«, entgegnete ich hastig. »Was bleibt uns Männern anderes übrig?«
»Lügen, Tom, was du gerade wieder ganz überzeugend getan hast!«, spottete Robin.
Gut, ich hätte auch sagen können, dass Abwesenheit das Herz sanfter stimmt und weder Margery noch ich geneigt waren, uns in ehelichen Zwist zu stürzen, wenn ich sie in Kidderminster besuchte. Nach meiner Heimkehr aus Frankreich hatte ich erwogen, sie und unseren Sohn mit mir zu nehmen, wenn ich in Robins Geschäften in Norfolk, Oxfordshire oder in London unterwegs war, doch meine Gemahlin hatte dies abgelehnt.
»Tom«, hatte sie erklärt, »ständig unterwegs zu sein wie die Vagabunden, das bekommt dem Jungen nicht. Außerdem bin ich wieder schwanger, und wenn es Vetter Dudley gelingt, wieder ein Amt bei Hofe zu erlangen, dann müssten wir um jeden kleinen Raum in jeder königlichen Residenz kämpfen und würden wahrscheinlich mit allem möglichen Gesindel zusammen untergebracht. Hier in Kidderminster dagegen wachsen sie gesund auf. Hier ist meine Heimat, und auch die deine. Natürlich ist es meine Pflicht als deine Gattin, dir in allem zu folgen, doch es ist auch meine Pflicht, darauf zu achten, das alles für deine Familie zum Besten steht, und das tut es, wenn du uns in Kidderminster lässt, nicht, wenn wir zwischen Norfolk und dem Süden wie dein Reisegepäck hin und her ziehen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.«
Und mehr musste sie auch nicht sagen.
Drei Jahre waren seit jenem Tag ins Land gegangen. Vor zwei Jahren starb Mary, und ihre Halbschwester Elizabeth folgte ihr auf den Thron. Es war, wie ich schon sagte, eine gute Zeit für mich und die Meinen, denn Robin behielt recht: Unsere neue Königin vergaß ihre alten Freunde nicht. Robins Schwester Mall wurde Hofdame, Ambrose wurde Feldzeugmeister, und Robin selbst erhielt das Amt des Oberstallmeisters, was ihn verantwortlich für alles Transportwesen bei Hofe machte, nicht nur für die Pferde. Er war es auch, der ihre Krönung organisierte und der beim Krönungszug direkt hinter ihr ritt. Ja, die guten Zeiten der Dudleys waren wieder zurückgekehrt, und das sprach sich bald bis in die Provinz herum. Margery konnte sich in Worcestershire vor gutwilligen Nachbarn kaum mehr retten, die an unsere Tür klopften und auf einmal ihr Herz für uns entdeckten. Einige hatten mich sogar beschworen, bei der Parlamentswahl für unseren Bezirk zu stehen. Schließlich hatte mein Patron das Ohr der Königin; er war ihr bester Freund, ihre linke Hand, die vielleicht auch bald die rechte werden würde, und ich war der wichtigste Mann in seinem Haushalt.
Leider blieb es nicht alles, was man sich erzählte, noch blieb »Freund« die Bezeichnung, die der Klatsch für Robin wählte. Die Königin war jung, weitaus jünger als ihre Schwester, und natürlich fragten wir uns alle von dem Moment ihrer Krönung an, wen sie heiraten würde. Dass sie heiraten musste, stand außer Frage. Frauen konnten schließlich keine Königreiche regieren, und überdies war es ihre Pflicht, die Dynastie ihres Vaters fortzusetzen. Da ich mich nur zu gut erinnerte, wie viele junge Engländer für Spanien im französischen Dreck gestorben waren, hoffte ich inbrünstig, dass ihr Gatte kein Ausländer wie Philipp sein würde, der uns für seine Zwecke ausbluten ließ, und damit stand ich nicht allein.
Angeblich hatte Philipp Elizabeth einen Antrag gemacht, kaum dass seine Gattin, ihre Halbschwester, unter der Erde lag, aber wenn er es tat, dann wurde er nicht angenommen. Er war nur der erste Mann von vielen, die man als zukünftigen König an Elizabeths Seite handelte. Mittlerweile ist es zu einem beliebten Wettsport unter den Adligen bei Hof wie unter den Bürgern in Stadt und Land geworden, darauf zu wetten, welcher Prinz von königlichem Geblüt aus welchem Reich sich als Nächstes um die Hand ihrer Majestät bewirbt. Nicht, dass ich mich an dergleichen Wetten beteilige. Das habe ich nicht nötig, und mein Geld ist mir dafür zu schade. Ich habe einträglichere Nebeneinkünfte. Schließlich bilden sich genügend Leute ein, dass sie sich jetzt an die Rockzipfel der Dudleys hängen müssten, und manchmal sind sie kompetent genug, dass ich sie nicht entmutige, sondern Robin weiterempfehle.
Diese Menschen vor meiner Tür kommen natürlich auch wegen des Klatschs, der nur ein paar Monate nach der Krönung losging, und keine Anzeichen zeigt, zu erlahmen: Dass ihre Majestät keinen Ausländer und auch keinen der zahlreichen Grafen, Barone und Herzöge aus unserem einheimischen Hochadel heiraten wird, die längst ebenfalls ihre Bewerbungen vorgetragen haben, sondern keinen anderen als meinen Verwandten und Patron, ihren Jugendfreund Robin Dudley.
John Dudley hatte sich vom jungen König Edward zum Herzog machen lassen, aber wer wegen Verrates hingerichtet wurde, konnte seinen Söhnen keine Titel und keinen Besitz vererben, und so waren Ambrose und Robin bisher weder Herzöge noch Grafen noch Barone. Wenn sich das ändern und Robin einen höheren adligen Rang einnehmen sollte, würde er das seiner Freundschaft mit der Königin verdanken, nicht seinem Blut, und damit wäre er für unseren Hochadel als Bewerber eine unsagbare Missachtung ihres eigenen Rangs. Dass Robin seit seinem achtzehnten Lebensjahr bereits verheiratet ist und daher gar nicht um die Hand der Königin anhalten kann, ob mit oder ohne neuen Titel, schert die Klatschmäuler dabei wenig. Unsere neue Königin ist selbst nur auf der Welt, weil ihr Vater, der alte König Henry, seine erste Ehe für ungültig erklärte und mit dem Papsttum brach, um ihre Mutter Anne Boleyn heiraten zu können. Aber der Klatsch, der mir ständig zu Ohren kommt, auf den ich manchmal sogar ganz offen angesprochen werde, der behauptet nicht, dass Robin, dem Amy keine Kinder geschenkt hat, beim Erzbischof von Canterbury um eine Auflösung seiner Ehe ersuchen würde, nein. Im April des letzten Jahres kam sogar einer der Leute des spanischen Botschafters zu mir. Da es sich dabei um einen der Männer handelte, die sich bei Königin Mary für die Begnadigung der Dudleys eingesetzt hatten, war ich so höflich wie möglich, auch wenn es schwerfiel, denn was er zu sagen hatte, war allerhand.
»Es heißt, Eure Lady habe eine Krankheit in ihren Brüsten«, begann er unverblümt, »und Lord Robert und die Königin warteten nur auf ihren Tod, um heiraten zu können.«
Ich gab mir alle Mühe, meine Wut über diese unverschämte Behauptung nicht zu zeigen. »Die Leute reden viel, wenn der Tag lang ist.«
»Dann geht es Eurer Lady gut?«, hakte er nach. »Es muss doch einen Grund haben, warum sie nicht als Hofdame der Königin bei Hofe weilt, so wie ihre Schwägerinnen, Lord Roberts Schwestern.«
»My lady bevorzugt das Landleben«, sagte ich steinern, »und da ist sie nicht die Einzige. Warum fragt Ihr nicht Cecils Sekretär nach seiner Herrin? Cecils Gemahlin weilt ebenfalls nicht bei Hofe, und ihm hat die Königin weit wichtigere Ämter übertragen als meinem Vetter.«
Darauf hätte er nun sagen können, dass sich niemand den biederen William Cecil, seines Zeichens Staatssekretär und erster Minister, als Ehebrecher vorstellen konnte, der nur auf den Tod seiner Gemahlin lauerte; von Robin Dudley hingegen, den man inzwischen bei Hofe den »Zigeuner« nannte, wollte man dies nur zu gerne glauben. Immerhin: Der Spanier war nicht entschlossen, auch noch diese Grenze der Höflichkeit zu überschreiten.
Andere hatten keine solchen Skrupel.
Der Frühling wurde Sommer, der Sommer Herbst, der Herbst Winter, ein neuer Frühling kehrte ein, und noch immer hatte die Königin keinem Freier ihr Wort gegeben.
Die Klatschgeschichten über sie und Robin wurden immer hässlicher. Inzwischen behauptete man schon, dass die Königin Robin heimlich einen Bastard geboren hätte. Wie sie, die stolz auf ihre schmale Taille war und ständig unter aller Augen, eine Schwangerschaft hätte verheimlichen sollen, das erklärten die Lästermäuler natürlich nicht. Selbst Margery, die sonst die Vernunft in Person ist, bestürmte mich bei einem Besuch in Worcestershire, ihr zu verraten, ob nicht doch etwas an dem Gerede wäre. »Nicht an dem über ein Kind«, setzte sie hinzu. »Wie töricht das ist, weiß ich selbst. Aber kann es nicht sein, dass dein Vetter Robin tatsächlich eines Tages den Thron besteigen wird? Denk dir nur, Tom, dann wären wir verwandt mit dem nächsten König von England!«
Ich dachte daran. Aber nicht gerne.
Das wird mir niemand glauben, aber die Aussicht war einfach zu viel des Guten für mein Gemüt. Die Dudleys wieder als einflussreiche Partei bei Hofe, das war alles, was ich mir erträumt hatte. In die königliche Familie einzuheiraten hatte Robins Bruder Guildford den Kopf gekostet. Wenn ich an die Bewerber um die Hand der Königin dachte, dann auch daran, dass sie zwischenzeitlich eines einte, sosehr sie sich auch voneinander unterschieden: Sie alle hassten Robin. Die Vorstellung, ausgerechnet ein Dudley, Sohn des hingerichteten John, Enkel des hingerichteten Edmund, könne König von England werden, erschien ihnen noch übler als die von einem Ausländer, einem zweiten Philipp als neuem Herrscher. Deswegen begannen einige von ihnen, hinter verschlossenen Türen über Alternativen zu diskutieren.
Ihre Majestät war das letzte überlebende Kind König Henrys, doch das hieß nicht, dass es keine weiteren möglichen Thronanwärter gab, angefangen bei den Enkeln seiner jüngeren Schwester, den beiden überlebenden Schwestern Grey, bis hin zur Enkelin seiner älteren Schwester, Mary Stuart, der katholischen Königin von Schottland und gleichzeitig auch Königin von Frankreich. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte Alpträume, dass wir alle wieder im Tower landeten, während sich die mächtigen Lords hinter die nächste Erbin in der Thronfolge stellten.
Nun hätte ich Margery natürlich enttäuschen und ihr sagen können, dass sich Amy Dudley bester Gesundheit erfreute, auch wenn man sie nun schon ein Jahr lang zur Kranken erklärt hatte. Dass Robin bei allem Ehrgeiz nicht auf den Thron zielte. Aber so einfach lagen die Dinge leider nicht.
So einfach lagen die Dinge nie.
Und dann kam er, jener 9. September im Jahre 1560.
»Meine Gemahlin ist tot«, sagte Robin Dudley, und es lag Ungläubigkeit in seiner Stimme, als habe nicht ganz England, ganz Europa seit mehr als einem Jahr prophezeit, dass sie sterben würde. Und ich? Ich dachte nicht sofort: Der Herr möge ihrer Seele gnädig sein! Oder: Die arme Amy! Mein erster Gedanke war noch nicht einmal die Frage, die ich sehr bald ein- und ausatmen sollte wie die Luft zum Atmen: die Frage nach der Natur von Amy Robsarts Tod. Nein, ich dachte: Warum jetzt? Warum ausgerechnet jetzt?
Das werde ich mir nie vergeben.
Ehe mir Robin von Amys Tod erzählte, hatte ich vorgehabt, mit ihm etwas zu besprechen, mit dem ich wochenlang gerungen hatte. Mein Vater war im vergangenen Jahr hochbetagt gestorben, und niemand war da, um das Land zu verwalten. Dann gab es noch den Parlamentssitz, in den mich die Einwohner von Kidderminster gerade erst gewählt hatten, auch wenn das Parlament selten zusammentrat. Gleichzeitig wurde mir die Arbeit als Robins rechte Hand allmählich zu viel, oder besser gesagt, sie nahm mehr und mehr Züge an, die mir nicht gefielen.
Der letzte Anstoß, dieses Gespräch mit Robin zu suchen, war der Geburtstag der Königin, den sie vor zwei Tagen gefeiert hatte. In den Wochen vorher hatte ich erlebt, wie diverse Höflinge alles, aber auch alles taten, um auf die Einladungsliste zu kommen. Dazu gehörte, mir ihre Dienstmägde zu schicken, um Geld und sich selbst anzubieten, damit ich bei Robin ein gutes Wort für sie einlegte. Da standen mir also eingeschüchterte junge Dinger gegenüber, die noch nicht einmal wie eine Hure bezahlt wurden für ihre Liebesdienste, denen einfach befohlen worden war, für einen Fremden die Beine zu spreizen, nur, damit ihr nobler Herr oder ihre edle Dame später behaupten konnte, sie seien von der Königin persönlich zu ihrem Geburtstag eingeladen worden. Ich bin alles andere als ein Kostverächter, aber ich würde nie eine Frau wollen, die nicht selbst für sich entschieden hat, wofür sie es tut, und der Befehl ihrer Herrschaft, den Rock hochzuschlagen und mit dem nackten Hintern zu wackeln, gehörte für mich nicht dazu. Das Fass zum Überlaufen brachte die für ihre Arroganz bekannte Lady Barrin, die – nach zwei zurückgewiesenen Dienstmädchen – mit ihrem Mann persönlich für eine Einladung bei mir vorsprach.
»Es tut mir leid, aber in dieser Angelegenheit kann ich Euch nicht behilflich sein«, versuchte ich die Unterredung abzukürzen, kaum dass sie begonnen hatte. Daran war eigentlich nichts missverständlich.
Lady Barrin jedoch wollte mich nicht verstehen. Wortlos, aber ohne jeden Versuch, es vor mir zu verheimlichen, fragte sie ihren Mann mit den Augen, wie weit sie gehen solle. Er gab ihr seine Antwort, indem er sich ebenso wortlos aus dem Zimmer verabschiedete. Wenige Augenblicke später schaute ich fassungslos auf die vom Mieder hochgeschobenen Brüste der vor mir knienden Frau, sah den Kopf, der sich meinem Hosenlatz näherte, und fühlte mich nicht angeregt, sondern angeekelt von all diesen Menschen bei Hof. Ich könnte jetzt daheim bei Margery und den Kindern sein, dachte ich plötzlich, und der Gedanke ließ mich in den nächsten Wochen nicht mehr los.
Robin und die Dudleys konnten eigentlich nicht mehr höher steigen. Für ein ausreichendes Einkommen aus den von mir verwalteten Gütern hatte ich gesorgt; mein Versprechen, ihm in der Not beizustehen, war erfüllt, und es würde nicht so schwer sein, einen Nachfolger für mich zu finden. Wollte ich denn wirklich enden wie mein Vater, dessen höchster Anspruch auf Ruhm gewesen war, mit den Dudleys verwandt zu sein, auch wenn er das in Zeiten der Verdammung schnell wieder vergaß? Ich hatte einmal aus eigenen Kräften etwas darstellen wollen; was hinderte mich daran, es nun endlich zu tun, nach Kidderminster zurückzukehren und nur noch nach London zu kommen, wenn das Parlament tagte? Ich war nicht mehr der Jüngste, und wenn ich es jetzt nicht tat, dann würde es zu spät sein.
Nachdem sich derlei Überlegungen in mir festgesetzt hatten, wurde ich sie nicht mehr los. Ich ließ den Geburtstag der Königin verstreichen, an dem Robin ohnehin keine Minute für eine ruhige Unterredung hatte, aber am Sonntag danach schien mir der geeignete Zeitpunkt gekommen, um mit ihm über meine Pläne zu sprechen. Bis er den Mund öffnete und jenen einfachen Satz sagte, der meine Welt ein weiteres Mal aus den Fugen hob.
Ganz gleich, auf welche Art Amy gestorben war, ich sah in jenem ersten Moment nur zwei mögliche Konsequenzen aus ihrem Tod für Robin Dudley, und damit auch für mich und die Meinen: die höchste aller Ehren, eine Krone, oder ein erneuter Sturz in die Tiefe, diesmal für immer. In einem wie dem anderen Fall sah ich für mich nur Unglück. Robin war bereits jetzt der meistgehasste Mann unter den Adligen bei Hofe, auch wenn man ihn bisher nur für einen möglichen Bräutigam hielt, für ein Hindernis, das einer anderen Ehe im Wege stand. Wenn die Königin ihn tatsächlich heiratete, würde das die Ehe zwischen ihrer Schwester Mary und Philipp von Spanien, die zwei Rebellionen im Land provoziert hatte, im Vergleich beliebt aussehen lassen. Es mochte sehr wohl sein, dass sich der Adel hinter eine ihrer Basen stellte, die Schwestern Grey oder die Königin der Schotten, und dass wir uns alle im Tower und bald tot wiederfanden.
Wenn die Königin Robin aber nicht heiratete, sondern fallenließ, eben weil jeder, aber auch jeder glauben würde, dass Amy keines natürlichen Todes gestorben war, dann war alles dahin, was wir seit jenem Tag im französischen Schlamm gewonnen hatten. Meine Kinder würden in Armut aufwachsen, und ich würde gewiss nicht im Bett sterben.
Natürlich sagte ich nichts dergleichen laut. Es war auch nicht nötig, denn Robin sprach gleich weiter.
»Die Nachricht, die ich aus Cumnor erhalten habe – es steht nur darin, dass sie die Treppe hinuntergestürzt ist. Sonst nichts.« Er sah mich ernst an. »Vetter Blount, ich weiß genau, was die Welt jetzt sagen wird, und du weißt es auch. Ich bitte dich, brich umgehend nach Cumnor auf und finde heraus, was geschehen ist. Ich brauche etwas, was ich dem Gerede entgegensetzen kann. Es wird bestimmt eine offizielle Untersuchung geben, aber du wirst vorher dort sein. Ich brauche die Wahrheit. Du musst, hörst du, du musst herausfinden, was dort wirklich geschehen ist, und …« Er sprach immer schneller und schneller, doch dann unterbrach er sich und ergriff meine Hand; seine eigene war kalt. »Die Wahrheit, Vetter. Ohne Ansehen der Person, ganz gleich, was du entdeckst. Ich muss es wissen.«
Erst da dachte ich an Amy, an die schöne junge Braut, auf deren Hochzeit ich getanzt hatte, und daran, wie ich sie zum letzten Mal sah. Auch andere Bilder stiegen in mir auf, und ich unterdrückte sie mit aller Gewalt. Es gab Erinnerungen an Amy, die ich nie hätte haben dürfen.
»Mein Beileid, my lord«, sagte ich, um von diesen Erinnerungen wegzukommen, und ich glaube, Robin verstand den Tadel in meiner Stimme sehr wohl: Er hatte kein Wort der Trauer von sich gegeben. Er ließ meine Hand los, und trat zurück.
»Wenn ich selbst nach Cumnor gehe«, sagte er, »wird es heißen, ich wolle mit eigener Hand Beweise beiseiteschaffen.«
Da hatte Robin nicht unrecht, doch wir wussten beide, dass auch ich als sein Mann dem gleichen Verdacht ausgesetzt sein würde.