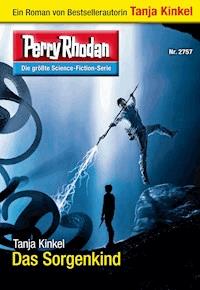2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die bedeutendste Königin des Mittelalters: Der historische Roman »Die Löwin von Aquitanien«, Tanja Kinkels Bestseller über Elionore von Aquitanien, als eBook bei dotbooks. Sie war dazu bestimmt, sittsam und still zu bleiben – doch wie keine andere Frau diktierte nur sie allein die Regeln ihres Lebens … Kaum wird die junge Eleonore von Aquitanien im Jahre 1137 mit dem französischen König vermählt, versetzt sie Freunde und Feinde gleichermaßen in Erstaunen und Entsetzen: vermessen ehrgeizig und überaus romantisch wird sie genannt, eine kaltblütige Intrigantin auf den Spielfeldern der Macht und anbetungswürdige Muse der Troubadoure. Ganz egal, ob sie sich einem Kreuzzug ins Heilige Land anschließt oder zu allem entschlossen gegen ihren zweiten Gemahl kämpft, den König von England: Immer gibt Eleonore den Männern ihrer Zeit neue Rätsel auf. Und wenn diese sich gegen sie verbünden? Dann spüren sie schnell, welche Kraft selbst in einer gefangenen Löwin lodert! Der Lebensroman einer großen Frau – farbenprächtig, mitreißend und leidenschaftlich erzählt: »Der Gesang einer modernen Troubadoura über eine der schönsten, klügsten und machthungrigsten Frauen ihrer Zeit.« ZEITmagazin Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Löwin von Aquitanien« von Bestsellerautorin Tanja Kinkel - die große Neuinterpretation des stürmischen Lebens der berühmten Eleonore von Aquitanien, die sagenumwobene Mutter von Richard Löwenherz. Fans von Madeline Miller und Jennifer Saint werden begeistert sein. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie war dazu bestimmt, sittsam und still zu bleiben – doch wie keine andere Frau diktierte nur sie allein die Regeln ihres Lebens … Kaum wird die junge Eleonore von Aquitanien im Jahre 1137 mit dem französischen König vermählt, versetzt sie Freunde und Feinde gleichermaßen in Erstaunen und Entsetzen: vermessen ehrgeizig und überaus romantisch wird sie genannt, eine kaltblütige Intrigantin auf den Spielfeldern der Macht und anbetungswürdige Muse der Troubadoure. Ganz egal, ob sie sich einem Kreuzzug ins Heilige Land anschließt oder zu allem entschlossen gegen ihren zweiten Gemahl kämpft, den König von England: Immer gibt Eleonore den Männern ihrer Zeit neue Rätsel auf. Und wenn diese sich gegen sie verbünden? Dann spüren sie schnell, welche Kraft selbst in einer gefangenen Löwin lodert!
Der Lebensroman einer großen Frau – farbenprächtig, mitreißend und leidenschaftlich erzählt: »Der Gesang einer modernen Troubadoura über eine der schönsten, klügsten und machthungrigsten Frauen ihrer Zeit.« ZEITmagazin
Über die Autorin:
Tanja Kinkel, geboren 1969 in Bamberg, studierte und promovierte in Germanistik, Theater- und Kommunikationswissenschaft. Sie erhielt acht Kultur- und Literaturpreise, Stipendien in Rom, Los Angeles und an der Drehbuchwerkstatt der HFF München, wurde Gastdozentin an Hochschulen und Universitäten im In- und Ausland sowie Präsidentin der Internationalen Feuchtwanger Gesellschaft. 1992 gründete sie die Kinderhilfsorganisation Brot und Bücher e. V, um sich so aktiv für eine humanere Welt einzusetzen (mehr Informationen finden Sie auf der Website brotundbuecher.de). Tanja Kinkels Romane, die allein in Deutschland eine Gesamtauflage von über sieben Millionen erzielten, wurden in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt und spannen den Bogen von der Gründung Roms bis zum Amerika des 21. Jahrhunderts.
Bei dotbooks veröffentlichte Tanja Kinkel ihre großen Romane »Die Puppenspieler«, »Wahnsinn, der das Herz zerfrisst«, »Mondlaub«, »Die Söhne der Wölfin«, »Die Schatten von La Rochelle« und »Unter dem Zwillingsstern«, die Novelle »Ein freier Mann« sowie ihre Erzählungen »Der Meister aus Caravaggio«, »Reise für Zwei« und »Feueratem«, die auch in gesammelter Form vorliegen in »Gestern, heute, morgen«.
Die Autorin im Internet: tanja-kinkel.de
***
eBook-Neuausgabe August 2021
Copyright © der Originalausgabe 1989 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen, unter Verwendung eines Bildmotiv von shutterstock/Evgeniia Litovchenko und des Gemäldes »View of Tautallon« von Alexander Nasmyth
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-684-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Löwin von Aquitanien« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Tanja Kinkel
Die Löwin von Aquitanien
Roman
dotbooks.
Gewidmet dem Andenken an eine wundervolle, tapfere und sehr geliebte Frau – Elisabeth Friederici
IAQUITANIEN
Ich weiß nicht, wach ich oder währt
Mein Schlaf noch, wirds mir nicht erklärt.
Nahezu hat sich mein Herz verzehrt
In tiefer Qual –
Doch ist es keine Maus mir wert,
Bei Sankt Martial!
Guillaume IX von Aquitanien
Kapitel 1
An dem Abend, als die zukünftige Erbin von Aquitanien gezeugt wurde, gab es weder Gewitter, seltsame Vogelflüge noch sonstige ausdeutbare Vorzeichen. Man könnte allerdings einen äußerst heftigen Zornesausbruch ihres Großvaters dafür in Anspruch nehmen. Doch die Höflinge um Guillaume IX waren seine Wutanfälle ebenso gewohnt wie sein schallendes Lachen, seinen funkelnden Witz oder seine Lieder. So sahen sie auch jetzt nicht beunruhigt, sondern milde belustigt zu, wie der Herzog von Aquitanien, Herr über die Gascogne, das Poitou, die Auvergne, Angouleme und Dutzende weitere Domänen, auf seinen ältesten Sohn und Erben einschrie, der den gleichen Namen trug.
»Hölle und Teufel, Guillaume, ich werde mir das nicht länger anhören! Was ich tue und mit wem ich ins Bett gehe, entscheide alleine ich!«
Guillaume der Jüngere sah unglücklich drein. Er besaß die riesige Gestalt seines Vaters, doch längst nicht dessen hitziges Gemüt, und obgleich ihm niemand mangelnde Tapferkeit nachsagen hätte können, haßte er im Grunde seines Wesens Streitereien. Gleichzeitig war er bei aller Friedfertigkeit aber auch halsstarrig, und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, hielt er mit der Zähigkeit eines unbeweglichen Menschen daran fest.
»Euer Gnaden«, entgegnete er nun, »es geht mir nur darum, daß Ihr sie behandelt, als wäre sie die Herzogin selbst und dadurch meine Stiefmutter. Unser ganzes Haus wird beschämt.«
»Was die Ehre unseres Hauses betrifft«, gab der Herzog gereizt zurück, »bestimme ich. Und bei Gott, mein Sohn, die Dame ist deine Schwiegermutter, also erweise ihr gefälligst den gebührenden Respekt und sprich mir nicht von Familienehre! Schließlich bist du mit ihrer Tochter verheiratet. Auch wenn man«, schloß er mit einem sarkastischen Unterton, »bis jetzt nicht viel davon merkt.«
Guillaume errötete bis an die Wurzeln seines ebenfalls roten Haares. Er zwang sich, ruhig zu bleiben, und erwiderte: »Genau darum geht es, Euer Gnaden. Diese Frau, die in den Augen der heiligen Kirche so gut wie Eure Schwester ist, zu Eurer Geliebten zu machen, ist Gott und den Menschen ein Greuel und …«
»Halt den Mund!« donnerte der Herzog. Er stand auf. Wenn er wollte, konnte Guillaume IX wahrhaft furchteinflößend wirken. Die Höflinge wichen ein wenig zurück. Doch wer einen weiteren Tobsuchtsanfall erwartete, täuschte sich.
»Guillaume«, sagte der Herzog beißend und kalt, »mir scheint fast, du bist eifersüchtig, was mich auch nicht weiter wundern würde. Schließlich muß man sich bei dem blassen Milchgesicht, mit dem du vermählt bist, jedesmal wie ein Märtyrer fühlen – falls du überhaupt in der Lage bist, dich bei ihr wie ein Mann zu verhalten!«
Totenstille herrschte. Guillaume hörte seinen eigenen schweren Atem. Auf den Gesichtern der Edelleute fand er etwas Mitleid, weit mehr Belustigung, doch in jedem Falle Vorsicht. Nur eine einzige kleine Gestalt trat vor, und Guillaume erkannte mit Entsetzen, daß sein siebenjähriger Halbbruder Raymond die ganze Szene miterlebt hatte. Raymond öffnete erschrocken den Mund, doch Guillaume schüttelte hastig den Kopf. Das werde ich ihm niemals verzeihen, dachte er, und starrte seinen Vater an. Vor dem Kind und dem ganzen Hofstaat. Zur Hölle mit ihm!
»Euer Gnaden«, sagte er knapp mit kalkweißem Gesicht, drehte sich um und verließ hochaufgerichtet die große Halle.
Aenor, Guillaumes zarte, sanftmütige Gemahlin, war selbstverständlich um ihrer Mitgift willen und aus politischen Gründen zu seiner Frau gewählt worden. Doch sie hielt sich für glücklicher als die meisten Frauen, denn sie hatte schnell gelernt, ihren Gemahl zu lieben, und so erkannte sie sofort seine Verstimmung, als er bei ihr hereinstürmte. Sie klatschte in die Hände und entließ ihre Damen. Während sie Guillaume schweigend einen Becher mit Wein eingoß und darauf wartete, daß auch die letzte Hofdame außer Hörweite war, wünschte sie, sie wären niemals nach Poitiers gekommen, um an diesem Weihnachtsfest des Jahres 1121 teilzuhaben.
»Er hat nicht auf dich gehört.« Es war eine Feststellung, keine Frage.
Guillaume schüttelte den Kopf. »Er wollte noch nicht einmal alleine mit mir sprechen«, antwortete er bitter, »er sagte, es gäbe in der Angelegenheit nichts, das nicht auch vom Stadtausrufer verkündet werden könnte.« Abrupt setzte er den Becher ab. »Vor ihnen allen … o mein Gott!« Er konnte ihr nicht wiederholen, was sein Vater ihm an den Kopf geworfen hatte.
»Glaub mir, ich weiß, wie es gewesen sein muß. Als ich zu meiner Mutter ging, lachte sie mir ins Gesicht.« Ihre Hand schloß sich um die seine. »Weißt du, daß die Leute in Poitiers begonnen haben, sie Dangerosa zu nennen oder la Maubergeonne?« Der letzte Name spielte darauf an, daß der Herzog seine Geliebte in dem prächtigen Burgturm Maubergeon untergebracht hatte, der von alters her der Wohnort der Herzogin von Aquitanien war. Guillaume hielt es für ein Glück, daß sich seine Stiefmutter Felipa in das Kloster Fontevrault zurückgezogen hatte, sonst hätte zweifelsohne auch sie diesen Streit miterlebt!
»Was hieltest du davon, wenn wir nun einen Mann der Kirche um Hilfe bitten würden, Bernhard von Clairvaux zum Beispiel? Er hat sich auch in der Vergangenheit nicht gescheut, gegen deinen Vater zu sprechen.«
Guillaume schüttelte den Kopf. »Das würde überhaupt nichts nützen. Denke nur an das letzte Mal. Er würde sich selbst vom Papst nichts sagen lassen.«
Der Herzog stand mit dem Klerus die meiste Zeit auf Kriegsfuß und war schon unzählige Male gebannt worden. Sein letzter Zusammenstoß mit dem für einen Abt noch verhältnismäßig jungen Bernhard von Clairvaux war ebenso berühmt wie berüchtigt; damals, vor etwa fünf Jahren, hatte Bernhard selbst, hier in Poitiers, in der Kathedrale Saint-Pierre die Exkommunikationsformel gegen Guillaume IX verlesen. Er hatte allerdings nicht damit gerechnet, daß der Herzog in die Kathedrale eindringen und ihm das Schwert an die Kehle setzen würde, um freundlich zu sagen: »So, jetzt sprich weiter, wenn du kannst.«
Hier waren zwei starke Willen aufeinandergestoßen. Bernhard von Clairvaux hatte, langsam und deutlich, Schweißperlen auf der Stirn, doch ansonsten ungebrochen, die Exkommunikation zu Ende gebracht. Danach hatte er seinen Nacken gebeugt und geflüstert: »Jetzt schlagt zu, wenn Ihr könnt!« Sekundenlang war das Schwert in der Luft gehangen, bis der Herzog es mit einem Auflachen wieder in die Scheide gleiten ließ und spöttisch meinte: »Nein, erwarte nicht von mir, daß ich dich ins Paradies schicke. Gehab dich wohl, kleiner Mönch.«
An dieses Ereignis erinnerte sich Guillaume jetzt, doch hatte er noch andere Gründe, sich nicht an die Kirche wenden zu wollen. Er wußte sehr genau, daß die Zusammenstöße seines Vaters mit dem Klerus allein dem Kampf um Macht dienten, und daß er selbst, wenn er einst Herzog wäre, für jede Hilfe und jeden Gefallen würde bezahlen müssen. Dies erwähnte er jedoch Aenor gegenüber nicht. »Er ist gottlos und böse, und ich hasse ihn! Das ist das Ende, ein für allemal. Von nun an werde ich ihm nur noch den Respekt erweisen, den ich ihm, meinem Lehnsherrn, schulde, aber nicht mehr!«
Aenor beugte sich über ihn und küßte ihn leicht auf die Lippen. Ihre niedergeschlagenen Lider verbargen ihre Gedanken. Seit ihrer Heirat hatte sie schon viele Streitereien zwischen dem Herzog und ihrem Gemahl erlebt. Doch Guillaume IX konnte, wenn er wollte, freundlich und gütig sein, Menschen bezaubern, als sei er ein Jahrmarktsgaukler, und er schien genau zu wissen, welche Saiten er im Herzen seines Sohnes anrühren mußte, um ihn immer aufs neue in hilfloser Liebe und Bewunderung an sich zu binden. Sie wußte, daß Guillaume sich in den zwanzig Jahren seines Lebens nichts mehr als die Anerkennung seines Vaters gewünscht hatte, und ahnte, daß dieses Bedürfnis nie endgültig erlöschen würde. Sie spürte, wie er sie in ungewohnter Heftigkeit an sich preßte, und war zugleich erfreut und beunruhigt. Bisher war er wohl zärtlich, aber kaum leidenschaftlich ihr gegenüber gewesen. Diesmal küßte er sie mit der Verzweiflung eines Erstickenden, hob sie auf und trug sie zu ihrem Lager.
Dieser Nacht der Liebe, des Zorns und Hasses, des Verlangens und der Erbitterung verdankte Alienor ihr Leben.
Alienor – Eleonore, Helienordis, Eleanor, in ihrer Heimat doch für immer und für alle Zeiten Alienor – wurde im Herbst geboren, in Schloß Belin, das nahe der Stadt Bordeaux lag. Dorthin hatten sich Guillaume und Aenor zurückgezogen, um so weit wie möglich vom Hof in Poitiers entfernt zu sein.
Trotz der Enttäuschung über die Geburt einer Tochter –obwohl sie anders als in Nordfrankreich nicht von der Thronfolge ausgeschlossen war – wurde die Geburt eines Kindes aus dem Haus Aquitanien mit einem prunkvollen Fest gefeiert, und die Vorbereitungen für die Taufe dauerten mehr als einen Monat. Das war ungewöhnlich, denn neugeborene Kinder starben zu jener Zeit noch leicht und schnell. Doch dies würde nicht irgendeine Taufe sein; ein großer Teil des aquitanischen Adels strömte nach Bordeaux, die Stadt selbst war durch Girlanden, bunte Tücher und Blumen zu einem Farbenmeer geworden, und obwohl bereits alle Herbergen, Klöster und Burgen der Umgebung mit Gästen belegt waren, trafen mit jedem Tag noch weitere Neuankömmlinge ein. Doch womit Guillaume gewiß nicht gerechnet hatte, war, daß ihm ein Herold am Tag vor der Taufe die Ankunft seines Vaters, des Herzogs von Aquitanien, ankündigte. Es blieben ihm genau vierundzwanzig Stunden, um sich auf diese Nachricht einzustellen, bevor er dem Herzog auf dem Schloßhof von Belin gegenübertreten mußte. Wie es sich für einen Vasallen gebührte, faßte er das Pferd seines Vaters beim Zügel. Der Herzog schwang sich mit einer Mühelosigkeit, um die ihn jeder jüngere Mann hätte beneiden können, aus dem Sattel, und Guillaume kniete vor ihm nieder.
»Euer Gnaden.«
Er fühlte sich jäh aufgehoben und umarmt; sofort versteifte er sich. Falls sein Vater es merkte, ließ er es nicht erkennen. »Zum Teufel, Guillaume, das Leben ist doch wunderbar! Wenngleich ich sagen muß, daß du dich mit so einer Botschaft etwas mehr hättest beeilen können – Lusignan wußte es eher als ich!«
»Ich nahm an, Ihr wäret enttäuscht, weil es kein Sohn ist«, entgegnete Guillaume kühl.
Sein Vater grinste. »Ich über ein Mädchen enttäuscht? Ich halte jedes einzelne von ihnen für einen Segen für die Menschheit, mein Junge! Außerdem hoffe ich doch, daß du noch mehr Kinder haben wirst. Da fällt mir ein«, er schaute suchend über sein Gefolge hinweg, »ich habe deinen Bruder mitgebracht. Er wollte die Taufe um keinen Preis versäumen. Raymond!«
Ein blonder Schopf hob sich. Da überall Gäste, Knechte und sonstige Bedienstete umherliefen, hatte Raymond es nicht leicht, sich seinen Weg durch die Menge zu bahnen. Endlich stand er vor ihnen. Guillaume bückte sich, nahm seinen kleinen Bruder auf und schwang ihn freudig herum. Raymond war ein liebenswerter Junge, lebhaft, ohne heftig zu sein, schlank und mager wie seine Mutter. Guillaume, dessen Mutter bei seiner Geburt gestorben war, konnte sich an keine andere Mutter als Felipa erinnern und dachte so gut wie nie daran, daß Raymond nur sein Halbbruder war. Wären sie gleichaltrig gewesen, hätten sie wie viele Fürstensöhne möglicherweise Rivalen sein können, doch so hing Raymond mit unerschütterlicher Heldenverehrung an Guillaume, und Guillaume brachte ihm seine uneingeschränkte Bruderliebe entgegen.
»Ich wollte Raymond einige Zeit bei dir lassen«, bemerkte der Herzog. »Hier ist es ruhiger, und in Poitiers fühlt er sich doch recht einsam.«
»Das habe ich nie gesagt!« protestierte Raymond, und sein Vater kniff ihn in die Wange.
»Nein, aber hast du vergessen, daß ich Gedanken lesen kann? Zum Beispiel weiß ich jetzt ganz genau, wo es dich hinzieht – zu den Ställen, um beim Absatteln der Pferde zu helfen!«
»So ist es«, bekannte Raymond, um gleich darauf eifrig zu fragen: »Darf ich?«
Der Herzog nickte, und Raymond rannte davon. Lachend wandte sich Guillaume IX an seinen Sohn, stieß ihn in die Rippen und meinte: »Wie du in seinem Alter; Pferde, Pferde, nichts als Pferde.«
Guillaume wollte gerade zustimmen, hielt aber ungläubig inne. War es möglich, daß er sich schon wieder bereit fand, mit seinem Vater zu scherzen, als sei nichts geschehen? Wie kennzeichnend das doch für seinen Vater war, dachte er mit aufwallendem Zorn, zu glauben, er brauche nur zu lächeln und sich liebevoll zu geben, und schon war alles wieder in Ordnung.
»Ich erinnere mich nicht, Euer Gnaden«, erwiderte er hart und abweisend.
Der Herzog blickte ihn nachdenklich an. »Nun«, sagte er langsam, »wie du willst. Aber ich möchte meine Enkeltochter sehen. Sollten wir nicht auch Aenor unsere Aufwartung machen?«
Guillaume saß vor dem Feuer in der kleinen Halle und starrte in die erlöschenden Flammen. Als er Schritte hinter sich hörte, nahm er an, es sei der Mundschenk, und befahl, ohne sich umzudrehen: »Bring mir noch etwas Wein!«
»Lieber nicht«, entgegnete eine wohlvertraute Stimme, »zuviel davon am Abend verträgst du nicht gut, weißt du das nicht, Guillaume?«
Er sprang auf.
»Setz dich«, sagte der Herzog und ließ sich mit einem Seufzer auf dem ausgebreiteten Bärenfell nieder. Guillaume sah ihn an. Warum konnte sein Vater ihn nicht in Ruhe lassen, warum mußte er hierherkommen und versuchen, den ach so vertrauten alten Tanz wiederzubeleben, statt ihre Beziehung auf dem sicheren, unpersönlichen Boden von Vasall und Lehnsherr zu lassen? Beide schwiegen sie eine Weile.
»Deine kleine Tochter scheint rotes Haar zu haben«, sagte der Herzog plötzlich, »wie du und ich. Und sie wird überleben. Glaub mir, ich weiß es.«
Guillaume erkannte Schmerz und Erinnerung in den ausgeprägten Zügen seines Vaters und dachte an die zahlreichen Kinder, die Felipa geboren und die so bald nach der Geburt wieder gestorben waren. Nur Raymond hatte überlebt, und Felipa hatte sich nach jeder Geburt mehr in ihren Glauben, in Bußübungen und Fasten zurückgezogen. Er fragte sich mit einem Mal, wie das Leben an der Seite der frommen, asketischen Felipa für seinen lebenslustigen Vater wohl gewesen sein mochte, und haßte sich schon im nächsten Atemzug selbst für den Gedanken. Es war Felipa, der Unrecht geschehen und die gedemütigt worden war, nicht der Herzog!
Hartnäckig schwieg er. Der Herzog zog eine Grimasse. »Manchmal bin ich mir nicht sicher, wer von uns beiden den größeren Dickkopf hat, Guillaume. Hölle, weißt du nicht, daß ich dich und deine ewigen Moralpredigten vermißt habe?«
Guillaume wandte sich ab. Seine Hände verkrampften.
»Hör zu«, sagte sein Vater ernst. »Ich bin Herr über das mächtigste und wohlhabendste Reich in Europa, und der arme Louis, der in seiner Ile-de-France sitzt und sich König schimpft, zittert vor Angst, ich könnte ihm sein lächerliches Königreich abjagen wollen. Gewisse Dinge kann ich mir einfach nicht bieten lassen, auch von dir nicht, und schon gar nicht in der Öffentlichkeit.«
»Die Öffentlichkeit war Eure Entscheidung«, murmelte Guillaume tonlos.
»Ja, ich weiß. Es war ein Fehler. Was willst du, Junge, selbst unser Herr Jesus traf Fehlentscheidungen – hätte er sonst Judas zu einem seiner Apostel gemacht?«
Guillaume war vollkommen bewegungslos. Er wagte kaum zu atmen, denn er fürchtete, daß er bei der kleinsten Bewegung die Beherrschung über sich verlöre. Mit einem Mal packte ihn sein Vater bei den Schultern.
»Verdammt, Guillaume, was willst du hören? Daß es mir leid tut, dich vor ihnen allen gedemütigt und Aenor beleidigt zu haben? Das tut es. Daß es nicht wieder geschehen wird? Das glaube ich schon.« Seine Mundwinkel hoben sich. »Du hast nun einmal ein unheiliges Talent dafür, mich in Wut zu bringen, mein Sohn.«
Guillaume schluckte. Er zitterte. Dann tat er etwas, das er sich später nie verzieh. Jäh und heftig erwiderte er die Umarmung seines Vaters. Mehrere Sekunden lang hielten sie einander fest, dann machte sich Guillaume mit einem Ruck los, stieß seinen Vater zurück und stürzte hinaus.
Bordeaux war gewiß nicht nur eine der bedeutendsten, sondern auch eine der schönsten Städte Aquitaniens. Am Ufer der Garonne hob sich die Silhouette der Stadt mit ihren neun Kirchen und der Kathedrale dunkel gegen den goldglühenden südlichen Himmel ab. Die Römer hatten gut befestigte Straßen und eine starke Stadtmauer hinterlassen, und sogar die Säulen eines alten Palasts ragten noch sichtbar empor. Seit ewigen Zeiten war Bordeaux dank seiner günstigen Lage ein Handelsstützpunkt, und Guillaumes Entscheidung, diese Stadt als Sitz für sich und seinen kleinen Hofstaat zu wählen, wurde von seinem Vater gutgeheißen.
Zweimal im Jahr, zu Ostern und zu Weihnachten, reiste Guillaume nach Poitiers. Er und sein Vater verhielten sich bei ihren seltenen Begegnungen kühl und höflich, und Guillaume war entschlossen, diesen Zustand beizubehalten. Er hatte seine Kindheit in dem ständigen Auf und Ab der Zornesausbrüche und Gunstbezeugungen seines Vaters verbracht und wünschte sich nunmehr nur Ruhe und Frieden.
In Bordeaux bewohnte er in der Regel das Palais l‘Ombriere, das innerhalb der Stadtmauern zwischen zwei schmalen Flußarmen lag, gelegentlich auch das etwas weiter entfernte Schloß Belin. Der Stadtrat von Bordeaux fühlte sich durch die ständige Anwesenheit des zukünftigen Herzogs sehr geehrt, und der niedere Adel nützte die Gelegenheit, sich über das Palais l‘Ombriere den Weg nach Poitiers zu bahnen. Guillaume schloß auch Freundschaft mit dem Erzbischof der Stadt, Geoffrey du Loroux, der einer der wenigen Kleriker war, die dem Haus Aquitanien nicht feindlich gegenüberstanden. Seine Stiefmutter Felipa starb in ihrem Kloster, und Aenor gebar ihm eine zweite Tochter, die Petronille genannt wurde. Guillaume stellte fest, daß er eigentlich glücklich war.
Seine ältere Tochter Alienor zählte vier Jahre, als der Herzog Bordeaux wieder besuchte. Diesmal handelte es sich um einen offiziellen Staatsbesuch, sein Vater empfing Gesandtschaften, Abgeordnete und Bittsteller, vergab einige Privilegien, wohnte huldvoll allen Festlichkeiten bei, die die Stadt ihm zu Ehren veranstaltete, und so dauerte es mehrere Tage, bis sie dazu kamen, ein persönliches Gespräch zu führen.
Der Herzog forderte Guillaume zu einem kurzen Spazierritt auf und entschied, auch Raymond und die kleine Alienor in Begleitung ihrer Amme mitzunehmen. Da es keine Möglichkeit gab, höflich abzulehnen, willigte Guillaume ein. Sie machten bald auf einer kleinen Lichtung halt, die in einem felsigen Tal lag. Ein Wasserfall sprang von den Steinen und sammelte sich zu einem kleinen See.
Die Sonne brach sich in dem bewegten Wasser, fing sich in Alienors Haar und übergoß sie mit wärmendem Licht. Das Kind breitete die Arme aus, wie um das Leuchten einzufangen, und lachte voll Freude und Entzücken.
»Alienor«, sagte der Herzog, der sie beobachtete, »Goldadler. Du hast ihren Namen gut gewählt, Guillaume.«
»An diese Bedeutung hatte ich gar nicht gedacht«, gab Guillaume ein wenig abweisend zurück. »Ich habe sie nach ihrer Mutter genannt: ›die andere Aenor‹.«
»Sei dem, wie es will«, bemerkte sein Vater friedlich, »wir haben schon ein Angebot für sie. Mein lieber Freund Louis, der König von Frankreich, schreibt mir, er hielte seinen Sohn Philippe für den geeignetsten Freier.« Er brach in Gelächter aus. »Kein Zweifel, daß Louis sie für eine goldene Gelegenheit hält, seinen Einfluß und sein Königreich endlich auch auf ein königliches Maß zu bringen.«
»Eine solche Verbindung hätte aber ihre Vorteile«, erwiderte Guillaume nachdenklich. »Wir wären ein geeintes Land, und …«
»Unsinn!« sagte sein Vater nachdrücklich. »Denk nur daran, was Louis zu bieten hat. Einen Königstitel und seine lächerlichen Ländereien, sehr viel mehr ist es nicht. Was seine Heeresstärke angeht, so war er schon über die Eroberung einer Festung, die nahe bei Paris liegt, so überglücklich, daß er dreißig Dankesmessen lesen und verkünden ließ, es sei ihm zumute, als sei er aus dem Gefängnis ausgebrochen. Seit über hundert Jahren hat sich kein Herzog von Aquitanien mehr die Mühe gemacht, vor dem französischen König seinen Lehnseid abzulegen. Unser Reich ist weit mehr als doppelt so groß und unabhängig, und durch diese Ehe wäre Aquitanien wieder ein echtes Lehen der Krone. Möchtest du das? Und, Guillaume«, er zwinkerte seinem Sohn zu, »was, wenn du nun einen Sohn bekommst? Der müßte sich dann mit dem nächsten König von Frankreich herumschlagen. Außerdem«, nun grinste er, »wenn der junge Philippe seinem Vater ähnelt, glaube ich kaum, daß deine Alienor zu ihm passen würde!«
Der Herzog wies auf Alienor und Raymond, die sich inzwischen voll Begeisterung am Wasser vergnügten. Alienors Amme, die es zu spät bemerkt hatte, hastete entsetzt zu ihrem Schützling und zog Alienor vom Wasser weg. Das kleine Mädchen, so jäh aus seinem Spiel gerissen, wehrte sich, biß, kratzte und brüllte wie am Spieß.
Der Herzog lachte. »Mir scheint, sie schlägt nach mir, Guillaume.«
Guillaume schien von dieser Feststellung nicht begeistert: »Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist, sie ist sonst brav und ruhig. Ihr solltet sie sehen, wenn Raymond ihr eine Geschichte erzählt.«
Der Herzog blickte auf seinen zwölfjährigen Sohn und entgegnete abgelenkt: »Ich wundere mich immer wieder über Raymond. Weiß Gott, in seinem Alter hätte ich ein Kleinkind, das sich mit so einer Beharrlichkeit an mich heftet, mit einem Fußtritt weggejagt. Man entdeckt erst später, daß Kinder unterhaltsam sein können. Ich habe es auch erst bei dir und Raymond festgestellt.«
»Ja, ich …« begann Guillaume und brach abrupt ab.
Sein Vater erwies sich einmal als feinfühlig und sprach weiter, als habe er nichts bemerkt: »Du hast doch nichts dagegen, wenn Raymond jetzt ständig bei dir bleibt? Es wäre nun ohnehin an der Zeit, ihn in einem Haushalt unterzubringen, wo er Lebensart und die ritterlichen Künste lernt, und bei wem sollte er das besser lernen als bei seinem eigenen Bruder?«
»Ich habe Raymond sehr gerne bei mir«, sagte Guillaume und war dankbar, daß die Begegnung mit seinem Vater diesmal ohne einen lauten Streit abgegangen war.
Das Palais l‘Ombriere, in dem Alienor aufwuchs, war nicht so groß wie der herzogliche Palast in Poitiers, doch es war weitläufig genug für sie, um immer wieder ihrer Amme entwischen zu können.
Sie liebte Raymond. Er rannte mit ihr durch die Gänge des Schlosses, spielte mit ihr Verstecken, erzählte ihr Geschichten von Rittern, Drachen und Feen und nahm sie manchmal auch in die riesige Küche mit, um ein wenig Essen zu stehlen. Als sie fünf Jahre alt wurde, brachte er ihr heimlich das Reiten bei. Natürlich fiel sie zunächst herunter und begann zu schreien – es waren weniger Schmerzens- als Zornestränen –, doch sie verlangte sofort, wieder auf das Pferd gesetzt zu werden, und Raymond war beeindruckt. »Du kannst ein echter Reiter werden, Alienor«, sagte er an diesem Tag, als sie sich beide wieder zurück in die Frauengemächer stahlen, die Alienor eigentlich noch gar nicht verlassen durfte, »aber hör um Himmels willen auf, jedesmal zu schreien, wenn du deinen Willen nicht bekommst!«
Der innige Wunsch, nicht die Achtung – und die Aufmerksamkeit – ihres Helden zu verlieren, bewirkte, daß Alienor tatsächlich versuchte, sich in Raymonds Gegenwart zusammenzunehmen, und daß ein einziges »Miau, Mädchen« genügte, um sie wieder in die Schranken zu weisen.
Etwas anderes war es jedoch, wenn ihre Mutter oder ihre Amme versuchten, ihr das Spinnen und Sticken beizubringen. »Jede Edelfrau muß spinnen können«, sagte Aenor und starrte verzweifelt auf ihre Tochter herab, die die Spindel auf den Boden geworfen hatte und trotzig mit dem Fuß aufstampfte. »Ich will nicht!« Selbstverständlich wußte sie, daß es von einem kleinen Mädchen zuviel verlangt war, stundenlang Flachs in der Hand zu halten, aber ein kleiner Anfang zumindest, das Bestreben, es zu versuchen …
Nicht, daß Alienor nie geduldig sein konnte. Zur Verwunderung ihrer Familie, ihrer Erzieherin und aller, die sie kannten, war sie in der Lage, stundenlang ruhig der Musik der Spielleute und den Gesängen der Troubadoure zuzuhören. Guillaume hatte zwar nicht die schöpferische Erfindungskraft seines Vaters, des Herzogs, doch auch er liebte die Dichtung, und zwei der Troubadoure an seinem Hof, Cercamon und Bledhri der Waliser, waren im ganzen Land berühmt. Raymond neckte Alienor damit, daß sie Bledhris Lieder doch gar nicht verstehen könne, und zu seiner Verblüffung wiederholte das aufgebrachte Kind Bledhris letztes Lied fast fehlerlos.
Anläßlich des Osterfestes des nächsten Jahres durfte Alienor ihre Eltern zum ersten Mal an den Hof ihres Großvaters begleiten. Die Reise wurde für sie eine Offenbarung. In allen Städten und Dörfern, durch die sie, auf das Pferd ihres Vaters gesetzt, zog (leider hatte sie Raymond versprechen müssen, nichts von seinem Reitunterricht zu erzählen), jubelten die Menschen ihr zu, und sie winkte hingerissen zurück. Man hatte ihr schon vorher mehrmals gesagt, daß sie die Erbin von Aquitanien war, doch noch nie zuvor hatte sie erkannt, was das wirklich bedeutete. Und das Land, das sie durchquerten, erschien ihr wie das Paradies.
Sie war immer enttäuscht, wenn ihr Vater sie wieder in die Sänfte plazierte, in der ihre Mutter reiste. Aenor war durch die lange Reise und das monotone Rütteln schläfrig geworden und schrank erst auf, als sie die begeisterte Stimme ihrer Tochter rufen hörte: »O Maman, es ist so wunderschön!« Da erst bemerkte sie, daß Alienor die Sänftenvorhänge aufgezogen hatte und mehr als ein Soldat aus ihrer Eskorte einen grinsenden Blick hineinwarf. Aenor richtete sich hastig auf, schloß die Vorhänge wieder und tadelte vorwurfsvoll: »Du bist ein böses Mädchen, Alienor, das darfst du nicht!«
»Aber warum nicht, Maman?«
Aenor seufzte, und ihre Gedanken schweiften ab, nach Poitiers, an den Hof, der sie dort erwartete. »Alienor«, sagte sie schließlich, »wenn wir in Poitiers sind, wirst du dort auch deiner Großmutter begegnen.« Alienor, die unzufrieden hin- und hergerutscht war, wurde aufmerksam. Sie hatte durch das Geschwätz von Aenors Damen schon viel von ihrer Großmutter gehört, der berüchtigten Dangerosa, die die schönste Frau der Welt sein sollte und ihren Großvater, den Herzog, behext hatte.
»Gott möge mir verzeihen«, sagte Aenor mit der leichten Trauer, die Alienor unbewußt immer mit der sanften, wehmütigen Frau verband, die sie zur Welt gebracht hatte, »daß ich so etwas sage, denn sie ist meine Mutter. Aber ich möchte nicht, daß du mit ihr sprichst oder in ihre Nähe gehst, mein Kind, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.«
Aenor hatte ihre Gründe, und die Liaison ihrer Mutter mit Guillaumes Vater war nur einer davon. Ihr ganzes Leben lang hatte Aenor beobachtet, wie ihre Mutter Menschen durch ihren Zauber an sich band und dann jäh wieder fallenließ. Darin unterschied sie sich vom Herzog, dachte Aenor; denn er ist wenigstens zu beständiger Zuneigung fähig. Außerdem verabscheute sie die Art, in der ihre Mutter Pläne machte und, ständig nach mehr Macht suchend, intrigierte. Sie hatte Aenors Heirat mit Guillaume betrieben, und als sie entdeckte, daß es ihr nicht genügend Macht einbrachte, die Schwiegermutter des zukünftigen Herzogs zu sein, hatte sie sich entschieden, auch noch die Geliebte des gegenwärtigen zu werden. Aenor fürchtete nichts mehr, als daß ihre Mutter auch Alienor in ihre Pläne einbeziehen und ausnützen könnte.
Andererseits bestand eigentlich noch keine große Gefahr deswegen. In den letzten fünf Jahren hatte sich die Geliebte des Herzogs nicht einmal nach ihren Enkelkindern erkundigt; sie waren ihr offensichtlich gleichgültig. Aenor hoffte es, und gleichzeitig, obwohl sie geglaubt hatte, sich längst mit dem Wesen ihrer Mutter abgefunden zu haben, schmerzte es sie.
Alienor hatte noch nie etwas so Wunderbares erlebt wie ihre Ankunft in Poitiers. Ihr Großvater erschien ihr in seinen prunkvollen Staatsgewändern wirklich wie ein märchenhafter König, und er erlaubte ihr nicht nur, am abendlichen Festmahl teilzunehmen, nein, er forderte sie auch auf, an seiner Seite zu sitzen.
»Ma belle Dangerosa wird es verstehen.«
Seit der Herzog den Spitznamen seines Volkes für seine Geliebte erfahren hatte, der ihn ungeheuer belustigte, verwendete er ihn selbst.
Die riesige Menge an Gästen, die fremdartigen Speisen, die ständig hereingetragen wurden, die vielen Gaukler, all das verdrehte Alienor leicht den Kopf, und sie wußte bald nicht mehr, wohin sie zuerst sehen sollte. Dann nahmen die Musikanten in der Galerie ihre Plätze ein, Flöten, Lauten und Tambourine erklangen, bis ihr Großvater aufstand und Schweigen gebot.
»Jetzt soll die Zeit der Lieder sein«, sagte er, »aber zuerst müssen wir noch die Herrin des Festes bestimmen, die zwischen den Sängern richten wird.« Vorschläge wurden laut; die ernsthafter gemeinten nannten im Hinblick auf den Herzog Dangerosa, während die scherzhafteren meinten, man solle doch eine der Küchenmägde wählen, die ihrer aller Gaumen heute so wunderbar erfreut hatten. Endlich trat auf ein unmerkliches Zeichen des Herzogs ein Ritter aus seinem Gefolge vor, kniete vor Alienor nieder und fragte: »Dame Alienor, wollt Ihr unsere Herrin des Festes sein?«
Alienor war so glücklich, daß sie am liebsten die ganze Welt umarmt hätte. Würdevoll, wie sie es bei anderen beobachtet hatte, gab sie zurück: »Es wäre mir eine Ehre.« Alle klatschten Beifall, die Spielleute stimmten erneut ihre Instrumente an, und staunend sah sie, daß ihr Großvater der erste war, der zu singen begann. Seine mächtige, sonst so rauhe Stimme klang auf einmal geübt und geschmeidig und füllte doch den ganzen Raum. Er trug ein Lied vor, das er im Heiligen Land gedichtet hatte, doch handelte es nicht von seinen Kämpfen, sondern von den Sarazeninnen. Alienor bemerkte, daß der Freund ihres Vaters, der Bischof von Bordeaux, die Stirn runzelte.
Auch Cercamon und Bledhri der Waliser nahmen an dem Wettbewerb teil sowie mehrere Edelleute aus dem Gefolge des Herzogs, und am Ende war Alienor schrecklich verlegen. Sie wünschte, ihr Großvater hätte nicht ebenfalls gesungen, denn sie wollte ihn nicht enttäuschen. Doch sie wollte auch eine gerechte Richterin sein, und schließlich kletterte sie von ihrem hohen Stuhl an der Seite des Herzogs herunter und ging auf den jungen Adligen zu, dessen Vortrag ihr am besten gefallen hatte. Dieser kniete rasch nieder, damit sie nicht mehr so sehr zu ihm aufschauen mußte. Sie konnte es nicht unterdrücken, rasch einen vorsichtigen Blick auf ihren Großvater zu werfen, sagte aber laut und deutlich zu dem Sänger: »Euch gebührt der Preis.«
Der Sänger nahm ihre Hand und küßte sie unter dem Beifall der Menge. Alienor sah wieder zu ihrem Großvater, dessen Gesicht ausdruckslos war.
»Weißt du nicht«, fragte er süffisant, »daß man seinen Gastgeber nicht beleidigt, Alienor? Warum hast du nicht mich gewählt?«
»Ihr wart nicht der Beste«, flüsterte sie, den Blick auf den Boden gesenkt.
Er stand auf. »Komm her und sag das noch einmal«, forderte er sie mit gedehnter Stimme auf.
Jetzt war Alienor eher wütend als ängstlich. Sie ging zu ihrem Großvater, stampfte mit dem Fuß auf und rief: »Ihr wart nicht der Beste!«
Stille herrschte. Dann brach der Herzog in Gelächter aus, hob sie auf und wirbelte sie herum. »Bei unserm Herrn Jesus«, keuchte er, als er wieder zu Atem kam, »das ist meine Enkelin! Du fürchtest dich vor nichts und niemandem, nicht wahr, mein Herz?« Er setzte sie auf dem Tisch ab und griff nach seinem Becher. »Trinken wir auf Alienor von Aquitanien!«
Aenor sah zu, wie die Amme ihre ältere Tochter vorsichtig zudeckte. Es war ein Wunder, daß Alienor nicht schon auf dem Gang eingeschlafen war, so übermüdet, wie sie sein mußte. Sie lächelte, als sie bemerkte, daß Alienors Daumen den Weg zu ihrem Mund gefunden hatte, eine Angewohnheit, die das Kind eigentlich schon längst aufgegeben hatte, und machte die Amme leise darauf aufmerksam. Dann ging sie, denn sie war zu ihrer Mutter gerufen worden. Als eine beflissene Kammerfrau Aenors Kommen ankündigte, saß Dangerosa, bereits in ihr Nachtgewand gekleidet, auf einem mit Luchsfellen bezogenen Schemel. Eine weitere Dienerin kämmte ihr langes, silbriggoldenes Haar, das hier im Süden eine wahrhaft seltene Kostbarkeit war, wie sie auch sonst in bewundernswerter Weise dem Schönheitsideal der Zeit glich: Sie hatte strahlend blaue Augen, eine reine, weiße Haut und die Gestalt eines jungen Mädchens. Niemand, der sie nicht kannte, hätte es für möglich gehalten, daß sie eine Tochter in Aenors Alter hatte, und Aenor vermutete, daß ihre Mutter auch nicht gerne daran erinnert wurde.
Dangerosa begann ohne Einleitung zu sprechen. »Mein Herr war heute sehr gnädig zu deiner Tochter«, sagte sie gleichmütig, »aber täusche dich nicht, er hofft noch immer auf einen männlichen Erben. Wie ich sehe«, ihr Blick glitt abschätzend von Aenors Gesicht zu ihrer Taille, »erwartest du wieder ein Kind?« Aenors Wangen brannten. Sie fühlte sich erniedrigt und nickte stumm, unfähig, eine andere Antwort zu geben. Ihr war es nie gelungen, in Gegenwart ihrer Mutter anders als scheu und nachgiebig zu sein.
»Nun«, fuhr Dangerosa fort, »vielleicht haben wir Glück, und es wird ein Junge. Damit wären alle Schwierigkeiten beseitigt. Falls nicht, dann würde ich vorschlagen, daß du deinem Gemahl zuredest, damit er sich wieder öfter bei Hofe blicken läßt und sich etwas mehr um die Gunst seines Vaters bemüht. Es gibt hier in Poitiers Mächte, die eine weibliche Herrschaft in Aquitanien ablehnen und ihn bestürmen, Guillaume zu übergehen und Raymond zum Erben zu machen.«
Aenor fand ihre Stimme wieder. »Raymond würde Guillaume nie verraten – oder Alienor!« stieß sie hervor.
Dangerosa betrachtete ihre Hände. »Seltsam«, bemerkte sie überdrüssig, »daß ich es fertiggebracht habe, eine so naive Tochter aufzuziehen. Der Junge mag jetzt noch keinen Gedanken daran verschwenden, deinen Gemahl um das Herzogtum zu beneiden, aber er wird erwachsen werden, und erwachsene Menschen sind machthungrig, Aenor.«
»Ganz gewiß trifft das auf Euch zu, Mutter«, erwiderte Aenor bitter, selbst überrascht von der Heftigkeit ihrer Reaktion. Derartiges hatte sie noch nie zuvor gewagt.
Dangerosa warf ihrer Tochter einen erstaunten Blick zu. »Sicher, ich gebe ohne weiteres zu, daß ein Hof unter Herzog Raymond keine Zukunft für mich böte. Er würde in mir immer nur die Rivalin seiner Mutter sehen. Aber was ich dir rate, kann dir nur nutzen, Aenor, und wenn dir etwas an deinem Gemahl und deinen Kindern liegt, hörst du auf mich.«
Aenor holte tief Luft. »Ich weiß nicht warum«, sagte sie leise. »Ich hatte so sehr gehofft, daß Ihr einmal mit mir über etwas anderes sprechen würdet als über Macht und Pläne. Aber das wäre wohl zuviel verlangt. Gute Nacht, Mutter.«
Alienor war auf der Suche nach Raymond, der an diesem Morgen bei seinem Vater sein mußte, als ihr Freund plötzlich aus einem Gang auftauchte und sie hastig beiseite zog.
»Alienor, was machst du hier? Komm, wir müssen hier schleunigst verschwinden!« Er legte ihr eine Hand auf den Mund. »Pssst. Vater und Guillaume streiten, hörst du es nicht? Und wenn sie herauskommen und uns hier finden, ist die Hölle los!«
Jetzt hörte Alienor die zornige Stimme ihres Großvaters ebenfalls, die immer durchdringender wurde, bis sie von den Wänden widerhallte: »… von allen selbstgefälligen Eseln, die ich je gekannt habe, bist du …« Einige Höflinge, die vorbeischlenderten, waren schon stehengeblieben.
Raymond entschied sich, Alienor auf den Rücken zu nehmen, und rannte dann los, bis er eine Fensternische fand, die abgelegen genug war, damit sie nichts mehr hörten und man sie nicht sehen konnte. Er setzte das Mädchen ab und starrte über sie hinweg aus dem Fenster.
»Es ist scheußlich«, sagte er leise und mehr zu sich selbst als zu seiner Nichte. »Seit Jahren ist das nicht mehr passiert, seit … und diesmal ist Guillaume im Unrecht, weil er die Lusignans verteidigt, und die sind Verräter, und …« Plötzlich bemerkte der Junge wieder, mit wem er sprach.
Alienor hörte zu, ohne wirklich zu begreifen. Bis jetzt war alles so wundervoll gewesen, und sie wollte nicht glauben, daß sich das geändert haben sollte. »Vielleicht tut er nur so, als ob er sich ärgert?« meinte sie hoffnungsvoll, eingedenk der Tatsache, wie ihr Großvater sich an ihrem Ankunftstag verhalten hatte. Raymond schüttelte den Kopf.
»Nein, er meint es ernst.« Jedenfalls, dachte er mit einem Zynismus, für den er eigentlich noch viel zu jung war, hatten sie diesmal daran gedacht, ihn vorher hinauszuschicken. »Ach, verdammt!« sagte er plötzlich laut und schlug mit der Faust gegen die Mauer.
Alienor hatte gute Lust, das gleiche zu tun, oder zumindest so zu schreien wie ihr Großvater. Denn eines verstand sie, und das überdeutlich: Die Freude und der Glanz des Osterfestes waren zu einem schwarzen Nichts zerfallen.
Kapitel 2
Toulouse, die letzte große unabhängige Stadt im Herrschaftsgebiet des Herzogs von Aquitanien, war seinerzeit durch seine Heirat mit Felipa an ihn gefallen, und der dortige Adel, der sich nie damit abgefunden hatte, erhob sich nun gegen ihn. Diese bestürzende Nachricht hatte zum Streit zwischen Guillaume und seinem Sohn geführt.
Der Herzog verdächtigte die Lusignans, eine ehrgeizige Familie, die einerseits gute Verbindungen nach Toulouse hatte und andererseits entfernt mit ihm verwandt war, so daß sie sich Hoffnungen auf das Herzogtum machen konnten, sich an der Verschwörung beteiligt zu haben. Dem widersprach Guillaume, der mit mehreren Mitgliedern der Familie befreundet war, energisch, und so stritten sie lange und erbittert. Guillaume warf seinem Vater vor, er sei gegen die Lusignans voreingenommen, da sie seit Jahren mit Dangerosa in Fehde lagen – ihre Besitzungen grenzten aneinander –, und von diesem Zeitpunkt an nahm der Streit einen katastrophalen Verlauf. Am Ende reiste Guillaume, aufs neue erbittert, zurück nach Bordeaux.
Der Herzog unternahm einen blitzartigen Feldzug gegen Toulouse, der ebenso erfolgreich wie grausam war und die vorher eher neutrale Bürgerschaft in ihrem Haß gegen ihn mit dem Adel vereinte. Er kehrte gealtert und verbittert zurück. Wie sich gezeigt hatte, waren die Lusignans tatsächlich in den Aufstand verwickelt gewesen, was in ihm jedoch nicht mehr denselben Zorn auslöste, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen war. Er stellte nur resigniert fest, daß Guillaume wieder einmal Freundschaft mit Treue verwechselt hatte. Wenig später erreichte ihn die lang erwartete Botschaft: Aenor hatte einen Sohn geboren, der Aigret genannt werden sollte.
Die Taufe eines männlichen Erben mußte selbstverständlich mit allem Prunk und Zeremoniell in Poitiers begangen werden, und der Herzog sorgte dafür, daß es ein denkwürdiges Ereignis wurde. Von den Höfen aller Nachbarländer trafen Glückwünsche ein, sogar der König von Frankreich schickte ein Schreiben. »Kein Wunder«, sagte der Herzog bester Laune zu seiner Geliebten, »sein Philippe ist jetzt weiter von Aquitanien entfernt denn je. Ist es nicht großartig, daß unser gemeinsamer Enkel über Aquitanien herrschen wird, obwohl wir nie verheiratet waren und keine Kinder haben?«
»Das ist allein deine Schuld«, murmelte Dangerosa mit halbgeschlossenen Lidern. Er lachte. »Mein Herz, ich weiß, es ist der Traum deines Lebens, Herzogin von Aquitanien zu werden, aber daraus wird nichts. Deine Domänen habe ich schon durch Guillaumes Ehe, und ich heirate immer nur Frauen, die mir mehr Nutzen als Ärger bringen – und vor allem Land. Die anderen behalte ich für die Liebe.« Sie warf einen Kamm nach ihm.
Guillaume war noch immer voller unversöhnlicher Ablehnung gegenüber seinem Vater. Aber in der überschäumenden Triumphstimmung, in der sich der Herzog befand, störte ihn das nicht weiter. Er würde Guillaume schon zur Einsicht bringen. Die Zukunft von Aquitanien war gesichert!
Erst als sich die Aufregung um die Taufe etwas gelegt hatte, fand er die Zeit, auf seine anderen beiden Enkelkinder zu achten. Petronille schien ein träges kleines Nichts zu sein. Alienor war seit dem letzten Jahr um einiges gewachsen, und er bemerkte überrascht, daß ihre kindlichen Züge sich zu einer wirklichen Schönheit auszuwachsen versprachen. Sie besaß hohe Wangenknochen, eine gerade, feingezeichnete Nase, eine edle Stirn und ein eigensinniges Kinn. Ihre Augen leuchteten in einem warmen Haselnußbraun, und als sie ihn unerwarteterweise bat, sie auf die Jagd mitzunehmen, stimmte er bereitwillig zu.
Er war entzückt darüber, daß sie eines der Ponys, die er aus Wales kommen ließ, allein reiten konnte, wenngleich er einen Mann aus seinem Gefolge anwies, ständig ein Auge auf sie zu haben. Zu Beginn war sie schweigsam, dann lenkte sie ihr Pony zu ihm und fragte mit großem Ernst: »Großvater, Euer Gnaden, können wir miteinander sprechen wie Erwachsene?«
Innerlich belustigt erwiderte er in demselben Tonfall: »Gewiß.« Alienor strich über die Mähne ihres Ponys. Schließlich platzte sie heraus: »Warum werde ich jetzt nicht mehr Herzogin von Aquitanien, wo Aigret geboren ist?«
Er war überrascht und bestürzt zugleich. Offensichtlich hatte sich niemand die Mühe gemacht, es dem Mädchen zu erklären, und niemand war auf die Idee gekommen, es könnte ihr etwas ausmachen – eine Annahme, die er geteilt hatte. »Kleines«, sagte er behutsam, »du hast jetzt einen Bruder.« Sie schüttelte den Kopf, und ihre roten Locken flogen. »Aber als Petronille geboren wurde, hat es doch auch nichts geändert!«
Jetzt hatte sie etwas geschafft, was seit Ewigkeiten niemandem mehr gelungen war: Guillaume IX in Verlegenheit zu bringen. Er war noch nie vor der Notwendigkeit gestanden, eine Tatsache erläutern zu müssen, die für ihn völlig selbstverständlich war. »Petronille ist ein Mädchen«, sagte er endlich langsam, »und Aigret ein Junge. Jungen haben immer und in allen Dingen den Vorrang vor Mädchen.«
»Aber das ist ungerecht«, sagte Alienor hitzig, »ungerecht! Aigret ist doch nur ein dummes Balg, das ständig plärrt, Maman ist seit seiner Geburt so krank und …« Ihre Unterlippe zitterte. Ihr Großvater sah sie an, als sei sie eine Fremde. Sechs Jahre, dachte er. Unglaublich. Andererseits, wer spürte Eifersucht schon so heftig und erbittert wie ein Kind?
»Alienor«, sagte er und faßte mit seiner Hand unter ihr Kinn. »Aigret bekommt Aquitanien, aber ich kann dir versprechen, daß ich für dich den edelsten und mächtigsten Gemahl suche, den es auf der Erde gibt.« Das Mädchen ballte seine Hände zu kleinen Fäusten. »Ich will keinen Gemahl«, antwortete sie störrisch, »ich will überhaupt nicht heiraten, ich will Aquitanien, und ich will niemals hier Weggehen!«
Ihr Großvater zog die Brauen hoch. »Wenn du dich nicht beizeiten daran gewöhnst, nicht alles zu bekommen, was du willst«, sagte er verschmitzt, »wird dich in deinem Leben noch sehr viel Ärger erwarten. Außerdem würde ich an deiner Stelle einen Gemahl nicht so schnell ablehnen. Männer haben ihre Annehmlichkeiten.«
Sie reckte das Kinn. »Welche?«
Der Herzog mußte ein Grinsen unterdrücken. »Wenn ich dir das sage, werden mir deine Eltern das niemals verzeihen.« Er fuhr mit einer Hand durch ihr Haar. »Immerhin, ich dachte, du wolltest eine Jagd sehen – sollten wir jetzt nicht die Falken steigen lassen?«
An diesem Abend beobachtete er vergnügt, wie sich das wilde Wesen vom Vormittag in einen anmutigen kleinen Engel verwandelte, während sie mit ihrem jungen Halbonkel tanzte. »Aber nur einen Tanz«, mahnte Aenor, »Raymond möchte schließlich auch mit Mädchen in seinem Alter tanzen.«
»Die werden warten«, entgegnete Raymond sorglos und mit einem Augenzwinkern. Der Herzog sah ihnen zu, wie sie die schwierigen Figuren abschritten, und staunte über die Sicherheit, mit der Alienor sich bewegte. Wer würde glauben, dachte er und lachte wieder in sich hinein, daß ihm diese kleine Hexe heute morgen ganz ohne Umschweife und vehement das abgefordert hatte, was er seit seinem sechzehnten Lebensjahr unangefochten beherrschte – Aquitanien?
Er selbst fühlte sich heute zu erschöpft, um zu tanzen, auch wenn ihm Dangerosa einen erbosten Blick zuwarf. Vielleicht sollte er wirklich den nächsten Feldzug Guillaume überlassen. Er lauschte dem Klang der Flöten. Musik, Musik – er hatte sie immer für die wahre Erlösung der Menschheit gehalten. Als der Tanz zu Ende war, erhob er sich. Er bedeutete den Spielleuten, aufzuhören. Die Gespräche um ihn verstummten allmählich. Als Schweigen eingekehrt war, rief er: »Laßt uns trinken!«
Er sah von Guillaume, seinem tugendhaften, halsstarrigen Sohn, den er liebte, zu Aenor, der sanften, blassen Aenor, die er zwar für eine der besten Frauen hielt, die er kannte, aber dennoch niemals gegen seine intrigante, prächtige Dangerosa eingetauscht hätte. Ah, Dangerosa, dachte er und lächelte ihr zu. Was für ein treffender Name das doch war!
Er schaute auf Raymond, seinen jüngeren Sohn, den er kaum kannte und der ein freundlicher Fremder für ihn geworden war. Raymond, vielleicht war es falsch, dich zu Guillaume zu schicken, wie Dangerosa mir geraten hat, aber ich glaubte, daß du dort glücklich sein würdest, und wußte, daß du es in Poitiers nicht warst, nicht mit Dangerosa vor Augen und dem Bewußtsein, daß deine Mutter dich in ihrem Kloster auch nicht haben wollte. Sein Blick wanderte zu Alienor, diesem amüsanten kleinen Mädchen, er blinzelte ihr zu und hob den Pokal, den man ihm gereicht hatte. »Auf das Leben, auf die Liebe und auf die Schönheit!« rief er, trank das Gefäß in einem Zug aus und schleuderte es fort. Einen Moment lang stand er still, dann wankte er und stürzte zu Boden.
Er war tot, als Guillaume neben ihm kniete und seine Schultern umfaßte.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht, daß Guillaume IX, seit mehr als dreißig Jahren Herr über das reichste Land Europas, nun endlich einem Feind erlegen war – dem Tod.
Noch während der neue Herzog, starr und bleich, in der Kathedrale Saint-Pierre in Poitiers die Lehnsschwüre seiner Vasallen entgegennahm, begannen sich die ersten Folgen zu zeigen. Der Adel aus Toulouse war erst gar nicht erschienen. Doch da Guillaume weder die Rücksichtslosigkeit noch das Geschick seines Vaters in der Kriegsführung besaß, konnte er die Rebellion diesmal nicht niederschlagen, sondern nur verhindern, daß sie auch auf andere Gebiete übersprang. Er kehrte schließlich von seinem fruchtlosen Feldzug gegen Toulouse zurück, den er mit wenig mehr Erfolg in unregelmäßigen Abständen wiederholen sollte. Die Verwaltung und der Handel Aquitaniens blühten unter seiner Regentschaft, doch die Kriegskunst war ihm nicht gegeben, und die Niederlagen hinterließen bei Guillaume ihre Spuren.
Nach vier Jahren hatte sich ein ständiger Zug der Bitterkeit in sein Gesicht gegraben, er war reizbarer geworden, und niemand hätte mehr sein wahres Alter erraten. Dann traf ihn ein neuer Schicksalsschlag: Seine Gemahlin Aenor, die sich, seit Aigret zur Welt gekommen war, nie ganz erholt hatte, starb an einer Fehlgeburt. Kurze Zeit später verließ sein Bruder Raymond Aquitanien.
Raymond war nun achtzehn Jahre alt. Er hatte noch Aenors Grablegung abgewartet und wollte sich nun von seiner Lieblingsnichte verabschieden. Alienor befand sich in dem Raum, den sie mit Petronille teilte. Ihr Haar war zu einem strengen Zopf geflochten, und ihre schwarzen Kleider überdeckten ihre Jugend. Sie blickte auf die Wandteppiche aus Flandern.
»Willst du mir nicht Lebewohl sagen, Alienor?«
Sie schluckte, dann brach es aus ihr heraus: »Oh Raymond, ich verstehe nicht, warum du jetzt gehen mußt!« Raymond sah gequält aus.
»Ich habe es dir doch schon erklärt, Kleines – es ist eine große Ehre für mich, daß der König von England mich an seinen Hof beruft, und …«
»Bedhri sagt«, unterbrach ihn das Mädchen, »die Normannen sind nur Räuber und Mörder, die sich in England und Sizilien ein paar Kronen ergattern konnten, und ich habe noch niemanden getroffen, der ihm da widersprochen hätte!«
Es entsprach der Wahrheit. Der jetzige König von England und Herzog der Normandie hatte einen langen und blutigen Krieg gegen fast alle seine Verwandten geführt, bis er an die Macht gekommen war. Jetzt war er ein alter Mann, doch um die Zukunft seines Reiches stand es nicht besser als zuvor, denn seine Tochter und sein Neffe warteten nur darauf, mit Klauen und Zähnen um den Thron zu kämpfen. Raymond wußte das, doch er war zu jung, um diese Situation nicht als Abenteuer und Herausforderung zu empfinden.
»Hier werde ich immer nur Guillaumes jüngerer Bruder sein«, sagte er offen, »und dort kann ich mir einen eigenen Namen, eigenen Ruhm und einen Platz erwerben.«
Alienor griff nach seinen Händen. »Aber warum mußt du uns ausgerechnet jetzt verlassen!«
Raymond machte sich los und wandte sich ab. Er ging ein paar Schritte, dann drehte er sich wieder um, und er erklärte schroff: »Ich kann es nicht mehr ertragen, ständig von den Verwandten meiner Mutter gegen Guillaume ausgespielt zu werden! Sie versuchen mich auf ihre Seite zu ziehen und erinnern mich ständig daran, daß meine Mutter die Gräfin von Toulouse war – es fehlt nur noch eine Aufforderung, mich der Rebellion anzuschließen! Und das Schlimmste ist, Guillaume ist seit der Sache mit den Lusignans gegen alles und jeden mißtrauisch. Wenn er mich verdächtigen würde, gegen ihn zu intrigieren – wirklich, es ist besser, ich gehe, solange noch Frieden und Liebe zwischen uns herrscht!«
Alienor lief zu ihm und umarmte ihn. Er hielt das Mädchen fest und dachte traurig, daß er sie lange Zeit nicht Wiedersehen würde, nicht miterleben würde, wie sie heranwuchs. Mit gezwungenem Lächeln meinte er schließlich: »Nun, Guillaume hat mich gebeten, noch einmal zu ihm zu kommen, aber ich sollte mich auch von Petronille verabschieden. Wo steckt sie?« Alienors Gesicht verdüsterte sich.
»Bei dem gräßlichen Aigret. Sie glaubt wahrscheinlich, ihm fehlt es bei den zahllosen Ammen und Dienern ein wenig an Gesellschaft!«
»Alienor«, sagte Raymond streng, »fängt das schon wieder an? Mit zehn bist du wirklich zu alt für eine derart kindische Eifersucht. Der arme Aigret hat dir nichts getan.«
»Ich hasse ihn!« entgegnete Alienor heftig. »Er ist daran schuld, daß meine Mutter gestorben ist. Bei seiner Geburt hat es angefangen, er hat sie umgebracht!«
Raymond legte beide Hände um ihren Kopf und zwang sie, ihm in die Augen zu sehen. »Sag so etwas nie wieder. Deine Mutter ist tot, weil sie eine Fehlgeburt hatte, und selbst wenn sie gestorben wäre, als Aigret zur Welt kam, könnte er immer noch nichts dafür!«
Alienor machte ein trotziges Gesicht, deswegen fügte er eindringlich hinzu: »Es ist schrecklich, ein Kind so zu beschuldigen, glaub mir! Auch meine Mutter hat sich von meiner Geburt nie wirklich erholt, ich habe sie kaum gekannt, weil sie so krank war. Und als sie nach Fontevrault ging, dachte ich, es sei meine Schuld. Weil ich sie krank gemacht habe, hat sich mein Vater Dangerosa zugewendet, und deswegen zog sie sich ins Kloster zurück. Davon war ich lange überzeugt, und der Beweis schien mir zu sein, daß sie mich nie besuchte oder sehen wollte. Alienor, ich möchte nicht, daß du deinem Bruder so etwas antust. Versprich es mir!«
»Also gut«, sagte sie widerwillig. »Ich verspreche es. Ich werde es nie wieder sagen, zu keinem Menschen.«
»Das ist mein Mädchen.« Raymond küßte sie leicht auf die Stirn. »Lebwohl, Alienor.«
Erst als er schon eine Viertelstunde verschwunden war, begann Alienor zu weinen. Sie fuhr sich zornig mit dem Handrücken über die Augen. Tränen waren für schwache Menschen, und sie wollte nicht weinen, nicht um ihre Mutter und nicht um Raymond, weil sonst die Verzweiflung kommen und sie überwältigen würde.
Alienor war schon immer froh gewesen, daß ihr Vater keiner von diesen törichten Nordfranzosen war, die, wie man hörte, dazu neigten, ihren Töchtern nicht nur das Schreiben, sondern auch das Erlernen von Sprachen und anderem Wissen zu verbieten. Sie fand Vergnügen darin, in fremden Zeiten und Welten zu schweifen, und nach Raymonds Abreise wurde ihr der Unterricht zur Leidenschaft. Allerdings nicht immer zur Freude ihrer Lehrer.
»Aber, Vater«, sagte sie zu dem unscheinbaren Pater Jean, der sie in Latein und Griechisch unterrichtete und mit ihr gerade die Evangelien durchging, »wie kann unser Herr Jesus die Dämonen in eine Herde von Schweinen gebannt haben, wo die Juden doch keine Schweine essen und also auch keine züchten? Wo kamen die Schweine her?« Pater Jean schlug innerlich ein Kreuz und verwünschte die Diskutierfreudigkeit seiner Schülerin, doch für diesmal wurde er einer Antwort enthoben, denn ein Diener brachte die Botschaft, Alienor möge eilends zu ihrem Vater kommen.
Guillaume lehnte an einem der Schloßfenster und starrte hinaus. Es war Winter, und Poitiers war seit Tagen von dichtem Nebel eingehüllt. Er fröstelte und dachte wehmütig an Bordeaux, wo nun wohl angenehme Wärme herrschen mochte. Er stöhnte. Vielleicht hatte er gehofft, wenn sein Vater nicht mehr da wäre, wäre auch diese Gefühlsverwirrung erloschen, mit der er nie fertig geworden war, jene gewalttätige Mischung aus Haß und Liebe, die allein sein Vater auszulösen imstande war. Doch er hätte es schon wissen müssen, als er ihn stürzen sah, seinen unzerstörbaren Vater: Er war bis an alle Ewigkeit an diesen Mann gekettet, der ihn nun noch mächtiger umklammert hielt, da er tot war.
Als Alienor eintrat, erschrak sie beim Anblick ihres Vaters. Er glich nun dem alten Herzog auf unheimliche Weise, doch fehlte ihm völlig jene Aura überschäumender Lebensfreude, die Guillaume IX noch bis zu seinem Tod begleitet hatte. Impulsiv fragte sie: »Vater, was ist Euch? Wieder Toulouse? Oh, ich wünschte, ich wäre ein Mann, dann würde ich selbst dort hinziehen und sie für Euch besiegen!«
»Ich zweifle nicht daran«, erwiderte er und lächelte leicht. »Deine Lehrer berichten mir, daß du mit ihnen sogar über Cäsars Strategie im Gallischen Krieg streitest.«
»Ach, Pater Jean ist so …«
Guillaume hob die Hand und gebot ihr Schweigen. »Der König von Frankreich hat erneut für seinen Sohn um dich angehalten«, sagte er. »Ich dachte, sein Sohn sei tot«, meinte Alienor verwundert. Ihr Vater schüttelte den Kopf. »Philippe ist tot. Aber er hat noch einen zweiten Sohn, Louis, der eigentlich zum Priester bestimmt war und jetzt der neue Thronfolger ist. Wie auch immer, König Louis hat diesmal sein Schreiben mit einem neuen Angebot bereichert. Er verspricht mir Waffenhilfe und öffentliche Ächtung von Toulouse durch die Krone, allerdings nur, wenn ich nach Paris reise und ihn offiziell durch einen Eid als meinen Lehnsherrn anerkenne.« Er zuckte die Achseln. »Dem Namen nach ist er es ohnehin, und es wäre nur eine Geste, die sein Ansehen in der Öffentlichkeit heben würde.«
Alienor nagte an ihrer Unterlippe. Sie erinnerte sich noch, oder vielleicht hatte man es ihr auch oft genug erzählt, daß ihr Großvater immer stolz darauf gewesen war, daß seit hundert Jahren kein Herzog von Aquitanien mehr den Lehnseid geleistet hatte. »Habt Ihr Euch schon entschlossen, Euer Gnaden?« fragte sie vorsichtig. »Es heißt immer, Euer Vater hätte die Nachteile einer solchen Heirat …«
»Er ist tot«, sagte Guillaume schärfer, als er es beabsichtigt hatte. Gemäßigter fuhr er dann fort:
»Selbstverständlich gibt es noch andere Heiratsanträge. Neben den bedeutungslosen wäre da vor allem der aus England zu beachten. Stephen, der Neffe des Königs, hat schon Raymonds Stellung dort vermittelt, was wohl so eine Art Vortasten war. Jeder weiß, daß er der nächste König werden will, und er braucht dringend Verbündete.«
»Aber er muß doch schon entsetzlich alt sein«, platzte seine Tochter heraus. Zum ersten Mal seit langem brach Guillaume in lautes Lachen aus. Schließlich sagte er: »Er ist nur ein paar Jahre älter als ich – wirklich uralt.«
Er räusperte sich. »Der eigentliche Grund, warum ich mit dir darüber gesprochen habe, Alienor, ist folgender: Ich nehme an, daß jetzt sowohl Louis als auch Stephen versuchen werden, Leute aus deiner Umgebung zu bestechen, damit sie dir Gutes über die jeweiligen Freier erzählen, und du bist alt genug, um das zu merken. Achte darauf und sage mir dann, wer es ist. Auf diese Art lernen wir die Spione in unserer Dienerschaft und bei Hofe kennen.«
Alienor nickte. Bestechung und Verschwörung waren für sie nichts Ungewöhnliches, sie gehörten zum Alltag des Hofes, an dem sie aufwuchs. Beispielsweise versuchte ihre Großmutter Dangerosa immer wieder durch derartige Mittel, wieder Einfluß zu gewinnen, damit sie ihrem Exil auf dem Lande entkommen konnte. Alienor wußte, daß sie damit entlassen war, und knickste. »Ich werde daran denken, Vater.«
Als sie die große Halle verlassen hatte, begann sie schneller zu laufen. Ihr war ein neues Argument eingefallen, mit dem sie Pater Jean ärgern konnte.
Mit der Zeit zeigte auch ihr Körper, daß Alienor eine Frau wurde. Sie hatte die Lieder der Troubadoure geliebt, doch nun schienen sie eine neue Bedeutung anzunehmen, und während sie bisher von dem Geschwätz ihrer Damen nur ungeduldig geworden war, lauschte sie nun halb widerwillig und halb neugierig. Was wissen sie, das ich nicht weiß?
Sie begann heimlich, ebenfalls Gedichte zu schreiben, doch sie schwor sich, sie nie jemandem zu zeigen. Überdies hatte sie kein Talent, um selbst zu singen, keine geeignete Stimme, und es gab nichts, was sie mehr bedauerte und als Mangel empfand. Doch Frauen konnten ohnehin kein Troubadour sein. Warum nicht? dachte sie unwillig. Früher, zur Zeit der heidnischen Römer und Griechen, hatte es Dichterinnen gegeben, und sie hatten sogar Schulen gegründet. Sappho war die allerberühmteste von ihnen und ihre geheime Heldin. Kurz nach ihrem zwölften Geburtstag entdeckte Alienor ein Fragment von Sappho, das sie in seinen Bann schlug:
Hinabgetaucht ist der Mond undmit ihm die Plejaden; Mitteder Nächte, vergeht die Stunde;doch ich liege allein …
Sie wiederholte es nachts, immer wieder, denn es schien ihr am besten all die unbekannten, neuen Gefühle auszudrücken, die sie aufrüttelten.
Nach dem Tod ihrer Mutter war Alienor nun die erste Dame am Hof. Immer schneller entwuchs sie der Welt der Kinder. Sie war noch nicht offiziell mit einem ihrer vielen Bewerber verlobt, doch in diesem Sommer ihres dreizehnten Lebensjahres entschied sich ihr Vater, nach Paris zu ziehen, um dort vor König Louis den Lehnseid zu leisten. Er übergab seinem Freund Geoffrey du Loroux, dem Erzbischof von Bordeaux, die Regentschaft und vertraute Alienor zu ihrem großen Stolz die Hofhaltung an.
Alienor saß gerade zusammen mit Bedhri in Aenors ehemaligem Gemach und tauschte mit ihm die geistvollen Rätsel aus, die in letzter Zeit Mode geworden waren, als ihre Schwester Petronille hereingestürzt kam.
»Und was ist tiefer als der tiefste See, Dame Alienor?«
»Das Herz einer Frau, die ein Geheimnis bewahrt. Jetzt werde ich …«
»Alienor, Alienor!« Petronille war völlig außer Atem. »Du mußt sofort kommen, es ist etwas Furchtbares geschehen! Aigret«, schluchzte ihre Schwester. »Er ist ganz plötzlich krank geworden, es ist entsetzlich, und …«
Alienor seufzte. Ungnädig gab sie zurück: »Beruhige dich, Petronille. Er wird sich den Magen verstimmt haben. Morgen schlingt er bestimmt wieder wie …«
»Nein, du begreifst nicht!« Auf Petronilles Gesicht brannten zwei rote Flecken. »Er ist wirklich krank! Bitte, Alienor, komm und sieh selbst!«
Alienor fragte sich, was sie an einer Übelkeit ihres verabscheuten kleinen Bruders ändern könnte, aber es schien keine andere Möglichkeit zu geben, Petronille zu beruhigen. »Schön«, sagte sie resignierend. »Gehen wir.«