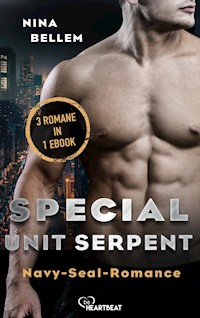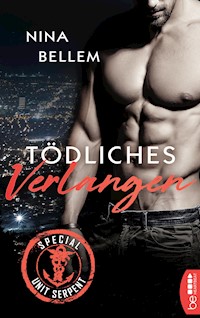Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mir wurden zwanzig Jahre meines Lebens gestohlen. Von einem Fae, einer magischen Rasse, die unerkannt unter den Menschen lebt. Und diese Jahre will ich wiederhaben.Mittlerweile bin ich sehr gut darin geworden, sie zu jagen. Dann klopft eines Tages ein sprechender Hund an meine Tür, meine Wohnung wird von fiesen Albtraumgestalten verwüstet und nebenbei steht noch das Schicksal der Welt auf dem Spiel.Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, ich bin nicht zufällig in dieser Geschichte gelandet
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Im Schatten der Raunacht
Spiel der Fae
Nina Bellem
Copyright © 2020 by
Lektorat: Stephan R. Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-300-3
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Danksagung
Kapitel 1
Man hängt nicht jeden Tag vom Berliner Fernsehturm. Zumindest ich nicht. Ich weiß, dass sich immer wieder irgendwelche Irren von einer Plattform vom Park Inn Hotel stürzen, aber die haben dafür auch einen Haufen Geld hingeblättert und sind an zwei Seilen und einem lächerlich grellgelben Geschirr gesichert. Ich hing nur an meinen Fingerspitzen von der Außenfassade der großen Kugel und sah auf die Menschen unter mir, die auf dem wirklich ekelerregend massiv aussehenden Betonboden spazieren gingen.
Ich kniff die Augen schnell wieder zusammen und versuchte den Wind, der an meinem Körper und meiner Kleidung zerrte, zu ignorieren.
»Ich würde die Augen ja öffnen«, drang eine angenehme Stimme durch die kreischenden Böen. »Man hat nicht oft die Möglichkeit, die Aussicht von der Stelle aus zu genießen, an der du dich gerade befindest.«
Ich schnaubte und presste die Lider noch ein wenig fester zusammen. »Dann komm doch heraus und leiste mir Gesellschaft, Miro.«
Der Wind ließ ein wenig nach und ich traute mich doch, die Augen zu öffnen. Direkt vor mir befand sich eine massive Fensterscheibe und dahinter saß auf einem einfachen Stuhl an einem Restauranttisch einer der schönsten Männer, die mir jemals untergekommen waren. Das schwarze Haar glänzte verführerisch. Der Hipster-Trend kam ihm zugute, denn er hatte die langen Strähnen zu einem Knoten gebunden und der einzige Zweck dieses Man Bun war es, sein ebenmäßiges Gesicht und die milchblasse Haut zu betonen. Seine blauen Augen funkelten amüsiert und er schenkte mir ein Lächeln, das einem normalerweise nur auf Plakaten begegnete, auf denen sich Unterwäschemodels rekelten.
Arroganter Bastard.
»Mir gefällt es hier drin eigentlich ganz gut.«
Ich schnaubte abermals und versuchte, nicht auf den Schmerz in meinen Fingern zu achten, die mit jeder Sekunde, in der ich mit meinem ganzen Gewicht an ihnen hing, länger und länger zu werden drohten. Der Wind wurde stärker, zerrte gieriger an meinem Körper und dröhnte in meinen Ohren.
»Du kannst das doch ganz einfach beenden«, hörte ich Miro sagen. »Gib einfach auf und ich lasse dich wieder herein.«
»Das könnte dir so passen«, zischte ich und versuchte meine Fingerkuppen allein mit der Kraft meines Willens in die Plastikverkleidung der Außenfassade zu graben. Mit eher mittelmäßigem Erfolg.
Ich konnte Miros Grinsen förmlich spüren, drehte den Kopf, sah ihn an und wollte ihm alle Schimpfwörter entgegenschleudern, die ich kannte – als mir genau diese im Hals stecken blieben. Miro grinste noch immer und sah mich an, aber das war es nicht, was mich so aus der Fassung gebracht hatte. Vielmehr waren es die Menschen um ihn herum. Durch das Fenster konnte ich in das Café beziehungsweise Restaurant im Inneren des Fernsehturms blicken und gerade beugte sich am Nebentisch hinter Miro ein Kellner zu einer Frau herunter. Er sagte etwas zu ihr und sie antwortete ihm – ich konnte deutlich die Bewegung ihrer Münder sehen –, aber anders als bei Miro konnte ich nichts davon hören. Nicht den kleinsten Laut.
Das bedeutete …
Ich sah ihm fest in die Augen und tatsächlich war sein triumphierendes Lächeln etwas verrutscht. Jetzt war es an mir zu lächeln. Ohne seinen Blick loszulassen, löste ich meine Finger der linken Hand, bis ich nur noch mit der rechten an der Fassade hing. Dann ließ ich los und stürzte knapp dreihundert Meter hinab, auf den Erdboden zu.
»Nicht nett, mir so den Spaß zu verderben.«
Dieser Schnösel besaß wirklich die Frechheit, beleidigt zu sein. Ich versuchte derweil, meinen Herzschlag von der Grenze zum Infarkt wieder wegzulocken und mir dabei nicht anmerken zu lassen, dass ich vor Angst beinahe gestorben wäre. »Es ist auch nicht nett, mich glauben zu lassen, ich würde vom Fernsehturm hängen.«
Er zwinkerte mir zu und nahm einen Schluck aus seinem Wasserglas. »Ach Vivienne, ich wusste doch, dass jemand Cleveres wie du einen einfachen Täuschungsbann durchschauen würde. Und sieh dich doch an – ich hatte recht.«
»Und wenn du nicht recht gehabt hättest? Ich hätte auch einfach einen Herzinfarkt haben können, weil ich wirklich denke, ich stürze ab.«
Miro stellte das Glas beiseite und stützte sich mit seinen angewinkelten Armen auf dem Tisch ab. Die Distanz zwischen uns wurde damit um wenige Zentimeter verringert und mich traf ein Duft nach Moos und nassen Steinen. Es irritierte mich – der Duft passte so gar nicht zu Miros Äußerem, das so sehr zu der Stadt in dieser Zeit gehörte. Ich musste wohl die Nase gerümpft haben, denn er verzog das Gesicht, kam aber noch näher. »So weit hätte ich es nicht kommen lassen. Ich bin kein Unmensch.«
»Du bist überhaupt kein Mensch. Du bist ein Fae«, erwiderte ich und wich ein wenig zurück. Der Kellner von eben kam an uns vorbei, wandte aber hastig den Blick ab, als hätte er gerade ein Liebespaar vor dem Kuss ertappt. Weiter daneben hätte er nicht liegen können.
»Warum magst du uns eigentlich nicht?«, fragte Miro nach und legte in einer übertrieben unschuldig fragenden Geste den Kopf schief.
»Darum geht es hier nicht«, erwiderte ich und tippte auf das Foto, das zwischen uns auf dem Tisch lag. »Es geht um sie.«
Er hob die wie von einem Maler gezogenen Brauen in die Höhe und musterte das Bild, als würde er es oder die Person darauf heute zum ersten Mal sehen. Beides stimmte nicht.
»Ich weiß immer noch nicht, was du von mir willst.«
Ich nahm das Bild auf und hielt es vor mir in die Höhe, damit er der jungen Frau darauf direkt in die Augen sehen musste. Sie selbst mochte zwar nicht anwesend sein, aber ich war hier, um für sie zu sprechen und um ein wenig Gerechtigkeit herauszuschlagen. Oder zumindest etwas, was dem nahe kam. »Ihr Name ist Milli. Du hast sie vor vier Jahren in einem Club hier in Berlin verführt und ihr dabei drei Jahre ihres Lebens gestohlen. Die will sie zurück.«
Er musterte das Foto noch einmal, ehe er wieder mich ansah. »Selbst wenn«, er betonte das letzte Wort, »wenn ich wirklich etwas mit dieser Milli gehabt haben sollte, was bringt dich darauf, dass ich ihr die geraubten Jahre zurückgeben kann? Und wieso sitzt sie dann nicht vor mir, sondern du?«
»Du weißt ebenso gut wie ich, dass du der heißblütige Lover gewesen bist, dem sie drei gestohlene Lebensjahre zu verdanken hat.«
»Dieses Wissen bringt dir nichts.« Er sah mir noch immer in die Augen, aber etwas darin veränderte sich. Das Blau der Iriden wurde dunkler, breitete sich aus, bis es den gesamten Augapfel übernahm. Schlieren und Wolken aus Blau und Schwarz schienen in seinem Blick um die Vorherrschaft zu ringen, bis das Schwarz gewann und wie Tinte in Wasser auseinanderdriftete. Seine Augen waren vollständig schwarz, dazwischen blitzten vereinzelte Leuchtpunkte auf, nein, keine Leuchtpunkte, sondern Sterne, ferne Galaxien, Welten, von deren Existenz die Menschheit nicht einmal etwas ahnte.
Ich sah der Unendlichkeit direkt in die Augen und konnte förmlich spüren, wie ihre Zeitlosigkeit drohte, mich hineinzusaugen, bis ich mich völlig darin verlieren und für immer darin verschwinden würde. Ein winziger Mensch, kaum mehr als ein Insekt, vor einer gottgleichen Kreatur.
Ich nahm das Wasserglas und schüttete Miro den Inhalt ins Gesicht.
Die Unendlichkeit blinzelte und in die nun wieder blauen Augen trat ungebremste Wut. »Du verdammte …«
Miro wollte aufspringen, wahrscheinlich um sich auf mich zu stürzen und mir den Hals umzudrehen, aber seine Wut verwandelte sich rasch in puren Unglauben, als er merkte, dass er sich keinen Zentimeter von seinem Stuhl erheben konnte.
Ich lehnte mich zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und sah ihm eine Weile dabei zu, wie er vergeblich versuchte, sich von seinem Stuhl zu lösen. »Ich verdammte, was?«, konnte ich es mir dann doch nicht verkneifen, zuckersüß nachzufragen.
Auf Miros perfektem Gesicht hatten sich kleine Schatten gebildet, die in dem Moment verschwanden, in dem der Kellner wieder an unserem Tisch vorbeikam. Er beäugte den Wasserfleck auf der Tischdecke und verschwand sofort. Wahrscheinlich weil er nichts mit dem scheinbaren Ehekrach zu tun haben wollte. Zwar war das Restaurant um diese Uhrzeit an einem Wochentag nicht besonders voll, aber der Kellner schien Miro daran zu erinnern, dass er sich noch immer in der Öffentlichkeit befand.
»Was hast du mit mir angestellt?«, fauchte der Fae, allerdings schon wesentlich leiser.
»Pilzsporen.«
Er runzelte die Stirn.
Diesmal war ich diejenige, die sich auf dem Tisch abstützte und die Entfernung zwischen uns verringerte. Diesmal wusste ich, was für ein Duft auf mich zukam, und auch wenn ich es nicht einmal unter Androhung von Folter zugegeben hätte, mir gefiel dieser Duft. Er erinnerte mich an Wälder, an die Zeit nach dem Regen. »Ich habe einen Kreis aus Pilzsporen unter deinen Stuhl gemalt. Sporen von Pilzen, die in einem perfekten Kreis stehen. Unter Eichen. Bei Vollmond.«
Es war eine verfluchte Drecksarbeit gewesen, nachts im Wald in Brandenburg herumzukriechen und mit einem feinen Pinsel die Sporen aus den Pilzen zu kratzen, ohne diese zu beschädigen, aber das war es wert gewesen, denn von Miros überheblicher Miene war nichts mehr zu sehen. Stattdessen schien er zwischen Unglauben und Wut zu schwanken. »Du hast einen verdammten Feenring gebaut?!«, knurrte er.
»Ich wusste, jemand Cleveres wie du würde da schnell draufkommen«, wiederholte ich seine eigenen Worte und stützte mein Kinn auf den Händen ab, wobei ich nicht anders konnte, als zu lächeln. »Und ohne dass ich ihn löse, wirst du diesen Ring nicht verlassen können. Kommen wir also noch einmal auf Milli zurück.«
»Du kannst mich nicht ewig hier sitzen lassen«, erwiderte er, ohne auf meinen Themenwechsel einzugehen. »Irgendwann schließt das Restaurant.«
Ich rieb mir über ein Ohrläppchen und ließ den Blick durch den Raum schweifen. Die Dame am Tisch war gerade dabei zu zahlen. Das Sonnenlicht, das durch die Fensterscheiben fiel, trug bereits die ersten Spuren von Rot in sich. »Nein, das kann ich nicht«, gab ich zu. »Aber ich kann einfach aufstehen und gehen. Und dann wirst du hier sitzen bleiben, unfähig, aufzustehen, unfähig, den Feenring zu zerbrechen. Und dann wird der Kellner kommen und dich bitten zu gehen. Und wenn du dich weigerst, wird er Fragen stellen. Er wird den Sicherheitsdienst rufen, vielleicht sogar die Polizei. Und ich werde in der Zwischenzeit mit der Berliner Zeitung telefonieren und die werden sicher gern einen Reporter schicken, der einen lustigen kleinen Artikel über den Mann schreiben wird, den die Polizei einfach nicht vom Fleck bewegen konnte, und mit ganz viel Glück wird er sogar ein Foto machen …«
»Schon verstanden«, knurrte Miro und kurz sah ich wieder die Sterne in seinen Augen aufblitzen. »Was will diese Milli? Die drei Jahre kann ich ihr nicht wiedergeben, das weißt du.«
Ich schlug den Blick nieder und sah auf das Foto zwischen uns, auf dem noch ein paar Wassertropfen glitzerten. »Sie möchte Schauspielerin werden. Irgendwann nach Hollywood gehen.«
»Und?«
»Und du sollst ihr dabei helfen.« Ich nahm eine Serviette und wischte das Wasser vom Foto. Langsam schob ich es ihm hin. »Gib ihr etwas von eurem Glanz. Etwas Glamour. Etwas von diesem ganz Besonderen, was man nicht lernen kann, das, womit man geboren sein muss.«
Miro hob eine Augenbraue. »Mehr nicht?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Das war ihre Forderung. Nimm es oder lass es.«
Es gefiel ihm nicht, das konnte ich deutlich sehen, auch wenn er so tat, als wäre dieser Preis eine unbedeutende Lappalie. Fae hielten Menschen für minderbemittelt, im besten Fall waren wir angenehme Haustiere oder Liebhaber für eine Nacht. Mehr nicht. Sie hassten es, wenn hin und wieder eine Nervensäge wie ich sie daran erinnerte, dass wir durchaus mehr auf dem Kasten haben.
Ich sah auf meine Uhr. »Das Restaurant schließt bald.«
Miro stieß einen Fluch aus, in einer Sprache, die ich nicht kannte, nahm das Foto, leckte sich über die Spitze seines Daumens und malte ein Zeichen auf Millis Gesicht. Es glühte kurz auf und verschwand dann vollständig. »Zufrieden, Füchsin?«
Ich nahm das Foto und verstaute es in meiner Handtasche. »Vielen Dank.«
»Dann zerstöre den Feenring.«
»Gleich. Vorher musst du mir noch versprechen, mir nichts zu tun, sobald ich dich befreit habe, und du schuldest mir einen Gefallen. Ich will dein Wort, schwöre auf die Sterne.«
Ich konnte förmlich hören, wie Miros Zähne aufeinanderknirschten und seine Hände ballten sich zu Fäusten. »Du überschreitest deine Grenzen, Vivienne.«
»Ich sichere mich nur ab. Und sosehr ich deine Gesellschaft auch genieße, Miro, bin ich mir doch sicher, dass du mir das hier bei der erstbesten Gelegenheit heimzahlen wirst. Da mache ich doch lieber das Beste aus der Situation.«
Ich musste einen wirklich guten Tag erwischt haben, denn der Fae knurrte, deutete aber ein Nicken an. »Ich schwöre auf die Sterne, dass ich dir nichts tue, sobald ich frei bin, und ich schulde dir einen Gefallen.«
Das genügte mir. Ich nahm die immer noch feuchte Serviette, kniete mich neben seinen Stuhl und wischte den Ring aus den feinen, pulverigen Pilzsporen unter dem Sitz weg. Kaum dass der Ring gebrochen war, spürte ich eine Hand um meine Kehle, die mich in die Höhe riss. Der Geruch von Moos und nassen Steinen erfüllte meine Welt und ich starrte Miro ins Gesicht.
»Du glaubst, du hast clever gespielt, Vivienne«, sagte er leise und sein Atem streifte mein Gesicht. »Aber ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich dir zeigen werde, wie sehr du dich irrst.« Er lächelte ungut und mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. »Bis dahin – lebe wohl.« Ich blinzelte und er war verschwunden.
Kapitel 2
Bevor ich nach Hause fuhr, machte ich noch kurz halt bei meiner Klientin Milli, um ihr die gute Nachricht zu überbringen. Als sie mich an der Haustür begrüßte, konnte ich bereits sehen, dass Miro seinen Teil des Handels eingehalten hatte. Millis Augen hatten dieses ganz besondere Funkeln bekommen und das Lächeln, das sie mir schenkte, hätte auch gut und gern auf eine große Kinoleinwand gepasst.
»Und?!«, fragte sie aufgeregt, noch bevor sie überhaupt »Hallo« sagte. Also hatte sie wohl noch nicht in den Spiegel gesehen.
Wir saßen an ihrem Küchentisch und sie schenkte mir gerade eine Tasse Kaffee ein, der zwar viel zu süß, aber höchst willkommen war, denn ich war verdammt müde. »Er hat eingelenkt«, erwiderte ich und deutete mit einem Nicken auf den Flur. Dort hing ein Spiegel, auch wenn ich gemerkt hatte, dass es nicht nur ihr Aussehen war. Millis Lächeln war strahlend, ihr Lachen hatte eine Nuance angenommen, die nahezu unwiderstehlich klang, und ihre Bewegungen waren grazil und anmutig.
Es war ihr deutlich anzusehen, wie ungeduldig sie war, gleichzeitig wollte sie aber auch nicht unhöflich sein und einfach aufspringen. Ich musste ein Grinsen unterdrücken. »Schau schon nach.«
Binnen eines Lidschlags war sie in den Flur gelaufen und ich konnte ein begeistertes »Ja!« hören. Strahlend kam sie zurück in die Küche und ich war mir ziemlich sicher, dass man dieses Strahlen sehr bald auf den Titelseiten aller Klatschblätter sehen würde. Sie umarmte mich stürmisch und breitete dann die Arme aus. »So klappt es mit dem nächsten Casting bestimmt!«
»Bestimmt«, nickte ich zustimmend und nahm einen Schluck von meinem Kaffee. »Freut mich, dass du zufrieden bist.«
»Bin ich«, sagte sie und drehte sich um sich selbst. Dann veränderte sich der Ausdruck in ihrem Gesicht und wo vorher noch ein Strahlen gewesen war, breitete sich nun Besorgnis aus. »Was soll ich denn jetzt machen?«, fragte sie mit dünner Stimme und sah mich mit großen Augen an.
»Was meinst du?«
»Das hier. Alles. Ich habe …« Sie stockte, als könnte sie es selbst kaum fassen, und sprach dann leiser weiter: »Ich habe mit einem Elfen geschlafen.«
»Einem Sidhe«, korrigierte ich sie.
Sie lächelte etwas gequält und hob die Schultern. »Du weißt, was ich meine. Wie macht man danach weiter? Ich meine, ich habe solche Sachen immer für Hirngespinste gehalten, so etwas gucken sich Fantasyfreaks im Kino an, aber das ist nichts, was man im Bett hat, oder?«
Ich beschloss, das ›Fantasyfreaks‹ geflissentlich zu überhören, weil ich wusste, was Milli plagte. So ging es jedem, der schon einmal Kontakt mit Fae gehabt hatte, egal wie kurz oder lang dieser Kontakt gewesen sein mochte. Er warf einen immer aus der Bahn, weil er die Decke von der Realität wegzog und zeigte, dass es da mehr gab als die uns bisher so vertraute Welt. Wenn man diese Sicherheit einmal verloren hatte, gab es kein Zurück mehr. Was man erfahren hatte, konnte man nicht mehr vergessen. Nur wie sollte man mit diesem Wissen ein normales Leben oder einen normalen Alltag aufbauen können?
»Du glaubst gar nicht, als was sich diese Traumprinzen und Prinzessinnen noch so entpuppen können, die man sich so ins Bett holt«, murmelte ich mehr zu mir selbst, bevor ich den Kopf hob und Milli direkt ansah. »Wenigstens sind sie sehr viel spärlicher verbreitet, als du denkst. Die Chance, dass du auf einen Sidhe triffst, ist kleiner als die, von einem Blitz getroffen zu werden.«
»Aber ich werde immer wissen, dass sie da sind.«
»Ja, das wirst du nicht mehr vergessen können. Aber es wird in den Hintergrund treten. Das Leben geht weiter; so ausgelutscht dieser Spruch auch ist, so wahr ist er doch. Jeder Tag, der vergeht, wird die Erinnerung ein wenig mehr verzerren und sie wird dir immer normaler vorkommen. Gib dir selbst Zeit.«
Milli sah mich dankbar an, dann schien ihr aber ein Gedanke zu kommen und sie verzog die Lippen zu einer nachdenklichen Schnute. »Denkst du, das Fernsehen würde mir meine Geschichte abkaufen?«
Mir wäre fast die Tasse aus der Hand gefallen. »Kein Fernsehen!«, sagte ich hastig. »Keine Zeitungen, keine Magazine, keine Blogs, Videos oder Podcasts! Glaub mir, die Sidhe hassen nichts mehr als unerwünschte Aufmerksamkeit und sollten sie Wind davon bekommen, landest du schneller in der Psychiatrie, als du blinzeln kannst.«
»Das will ich auf keinen Fall!«, stieß sie erschrocken aus und betastete ihr Gesicht. »Außerdem brauche ich das ja auch nicht, denn das nächste Casting wird mein Durchbruch. Das spüre ich!« Sie begann, sich wieder um sich selbst zu drehen.
Ich wartete, bis sie genug Ballerina gespielt hatte, und räusperte mich dann.
»Oh, natürlich, die Bezahlung.« Sie verschwand wieder im Flur und kehrte mit einigen Geldscheinen zurück, die sie mir in die Hand drückte. Ich zählte sie rasch durch und steckte sie dann ein. »Danke.«
»Ich muss dir danken«, sagte sie und fuhr sich mit den Händen über die Wangen. »Das war die drei Jahre allemal wert.«
Ich biss die Zähne zusammen, sagte aber nichts dazu. »Na gut«, lenkte ich schnell ab. »Ich mach dann mal wieder los. Und in Zukunft Finger weg von hübschen One-Night-Stands.«
»Ganz sicher!« Sie lachte und die Sonne ging auf. »Und falls ich doch mal wieder auf einen von denen treffe, kann ich dich ja anrufen.« Sie runzelte die Stirn, als wäre ihr gerade etwas eingefallen. »Warum hast du eigentlich keine E-Mail-Adresse?«
»Ich bin nostalgisch«, wich ich ihrer Frage aus. »Ich mag Festnetztelefone.«
»Schräg«, kommentierte Milli, und wandte sich zur Tür. Das Thema schien damit für sie erledigt.
Ich verabschiedete mich und ließ sie mit ihrem neu gefundenen Lebensglück allein.
Mittlerweile war es bereits Nacht geworden, und mit der Bezahlung in der Tasche fuhr ich zum Lagerhaus, in dem ich meine Utensilien aufbewahrte. Dort verstaute ich das Glas mit Pilzsporen im Regal und ließ meinen Blick noch einmal prüfend über die übrigen Gläser und kleinen Tiegel gleiten, um sicherzugehen, dass noch alles an Ort und Stelle war, bevor ich mich auf den Heimweg machte. Von hier aus war es nicht weit bis zu Hause und ein kurzer Spaziergang in der kühlen Luft würde mir dabei helfen, wieder einen freien Kopf zu bekommen.
Nach dem Zusammentreffen mit Miro war ich völlig fertig – Fae sind clever und drehen dir aus dem kleinsten Ausrutscher direkt einen Strick. Man muss jeden Augenblick, den man in ihrer Nähe verbringt, auf der Hut sein, um nicht einen Fehler zu machen, der einen das Leben oder vielleicht sogar die Seele kosten könnte. Nur wenige Menschen wissen das so gut wie ich.
Vor über zwanzig Jahren hatte ich mich auf der Love-Parade mit einem von ihnen eingelassen – natürlich wusste ich nicht, dass er ein Fae war, sondern hielt ihn für einen heißen Typen, mit dem ich eine Nacht verbringen konnte – und es hatte mich eben um diese zwanzig Jahre gebracht. In einem Moment lag ich noch befriedigt in einem weichen Bett und im nächsten waren zwanzig Jahre vergangen und ich war irgendwo in einem Waldstück am Wannsee wieder aufgewacht und plötzlich hatten wir 2017 anstatt 1997. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich wieder zurechtgefunden habe. Meine Freunde und meine Familie von früher habe ich nicht mehr kontaktiert – außer meine Mutter, aber nachdem sie einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte, weil ihre tot geglaubte Tochter plötzlich vor der Tür stand und nicht um einen Tag gealtert war, habe ich es gelassen.
Ich habe mich so gut es ging von allen ferngehalten, die mal etwas mit mir zu tun gehabt hatten. Leicht war es nicht, sich in dieser veränderten Welt zurechtzufinden. Die Welt hatte in den letzten zwanzig Jahren, im Gegensatz zu mir, keinen Dornröschenschlaf gehalten. Eher im Gegenteil, sie hatte sich rasend schnell weiterentwickelt und ich hatte selbst jetzt, zwei Jahre nach meinem Erwachen, immer noch Schwierigkeiten, allem zu folgen.
Zum Glück fand ich Elsa.
»Hallo.« Die Frau im Türrahmen der Berliner Altbauwohnung wirkt freundlich, mustert mich aber eingehend, um sich ein Bild von mir zu machen. Dennoch war das sehr viel freundlicher als der Empfang an der letzten Wohnung, die früher, vor etwa zwanzig Jahren, mal meine Wohnung gewesen war. Diese Frau hatte mich angeschnauzt, dass sie diesen Gentrifizierungsquatsch nicht mitmachen würde und ich sollte meinen wohnungsgierigen Hipsterarsch gefälligst wieder ins Schwabenland schaffen, wo er hergekommen ist.
Dass ich nicht aus Schwaben stamme, habe ich dann gar nicht erst versucht zu erklären, sondern hatte direkt das Weite gesucht.
Zum Glück fand ich bei meinem anschließenden Tröstversuch im nächstgelegenen Café die Anzeige für ein freies Zimmer mitten in Moabit.
»Du bist die Erste«, begrüßt mich die Frau im Türrahmen und bittet mich herein.
»Ist das so ungewöhnlich?«, frage ich, während ich ihr durch den großen Flur in die Wohnküche folge. Sie ist ziemlich groß – die Küche, die Frau allerdings auch – und gemütlich eingerichtet. Weiß und helles Blau sind hier vorherrschend und überall stehen Töpfe und andere Gefäße mit Pflanzen herum. Der Duft von Zimtgebackenem und Kaffee wabert durch die Luft. Zum ersten Mal, seit ich im Grunewald aufgewacht bin, habe ich das Gefühl, mich irgendwo wohlfühlen zu können. Mir kommen die Tränen, aber ich schlucke sie herunter.
Nicht schnell genug, wie es aussieht, denn das Lächeln meiner hoffentlich zukünftigen Mitbewohnerin verschwindet schlagartig und weicht einer besorgten Miene. »Alles okay?«
Ich beiße die Zähne zusammen und zwinge mich zu nicken. Mir gelingt es sogar, so etwas wie ein Lächeln zustande zu bringen. »Ja, ich hab nur … eine harte Woche hinter mir.« Eher zwei harte Jahrzehnte, bloß wer würde mir das schon glauben? »Mein Name ist übrigens Vivienne.« Ich strecke ihr die Hand entgegen und sie ergreift sie. »Elsa. Ich bin vor fünf Jahren aus Schweden hergekommen. Aber bitte erwarte nicht, dass ich ›Let it go‹ singe.«
Offensichtlich war das ein Witz, denn sie sieht mich erwartungsvoll an, doch ich verstehe nur Bahnhof. »Schweden also«, sage ich nach einer peinlichen Pause. »Riecht es hier deshalb so gut?«
»Ja. Kanelbullar«, sagt Elsa. Sie ist wohl auch froh, dass wir diesen Witz hinter uns lassen können, und bedeutet mir, mich zu setzen. Auf dem klobigen Holztisch steht eine bauchige dunkelblaue Kaffeekanne und zwei große, dazu passende Tassen. Komplettiert wird das Set durch ein winziges Milchkännchen, eine Miniaturausgabe der Kaffeekanne, und ein Schälchen mit Zucker. »Bedien dich«, sagt sie und bückt sich in der gleichen Bewegung zum Ofen, aus dem sie ein Backblech mit Zimtschnecken zieht. Ich fange fast an zu sabbern.
»Die müssen noch etwas abkühlen.« Elsa setzt sich zu mir, schenkt mir und dann sich Kaffee ein und schiebt mir Zuckerschälchen und Milch hin. Ich kippe mir etwas von beidem in den Kaffee und lege die Hände um die Tasse, die sich durch den heißen Kaffee schnell erwärmt. Die letzten Tage habe ich mit dem Erlös aus dem Verkauf des Schmuckes, den mir meine Oma vermacht hatte, überbrückt. Meine Mutter hatte mich immer gedrängt, den Schlüssel für das Schließfach bei mir zu tragen, »für Notfälle«. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nie an so eine Art von Notfall gedacht hatte, und auch wenn ich mich immer mit ihr wegen dieser Marotte gestritten hatte, war ich nach meinem One-Night-Stand froh, dass ich auf sie gehört und den Schlüssel an diesem Tag dabeihatte.
Das Geld, das ich für den Schmuck im Pfandleihhaus bekommen habe (schräge bunte Scheine namens Euro, die aussehen wie Spielgeld), hat ausgereicht, damit ich ein Zimmer in einem heruntergekommenen, aber billigen Hostel mieten konnte. Dort zieht es ständig und entweder haben die Leute im Nebenzimmer einen Kojoten als Haustier, der es zur Entspannung jede Nacht mit einer sehr lauten Katze treibt, oder sie sollten dringend mal zum Arzt gehen und sich die Stimmbänder untersuchen lassen. So oder so, ich komme dort kaum zum Schlafen.
»Bist du gerade erst nach Berlin gezogen?«, fragt Elsa und nimmt einen Schluck aus ihrer Tasse.
»So in etwa, ja.« Ich puste in meinen Kaffee und betrachte die Ringe, die sich durch die Flüssigkeit ziehen.
»Studentin?«
»Nicht so richtig.«
»Du arbeitest schon?«
»Also … na ja …«
»Nicht sehr gesprächig, hm?«
Ich lasse meine Tasse sinken und spüre, wie sich Röte heiß auf meinem Gesicht ausbreitet. »Habe ich das mit der harten Woche schon erwähnt?«, versuche ich mich herauszureden.
Elsa scheint mir mein Verhalten aber nicht übel zu nehmen. Sie stellt ihre Tasse ab, verschränkt die Arme auf dem Tisch und beugt sich näher zu mir. »Die Stadt kann einen ziemlich fertigmachen, wenn man nicht weiß, was einen erwartet.« Sie steht auf und kommt mit einem Teller zurück, auf dem zwei Zimtschnecken liegen, stellt ihn vor mir ab und setzt sich neben mich.
Ich habe es wirklich versucht, aber mit dem warmen Gebäck vor mir und der wirklich netten Elsa neben mir kann ich die Tränen nicht mehr länger zurückhalten und ich heule mir gefühlt eine Stunde lang die Augen aus, während Elsa mich tröstet.
Irgendwo zwischen aufgeweichten Zimtschnecken und von Tränen verwässertem Kaffee wurden wir Freundinnen. Ich erzählte ihr, dass ich keinen Job hatte, aus meiner Wohnung geflogen war und einen Gedächtnisverlust hatte, was sie mir nie so wirklich abgenommen hat, aber sie hat mich nie gedrängt, die Wahrheit zu sagen. Selbst wenn, was hätte ich ihr sagen sollen? Anfangs dachte ich ja selbst noch, es wäre eine seltene Art von Amnesie, wobei ich mir nicht erklären konnte, wie ich zwanzig Jahre unentdeckt und ohne jede medizinische Betreuung im Grunewald hatte herumliegen können, ohne zu sterben. Außerdem war ich keinen Tag gealtert. Rein von meinem Geburtstag her wäre ich knapp vierzig, ich sah aber nicht älter aus als zwanzig.
Stattdessen half Elsa mir, wieder auf die Füße zu kommen und mich zurechtzufinden. Ich zog bei ihr ein und als ich ihr eines Tages doch von meinem Gedächtnisverlust erzählte, war sie diejenige, die vorschlug, auch andere, abwegigere Erklärungen in Betracht zu ziehen. Also begann ich, auch die unwahrscheinlichsten Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Ich stieß bald auf die Fae – die Wesen aus dem Reich des Zwielichts –, von denen einige Frauen und Männer verführen, um ihnen die Lebensjahre zu stehlen. Die, die sich Menschen als Liebhaber suchen und schön wie die Sünde sind, werden Sidhe genannt und keiner weiß, warum sie diesen Zauber veranstalten. Mittlerweile hatte ich auch schon Fae kennengelernt, die keine Sidhe waren und sich tunlichst von uns Menschen fernhielten, was aber nicht bedeutete, dass sie uns nicht doch gern Schaden zufügten, wenn sie die Möglichkeit dazu bekamen.
Für mich war damals aber schon klar – ich musste den Fae oder Sidhe oder wie auch sonst sich der Knabe nennen mochte, der mir mein Leben gestohlen hatte, ausfindig machen und ihn dazu bringen, mir mein Leben zurückzugeben. Sidhe hielten sich für überlegen, es gab allerdings Methoden, wie man ihnen empfindlich schaden konnte.
Eisen verbrennt sie.
Feenringe aus Pilzen oder Bäumen bannen sie.
Ich war sogar so verrückt, Elsa von meinen Recherchen zu erzählen, und sie war so verrückt, mir zu glauben. Zumindest behauptete sie das. Auch wenn ich manchmal das Gefühl hatte, dass sie es eher als mein kleines verrücktes Esoterik Hobby ansah, aber zumindest gab sie mir das Gefühl, kein verrückter Freak zu sein.
Ich war durch meine Recherchen mittlerweile recht gut darin geworden, diesen spitzohrigen Mistkerlen Feuer unter dem Hintern zu machen, und wie es der Zufall so wollte, verdiente ich mir auch meinen Lebensunterhalt damit. Es gab mehr Sidhe-Opfer, als man glauben mag, und es hatte sich herumgesprochen, dass ich ihnen helfen konnte. Mir half es auch – zum einen durch ein paar Euro in der Geldbörse, zum anderen konnte ich so weiterhin den Sidhe suchen, der mich damals verführt und mir alles genommen hatte. Im Augenblick fühlte ich mich allerdings nicht wie die nach Rache kreischende Walküre aus einer Oper, sondern wie eine sehr erschöpfte Mitzwanzigerin, die eine Pause brauchte.
Ich wollte eigentlich nur noch ein Glas Wein, eine heiße Badewanne und dann vielleicht mit einem Buch ins Bett. Elsa war über Weihnachten für ein paar Tage zu ihren Eltern ins Ruhrgebiet gefahren, was bedeutete, ich hatte die Wohnung noch bis morgen für mich. Herrliche Ruhe.
Dachte ich zumindest.
Etwa fünf Minuten nachdem ich zu Hause angekommen war und mir gerade die Schuhe ausziehen wollte, kratzte es an meiner Wohnungstür. Verdattert sah ich durch den Türspion, aber der Flur war leer. Ich dachte schon, ich hätte mir das alles eingebildet und drehte mich wieder um, als das Kratzen abermals ertönte, lauter diesmal. Vorsichtig öffnete ich die Tür einen Spaltbreit. Davor saß ein Besucher, den ich ganz sicher nicht eingeladen hatte.
Er war klein, hatte vier kurze – wirklich sehr kurze – Beine und riesige, fledermausartige Ohren. Sein Fell war hellbraun mit einer weißen Zeichnung auf der Schnauze, die sich bis über seinen Bauch und die vier Pfoten erstreckte. So etwas hatte ich bisher nur im Fernsehen gesehen, wenn es eine Dokumentation über die englische Queen gab – die überraschenderweise auch schon auf dem Thron gewesen war, als ich noch nicht von einem Fae abgezockt worden war – und über ihre kleinen Hunde, die Welsh Corgis, berichtet wurde. Aber was machte so ein kleiner Vierbeiner ausgerechnet vor meiner Tür?
Ich näherte mich dem Hund mit ausgestreckter Hand. »Na, wer hat dich denn hier vergessen? Oder bist du ausgebüxt?«
Ich hielt ihm die Hand entgegen, damit er daran schnuppern und mich kennenlernen konnte. Der Corgi legte den Kopf ein wenig schief, sah zu mir auf und sagte: »Kann ich endlich reinkommen? Ich friere mir hier den Hintern ab.«
Ich tat das, was jeder intelligente Mensch getan hätte: Ich richtete mich auf und schlug dem Hirngespinst die Tür vor der Nase zu.
»Hey!«, bellte es von draußen.
Die Augen zusammengekniffen, lehnte ich rücklings an der Tür und zählte leise bis zehn. Eigentlich hatte ich bisher gedacht, dass es keine Langzeitschäden gäbe, wenn man so viel mit Fae zu tun hatte, aber wie es aussah, hatte ich mich geirrt.
»Hey! Aufmachen!« Wieder das Bellen des Hundes.
»Hau ab«, schrie ich. »Du bist nur in meinem Kopf.«
»Ich bin vor deiner Wohnungstür und mir ist kalt. Mach schon auf.«
Wieder atmete ich tief ein, zählte bis zehn und lauschte. Es war still vor der Tür, kein Bellen, kein Brüllen. Vorsichtig drehte ich mich um, stellte mich auf die Zehenspitzen und schielte mit schief gelegtem Kopf durch den Türspion. Der Corgi saß noch immer vor der Tür, und sah zu mir auf. »Mir ist kalt.«
Ich wich von der Tür zurück, schlug mir mit der flachen Hand ins Gesicht und sah dann wieder durch den Spion hinunter. »Mir ist immer noch kalt. Und ich weiß, dass du mich durch das Guckloch hindurch beobachtest.«
»Du kannst doch gar nicht wissen, wann ich durch den Spion sehe oder nicht!«, rief ich, halb triumphierend, halb aufgebracht. »Was beweist, du musst irgendein Hirngespinst sein!«
»Man sieht deinen Schatten durch den Spalt unter der Tür, wenn du dich bewegst«, erwiderte der kleine Hund trocken. »Und hinter dem Türspion ist es dunkel geworden.«
Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Diese Halluzination glaubte auch noch cleverer zu sein als ich. Ziemlich frech. Aber leider auch ziemlich einleuchtend, denn wenn der Hund da draußen an Dinge dachte, die ich bisher nicht bemerkt hatte beziehungsweise gar nicht hatte bemerken können, musste das heißen, dass er echt war.
Ich atmete tief ein, öffnete die Tür und sah zu dem Tier hinunter. »Klugscheißer«, sagte ich.
»Sehr höflich.« Der kleine Corgi schnaubte hingebungsvoll. »Warum stellst du dich so an?«
»Weil ich bisher noch nie ein sprechendes Tier gesehen habe.«
»Du kennst doch Fae? Warum erschreckt dich dann ausgerechnet ein sprechender Hund?«
Mit einem müden Seufzen massierte ich mir den Nasenrücken. »Es gibt keine sprechenden Tiere bei den Fae. Und woher weißt du das alles über mich?«
Anstelle einer Antwort drehte der stummelbeinige Corgi sich um und bellte einmal. Es klang wesentlich tiefer, als ich es einem so kleinen Knirps von Hund zugetraut hätte, und dann drehte er sich wieder zu mir. Hinter ihm bewegte sich etwas und kurz darauf trat ein kleines Mädchen aus dem Schatten. Es war klein, sicherlich kaum älter als neun oder zehn Jahre alt. Ihre Haut sah weich und flaumig aus, wie bei den meisten Kindern in diesem Alter, aber sie war so weiß wie Porzellan. Ihr Gesicht war so ebenmäßig, dass ich sie fast für eine Fae gehalten hätte, nur der unsichere Ausdruck in den großen grünen Augen war menschlich. Sie strich sich eine Strähne ihres langen blonden Haares hinters Ohr und stellte sich neben den Corgi. Das ungleiche Paar sah mich an, als hätte ich gerade meinen Einsatz in einem Theaterstück verpasst. Nur leider hatte irgendjemand vergessen, mir einen Souffleur an die Seite zu stellen.
Der Corgi räusperte sich. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass Hunde das können. »Auf die Gefahr hin, wie eine kaputte Schallplatte zu klingen …«
»Schon klar, dir ist kalt, und ich soll dich …«
»Uns.«
»Ah, natürlich, ich soll euch reinlassen«, beendete ich meinen Satz, nachdem der Hund mich unterbrochen hatte. Eigentlich wollte ich die beiden nicht in die Wohnung bitten. Nein, ich wollte diesen sprechenden Hund und seine stumme Begleiterin ziemlich sicher nicht in meine Wohnung lassen, aber dann hörte ich das Zuschlagen der Haustür und mir fiel wieder ein, dass ich eben mit einem sprechenden Hund und seiner stummen Begleiterin mitten im Flur eines Mehrfamilienhauses stand. Ich machte einen Schritt rückwärts und schob die Wohnungstür auf. »Aber nur bis hier«, stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und schielte an den beiden vorbei, während sie rasch eintraten, um zu sehen, ob nicht irgendeiner meiner Nachbarn plötzlich im Flur auftauchte.
Die beiden uneingeladenen Besucher blieben tatsächlich brav im Wohnungsflur stehen, während ich die Tür zuschlug und eilig abschloss. »Okay, was soll die Scharade? Wer seid ihr? Und was wollt ihr von mir?«
Der Corgi und das Mädchen wechselten einen Blick miteinander, dann trat der kleine Hund vor und sah zu mir auf. »Wir brauchen deine Hilfe. Moran wird verfolgt.«
Jetzt hatte die weibliche Begleitung dieses unhöflichen Hundes also einen Namen. Eigentlich hätte ich mit etwas Gängigerem gerechnet, wie Nadine oder Karin, aber eigentlich hätte ich es besser wissen müssen – immerhin zog dieses kleine Mädchen mit den großen Augen mit einem sprechenden, sehr frechen Hund durch die Gegend. »Und wie soll ich dabei helfen?«
»Er sagte, es hätte etwas mit den Elfen zu tun.« Zum ersten Mal öffnete Moran den Mund. Ihre Stimme passte zu ihrem Aussehen – ein wenig dünn, aber sehr schön.
»Nenn sie lieber nicht Elfen, das haben sie nicht so gern«, erwiderte ich und sah zwischen ihr und dem Corgi hin und her. »Ein Fae ist hinter ihr her?«
»Wahrscheinlich sogar ein Sidhe. Sicher bin ich nicht. Und allein kann ich sie nicht beschützen. Du bist die Beste, wenn es um Fae geht. Darum brauchen wir deine Hilfe.«
Ich biss die Zähne zusammen. Das war eine plumpe Schmeichelei, aber es war dennoch schön zu hören, wenn die eigene Arbeit geschätzt wurde. Ich fuhr mir mit der Hand durch mein Haar und seufzte tief. »Wenn du weißt, dass ich die Beste bin, weißt du auch, dass das nicht in mein Gebiet fällt. Ich bedrohe Fae nicht, ich hole nur zurück, was sie sich unrechtmäßig genommen haben. Ich bin kein Bodyguard, nur Detektivin.«
»Wir können Sie bezahlen«, schaltete Moran sich ein.
»Darum geht es nicht«, erwiderte ich und schüttelte den Kopf. »Ich kann wirklich niemanden beschützen – wenn ich einen Fae für einen Klienten aufspüren soll, kann ich mich vorbereiten. Ich habe Hinweise, kann herausfinden, ob er ein Sidhe oder ein anderer Fae ist, und weiß, wie ich ihn unter Druck setzen kann. Aber das erfordert viele Informationen, die ich sammeln muss, und vor allem Zeit. In meinem Keller liegen nicht irgendwelche Anti-Fae-Waffen herum, die ich einem Sidhe vor die Nase halten und ihn damit bedrohen kann.«
Das war nicht gelogen. Ich war kein weiblicher Kevin Costner, der mit einer Glock bewaffnet an der Seite eines Klienten durch die Nacht schlich und alles niederschoss, was nicht menschlich aussah. Aber ich musste zugeben, dass mir die beiden leidtaten. Der Hund ließ sogar die Fledermausohren hängen und Moran blickte zu Boden.
»Vielleicht kann ich euch helfen, wenn ihr beide wisst, was genau sie bedroht. Lasst uns morgen früh darüber sprechen. Heute kann ich wirklich nichts für euch tun.«
Moran wirkte ein wenig getröstet, sie lächelte sogar scheu, aber der Corgi war alles andere als begeistert. Er musterte mich eine Zeit lang, als würde er glauben, dass ich ihnen nur etwas vormachte. Schließlich schnaubte er und ging stumm zur Wohnungstür. Wie auf ein geheimes Zeichen hin folgte Moran ihm. Sie winkte mir ein wenig schüchtern zum Abschied, öffnete dann die Tür und ohne ein weiteres Wort verschwanden die beiden hinaus in die Nacht.
Kapitel 3
Ich hatte meinen ursprünglichen Plan – Rotwein, Badewanne und vielleicht ein gutes Buch – noch nicht aufgegeben, aber eigentlich war mir die Lust vergangen. Nein, nicht vergangen, sie wurde nur von einem ziemlich schlechten Gewissen überlagert. Es war halb neun, aber trotz allem schon dunkel und es fühlte sich schlecht an, daran zu denken, dass ich die beiden wieder in die Nacht hinausgeschickt hatte. Die Erinnerung an den Blick des Corgis machte es nicht besser.
Ich saß in der Badewanne und machte mir Gedanken, weil mich ein sprechender Hund anklagend angesehen hatte. Jetzt stand ich wirklich kurz davor, den Verstand zu verlieren.
Dagegen hilft am besten mehr Wein, dachte ich, schenkte mir ein weiteres Glas ein und nahm das Buch vom Badewannenrand. Stephen Kings Es. Wenn mich das nicht auf andere Gedanken brachte, dann half wohl gar nichts mehr. Ich rutschte tiefer in das heiße, schaumige Wasser, trank einen Schluck und schlug das Buch auf. Langsam entfaltete das heiße Wasser seine Wirkung. Gut, der Alkohol war wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig daran, aber bald war ich gedanklich kaum noch bei dem traurigen Hund und seiner Freundin, sondern ganz in den Abwasserkanälen von Derry versunken. Ich war gerade an der Stelle, an der Beverly unheimliche Stimmen aus ihrem Abfluss hört, als es mir das erste Mal auffiel – ein Kratzen. Ich rieb mir über das Ohr, nahm noch einen Schluck Rotwein und las weiter, weil ich dachte, es kam aus dem Badezimmer der Nachbarn auf der anderen Seite der Wand. Während ich weiterlas, wiederholte sich das Geräusch.
Mit gerunzelter Stirn senkte ich das Buch und lauschte dieses Mal aufmerksamer. Ein Kratzen, eindeutig. Wahrscheinlich eine der beiden Katzen der Nachbarn. Manchmal kratzten sie an den Rohren – die Katzen, nicht die Nachbarn – oder jagten sich fauchend durchs Bad, was auf unserer Seite dann klang wie ein Boxkampf zwischen zwei Kettensägen. Aber dieses Mal stimmte irgendetwas mit dem Kratzen nicht. Ich konnte den Finger nicht darauf legen, was genau es war, aber es machte mich nervös. Vielleicht nicht der beste Zustand, um sich mit einem Horrorroman in einer rutschigen Badewanne zu betrinken.
Ich stieg rasch aus dem heißen Wasser, legte das Buch beiseite und drehte mich um, um das Wasser aus der Badewanne abzulassen. Dabei stellte ich mich aber alles andere als geschickt an und stieß die Weinflasche um, die mit lautem Klirren auf den weißen Fliesen im Bad zerbrach. Roter Wein sickerte heraus, tränkte den flauschigen Vorleger vor der Wanne und den vor der Toilette.
»Scheiße!«, entfuhr es mir. Ich warf mir meinen Bademantel über und ging schnell hinaus, um die Sauerei aufzuwischen, möglichst ohne mich dabei zu schneiden. Als ich zurückkehrte, begrüßte mich ein weiteres Kratzen. Jetzt wusste ich endlich, was genau mich an diesem Kratzen gestört hatte, was daran so anders war, worauf ich den Finger nicht hatte legen können – das Kratzen war aus der falschen Richtung gekommen. Die Katzen waren immer in der linken Ecke des Badezimmers zu hören. Dieses Kratzen kam von der Decke, genauer gesagt aus dem Abzugsloch, das nur mit einem Gitter abgedeckt war. Gänsehaut breitete sich auf einen Schlag auf meinem ganzen Körper aus und ich hätte schwören können, dass selbst die Haare auf meinem Kopf zu Berge standen.
»Nur eine Ratte, irgendwo in den Rohren«, sagte ich zu mir selbst. »Nur eine Ratte, nichts weiter.«
Ich schloss die Augen, atmete tief ein und öffnete sie dann wieder. Das Kratzen war verschwunden.
Dafür hatte das Flüstern begonnen.
Wo …
… kriegen dich.
Wo …
Lauf …
… kriegen dich.
Ich war wie erstarrt. Meine Gänsehaut gab mir das Gefühl, dass meine Haut sich gleich von meinem Körper lösen wollte, und ich hörte ein Klappern, das sich recht bald als meine Zähne entpuppte, die aufeinanderschlugen. Das waren doch nicht wirklich Stimmen, die aus meiner Lüftung kamen, oder?
Das Mädchen …
Wo …
Gib uns …
… Mädchen.
Endlich konnte ich meinen Kiefer wieder unter Kontrolle bringen, aber beim Rest meines Körpers wollte mir das nicht so recht gelingen. Er war vor Angst steif wie Eis, erstarrt und jenseits meines Zugriffs. Zumindest mein Gehirn funktionierte noch und es verstand endlich, was die Stimmen da wisperten. Mädchen. Wie das Mädchen, das mit dem kleinen Hund hier gewesen war.
»Sie … sie ist nicht hier«, brachte ich kaum hörbar heraus. Es folgte ein Moment der Stille. Ich starrte noch immer wie gebannt auf das Gitter des Abzugs.
Das wackelte.
Sich wölbte.
Bebte.
Aus dem sich die Schrauben lösten.
Und das schließlich herunterfiel.
Schattenartige Klauen drängten sich durch die enge Öffnung und krümmten sich. Das reichte, um mir die Kontrolle über meinen Körper zurückzugeben. Ich riss den Mund auf, schrie, wirbelte herum und rannte aus dem Bad.
Ich nahm mir kaum die Zeit, mir etwas Ordentliches überzuwerfen, schlüpfte hastig einfach in meine Unterwäsche und die Jeans, streifte mir noch auf dem Weg zur Tür hinaus meinen Hoodie, Jacke und Tasche über und versuchte, mit hopsenden Bewegungen in meine Schuhe zu kommen, ohne die Treppe hinunterzufallen, während ich gleichzeitig hektisch zu der zugefallenen Wohnungstür hinter mir sah, aus Angst, dass diese Schattenklaue mir folgte.
Eigentlich hatte ich gehofft, niemals auf das Notfallkit in meinem Lager angewiesen zu sein, aber wofür sonst hatte ich es zusammengestellt? Notfallkit war eigentlich auch nichts anderes als ein Angebername für meinen Rucksack, in dem ich eine Lage Kleidung zum Wechseln, ein paar Proteinriegel und Wasser verstaut hatte. Eigentlich hatte ich ihn nur auf Elsas Drängen hin zusammengestellt, weil sie sich ständig Sorgen machte, dass ich mich mal mit dem falschen Fae anlegte. Ich hatte das immer für übertriebene Vorsicht gehalten, aber wie sich herausstellte, hatte sie recht gehabt. Auch wenn ich mich ausnahmsweise mit niemandem angelegt hatte. Moran und der Hund waren zu mir gekommen, nicht umgekehrt. Ich hatte ihren Auftrag offiziell noch gar nicht angenommen, dennoch befand sich jetzt irgendein gruseliges Schattenwesen in meiner Wohnung und wartete auf meine Rückkehr, um …
Mir lief es eiskalt über den Rücken. Elsa! Ich hatte Elsa ganz vergessen! Sie würde morgen Nachmittag zurück nach Hause kommen, außer, sie hatte mal wieder Streit mit ihrem Freund und würde früher heimkommen und dann eine verdammt unangenehme Überraschung vorfinden. Das konnte ich nicht zulassen. Da die beiden aber gerade ihre Eltern im Ruhrgebiet besuchten, konnte es genauso gut sein, dass nur er bei einem Streit nach Hause fuhr und sie länger dortblieb. Mein Blick schweifte zu dem Rucksack zu meinen Füßen, der auf dem staubigen Betonboden stand. In der Seitentasche befand sich ein flaches Gerät, ein Handy, wie Elsa mir mehr als einmal erklärt hatte, und ich wusste, dass ich es theoretisch wie ein Telefon benutzen und Elsa damit warnen konnte. Theoretisch.
In den letzten zwanzig Jahren war der technische Fortschritt in einem Tempo vorangaloppiert, dass ich mich immer wieder fragte, wie die Menschen da mithalten konnten. Internet, Smartphones, YouTube – alles Dinge, an die ich mich nach meinem Aufwachen nur schwer gewöhnen konnte. Ohne Elsa hätte ich die Hälfte davon noch immer für eine Erfindung aus einem Science-Fiction-Film gehalten. So wirklich kannte ich mich damit noch immer nicht aus, aber ich gab nicht auf. Bis auf die Sache mit dem Handy. Das Ding war und blieb einfach ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Keine Ahnung, warum ausgerechnet dieses Ding mir Schwierigkeiten bereitete, denn ich sah ständig Leute auf der Straße, die damit herumspielten, als wäre es ein angewachsener Teil ihres Körpers, aber ich kriegte es einfach nicht hin.
Mit spitzen Fingern zog ich das flache, silbrig glänzende ›Telefon‹ aus der Tasche und drückte die Taste an der Seite, bis ein Bild auf dem schwarzen Bildschirm aufflammte. Ich gab auf der eingeblendeten Tastatur den Code ein und atmete tief durch, als sich das Bild änderte. Gut, immerhin diese Hürde hatte ich schon einmal überwunden. Viele kleine viereckige Bildchen erschienen auf buntem Hintergrund und ich schielte darauf hinunter, in der Hoffnung, dass irgendeines davon mir Auskunft geben konnte, wo verdammt noch einmal die Telefonfunktion zu finden war.
Nach einigem Suchen fand ich endlich den weißen Telefonhörer auf grünem Grund und tippte darauf. Woraufhin eine lange Liste von Namen und Nummern auftauchte. Elsas Name war nicht zu sehen. Ich tippte versuchsweise einen der Namen an, der Bildschirm wurde schwarz, nur noch der Name leuchtete auf und dann blinkte ein weißes Feld. Ich versuchte, wieder daraufzudrücken, und eine Tastatur erschien auf dem Bildschirm.
Frustriert warf ich das Handy auf die Liege, die ich für späte Überstunden aufgestellt hatte, und verschränkte die Arme. Fürs nächste Mal musste ich mir einen Telefonanschluss ins Lager legen lassen. Falls das überhaupt möglich war. Lagerräume hießen seit Neuestem Storage und man konnte sie an jeder Ecke mieten. Mein Lager befand sich in einem dieser riesigen Klötze aus gestanztem Metall, nahe der Spree an der Grenze zum Wedding, und es hatte den großen Vorteil, dass ich Tag und Nacht hineinkonnte. Hier bewahrte ich neben meinem Notfallkit auch meine Zutaten, Kräuter und Bücher zur Fae-Abwehr auf. Eine Waffe gab es auch, die ich nur ungern benutzte und bisher erst bei einem Einsatz dabeihatte, um mich zu schützen, falls der Fae mein Angebot nicht annehmen wollte. Zum Glück hatte ich sie damals nicht benutzen müssen.
Aber in diesem Fall ging es um Elsas Sicherheit und, was man nicht unterschätzen durfte, mein Zuhause. Wenn ich Elsa nicht erreichen konnte, musste ich dieses Vieh aus meiner Wohnung vertreiben, ehe sie zurückkehrte. Dieses Mal konnte ich die Waffe gut gebrauchen und nahm sie aus dem Regal, in dem ich sie verstaut hatte. Ihr Griff lag gut in meiner Hand und sie fühlte sich schwer und gut ausbalanciert an.
Eigenschaften, die man bei einer eisernen Bratpfanne sonst nicht vermutet hätte, aber bei diesem Schätzchen hatte ich Glück gehabt. Eisen verbrannte alle Fae und wenn diese Schattenkreatur in meinem Badezimmer nicht genau das war, fraß ich einen Besen samt Stiel. Mit einer Bratpfanne konnte man sehr effektiv Schläge austeilen, selbst wenn man kein begnadeter Kämpfer war, und sie tat auch weh, wenn der Gegner kein Fae war.
Ich steckte sie in meinen Rucksack und nahm auch einige Pilzsporen und meine Glamoursalbe mit. Die Salbe half mir dabei, die Zauber der Fae zu durchschauen. Die Sporen konnten mir dabei helfen, sie einzusperren. Wenn ich denn die Gelegenheit dazu bekam. Aber half das alles gegen meinen dunklen Angreifer? Ich nagte an meiner Unterlippe. Von Schattenklauen, die durch die Abzugsrohre kamen, hatte ich noch nie etwas gelesen oder gehört, was nicht bedeuten musste, dass es sie nicht gab. Immerhin hatte ich sie noch vor zwei Stunden in meinem eigenen Badezimmer gesehen. Vielleicht hatte einfach keiner der Chronisten, die die Bücher, die in meinem Lager standen, verfasst hatten, jemals etwas von dieser Schattenklaue gehört, weil jeder, der sie erforschen wollte, dabei umgekommen war.
Kein besonders tröstlicher Gedanke.
Aber es gab jemanden, der etwas über sie wissen konnte. Ich blickte mich suchend um, nahm noch einen kleinen Beutel mit Pflanzendünger aus dem Regal und verließ dann das Lager.
Selbst Berlin, die Stadt, die von sich behauptet, niemals stillzustehen, wird um drei Uhr nachts ruhiger. Auf den Straßen fahren nur noch wenige Autos und noch weniger Nachtbusse und auch die Menschen ziehen sich zurück, zumindest, wenn es nicht mehr Sommer und unter der Woche ist.
Ich fuhr mit meinem kleinen Mini am Hauptbahnhof entlang und genoss den kaum existenten Verkehr. Das neue Gebäude des Hauptbahnhofs war hell erleuchtet, aber im Innern war kaum jemand zu sehen, nur einige Obdachlose hatten es sich unter dem überhängenden Glasdach gemütlich gemacht. Ich bog auf die rote Brücke ein und fuhr an der Schweizerischen Botschaft vorbei, die ein wenig einsam auf dem offenen Feld stand. Früher hatte es hier noch mehr Botschaften gegeben, aber Elsa hatte mir erzählt, dass sie alle weggezogen waren. Nur die Schweizer hatten sich geweigert, ihre Botschaft zu verlegen, und standen nun allein auf weiter Flur da. Irgendwie charmant.
Ich fuhr durch das Regierungsviertel und stellte meinen Mini in einer Seitenstraße neben dem Reichstag ab. Die Kuppel war, wie auch der Bahnhof, illuminiert und sah aus wie eine seltsame Qualle oder ein gläserner Wackelpudding.