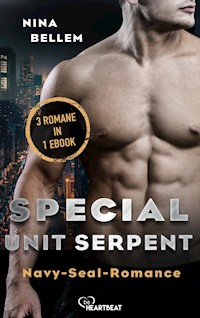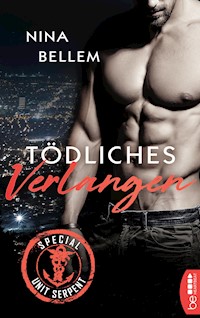4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Märchen zum Einschlafen? Dieser nervenaufreibende Thriller sorgt garantiert für schlaflose Nächte - exklusiv als E-Book! Undine Meerbach arbeitet als freie Profilerin und muss sich dafür immer wieder in die Gefühle anderer Menschen hineinversetzen. Als ein perfider Serienmörder seine Opfer auf grausame Weise nach Märchenmotiven hinrichtet, bittet die Polizei Undine um Hilfe. Doch je tiefer sie in die Gedanken des Killers eintaucht, desto deutlicher wird es, dass sie in ihrer eigenen Vergangenheit suchen muss, um den Mörder zu stellen. Und diese Erkenntnis bringt sie selbst in höchste Gefahr ... (ca. 250 Seiten)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Die Autorin
Impressum
NINA BELLEM
Märchentod
Roman
Zu diesem Buch
Märchen zum Einschlafen? Dieser nervenaufreibende Thriller sorgt garantiert für schlaflose Nächte – exklusiv als E-Book!
Undine Meerbach arbeitet als freie Profilerin und muss sich dafür immer wieder in die Gefühle anderer Menschen hineinversetzen. Als ein perfider Serienmörder seine Opfer auf grausame Weise nach Märchenmotiven hinrichtet, bittet die Polizei Undine um Hilfe. Doch je tiefer sie in die Gedanken des Killers eintaucht, desto deutlicher wird, dass sie in ihrer eigenen Vergangenheit suchen muss, um den Mörder zu stellen. Und diese Erkenntnis bringt sie selbst in höchste Gefahr …
»Aber im Winkel am Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit lächelndem Munde – tot, erfroren am letzten Abend des alten Jahres. Der Neujahrsmorgen ging über der kleinen Leiche auf, welche mit Schwefelhölzern dasaß, wovon ein Bund fast verbrannt war.«
Er hatte aufgehört zu schreien. Endlich hatte er aufgehört zu schreien. Sie rieb sich über die geröteten Augen und dann über den Kiefer. Erst jetzt bemerkte sie, wie verkrampft sie war, und ihr Körper verspannte sich noch mehr, als sie an die vergangenen Stunden dachte.
Er hatte stundenlang geschrien, gebrüllt, geplärrt und wollte sich einfach nicht beruhigen lassen. Weder Schnuller noch Essen hatten geholfen. Das Gesicht rot angeschwollen, die Hände zu winzigen Fäustchen geballt, hatte er in der Wiege gelegen und geschrien.
Sie war müde und sehnte sich danach, in die Küche zu gehen, zu dem Bierkasten unter der Spüle, und endlich Ruhe zu finden. Zumindest für ein paar Minuten. Aber wenn sie in die Küche ging, musste sie am Wohnzimmer vorbei, und dort stand die Wiege. Einen neuerlichen Schreianfall wollte sie nicht riskieren.
Dann wenigstens eine heiße Dusche! Das Bad war ja gleich neben ihr. Erschöpft fuhr sie sich mit beiden Händen über das Gesicht. Eine heiße Dusche und danach ins Bett. Einfach nicht mehr daran denken.
Hastig streifte sie ihre Kleidung ab und kletterte in die schmale Badewanne. Mit leisem Zischen schoss das Wasser aus der Duschbrause und klatschte auf ihren Kopf. Es floss über ihren Körper, benetzte ihre Arme und glitt über den Ansatz ihrer nackten Brüste. Doch es war kein Wasser!
Im ersten Moment fühlte sich ihr Kopf taub an. Zugleich geschah auf ihren Armen etwas Merkwürdiges – dort, wo die Tropfen aufgeprallt waren, hatte die Haut sich rot verfärbt. Die kreisrunden Stellen dehnten sich aus, brodelten regelrecht und platzten schließlich auf. Entsetzt musste sie mit ansehen, wie ihre Haut sich vom rohen Fleisch zu lösen begann.
Etwas Warmes floss über die Stirn in ihre Augen. Fahrig wischte sie sich darüber, unfähig den Schrei herauszulassen, der in ihrer Kehle feststeckte. Auf ihren Fingern klebte, dick und sämig, ihr eigenes Blut. Als sie sich über den Schädel fuhr, hielt sie ein Büschel Haare in der Hand, die in einem losen Fetzen Haut steckten.
Noch immer rauschte die durchsichtige Flüssigkeit aus der Brause, floss über ihren Kopf und mischte sich mit dem Blut zu hellrosafarbenen Strömen, die ihren ganzen Körper hinabrannen und zu glitzernden gefrorenen Spuren eintrockneten.
Dann kam der Schmerz. Und endlich konnte sie schreien.
An den meisten Tagen hatte sie sich gut im Griff. Dann war sie normal und fiel nicht weiter auf. Doch an den restlichen Tagen funktionierte das gar nicht. Da fühlte sie sich wie der Empfänger eines Radios, der wahllos alles aufschnappte, was ihm gesendet wurde.
Der heutige Tag gehörte eindeutig zur letzten Kategorie.
Undine, von engen Freunden auch Dina genannt, saß mitten in einem trendigen Brunch-Café, unweit der Schönhauser Allee, und rührte in ihrem Milchkaffee, während sie versuchte, die ihr gesendeten Signale so gut es ging auszusperren.
Ihre Freundin Rosa saß ihr gegenüber und betrachtete sie eingehend. Dina konnte das deutlich spüren. »So schlimm heute?«, fragte sie und nippte an ihrem alkoholfreien Frühstückscocktail.
Dina rieb sich über die Stirn, die Augen geschlossen. Die Sonne fiel durch die hohen Fenster des Cafés und blendete sie. Einer der Sonnenstrahlen spiegelte sich in Rosas Besteck und tanzte penetrant vor Dinas Nase herum.
»Schlimm ist gar kein Ausdruck«, erwiderte sie.
»Woran liegt es diesmal?«
Dina zuckte mit den Schultern, auch wenn sie es eigentlich genau wusste. Sie hatte ein Date mit einem Typen gehabt, und ihr war jetzt schon klar, dass es nichts werden würde. Aber allein die Vorstellung, ihm das sagen zu müssen, drehte ihr den Magen um.
Am Nebentisch begann ein Kind im Kinderwagen zu weinen. Der Vater griff, ohne überhaupt hinzusehen, nach dem Gestell und brachte es ins Schaukeln, während er sich weiter mit seiner Begleiterin unterhielt, die das Kind gar nicht zu beachten schien. An einem anderen Tisch direkt daneben unterhielt sich ein junges Pärchen, aber ein flüchtiger Blick hatte Dina gereicht, um zu erkennen, dass es sich bei dem Gespräch nicht um Liebesgeflüster handelte.
»Geht es denn? Oder willst du lieber nach Hause gehen?«, holte Rosa Dina zurück in die Realität.
Die winkte ab und trank einen Schluck Milchkaffee. »Jetzt habe ich mich schon hierher gequält, jetzt bleibe ich auch«, erklärte sie und bemühte sich, ihre Worte mit einem entschuldigenden Lächeln zu untermauern. Das Kind schrie mittlerweile, und auch das Gespräch am Nebentisch war hitziger geworden. Rosa sah hinüber, und aus einem Reflex heraus folgte Dina ihrem Blick – wofür sie sich schon im nächsten Moment verfluchte.
Der Kindsvater blickte noch immer nicht nach seinem Sprössling. Stattdessen hatte er die Schultern zurückgeworfen und beugte sich über den Tisch näher zu seiner Begleiterin. Er erzählte ihr mit weit ausholenden Gesten etwas, und Dina konnte an ihren erhobenen Brauen und den ihm zugewandten Körper erkennen, worum es sich handelte – das war ein ganz altmodisches Balzritual.
Dina spürte, wie auch ihre Schultern sich strafften, wie sie das Bedürfnis überkam, Rosa mit möglichst deutlichen Beschreibungen von ihrem letzten Fall als Profiler zu erzählen, was sie sicherlich beeindrucken würde …
Dina stöhnte auf. Offensichtlich funktionierte ihre natürliche Barriere heute überhaupt nicht.
Sie wollte wegsehen, blieb dabei aber an dem Tisch mit dem jungen Pärchen hängen. Die Frau saß mit steif aufgerichtetem Rücken und angelegten Ellenbogen auf dem Stuhl. Wann immer sie den Mann vor sich ansah, wurden ihre Augen unmerklich schmaler, und sie drückte ihre Lippen fester aufeinander. Ihr Blick war dabei auf seine Augen fixiert.
Innerlich seufzte Dina, aber ihr Rücken wurde gerade, und die Ellenbogen drückten sich gegen ihre Seiten. Die Haltung war verkrampft und zog schmerzhaft in ihren Nacken hoch. Sie spürte Wut und Enttäuschung, die sich auf niemand Bestimmten konzentrierte.
Der Mann schien von dem Unmut seiner Begleiterin nichts mitzubekommen, oder er ignorierte sie einfach. Sein Blick streifte durch das Café und sah nichts Besonderes an, aber mit jeder Sekunde, die sie schwiegen, wurde die Haltung der Frau angespannter.
Der Schmerz in ihrem Nacken verschlimmerte sich. Dina lehnte sich zurück, um ihm entgehen zu können, aber da fiel ihr Blick wieder auf den Kindsvater, und sogleich warf sie sich in die Brust, das Kinn erhoben …
Es wurde zu viel. Das Radio empfing zu viele Signale auf einmal und mischte sie zu einem undefinierbaren Wirrwarr, den Dina nicht länger ertrug.
»Es reicht«, donnerte sie los und stand auf. Die Gespräche im Café verstummten, und alle sahen sie an. Auch Rosa wirkte verwirrt und brachte kein Wort heraus, sondern blickte sie nur irritiert an. Dina lief rot an, kramte hastig einen Zwanzigeuroschein aus der Handtasche und wollte gerade das Lokal verlassen, als sie hörte, wie die Frau am Pärchentisch verächtlich schnaubte. Das reichte.
»Wenn ich Sie wäre, würde ich nicht so viel rumschnauben, sondern lieber zusehen, dass ich meine bescheuerte Eifersucht in den Griff bekomme! Ihr Mann steht kurz vor der Trennung, weil ihn genau das nervt, und wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, er kann zweifellos jederzeit was Besseres finden«, giftete sie und spürte einen winzigen Triumph, als die Frau mehrmals den Mund öffnete, aber offensichtlich doch nichts Schlagfertiges auf der Zunge hatte.
Dina knallte ihr Geld hin, drehte sich um und rauschte aus dem Café.
Der Geruch am Schauplatz eines Mordes war stets der gleiche – eine Mischung aus Chemikalien, Schweiß und dem süßlichen Duft der Fäulnis. Egal ob die Leiche auf der Straße oder, wie hier, in einem Badezimmer gefunden wurde, es roch immer ähnlich.
Undine Meerbach bemühte sich, nicht die Nase zu rümpfen, als sie das Badezimmer betrat, das mit einem Mann von der Spurensicherung und der Leiche in der Badewanne bereits nahezu ausgefüllt war. Der Mann trug einen weißen Ganzkörper-Schutzanzug, ähnlich den Anzügen, die man in jedem Baumarkt zum Schutz vor Farbe beim Streichen bekam. Ein aufgenähtes Schild auf seiner linken Brusttasche wies ihn als D. Sturder aus. Der weiße Stoff wirkte seltsam passend in dem gekachelten Badezimmer.
Er sah auf, als Undine eintrat, und nickte ihr zu. Ganz offensichtlich ging er davon aus, dass sie zum Team gehörte, wenn sie so selbstverständlich in einen Tatort hineinspazierte. Sie erwiderte das Nicken und trat neben ihn. Es stellte bei diesen glatten Kacheln eine kleine Herausforderung dar, sich mit einem eleganten Hosenanzug und Pumps auf die Fersen zu hocken, aber Undine meisterte sie dank jahrelanger Übung.
Sturder grinste schief, wurde aber wieder ernst, als Undine sein Lächeln nicht erwiderte. Er deutete mit dem Finger zu der Leiche, die zusammengekauert in der Wanne saß. Undine hatte ihr nur einen flüchtigen Blick gewährt, als sie das Badezimmer betreten hatte, doch jetzt war sie aufmerksamer und hob überrascht eine Augenbraue. Der Mann neben ihr fand sein Grinsen wieder. »Mit so etwas haben Sie wohl nicht gerechnet?«
Undine machte sich nicht einmal die Mühe, ihm den Kopf zuzuwenden, sondern beugte sich vor, etwas näher an die Wanne heran. »Vorsicht, nicht den Wannenrand anfassen!«, warnte Sturder sie, und Undine knirschte mit den Zähnen.
»Es ist nicht mein erster Tatort«, sagte sie ruhig und warf ihm jenen eiskalten Blick zu, der sich schon oft genug als Abstandshalter bewährt hatte. Nach ihrem Auftritt am Morgen fühlte sie sich noch immer nicht ganz auf der Höhe, auch wenn es ihr langsam besser ging.
Er hob beschwichtigend die Hände und sprach sie nicht weiter an. Undine schenkte ihm keine Beachtung mehr und sah sich die Leiche genauer an. Es handelte sich um eine Frau mit massivem Übergewicht. Um den Bauch hing die Haut lose herab, und Schwangerschaftsstreifen zogen sich über die Seiten und die Hüften. Das Gesicht wirkte auf den ersten Blick kindlich, doch bei genauerem Hinsehen erkannte Undine die Falten um die Augen und den Mund – zumindest in der Hälfte, die intakt geblieben war. Die andere Hälfte wies Ähnlichkeit mit einem Stück rohem Fleisch auf, das in der Metzgertheke auslag. Die Haut war aufgeplatzt und aus den Wunden war Blut über das Gesicht der Frau gelaufen, das nun braun getrocknet an ihr klebte.
Ähnliche Wunden zeigten sich auch auf ihren Brüsten und den Armen. Sie wirkten wie Verbrennungen unter der Haut, die sich durch das Fleisch nach oben gefressen hatten.
Der Rest des Körpers machte einen halbwegs unversehrten Eindruck; die Haltung stach jedoch ins Auge: Die Leiche war gegen das Fußende der Wanne gelehnt, und ihr Kinn ruhte auf der geschundenen Brust. Die halblangen aschblonden Haare mit helleren Strähnchen waren ordentlich zurückgekämmt, die Hände vor der herunterhängenden Bauchdecke gefaltet. Zwischen den Fingern klemmte etwas, das Undine nicht genau erkennen konnte. Kurzerhand griff sie nach der Pappschachtel, in der sich Einweg-Latexhandschuhe befanden, und streifte sie sich über. Sie stützte sich trotz Sturders lautstarker Proteste auf den Wannenrand und beugte sich so nah über die Leiche, dass sie den süßlichen Geruch nun deutlich als Verwesungsgestank wahrnehmen konnte. Dennoch bewegte sich Dina nicht im Geringsten, bis sie erkannt hatte, worum es sich handelte: In den Händen der Leiche befanden sich Streichhölzer, zu einem Bündel zusammengefasst und von einem Gummiband gehalten. Einige der roten Schwefelköpfe waren abgebrannt und stachen schwarz zwischen den anderen hervor. Dazwischen entdeckte sie etwas, das wie die Ecke eines Stückes Papier aussah. Mehr konnte sie jedoch nicht erkennen, ohne die Finger der Frau aufzubiegen. So weit reichte ihr Mut jedoch nicht.
Sie konzentrierte sich daher erst einmal auf die Stellen der Leiche, die sie ohne Gewalteinwirkung sehen konnte. »Vergesst niemals: Die Lösung liegt im Gesamtbild.« Die Stimme ihres ehemaligen Dozenten in Amerika klang Dina so deutlich in den Ohren, als würde der Mann hinter ihr stehen. Sie hatte während ihrer Zeit in den USA jedes Wort von Dericksen aufgesogen, als wäre es Wasser und sie gerade in der Wüste am Verdursten. Daher konzentrierte sie sich immer auf jede Einzelheit, die mit dem bloßen Auge wahrnehmbar war. Was ihre Augen ihr nicht verraten konnten, würden später die Leute von der Spurensicherung und der Rechtsmedizin nachholen.
Insgesamt sah der Korpus normal aus, soweit man das von einer Leiche sagen konnte. Erst aus der Nähe bemerkte Undine den feinen Schimmer, der über dem unversehrten Teil der Haut lag. »Was ist das?«, fragte sie Sturder und deutete auf den Bauch der Frau, auf dem der Schimmer am deutlichsten zu erkennen war.
»Keine Ahnung. Ich …«
»Es handelt sich um Eis. Vereisung, um genau zu sein. Hallo, Dina!«
Die meisten Menschen außerhalb ihrer Heimatstadt bemühten sich, ihren Namen französisch, mit stummem E, auszusprechen. Hier in Berlin waren die Leute weniger subtil und sprachen ihn genauso aus, wie er geschrieben wurde. Dina nannten sie jedoch nur vier Leute auf der Welt. Und sie wusste genau, zu wem die dunkle Stimme gehörte, auch wenn sie gehofft hatte, sie nie wieder hören zu müssen. Langsam stand sie auf und streifte sich die Handschuhe ab, ohne sich umzudrehen. »Hallo, Peter! Ist das auch die offizielle Todesursache?«
Er trat neben sie und blickte auf die Leiche. »Als Feldkamp mir sagte, dass er einen externen Profiler hinzuziehen würde, hätte ich nicht gedacht, dass er dich meinen könnte«, überging er ihre Frage einfach.
»Du wusstest immer, womit ich meine Brötchen verdiene«, erwiderte sie trocken.
»Beratung bei Mordfällen ist mir neu.«
Sie zuckte mit den Schultern. »In den letzten drei Jahren hat sich so einiges verändert.«
Ihre Worte hatten ihn getroffen; sie spürte deutlich, wie seine Stimmung kippte. Es waren nur subtile Veränderungen: das Anspannen des Kiefermuskels, die Verlagerung des Gewichts. Aber sie reichten ihr, um in ihm lesen zu können wie in einem Buch. Darin war sie immer gut gewesen.
»Hast du noch mal mit ihr gesprochen?«
Abermals zuckte Undine mit den Schultern. »Ich rede oft mit ihr, im Gegensatz zu dir. Das ist aber etwas, das dich nichts angeht.«
Diesmal hätte selbst ein Ungeübter die Zeichen in Peters Körpersprache lesen können – er ballte die Hände zu Fäusten, verkniff sich aber eine Antwort.
Undine strich eine Haarsträhne aus ihrem kurzen Pagenschnitt zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Also, was ist die offizielle Todesursache?«
Peter steckte die Hände in die Hosentaschen seiner Jeans. »Das übliche Spiel – die Infos bekommen wir erst, sobald die Leiche beim Rechtsmediziner war.«
»Das sagt der Polizist. Was sagt der Bulle?«, fragte sie ihn ungerührt.
In Peter rang der Wunsch, mit seiner Vermutung herauszuplatzen, deutlich mit der Kränkung über ihre rüde Zurückweisung. Schlussendlich siegten aber Stolz und Instinkt. »Ich habe bisher keine sichtbare Verletzung gesehen, die auf einen Kampf hindeutet – keine Schuss- oder Stichwunde. Das da« – er machte eine unbestimmte Geste, die alle aufgeplatzten Hautstellen der Frau einschloss – »wurde wohl von flüssigem Stickstoff verursacht. Das sagt zumindest die Rechtsmedizinerin, aber sie will sich erst festlegen, wenn sie die Symptome live gesehen und nicht nur übers Telefon beschrieben bekommen hat. Das würde zumindest auch die postmortale Vereisung erklären.«
Undine sah auf die Duschbrause. »Stickstoff wird meines Wissens aber nicht durch gewöhnliche Wasserrohre gepumpt.«
»Das sind auch keine gewöhnlichen Rohre«, meldete sich Sturder zu Wort. Er deutete mit dem Zeigefinger auf die Brause. »Wir haben frische Schleifspuren im Metall der Haltestange gefunden. Offenbar sind sowohl der Schlauch als auch der Duschkopf manipuliert worden. Jemand hatte sie direkt mit einem externen Behälter verbunden, der dort angebracht worden war.«
»Und das hat sie nicht bemerkt?«, fragte Undine.
»Wie oft schaust du in jede Ecke deines Badezimmers, wenn du in Gedanken bist und dich in deinen eigenen vier Wänden sicher fühlst?«, fragte Peter, und im Stillen musste Undine ihm recht geben.
»Habt ihr den Zettel schon analysiert?«
Peter wusste anscheinend sofort, was sie meinte. »Wir müssen warten, bis die Jungs hier fertig sind und alles ins Labor gebracht haben.«
Sturder tippte kurz zum Militärgruß an seine Stirn, als er Peters Worte hörte, sah aber nicht von seiner Arbeit auf.
Undine nickte nur und ließ den Blick noch einmal durch das Badezimmer schweifen. »Okay, was wisst ihr sonst schon über die Tote?«
»Ihr Name ist Inge Bach. Alter fünfunddreißig, alleinerziehend und arbeitslos. Sie ist gerade in einer Ein-Euro-Maßnahme des Jobcenters.«
Undine blickte auf. Auf dem Weg von der Eingangstür ins Badezimmer hatte sie nur zwei weitere Türen gesehen. »Wie alt ist das Kind?«
Peter sah düster in den Flur. »Der Junge ist nicht älter als fünf oder sechs Monate. Die Kollegen vom Jugendamt waren bereits da und haben ihn mitgenommen. Die kannten die Adresse wohl schon.«
»Was meinst du damit?« Undine war hellhörig geworden.
Zwischen Peters hellen Augenbrauen bildete sich eine steile Falte. »Offenbar gab es früher schon diverse Beschwerden der Nachbarin in der Wohnung darunter. Der Junge war tagsüber alleine und schrie stundenlang, bis die Mutter nach Hause kam.«
Undine sah ebenfalls in den Flur. »Kann ich das Kinderzimmer sehen?«
»Es gibt keins. Wir haben nur eine Wiege im Wohnzimmer gefunden, die kannst du dir gerne ansehen.«
Undine nickte. Die Präsenz der Leiche wurde mit jeder Sekunde, die sie sich länger im Badezimmer aufhielt, drückender, und für den Moment hatte Undine genug gesehen. Peter ging voraus, weit war es nicht. Hinter einer Tür mit billigem Plastikaufdruck in Holzoptik befand sich das Wohnzimmer, das eher zweckdienlich als gemütlich eingerichtet war. Die Tapete war abgenutzt und von Zigarettenrauch gelblich verfärbt. In einer Ecke war sie ausgerissen und hing lose herab. Eine billige Ledercouch mit Récamiere, ein Flachbildfernseher und ein Schrank komplettierten das Ensemble, zu dem auch eine Wiege an der Wand gehörte.
Man musste nicht sonderlich empathisch sein, um die Trostlosigkeit zu erfassen, die der Raum ausstrahlte. Undine warf einen Blick in die Wiege – sie war ebenso zweckmäßig wie das Zimmer, ein einfaches Kissen und eine Decke in einem viereckigen Gitterbettchen. Nicht einmal ein Kuscheltier. »Der Junge zeigte deutliche Zeichen von Unterernährung und Vernachlässigung«, sagte Peter neben ihr. Unbewusst nickte Dina. »Glaubst du, es wird ihm jetzt besser gehen?«
Peter gab ein Schnauben von sich. »Mit unserer Erfahrung? Da fragst du noch?«
Dina fuhr sich über die Stirn. »Nicht hier«, murmelte sie, auch wenn außer ihnen sonst niemand im Zimmer war. Sie zog das Jackett ihres Hosenanzugs zurecht und straffte die Schultern.
»Mir erscheint der Mord mehr als ungewöhnlich«, wechselte Peter das Thema. »Ich meine, die Frau hatte offenbar kein Geld und war mit ihrem Leben und dem Kind hoffnungslos überfordert. Warum tötet jemand sie auf derart ausgefeilte Weise? Wo liegt das Motiv?«
»Wie du schon sagtest, war die Tote überfordert. Ich vermute, dass sie mit einer ganz bestimmten Absicht ausgestellt und hergerichtet wurde.« Undine machte eine halbe Drehung in den Raum hinein und ließ ihren Blick darüber schweifen. »Die ganze Wohnung zeugt davon, dass sie mit ihrem Leben abgeschlossen hatte. Für sie gab es keine Wünsche mehr und auch keine Hoffnung, dass die Situation sich jemals wieder ändern würde. Diese Hoffnungslosigkeit hat sie schließlich auf ihr Kind übertragen, indem sie es nicht mehr versorgte.«
»Das ist herzlos.«
»Das ist nur allzu menschlich. Für sie lag kein Sinn mehr darin, dem Jungen mehr Aufmerksamkeit angedeihen zu lassen als nötig. Er würde in ein ebenso trostloses Dasein hineinwachsen wie sie auch. Dass der Junge schrie und von ihr Aufmerksamkeit und Zuneigung forderte, hat sie zusätzlich unter Druck gesetzt und ihre seelischen Qualen gesteigert.« Sie zeichnete mit der Fingerspitze einen Kreis in die Luft. »Es war eine Spirale, die sich unaufhaltsam nach unten drehte – sie gab auf, vernachlässigte ihr Kind, die Vernachlässigung forderte sie, woraufhin sie noch mehr aufgab … es ging steil bergab.«
Peter schnaubte abfällig. »Das erklärt aber nicht, warum jemand der Meinung ist, sie wie einen Eiszapfen präsentieren zu müssen.«
»Ich weiß nicht, wieso«, sagte Dina leise, weil ihr ein Gedanke kam, »aber ich werde das Gefühl nicht los, dass die beiden Dinge miteinander zusammenhängen. Aber dafür muss ich erst mehr wissen. Was mich nicht loslässt, ist die Drapierung der Leiche.«
»Die betende Haltung?«
Dina schüttelte den Kopf. »Nein, nein, sie betet nicht, sie hält etwas in den Händen. Streichhölzer. Erinnert dich das nicht an etwas?« Sie legte den Kopf schief; ihr lag auf der Zunge, was es war, aber sie bekam den Gedanken einfach nicht zu fassen.
Peter wollte antworten, doch das Schrillen der Klingel riss beide aus ihren Überlegungen. Sie gingen in den Flur, wo Sturder bereits dabei war, die Tür zu öffnen. Der herbeigerufene Bestattungsunternehmer war mit einigen Helfern gekommen, um die Leiche abzutransportieren und in die Pathologie zu fahren. Der Transportsarg, den sie zwischen sich schleppten, erinnerte an die harmlosen Dachtransport-Boxen, die man auf den Wagen der Wintersportfreunde sah. Allerdings war deren Inhalt meist weniger vom Verfall betroffen.
Peter trat an einen der Männer heran und sprach leise mit ihm; der nickte und verschwand dann mit seinem Kollegen im Badezimmer. Undine fragte sich, wie sie samt Sarg in dieses Zimmerchen hineinpassen sollten, doch zu ihrer Überraschung kamen die beiden Männer nach einer Weile wieder heraus, mit dem deutlich schwereren Sarg zwischen ihnen. »Hier.« Der hintere Mann hielt Peter während eines kleinen Balanceakts mit der anderen Hand etwas hin. Er trug Latexhandschuhe, und Peter beeilte sich, den Ärmel seines Sweatshirts über die Hand zu ziehen, ehe er den Zettel entgegennahm. Undine ließ sich von Sturder zwei Latexhandschuhe reichen und streifte sie über. Wortlos hielt sie Peter die Hand hin, der die Stirn runzelte, ihr den Zettel aber übergab. Undine war sich sicher, dass er sich so etwas von einer anderen extern hinzugezogenen Mitarbeiterin nicht bieten lassen würde, aber sie war nicht irgendjemand anders. Auch wenn sie sich in seiner Nähe nicht sonderlich wohl fühlte, so war sie jetzt doch froh, dass er hier war. Es erleichterte ihr die Arbeit vor Ort.
Sie bemühte sich, den Zettel nicht mehr als nötig zu berühren, und entfaltete ihn mit spitzen Fingern. »Es war einmal«, las sie laut vor. Die Worte waren am Computer geschrieben und dann ausgedruckt worden.
»Mehr nicht?«, fragte Peter enttäuscht.
Undine zuckte mit den Schultern. »Nur das.«
»Was soll dieser Psychopathen-Profiler-Mist?«, murmelte er halblaut. Er hob die Augenbrauen, als er Undines finsteren Blick bemerkte und dessen gewahr wurde, was er da gesagt hatte. »’tschuldige«, brummte er und tastete mit den Händen fahrig in Richtung der Brusttasche seiner Jacke, zog die Hände aber plötzlich zurück, als ob er sich verbrannt hätte.
»Wann hast du aufgehört?«, fragte Dina.
Ertappt sah Peter auf. »Vor drei Monaten.«
Dina nickte und reichte ihm den Zettel. Diesmal zog Peter auch Latexhandschuhe über, ehe er ihn entgegennahm.
»Ermittelst du auch direkt in dem Fall, oder ist Feldkamp der Chef.«
»Das ist noch nicht raus. Noch wurde keine Sonderkommission gebildet, aber sobald die Soko steht, wird auch der Leiter bestimmt werden.«
Dina musterte Peter, der ihrem Blick auswich. Irgendetwas war da noch im Busch, aber sie konnte den Finger nicht darauf legen, weil sie nicht wusste, was es war. Außerdem hatte sie auch keine Lust weiter nachzubohren. Das würde früher oder später nur zu persönlicheren Themen führen, und die wollte Dina unter allen Umständen vermeiden.
»Dann bleibe ich erst einmal mit Feldkamp in Kontakt«, sagte sie. »Mehr als raten kann ich im Augenblick ja nicht, solange ihr keine Hinweise oder die Ergebnisse der Gerichtsmedizin habt.«
Peter lächelte schief. »So schnell wird die dir keine Ergebnisse liefern. Ich kenne die Leute.«
»Dann mach ihnen Druck. Ihr habt es hier mit einem Täter zu tun, der gerade erst angefangen hat.« Sie lächelte bittersüß. »Und wir werden uns bald am nächsten Tatort wiedersehen.«
Langsam fädelte Dina sich in den Stadtverkehr ein, der sie schließlich von Marzahn in den Wedding spülen würde. Die Fahrt in ihrem kleinen Corsa benötigte theoretisch knapp vierzig Minuten. Während des Feierabendverkehrs konnte sich die Zeit aber durchaus verdoppeln.
Heute war Dina froh über die Verzögerung, während sie mit den Autos vor und hinter sich Stop-and-go spielte. Sie brauchte Zeit, um ihre Gedanken zu ordnen, und das konnte sie beim Autofahren immer am besten. So sicher, wie sie sich Peter gegenüber gegeben hatte, war sie bei Weitem nicht. Es war eine reine Vermutung gewesen, dass der Täter es nicht bei diesem einen Mal belassen würde, aber sie beruhte auf ihrem Instinkt. Es war immerhin Peter gewesen, der ihr beigebracht hatte, genau diesem Instinkt zu vertrauen, und selbst wenn sie mit ihm nichts mehr zu tun haben wollte, so war sie ihm doch dankbar für diese Lektion.
Wer, um Himmels willen, machte sich die Mühe, jemanden mit flüssigem Stickstoff zu töten? Wie funktionierte das überhaupt?
Dina schüttelte den Kopf und kreuzte die Hände auf dem Lenkrad, das Kinn darauf gestützt, während die Ampel, drei Autos vor ihr, von Gelb auf Rot sprang. Sie musste später unbedingt recherchieren, was genau Stickstoff mit dem menschlichen Körper anstellte. Das Bild von Inge Bach stieg vor ihrem inneren Auge auf und jagte ihr einen Schauer über den Rücken. Es war nicht gelogen gewesen, als sie gesagt hatte, dass es nicht ihr erster Tatort war. Aber bei den letzten beiden Mordschauplätzen waren die Toten bereits abtransportiert worden, und alles, was Dina präsentiert worden war, war ein blutiger Fußboden und ein paar zersplitterte Möbelstücke. So etwas wie das hier hatte sie noch nicht gesehen, und sie war sich sicher, dass sie in Zukunft auch darauf verzichten konnte. Aber …
Hinter ihr hupte es laut, und erschrocken würgte Dina den Motor ihres Corsas ab. Fluchend drehte sie den Zündschlüssel im Schloss und drückte den Schalthebel in den ersten Gang.
Fünfzehn Minuten später steckte sie den Schlüssel in das Schloss ihrer Wohnung. Die drei Zimmer lagen nah am Bahnhof Wedding und waren daher so günstig, dass es fast schon lächerlich war. Die Gegend war nicht die beliebteste – auch wenn in Berlin Wohnungsknappheit herrschte, überlegte man es sich dreimal, ob man hierherzog. Die Kriminalitätsrate war absurd hoch, ebenso wie die Zahl der Arbeitslosen.
Undine kannte keine Gegend, in der sie lieber wohnen würde. Sie mochte die Ehrlichkeit, die hier herrschte. Wenn der Typ aus der U-Bahn-Station einem vor die Füße spuckte, war das ebenso ehrlich gemeint wie die leckeren Kuchenstücke, die Frau Irgens aus dem Erdgeschoss manchmal zu Dina heraufbrachte.
Daher störten sie die angekokelten Stuckarbeiten im Treppenhaus und das abgesplitterte Holzgeländer auch nicht, als sie die Stufen zu ihrer Wohnung hinaufging.
Hinter ihrer Eingangstür empfing sie weiches Sonnenlicht, das durch die hohen Fenster strömte. Obwohl Dinas Wohnung im Vorderhaus lag, direkt zur Straße hin, war es dort recht ruhig. Die Sonne schien noch herein, obwohl weiter im Osten bereits dicke Wolken heranzogen. Vielleicht würde der erste Schnee des Jahres doch nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Schon beim Hereinkommen sah Dina die Anzeige ihres Telefons blinken – eine neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Mit einem ergebenen Seufzen drückte sie die Abspieltaste; eine männliche Stimme meldete sich: »Hey … hey, hallo, Undine. Du hattest ja gesagt, dass wir noch einmal telefonieren können. Ja … also, wie du siehst, ich rufe dich gerade an, aber du bist nicht da. Ich würde dich gerne noch einmal treffen; es gibt etwas, was ich dir zeigen möchte. Komm doch morgen gegen drei einfach bei mir auf der Arbeit vorbei. Ich sag an der Kasse Bescheid, dann lassen sie dich durch. Okay, dann bis morgen!«
Dina seufzte abermals, diesmal eher genervt als ergeben. Sie hatte Mike völlig vergessen. Aus einer Weinlaune heraus hatte sie sich auf dieser Flirtplattform angemeldet, und Mike hatte ihr daraufhin als Erster geschrieben. Sie hatten sich sogar getroffen – allerdings war er wesentlich begeisterter von ihr gewesen als sie von ihm. Dennoch hatte sie die Sache nicht sofort beendet. Rosa, ihrer besten Freundin gegenüber, hatte sie behauptet, dass sie glaubte, es könne sich noch etwas zwischen ihnen entwickeln, aber insgeheim wusste Dina, dass sie sich nur davor drückte, mit der Last von Mikes eingebildetem Liebeskummer herumlaufen zu müssen. Sie hatte gelernt, sich weitestgehend vor den Gefühlen anderer Menschen zu schützen, aber wenn sie müde, gestresst oder sonst wie aufgewühlt war, wurde diese Barriere brüchig. Vor jemandem zu stehen und ihm den Laufpass zu geben kam einer Einladung zur Depression gleich. Dina wollte diesen unangenehmen Moment so lange wie möglich aufschieben. Da sie nicht wusste, wie sie mit Mikes neuerlicher Einladung umgehen sollte, beschloss sie kurzerhand, sich erst morgen früh damit zu beschäftigen. Sie nestelte ihren Kaschmirschal und danach den Mantel auf. Beides wanderte ordentlich in den »guten« Schrank, ein voluminöses Möbelstück aus der Ikea-Filiale Tempelhof, das fast das gesamte Wohnzimmer einnahm. Der Rest des Raums war gefüllt mit Schuhregalen und kleineren Garderobenständern, an denen diverse Schals und Tücher hingen. Die Schränke beherbergten Kleidung von Gucci, Joop und Chanel, und in den Schuhschränken stapelten sich Pumps von Manolo Blahnik, Miyake und anderen Edeldesignern.
In den Regalen, Ablagen und Schränken im Badezimmer sah es ähnlich aus – teure Kosmetika und Pflegemittel-Tiegelchen im Wert von mehreren Hundert Euro lagen wild durcheinander.
Der Kontrast zum Schlafzimmer hätte nicht größer sein können – der Raum wurde von einem großen Bett eingenommen, daneben standen ein wesentlich schmalerer Schrank und eine Kommode. Neben dem Bett und auf der Kommode lagen Sweatshirts, Jerseyhosen und dicke Socken durcheinander. Keines dieser Teile trug irgendeinen teuren Markennamen oder wirkte besonders hochwertig. Die Sachen waren durchweg ausgebeult und alt. Das einzige Dekostück im Zimmer war ein silberner Bilderrahmen, in dem ein Foto von drei Kindern steckte. Das Sonnenlicht brach sich in dem polierten Glas, und Dina griff danach. Die Kinder auf dem Bild waren nicht älter als zehn; sie hatten die Arme um die Schultern des jeweils anderen gelegt und grinsten gut gelaunt in die Kamera.
Undine erinnerte sich, dass sie an diesem Tag gar nicht so fröhlich gewesen war, wie sie aussah. Sie hatte sich von den anderen beiden anstecken lassen und so breit gegrinst, weil die zwei es taten. Sie hatten immer alles gemeinsam getan – Rosa, Peter und Dina, ein unzertrennliches Trio.
Dina stellte das Foto wieder ab und massierte mit den Fingern die Schläfen. Das alles war lange her, so unglaublich lange schon. Sie merkte, dass sich ihre Kehle zuschnürte. Die Erinnerungen an diese Zeit waren noch immer schmerzhaft. Das Zusammentreffen mit Peter an diesem grauenvollen Tatort hatte diese Ereignisse jedoch unbarmherzig wieder ans Tageslicht gezerrt, und Dina wusste nicht, wie sie sie nun wieder ins Dunkel zurückstoßen sollte.
Am Tatort hatte sie sich ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren können, aber jetzt, in der Ruhe ihrer eigenen vier Wände, merkte sie erst, wie sehr das Wiedersehen mit Peter sie aufgewühlt hatte. Immerhin war es seine Schuld gewesen, dass das Trio vor einem Jahr unwiderruflich auseinandergebrochen war. Er hatte Rosa wehgetan und Dina damit tief enttäuscht. Sie hatte immer viel von Peter gehalten, hätte ihn vor jedem anderen Menschen verteidigt, wäre für seine Ehre eingetreten – und dann hatte Peter selbst alles zerstört.
Ein bitterer Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus, und sie spürte zu ihrer eigenen Überraschung Feuchtigkeit über ihre Wangen rinnen. Verlegen wischte sie die Tränen weg und betrachtete sich im Spiegel. Nein, sie konnte nicht zulassen, dass dieser Mann in ihr Leben zurückkehrte. Das war sie Rosa schuldig; sie konnte an diesem Fall nicht mitarbeiten, egal was sie am Morgen gesagt hatte. Nachdem sie tief eingeatmet hatte, griff Dina nach ihrem Handy und rief Jürgen Feldkamp an.
Jürgen Feldkamp besaß eine natürliche Autorität, um die Peter ihn insgeheim immer beneidet hatte. Der ältere Mann mit der Hornbrille, der bulligen Statur und dem fliehenden Haaransatz machte auf den ersten Blick einen farblosen Eindruck, aber sein jüngerer Kollege hatte schon oft miterlebt, wie Jürgen in den unterschiedlichsten Situationen mit ungeahnten Talenten aufwarten konnte. Auch jetzt stand er vor der versammelten Mordkommission des Präsidiums, die Arme vor der Brust verschränkt, und ließ den Blick über die Menschen vor ihm schweifen.
Mit zwanzig Mann war der kleine Besprechungsraum voll, einige der Kollegen mussten sogar stehen, weil nicht genügend Stühle vorhanden waren. Dennoch beschwerte sich niemand, alle hatten den Blick auf den kleinen Mann vor der Glastafel gerichtet. »Wie die meisten von Ihnen bereits mitbekommen haben, hat heute in Marzahn ein Mord stattgefunden, der, sagen wir mal so, alles andere als gewöhnlich ist. Wir haben Glück gehabt, dass es heute eine Störung im Polizeifunk gab und wir daher noch keine Aasgeier von der Presse am Tatort herumschwirren hatten. Dennoch ist Eile geboten – dieser Mord muss schnellstmöglich aufgeklärt werden. Das heißt, wenn Sie sich für die Soko bewerben, erwarten Sie viel Arbeit, viel Druck, sowohl von innen als auch von außen, wenig Schlaf und jede Menge Frustration. Den Kaffee bekommen Sie allerdings umsonst.«
Ein höfliches Lachen ging durch die Reihen, aber Peter, der in der hinteren Ecke des Raumes saß, sah in vielen Gesichtern die aufgekeimte Hoffnung von der nackten Realität überrollt zu werden. Als Mitglied einer Sonderkommission ausgewählt zu werden, die sich mit einem Fall wie dem des Stickstoffmörders befasste, konnte einen raschen Aufstieg auf der Karriereleiter bedeuten. Was viele freilich nicht bedacht hatten, war, dass es harter Arbeit bedurfte und die Chancen höher lagen, dass man scheiterte. Peter kam nicht umhin, Jürgens Entschluss, das gleich allen klarzumachen, zu bewundern. Er selbst war zwar schon mehrmals Teil einer Soko gewesen, aber an einem Fall wie diesem hatte er bisher noch nie mitgearbeitet. Und die viele Arbeit erschien ihm eher wie ein Bonus als wie eine Bürde. So musste er sich zumindest keine unangenehmen Fragen darüber anhören, warum er nicht nach Hause fuhr oder schon wieder eine Nacht im Büro verbracht hatte.
Er bemerkte, dass er an seiner Brusttasche herumspielte, und zog rasch die Hand zurück. »… Ihre Bewerbung dann auf meinem Schreibtisch«, beendete Feldkamp gerade seinen Vortrag. Die Kommissare standen auf, Stühle rutschten quietschend über den Boden, und vielstimmiges Gemurmel erfüllte den Raum. Peter stand auf und ging nach vorn zu Feldkamp. »Herzlichen Glückwunsch zur Leitung der Soko«, begrüßte er den älteren Kollegen mit einem schiefen Grinsen und streckte ihm die Hand entgegen. Feldkamp winkte ab. »Ne, ne, so weit sind wir noch lange nicht. Ich soll lediglich, die Mitglieder auswählen und die Sache im Vorfeld koordinieren. Wer die endgültige Leitung dann übernimmt, wird noch entschieden. Allerdings hätte ich dich schon gerne an Bord. Sag mir einfach, dass du dabei bist, und die Sache ist geritzt.«
Peter fühlte sich geschmeichelt und nickte. »Natürlich.«
Feldkamp lachte, was die Falten in seinen Augenwinkeln stärker hervortreten ließ. »Natürlich – klasse! Das klingt, als wärst du wirklich heiß auf die Sache.«
Peter fühlte sich ertappt; er zuckte mit den Schultern und räusperte sich. »Hast du schon jemanden im Auge, den du für die Soko haben willst?«
Sie sahen beide zur Tür, wo sich gerade die letzten Zuhörer hindurchquetschten. »Es gibt ein paar Leute, die geeignet wären, aber ich würde gerne einigen der jüngeren Kollegen eine Chance geben. Die sind meist mit mehr Biss bei der Sache und hängen sich richtig rein.«
»Na, dann hoffe ich doch, dass ein paar davon sich trauen, eine Bewerbung abzugeben.«
In diesem Moment klingelte Feldkamps Handy. Peter nickte ihm zu, zum Zeichen, dass er gehen würde, und ließ seinen Kollegen allein mit seinem Telefonat. Auf dem Weg zu seinem Büro machte er am Kaffeeautomaten halt. Die endgültige Zusammenstellung der Soko würde erst morgen erfolgen, aber Peter wollte so viel Vorarbeit leisten wie möglich. Wenn er jetzt die einzelnen Zeugenaussagen der Nachbarn um Inge Bachs Wohnung durchging, konnte es womöglich die ganze Nacht dauern, bis er fertig war. Perfekt.
Peter nahm sich eine Tasse Kaffee, setzte sich an seinen Schreibtisch und begann mit der Arbeit einer langen Nacht.
Der Morgen nach der Besichtigung der Leiche fühlte sich unwirklich an. Dina wusste, dass es nicht nur an der Toten lag, sondern auch damit zusammenhing, dass sie Peter so unerwartet wiedergesehen hatte. Aber genau das war ja der Grund gewesen, wieso sie den Job aufgegeben hatte. Dennoch ließ sie die Sache nicht los. Sie erinnerte sich daran, im Traum Peters Gesicht gesehen zu haben, dessen Augen sie stumpf angestarrt hatten, bis sie bemerkte, dass es sich bei dem glotzenden Gesicht gar nicht um Peters Kopf, sondern um den von Inge Bach, der Frau, die mit Stickstoff ermordet worden war, gehandelt hatte.
Spätestens jetzt hätte sie den Job abgesagt.
Zum Glück hatte sich Feldkamp, der Polizist, der sie angefordert hatte, als verständnisvoll erwiesen und sie lediglich daran erinnert, dass sie laut Vertrag zu Stillschweigen verpflichtet war.
Heute wollte Dina nichts mehr von irgendwelchen Leichen oder stoppelbärtigen Bullen wissen – sie würde sich eine Pizza bestellen, die Tür abschließen und den Tag vor der Glotze verbringen. Das dachte sie zumindest.
Das Klingeln des Telefons löste diese Pläne in Luft auf … Dina hoffte, dass es Rosa war, doch als sie den Hörer ans Ohr drückte, hörte sie nur Mike. »Hey, Undine.«
Sie bemühte sich, nicht zu tief einzuatmen – die Einladung! Die hatte sie völlig vergessen. »Oh, verflixt, Mike, entschuldige, ich wollte mich noch melden …«
»Schon gut.« Seine Stimme klang enttäuscht, auch wenn er sich bemühte, es zu verbergen. Dina spürte einen scharfen Stich, als ihr schlechtes Gewissen sich meldete. »Ist denn alles in Ordnung mit dir? Ich hatte schon Angst, dass dir etwas zugestoßen ist.«
»Nein, es ist alles okay. Ich hatte nur so furchtbar viel um die Ohren«, entschuldigte sie sich hastig, und auch wenn es keine Lüge war, fühlte sie sich mies.
»Ach, das kenne ich. Wenn bei uns die Bären wieder in Paarungsstimmung sind, komme ich auch kaum nach Hause.«
Dina musste kurz überlegen, wie Mike auf Bären kam, bis ihr wieder einfiel, dass er als Pfleger im Berliner Zoo arbeitete. Sie zwang sich zu lächeln. »Siehst du. Ich würde meinen Fehler aber gerne wiedergutmachen.«
»Das kannst du.« Sie konnte spüren, dass auch er lächelte. Ein alter Trick, den ihr Professor ihr mal gezeigt hatte, wenn man selbst lächelte, erwiderte das Gegenüber diese Geste in neun von zehn Fällen und wurde dadurch positiver gestimmt. Die Geste allein reichte schon aus, um die Stimmung zu manipulieren. Und es funktionierte selbst ohne Blickkontakt.
»Die Überraschung ist noch da. Komm doch einfach später vorbei.«
Dina warf einen Blick auf ihr Handy; es war kurz nach vier. Sie konnte in einer guten halben Stunde am Zoo sein. Und Rosa hatte ihr ja auch gestern noch geraten, dass sie endlich mal wieder rauskommen solle.
»Gut, ich bin dann gegen halb fünf da.«
»Super! Frag an der Kasse einfach nach mir, dann lassen sie dich so rein.«
»Was für eine elende Schweinerei!« Jürgen Feldkamp, Leiter der Sonderkommission zur Untersuchung des Mordes an Inge Bach, rieb sich über das stoppelige Kinn und erweckte nicht gerade den Eindruck, als ob ihm der penetrante Leichengeruch viel ausmachen würde. Peter dagegen gehörte zu der Sorte Polizisten, die den Geruch trotz Kampfersalbe unter der Nase einfach nicht ignorieren konnten. Er hatte jedes Mal das Gefühl, in kaltem Schweiß zu baden, wenn er die Räume der Pathologie betrat.
Er hatte einige unbequeme Stunden mit dem Gesicht auf seinem Schreibtisch verbracht, und auch der trübe Kaffee, den er literweise getrunken hatte, hatte nicht dazu geführt, dass er sich besser fühlte.