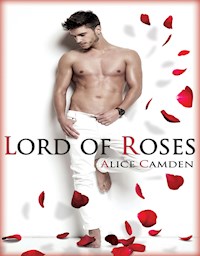Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dead soft verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Im Schatten der Todessteine
- Sprache: Deutsch
Während Jannis und Talin ihre gefährliche Reise nach Valan fortsetzen, findet ausgerechnet der sorglose Valaner Kalen, der sein Leben bisher als trinkfester Jungpriester im Tempel genossen hat, einen schwer verletzten Jungen in den Todessteinen. Er ist gezwungen, sich um den stummen Jungen zu kümmern und gleichzeitg gegen die bösen Mächte zu kämpfen, die ihn zu verfolgen scheinen. Was hat es mit dem jungen Sami auf sich? Und an welchem Punkt kreuzt sich seine Schicksalslinie mit der von Jannis und Talin?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alice Camden
Höllenauge
Im Schatten der Todessteine
Impressum
© dead soft verlag, Mettingen 2016
http://www.deadsoft.de
© the author
Cover: Irene Repp
http://www.daylinart.webnode.com
Bildrechte
© karl umbriaco – shutterstock.com
© Yeko Photo Studio – fotolia.com
© Thomas Otto – fotolia.com
1. Auflage
ISBN 978-3-945934-73-9
ISBN 978-3-945934-74-6 (epub)
Kapitel 1 – Jannis
„Kraaaahhh!“ Der laute Schrei eines Raben riss Jannis aus seinen Gedanken. Für einen Moment blieb er stehen und sah sich um. Er wollte sich alles ganz genau einprägen. Dieser Wald war sein Zuhause und jetzt war er kurz davor, ihn für eine unbestimmte Zeit zu verlassen. Ein Gefühl von Enge schob sich um seine Brust. Ob er diesen Ort wohl je wiedersehen würde? Die Bäume, die Sträucher, die kleinen Blumen auf den Lichtungen, sie waren für lange Zeit seine einzigen Freunde gewesen. Treue, stumme Freunde, die sich all seine Sorgen angehört und ihn nie weggejagt hatten. Mit geschlossenen Augen atmete Jannis die frische Waldluft ein. Sie roch nach Moos, Rinde und dem modrigen Waldboden. Er blinzelte und sah hinauf zum Himmel, der hier und da durch das Blattwerk schimmerte. Die Sonne spiegelte sich in den Blättern und die Vögel sangen fröhlich in den hohen Kronen der Bäume. Es war ein warmer Sommernachmittag und Jannis freute sich über die Kühle und den Schatten im Wald.
Bald würde der Finsterwald hinter ihnen liegen, dachte er und fühlte sich wehmütig und zugleich neugierig auf das, was vor ihm lag. Die ersten Ausläufer der Todessteine wurden noch vom Waldrand verdeckt, aber Jannis wusste, es war jetzt nicht mehr weit. Und hinter dem Gebirge lag Valan. Schon der Name des Landes ließ ihn lächeln. Es klang nach Abenteuer und Freiheit. Doch schnell schoben sich dunkle Gedanken vor seine Freude.
Talin und er waren nicht zum Vergnügen auf dieser Reise. So oft sie auch zusammen von Talins Heimat träumten, so sehr war ihnen bewusst, sie waren noch lange nicht dort angekommen. Der Wolfsfluch in Talin war noch nicht gebrochen, der Mord, der ihm angelastet wurde, noch nicht aufgeklärt und sie würden mächtige Verbündete brauchen, um all das zu schaffen. Jannis seufzte und beeilte sich, Talin einzuholen. Bald lief er wieder hinter seinem Gefährten her. Um die Sorgen aus seinem Kopf zu vertreiben, begann er, das Wolfslied zu singen.
„Jannis, mein Freund, wenn ich noch einmal das Lied vom Wolf hören muss, ringe ich dich auf der Stelle nieder und sorge dafür, dass du ein anderes Lied singst.“ Talin lachte, drehte sich um und stieß Jannis mit dem Ellbogen in die Seite.
„Du kannst ja ein valanisches Lied singen“, antwortete Jannis und zuckte mit den Schultern.
„Ich singe dir gleich ein valanisches Lied vor. Das vom Wolf, der ein Eichhörnchen frisst.“ Grinsend fuhr Talin ihm mit einer Hand durchs Haar und richtete ein Chaos auf seinem Kopf an.
„Hey, Valaner. Lass das!“, protestierte Jannis. Vorsichtig tastete er nach seinen blonden Haaren.
„Ah Grünthaler, so siehst du jeden Morgen aus. Ich weiß nicht, mit welchen wilden Tieren du in der Nacht kämpfst, aber morgens siehst du aus, als wäre eine Katze auf deinem Kopf gestorben.“
Jannis schlug mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf seines Freundes. Bevor er die Hand zurückzog, strich er wie zufällig durch das weiche schwarze Haar. Er sah zu seinem lachenden Gefährten und bewunderte für einen Augenblick die langen dunklen Wimpern, die seine braunen Augen umrandeten. Die schwarze Uniform der Kettenwerfer, die sein Gefährte trug, war inzwischen an vielen Stellen abgewetzt. Doch sie war gewaschen und der große schlanke Valaner sah für Jannis immer noch wahnsinnig beeindruckend aus. Talin hatte den Kopf in den Nacken gelegt und lachte herzhaft. Insgeheim freute Jannis sich, dass sein Freund heute so albern war. Jannis kannte ihn hochmütig, niedergeschlagen und todtraurig. Ab und an war er gierig und dann wieder sanft und zärtlich. Aber Jannis mochte ihn am liebsten albern und ausgelassen. Schon griff Talins Hand nach ihm.
„Wie, du schlägst mich schon wieder? Jetzt bist du dran!“ Wieder lachte Talin und Jannis hätte schwören können, in seinen Augen zuckten Blitze. Scheinbar eingeschüchtert rannte er los. Seine ganze Kindheit war er durch den Wald gelaufen. So schmal er war, so schnell konnte er rennen. Hätte er sich wirklich angestrengt, vielleicht wäre er Talin davongelaufen. Doch seinem Liebsten davonzulaufen, war das Letzte, was er wollte. Schnell ließ er den Valaner an einer Lichtung herankommen und fand sich einen Moment später auf dem Boden wieder, sein Gesicht in das weiche Gras gepresst. Talin lag mit seinem ganzen Gewicht auf ihm und flüsterte ihm ins Ohr: „Hör gut zu. Jetzt singe ich das Lied vom Wolf und vom Eichhörnchen.“
Ehe er etwas erwidern konnte, hatte ihn sein Gefährte von seiner Hose befreit und biss ihm in eine Hinterbacke.
Da ist er wieder, der wilde Wolf, dachte Jannis erfreut. Was, wenn er Talin noch mehr seiner Lebenszeit geschenkt hätte? Wenn schon zwei Monate so einen Unterschied in Talins Kraft bewirkten, was hätten erst sechs Monate ausgemacht? Der Wolfsfluch raubte Talin nach wie vor bei jeder Verwandlung die Lebenskraft. Immerhin besaß er jetzt wieder Kräfte, die man ihm rauben konnte, dachte Jannis erfreut.
Talins Zunge begann einen Tanz an Jannis’ Hintereingang, und er hörte auf zu denken. Seine Hüfte bewegte sich im Takt. Irgendwann in den letzten Tagen hatte Talin ihm die letzte Scham aus dem Körper geküsst. Jannis fühlte, wie er umgedreht wurde, und ganz von selbst schob er sein Bein über Talins Schulter. „Hmmm, vor einem Augenblick ist das Eichhörnchen noch vor mir geflüchtet und jetzt kann es nicht erwarten, geschossen zu werden.“ Talin grinste.
Jannis trat ihm mit dem Fuß sanft gegen die Brust. „Den Blitzspruch kann man auch durch die Füße schicken, Hoheit“, schnaufte er.
„Dann bleibt mir keine Wahl. Ich muss mich anstrengen, damit dir kein Spruch mehr einfällt.“ Talin lächelte und küsste Jannis auf den Fuß. Viel Zeit ließ er sich heute nicht mit der Vorbereitung des Rittes. Dann begann er, seinen Weg in Jannis zu suchen, und bewegte sich erst langsam und bald immer schneller in ihm. Jannis verlor sich in Talins Rhythmus. Ja, das war das Lied.
„Talin, wir haben keine Zeit. Es war gefährlich, bei Tag zu reisen. Schau, es wird langsam Abend. Lass uns eine Höhle für die Nacht suchen.“
Erschöpft lagen sie eine Weile später zusammen im weichen Gras und Jannis zupfte an einer von Talins schwarzen Strähnen.
„Es ist uns doch niemand begegnet. Es ist angenehmer, bei Tag als Mensch zu reisen, und nicht in der Nacht als Wolf. So können wir in der Nacht rasten und müssen uns nicht am Tag mühsam ein Versteck suchen“, erklärte Talin.
Jannis schüttelte den Kopf. „Es ist trotzdem gefährlich.“
Er stand auf, klopfte sich die letzten Blätter vom Körper und half Talin auf die Füße. „Komm, Prinz Sorglos, lass uns endlich in dieses von allen Geistern verlassene Gebirge aufbrechen.“ Jannis wollte nicht zugeben, dass er nur zu gerne im weichen Gras liegen geblieben wäre. Seufzend kam er auf die Füße und bot Talin seine Hand als Unterstützung an.
Eine Weile liefen sie lachend und plaudernd nebeneinander, bis Talin Jannis anstieß und sagte: „Hey, sieh nur, die Todessteine!“
Beunruhigt blickte Jannis in die Richtung, in die Talin zeigte. Mächtig erhob sich die Gebirgskette vor ihnen. Schroff ragten die Felsen hoch hinaus und auf den Gipfeln war Schnee zu erkennen. Jannis hatte seine Mutter ein einziges Mal zur letzten offenen Handelshöhle begleitet, die der große Tempel von Valan für die Heiler aus Grüntal in den Todessteinen betrieb. Der Tempel schickte jeweils einen Priester für vier Wochen in die versteckte Höhle. Nur die Heiler kannten ihre Lage. An diesem einsamen Ort hatte seine Mutter Tränke und Tinkturen gegen Heilpflanzen aus Valan getauscht. Wein und Lebensmittel aus Grünthal nahmen die Priester gerne. Der Weg zur Höhle dauerte fast einen ganzen Tag und war beschwerlich. Hoch oben lag sie, fernab der Hauptroute. Er konnte sich noch gut erinnern, wie seine Mutter ihn das letzte Stück tragen musste. Jannis schauderte bei dem Gedanken, fünf, vielleicht sechs Tage, in diesem Gebirge verbringen zu müssen.
„Hier beginnt eine Route, die neben der Hauptpassage verläuft“, erklärte Talin und zeigte auf die schmale Schlucht, die sich vor ihnen auftat. Eng schlängelte sie sich bis weit nach oben. Der Abstieg war von ihrem Standpunkt aus nicht zu erkennen. Jannis versuchte, sich auf Talins Worte zu konzentrieren. „Diese Route hat steile Aufstiege und die Wege über die Berge sind oft schmal, die Schluchten eng. Aber die Heiler, die nach Valan wandern, werden sie nicht nutzen. Als ich vor einigen Monaten aus meiner Heimat geflohen bin, habe ich diesen Weg genommen“, erklärte Talin weiter.
Jannis nickte. „Gut. Ein Kettenwerfer und ein grünthaler Heiler erregen zu viel Aufsehen auf der Hauptroute. Wieso kennst du die Nebenroute eigentlich?“
„Die Verwandlung mag schmerzhaft sein, aber die Wolfsgestalt hat einige Vorteile. Ich bin schnell im Gelände und kann solche Routen leicht auskundschaften. Ich konnte zwar nur bei Tag als Mensch reisen, weil dem Wolf meine Uniform zu schwer gewesen wäre, doch der Wolf konnte diesen Weg in der Nacht auskundschaften.“
Vorsichtig tasteten sie sich hintereinander durch die Schlucht, die kaum breiter als ein valanischer Mann war. Die hohen Gipfel warfen lange, drohende Schatten durch die Schlucht und Jannis fühlte sich unbehaglich in der fremden, unwirtlichen Umgebung. Er hoffte, sie würden schnell vorankommen. Eine Weile liefen sie, achtsam auf jeden Schritt, an immer gleich aussehenden Felsen, Steinen und Geröllhaufen vorbei.
Bis Talin endlich stehen blieb und sagte: „Hier, schau. Die Höhle sieht doch gut aus. Sie ist groß genug und wir können die Nacht geschützt vor Wind und Kälte darin verbringen.“ Er zeigte auf den großen Höhleneingang, der direkt vor ihnen lag. Jannis legte den Kopf zur Seite und betrachtete die Höhle.
Es war eine der alten Handelshöhlen, die es selbst auf dieser Nebenroute gab. Sie war groß und der Tisch aus Steinen war noch vorhanden. Der hintere Teil war eingefallen. Durch Lücken in der Wand aus Geröll konnte man einen Verbindungstunnel sehen. Ein ganzes System dieser Tunnel verband einst die Höhlen untereinander. Jetzt waren sie verfallen oder drohten einzustürzen. Jannis betrat die düstere Höhle. Sie war weitläufig und man konnte überall aufrecht stehen. Schließlich sah er sich den lebensgefährlichen Gang am Ende genauer an. Der Einstieg zu dem Verbindungsgang war fast vollständig von Steinen bedeckt. Nein, betreten konnte man ihn nicht, doch als Kamin war er noch brauchbar. Er nickte Talin zu. An Jannis’ Tasche baumelten zusammengeschnürt einige dünne trockene Äste, die sie unterwegs gesammelt hatten. Er schichtete sie auf und zündete mit Magie ein Feuer vor der steinernen Wand im hinteren Höhlenteil an. Tatsächlich, der Rauch wurde durch die lockeren Steine in den Verbindungstunnel geleitet.
„Eine gute Idee. Auch wenn mich deine Mutter für immer hasst, ich bin froh, dass du bei mir bist“, bemerkte Talin und strich Jannis anerkennend über den Kopf.
„Als würde ich dich verfluchten Wolf alleine durch diese steinige Hölle schicken“, erwiderte Jannis schroff. Aber er musste lächeln.
Talin grinste breit. „Verflucht oder nicht, alles, was dafür sorgt, dass du morgens nicht neben mir aufwachst, ist eine schlechte Idee.“ Er beugte sich vor und Jannis fühlte die vertrauten Lippen auf seinen. „Deine Mutter ist eine erstaunliche Heilerin. Dieser Stärkungstrank ist unglaublich. Ich fühle mich so viel besser. Ich schwöre, vor ein paar Tagen dachte ich noch, ich überlebe den nächsten Tag nicht, und jetzt …“ Er schob seine Hand unter Jannis’ Hemd.
„Und jetzt willst du dafür sorgen, dass ich den nächsten Tag nicht erlebe, weil ich vor Erschöpfung sterbe?“, fragte Jannis und sah zur Seite. Talin sollte sein nachdenkliches Gesicht nicht sehen. Jannis zuckte unwillkürlich, wenn er an das dachte, was hinter ihm lag. Es war der schlimmste Moment seines bisherigen Lebens gewesen, als er bemerkte, dass er zusammen mit seinem toten Geliebten in die Welt des Lichts gefallen war. Am Ende hatte ihnen ein Fuchsgeist geholfen, und mit zwei Monaten von Jannis’ eigener Lebenszeit war Talin in der Lage, weiterzuleben.
Zwei weitere Monate hatten sie nun, um Talins Fluch zu brechen. Der uralte Fluch zwang seinen Gefährten, sich jede Nacht unter schrecklichen Schmerzen in einen Wolf zu verwandeln und jeden Morgen bei Sonnenaufgang zurück in einen Menschen.
Talin wusste nichts von all dem. Er war am Morgen lebendig neben Jannis aufgewacht und konnte sich nicht an seinen Tod erinnern. Warum sollte Jannis es ihm auch erzählen? Sicher würde Talin sich aufregen, mit ihm schimpfen, und es würde nichts ändern. Langsam drehte er den Kopf zu seinem Gefährten und zwang sich zu einem Lächeln.
„Schön, dass der Trank so gut wirkt“, sagte er und fühlte sich wie ein Verräter. „Gib mir das Kaninchen, das wir heute Mittag geschossen haben, die Sonne wird bald untergehen und dann …“
Eine fremde Stimme unterbrach ihn. „Heute Mittag waren sie die Jäger und jetzt sind sie die Beute. Na dann, lasst uns diese zwei Kaninchen festhalten, bis der Meister kommt.“
Jannis’ Kopf fuhr herum. Im flackernden Licht des Feuers stand eine Gruppe vermummter Gestalten. Sieben zählte er. Sie trugen schwarze Roben, die Kapuzen so tief über die Gesichter gezogen, dass sie nur durch einen Schlitz sehen konnten. Auf ihren Roben waren in roter Farbe Vögel abgebildet. Rabenvögel.
Jannis hörte das Klirren von Talins Wurfsternen und wusste, sein Gefährte machte sich bereit, zu kämpfen. Schnell griff er nach seinem Jagdmesser. Er fühlte, wie der Angstschweiß auf seine Stirn trat, seine Hand zitterte. Doch die Ereignisse der letzten Tage machten ihn mutig. Wenn sie Bärenfallen, Höllendämonen und verrückte Priester erledigen konnten, hatten sie eine Chance gegen eine Truppe Wegelagerer in merkwürdiger Aufmachung.
„Wer seid ihr und was wollt ihr von uns?“, fragte er, viel lauter als beabsichtigt.
„Bannt den Kettenwerfer!“, kam es unter einer der Kapuzen hervor.
Drei der Gestalten traten vor, hielten die Hände vor den Körper und sprachen einen Bannspruch aus, der Talin so hart traf, dass er sofort in seiner Bewegung verharrte. Jannis’ Glieder zuckten vor Schreck heftig. Magie? Aber Wegelagerer konnte doch niemals Magie wirken. In Grünthal konnten nur … nur Heiler Magie ausüben. Was ging hier vor sich? Jannis sah, wie Talin mit einer Hand einen seiner Wurfsterne umklammerte. Der Zauberspruch ließ seine Hand krampfen, der spitze Stern bohrte sich gnadenlos hinein. Blut tropfte auf den Höhlenboden. Jeder Tropfen nahm ein Stück von Jannis’ Mut mit sich. Talin, der Krieger, der mutige Kettenwerfer, gebannt? Ein flaues Gefühl breitete sich in Jannis’ Magen aus. Dort, wo gerade noch der Mut in ihm aufgeflammt war, machte sich jetzt Hoffnungslosigkeit breit. Seine Hand verkrampfte sich ebenso wie die seines Gefährten. Es war fast, als könnte er den stechenden Schmerz an seiner eigenen Hand fühlen. Was konnte er alleine schon ausrichten? Zwei Gestalten kamen auf ihn zu, umrundeten ihn und nickten sich zu.
„Ein valanischer Kettenwerfer, so nah an Grünthal und in Begleitung eines grünthaler Jungen, das ist zu merkwürdig. Der Meister wird das wissen wollen. Sperren wir sie hier ein, bis er zurück ist. Soll er entscheiden, was mit ihnen geschieht.“
Der Vermummte sprach eindeutig in der Sprache Grünthals. Panisch versuchte Jannis, seine Gedanken zu ordnen. Magier, und sie hatten einen Meister?
„Er hat nicht gesagt, wann er zurück ist. Es kann Wochen dauern. Was machen wir so lange mit den beiden?“, fragte der andere. Wochen? Das konnte nicht sein. Wieso sollten sie Wochen hier eingesperrt werden? Jannis fühlte sich wie ein eingesperrtes Tier zwischen den Gestalten, die ihn immer noch umrundeten. Raus! Er musste sofort hier raus, und er musste Talin mitnehmen! Immer mehr Panik kroch durch seine Glieder, ließ sie unruhig zucken. Hektisch suchte er die Höhle mit den Augen ab. Wo war der Ausweg, die Rettung? Sie mussten zur Rabeninsel. Talins Freunde warteten doch auf Nachricht von ihnen. Sie durften jetzt nicht aufgehalten werden! Jannis fühlte, wie sein Magen vor Angst rebellierte.
„Nein!“, rief er und wollte eine der Gestalten mit dem Messer attackieren. Er hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, da wurde er von einer Kraft erfasst und gegen die Höhlenwand geschleudert.
„Auuuuuu!“, schrie er und fiel auf den Boden. Wieder durchfuhr ihn ein Schmerz bei dem Versuch, aufzustehen. Er strauchelte, krümmte sich und fiel erneut zu Boden. Vorsichtig fuhr er sich mit der Zunge über die Lippen und schmeckte Blut. Es war vorbei. Es gab kein Entkommen, keine Rettung. In seiner Verzweiflung begann Jannis, ein stummes Gebet an die Geister des Lichts zu schicken. Auch den Fuchsgeist, der Talin schon einmal das Leben gerettet hatte, rief er an. Er erhielt keine Antwort und die Verzweiflung verdunkelte seinen Geist. Warum, dachte er. Warum jetzt? Die Reise war so gut verlaufen, sie hatten eine sichere Höhle gefunden ... warum?
Jemand lachte. „Was für ein dummer Junge. Siehst du nicht, dass wir in der Überzahl sind? Warte mein Kleiner, ehe du noch einen irren Gedanken hast, zeige ich dir, mit wem du es zu tun hast“, sagte einer aus der Gruppe der Vermummten.
Einer der beiden Männer, die ihn umrundet hatten, trat an ihn heran. Er legte eine Hand auf Jannis’ Kopf und murmelte einen Spruch. Ein brennender Schmerz breitete sich zuerst in seinem Kopf aus und wanderte schließlich durch seinen ganzen Körper. Es fühlte sich an, als würde er von innen verbrennen.
„Ahhh … Nein, ahhh, nei...!“, schrie er und rollte sich auf dem Höhlenboden zusammen. Ein Wort bohrte sich durch den Schmerz. „Schwarzmagier!“.
Das war ein schwarzmagischer Schadensspruch. Oh nein, sie wurden von einer Gruppe Schwarzmagier bedroht. Nur langsam glitt das grauenhafte Brandgefühl aus seinem Körper. Ganz still blieb er liegen. Nicht bewegen. Totstellen. Wer anderen so schnell Schaden zufügte, würde auch vor einem Mord nicht zurückschrecken. Verzweifelt versuchte Jannis, ein Keuchen zu unterdrücken. Doch im nächsten Moment brach es zusammen mit all dem Brandschmerz aus ihm heraus. Die Steine unter seinem Rücken gaben ihre Kälte nicht frei, vielmehr schienen sie von der magischen Hitze, die langsam seinen Körper verließ, zu glühen. Mühevoll versuchte er, den Kopf zu drehen. Was war mit Talin? Was würden sie ihm alles antun? Aus den Augenwinkeln konnte er erkennen, wie Talin immer noch hilflos gebannt dastand, die Hand um seinen Wurfstern gekrampft. Jannis’ Hand fand einen Stein. Verzweifelt krallte er sich daran, wollte ihn wütend nach den Vermummten werfen. Ein verletzter Junge mit einem Stein würde keine Gruppe von Schwarzmagiern aufhalten, das war ihm bewusst. Aber er wollte nicht einfach hier liegen und auf den Tod warten. Doch sein Arm gehorchte ihm nicht. Der Schmerz saß noch zu tief in seinen Gliedern.
„Gut so!“, hörte er eine der Gestalten sprechen. „Der Kleine hat es verstanden. Der Auftrag des Meisters war eindeutig. Wir halten alle auf, die uns ungewöhnlich vorkommen, bis er sein Werk vollendet hat. Diese beiden sind mehr als ungewöhnlich. Die werden ihm einige Taler wert sein. Lasst uns die Höhle verschließen, ich habe Besseres zu tun, als den Abend in den Todessteinen zu verbringen.“
„Sollen wir sie wirklich am Leben lassen?“, fragte ein anderer aus der Gruppe.
„Was an ‚haltet alles, was ungewöhnlich ist, fest, aber lasst es am Leben‘ ist für dich schwer zu verstehen?“, brummte der Erste.
Jannis rührte sich nicht. Sie durften am Leben bleiben? Er verstand nicht. Unter Schmerz und Verzweiflung mischten sich Hoffnung und Unverständnis. Wieso wurden sie nicht getötet? Für diese Widerlinge waren sie doch nur zwei Wanderer, die sie quälen und töten konnten, wie sie wollten. Und von welchem Meister sprachen sie überhaupt? Ein Meister der schwarzen Magie? Nein! Er durfte auf keinen Fall einen Blick auf Talin werfen. Jeder schwarzmagische Meister wäre in der Lage, den gebannten Wolf zu erkennen. Das kleine Pflänzchen Hoffnung, das soeben in Jannis aufgekeimt war, begann zu verwelken. Er wollte laut schreien, um Hilfe rufen, aber es war nutzlos. Wer sollte sie hören, und was konnte er schon gegen diese Männer ausrichten? Stumm starrte er auf den Boden, gefangen in der Höhle und seinen eigenen Gedanken. Kurze Zeit später hörte er Schritte, die sich entfernten. Jemand sprach einen Bannspruch aus, der die Höhle magisch verschloss.
„Warte“, sagte einer aus der Gruppe, „ich traue diesen beiden nicht. Ein Valaner und ein Grünthaler? Was wollen sie hier zusammen?“
„Der Kleine ist hübsch anzusehen. Du weißt doch, wie die valanischen Kerle sind, die nehmen alles, was hübsch ist. Der Junge wird das Spielzeug dieses Kettenwerfers sein.“
„Für ein blondes Spielzeug hätte er sein Land nicht verlassen müssen. Es reisen genug Heiler zum großen Tempel.“
Jannis rührte sich immer noch nicht. Planten die Schwarzmagier doch ihren Tod? Ein Schauer durchlief seinen gequälten Körper.
„Los, lass uns die Höhle zusätzlich mit Steinen verschließen. Dann ist dieses merkwürdige Paar sicher aufgehoben, bis der Meister kommt.“
„Wie sollen wir sie bis dahin am Leben halten, wenn du die Höhle verschließt, du Narr?“
„Es reicht ein kleines Loch, um sie mit Wasser und Nahrung zu versorgen. Glaub mir, der Meister wird dankbar sein, wenn wir sie sicher für ihn verwahren.“
Im Gemurmel, das sich in der Gruppe erhob, konnte Jannis keine Wörter mehr ausmachen. Kurze Zeit später hörte er ein Grollen wie von Donner. Eine Lawine aus Steinen und Schutt verschloss unter lautem Getöse den Höhleneingang. Dann war alles still.
Jannis dreht den Kopf langsam zu Talin und erschrak. Die Verwandlung hatte begonnen. Der mächtige Wolfsfluch überlagerte den Bann der Schwarzmagier und zwang Talin auf die Knie. Er stöhnte und seine Glieder zuckten unkontrolliert. Das schmerzerfüllte Keuchen, das aus Talins Kehle drang, war grauenhaft. Jannis lag kaum zwei Schritte von ihm entfernt auf dem Boden. Hektisch sah er sich um und kroch langsam ein Stück zur Seite. Der Gedanke, mit einem eingesperrten, verfluchten Wolf zusammen in einer Höhle festzusitzen, tauchte in seinem Kopf auf und ließ ihn erschaudern. Er kannte diesen Wolf, das war immer noch sein Gefährte, und doch, was, wenn der Instinkt des Tieres zu stark wurde? Würde er ihn in Panik anfallen? Aber die grauenhafte Verwandlung, die der Wolfsfluch Talin aufzwang, war nicht aufzuhalten. Jannis drehte den Kopf zur anderen Seite. Er konnte nicht hinsehen. Er hasste es, dieses grausame Schauspiel. Die Knochen, die hörbar brachen, das Blut, aufgeplatzte Haut, die Wunden, über die sich langsam das Fell schob. Die schrecklichen Laute, die Talin mühsam unterdrückte. Plötzlich fühlte Jannis, wie sich Schmerz, Sorge und Erschöpfung in seinem Magen zu etwas Ungutem mischten. Ihm wurde übel und im nächsten Moment verlor er das Bewusstsein.
Kapitel 2 – Kalen
Hektisch bewegten sich die kleinen, dunklen Punkte in der Schlucht unter ihm. Kalen verengte die Augen, aber er konnte nicht erkennen, was genau sich dort unten abspielte. Näherten sich die Punkte einer Höhle? Nun, es war schon spät am Nachmittag. Sicher handelte es sich um eine Gruppe Heiler aus Grünthal auf dem Weg nach Valan. Noch einmal sah er hinunter in die Schlucht. Warum waren die Heiler alle so dunkel gekleidet? Er wusste nicht, was eigenartiger war: ganz in Schwarz gekleidete Heiler in der Ferne zu sehen, oder dass sie die gefährliche Nebenroute der Hauptpassage vorgezogen hatten. Kalen seufzte und setzte seinen Weg fort.
Am Ende war es ihm gleich, warum sich diese Gruppe dort unten in der Schlucht für den schwereren Weg entschieden hatte. Er war zu sehr mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, um sich darüber weiter den Kopf zu zerbrechen. Wer auch immer behauptete, das bequeme Leben eines Jungpriesters im großen Tempel von Montsilvan gerne gegen diese zugige Ödnis einzutauschen, log! Selbst wenn es nur für einen Monat war, wie viele Feste würde er eigentlich verpassen? An wie vielen Trinkgelagen würde er nicht teilnehmen können und wie viele Abenteuer in fremden Betten würde er in einem Monat nicht erleben? Verfluchte Dämonen, er hatte jedes Recht, sich selbst zu bedauern.
Kalen keuchte unter der Last seines Gepäcks. Verdammter Aufstieg. Er war ein guter Läufer, aber hier oben wurde die Luft dünn und die Schlucht war inzwischen so eng, dass er aufpassen musste, seinen guten Mantel nicht an den Felsen zu zerreißen. Wie gut, dass er sich so lange vor dieser Pflicht hatte drücken können, dachte Kalen. Beim nächsten Gedanken musste er grinsen. Fünf Mal hatte ihn der oberste Priester des Tempels daran erinnert, es wäre nun seine Zeit, die letzte Handelshöhle für einen Monat zu betreiben. Die erste Nachricht war aus dem offenen Fenster gefallen, was hätte er tun können? Die Nächste war in einer Wasserschale gelandet, sodass sie unleserlich wurde, bevor er sie öffnen konnte. Ein Bruder musste glatt vergessen haben, sie zuzustellen. Kalen war immer erfinderischer geworden und hatte sich an seinen eigenen Ausreden erfreut. Noch in diesem grässlichen Gebirge musste er lachen, wenn er an seinen Erfindungsreichtum dachte.
Aber vor ein paar Tagen war ihm das Grinsen vergangen. Da stand sein Vorgesetzter, der oberste Priester Valans, persönlich vor seiner Tür und sah nicht erfreut aus. Juris, der Obere, war ein strenger Mann. Streng mit den Gläubigen, streng mit den Priestern und streng mit sich selbst. Er kannte nur Arbeit und Opfer für den Tempel. Niemals schien er Geliebte zu haben und von Feiern hielt er sich fern. Er lebte nur für den Tempel. Wie sollte so ein Mann, der von morgens bis abends nur Pflicht atmete, je verstehen, warum Kalen keine Lust hatte, seine Zeit in den Todessteinen zu verschwenden? Mit Schaudern dachte Kalen an das unerfreuliche Gespräch.
„Kalen vom Taubengrund! Du vergnügungssüchtiger Abklatsch eines Priesters! Wenn du Zeit hast, jedes hübsche Mädchen und jeden stattlichen Jungen in Montsilvan zu beglücken, wirst du nun auch die Zeit finden, deine Pflicht zu tun! Sofort suchst du die Tempelapotheke auf. Du wirst morgen abreisen!“, donnerte Juris wütend.
„Aber … aber Oberer, Ihr könnt mich doch nicht so schnell losschicken! Der Weg ist weit und ich muss so lange dort bleiben. Ich bin noch nicht vorbereitet!“, hatte Kalen gefleht.
Doch der Obere ließ sich einfach nicht erweichen. Seine Augen blitzten wütend auf, als er zu Kalen sagte: „Du sollst mitnichten den ganzen Sommer dort verbringen, du Ausflüchte suchende Ausgeburt eines Schnapsdämons. Einen Monat deiner Zeit braucht der Tempel. Wir wollen ja schließlich nicht deinen vielen anderen Aktivitäten im Wege stehen. Du reist morgen zur Handelshöhle!“
Kalen hatte sich gewundert, wie ein so zierlicher Mann wie der Obere eine Anweisung so laut brüllen konnte. Bestimmt hatten einige der Steine im Gang gewackelt. Die Falte zwischen den Augen des Oberen war so tief wie ein Krater in den Todessteinen geworden.
Er lag ja gar nicht so falsch, sein Vorgesetzter, musste er zugeben. Aber Kalen war der festen Überzeugung, all die Schriften könnte er später noch lesen, und die Sprüche waren sicher schnell zu lernen, wenn es nötig war. Die Prüfung zum Jungpriester hatte er schließlich auch wiederholen können. Ein Ausschluss aus der Priesterschaft? Das hätte ihm gerade gefehlt, auf keinen Fall wollte er das gute Leben im Tempel aufgeben. Der Gedanke daran war schlimmer als der eisige Wind, der hier oben in den Todessteinen an ihm zerrte. Schnell schloss er die obersten Knöpfe des langen schwarzen Mantels und schlang den roten Schal fester um seinen Hals. Dieser Schal ... war er nicht das Geschenk irgendeines Geliebten gewesen? Nun, wer auch immer ihn damit beschenkt hatte, in diesem Moment war er nur dankbar über den zusätzlichen Schutz. Er zog den Schal über den Mund und stapfte weiter die Schlucht hinauf.
So froh war er damals gewesen, als er feststellte, dass er nicht nur Wolfswandler war, wie alle valanischen Männer. Er konnte außerdem Magie wirken und durfte deshalb im Tempel vorsprechen. Auf die Aufnahmeprüfung hatte er sich tatsächlich mit viel Fleiß vorbereitet. Einmal aufgenommen, entließ der Tempel seine Priester nur in Ausnahmefällen. Aus dem einfachen Leben eines Bauernsohns im Taubengrund rutschte er durch die bestandene Prüfung in das bequeme Dasein eines Tempelpriesters. Das war schon ein großes Glück. Kalen schämte sich kein Stück dafür, dass er dieses gute, neue Leben ausnutzte.
Es war doch nicht seine Schuld, dass die Natur es gut mit ihm gemeint hatte. Für einen Valaner war er nur mittelgroß, aber sein Körper war ohne viel Zutun stark und doch elegant. Er wusste, dass sein Gesicht schön anzusehen war, das glänzende schwarze Haar fiel ihm weit in den Rücken. Er hatte viele Freunde, im Tempel, auf der Burg und in den Wirtshäusern des Vergnügungsviertels. Er war eben immer gut gelaunt und hatte eine schöne Singstimme. Ach, bestimmt vermissten sie ihn schon im Schwarzen Schaf, dem Wirtshaus, in dem er die meisten seiner Abende verbrachte. Statt zu flirten, zu feiern und zu singen, schleppte er sich in diesem Moment mit dem Holzgestell ab, das ihm der Bruder aus der Tempelapotheke eindeutig überladen hatte. Wer sollte all die Pflanzen, Tinkturen, Salben oder Tränke tauschen? Nur die grünthaler Heiler wussten von der letzten Handelshöhle. Einsam, langweilig und windig, so würde der nächste Monat in Kalens Leben werden. Da war er sich ganz sicher.
Die enge Schlucht öffnete sich immer mehr. Links und rechts lagen Eingänge zu den ehemaligen Handelshöhlen. Kalen hatte die Geschichtsstunden im Tempel immer am meisten gehasst. Nur Bruchstücke waren ihm in Erinnerung geblieben. Wie war das noch gleich? Vor vielen Jahren waren die Grünthaler der gleichen Religion wie die Valaner gefolgt? Dann war es zu einem Umsturz gekommen und vier Fürsten hatten die Burg eingenommen, die Macht unter sich verteilt. Sie hatten eine neue Religion eingeführt, die nur noch einem Gott folgte. Die Geister und alles, was damit in Verbindung stand, wurden verbannt. Nur die magiebegabten Heiler folgten heimlich weiter dem Weg der alten Geister. Dafür wurden sie von den neuen Herrschern geächtet und verfolgt. Bis heute war das so, erinnerte Kalen sich. Um die Heiler zu unterstützen, betrieb der Tempel diese letzte Handelshöhle. Und verfluchte Dämonen, sie lag wirklich versteckt hier oben, dachte Kalen und sah sich um. Eine verfallene Höhle reihte sich an die nächste. Über der Schlucht war ein Plateau erkennbar, auf dem Schnee lag. Schnee, dachte Kalen entsetzt. Im Sommer. Er schüttelte sich. Endlich unterschied sich eine der Höhlen von all den anderen. Kalen zog die Karte aus seinem Mantel, die man ihm im Tempel zugesteckt hatte. Oh ja, er war am Ziel.
„Hey, Brin?“, rief er in die Höhle. Langsam trottete er durch den breiten Eingang. Nach ein paar Schritten fühlte er die Wärme, die aus dem Inneren zu kommen schien.
„Bruder Brin, ich bin es, Kalen. Zeig dich. Oder störe ich dich beim Essen?“
Schritte waren zu hören, ein großer Kerl mit einem enormen Bauch erschien im Höhleneingang.
„Was schreist du hier herum, du Narr? Wo ich gerade von Narren spreche, wie kamen sie denn darauf, ausgerechnet dich zu schicken? Feste werden hier selten gefeiert, Bruder Kalen.“
Kalen verdrehte die Augen. „Ja ja, dafür scheint es nicht an Nahrung zu mangeln“, erwiderte er und klopfte seinem Mitbruder freundlich auf den Bauch, bevor er anfügte: „Ich habe um diese Ehre nicht gebeten. Aber nun bin ich hier und wäre dir dankbar, wenn du mir diese wunderbare Aufgabe erklären könntest.“
„Hm“, schnaufte Brin, „da gibt es nicht viel zu erklären. Komm mit.“
Er packte Kalen am Arm und zog ihn in die Höhle. Etwa in der Mitte bogen sie um die Ecke. Der hintere Teil lag versteckt im Dunkeln und wurde nur durch Fackeln, die an der Wand angebracht waren, erhellt. Gleich zwei flauschige Schaffelle lagen auf einem weiteren, dünneren Tierfell. Allerlei Kisten, in denen Kalen die Waren vermutete, waren am Rand aufgebaut. Ganz hinten befand sich eine Feuerstelle, darüber ein Topf aus Metall. Daneben ein einfaches Regal aus Holz, auf dem Holzschüsseln und Löffel angebracht waren. Über der Feuerstelle war eine große Abdeckung aus Stein und Lehm geformt, die in einem raffinierten System von Lehmkanälen endete, die sich über die gesamte Decke bis hin zum Ausgang zogen. So konnte der Rauch abgeleitet werden und gleichzeitig wurde die ganze Höhle beheizt.
„Hier sind die Waren“, brummte Brin und zeigte auf die Kisten. Er sah Kalen scharf an. „Die Heiler kommen, kaufen oder tauschen und wollen so schnell wie möglich die Todessteine wieder verlassen. Ach ja, das werde ich jetzt ebenfalls tun. Gehab dich wohl, Bruder Kalen. Beim Mandelblütenfest werde ich einen Met auf dein Wohl trinken.“ Mit diesen Worten griff Brin sich ein Holzgestell, das Kalen bisher nicht gesehen hatte, weil es im Dunkeln der Höhle an der Wand lehnte.
„Hey, was soll das?“, fragte Kalen überrascht, als er sah, wie schnell sich sein Mitbruder aufmachte, zu verschwinden. Schnell streckte er die Hand aus und wollte Brin am Mantel packen. Doch der dicke Kerl war geschickter, als er aussah. Er trat einen Schritt zur Seite und Kalen griff ins Leere. Schon war Brin wieder in Bewegung. Dann blieb er kurz stehen und drehte sich um. „Ich habe dir alles erklärt. Ohne Schnaps und Gespielen bist du sicher schlauer als sonst. Du kommst schon zurecht. Ich habe unsere schöne Hauptstadt seit vier Wochen nicht gesehen, ich bin jetzt weg.“
Die übereilte Verabschiedung ließ Kalen verwirrt zurück. Er lehnte sich gegen die Höhlenwand im Handelsteil und sah mit verengten Augen zum Eingang. Wie unhöflich der dicke Brin doch war! Kalen schüttelte den Kopf. Er hätte wenigstens noch eine kleine Unterhaltung mit ihm führen können, anstatt gleich wegzurennen. Brin wusste doch, dass Kalen jetzt einen Monat zur Einsamkeit verdammt war. Seit wann verhielt man sich so abweisend unter Tempelpriestern? Brin war ein paar Jahre älter als er und gehörte zu denen, die auf die jungen Priester heruntersahen. Aber ab und an hatte er ihn schon beim Feiern getroffen. Na, dem würde er sicher keinen Met mehr im Wirtshaus ausgeben. Mürrisch zog Kalen seinen Mantel aus und legte ihn neben die Felle.
Um den Schreck zu verdauen, erwärmte er sich etwas Wasser im Topf und gab einige Kräuter hinein. Dann ließ er sich mit gekreuzten Beinen auf einem der Schaffelle nieder. Erfreut fühlte er, wie der Tee seinen Mund und den Bauch wärmte. Wenigstens das Bettenlager sah gut aus. Er war bei Weitem nicht so breit wie Brin und konnte die beiden Felle übereinander legen.
Erschöpft seufzte er und beugte sich vor, um seine schweren Stiefel auszuziehen. Da! Was war das? Ein Geräusch schlich sich in sein Ohr. Er sah sich in der Höhle um. Tiere konnten jederzeit hereinkommen. Er überlegte, welchen Bannspruch er gut genug beherrschte, um den Höhleneingang zu verschließen, und ob der dicke Brin dies schon erledigt hatte. Da war es wieder zu hören, das merkwürdige Geräusch. Gespannt horchte er in die Nacht. Der Wind pfiff unaufhörlich über die Gipfel und durch die Schluchten. Das ständige Heulen und Pfeifen würde viele merkwürdige Töne in der Nacht verursachen. Da, schon wieder. Was war das nur für ein Laut? Als er es erneut vernahm, klang es anders als die übrigen Töne der Nacht. Mehr wie ein Wimmern. Er lauschte auf den Wind. Er heulte, er pfiff, er rüttelte. Aber er wimmerte nicht. Hm, sicher ein verletztes Tier. Kalen machte sich auf zum Höhleneingang, um ihn für die Nacht mit einem Bann zu belegen. Auf keinen Fall wollte er morgen früh eine Herde Bergziegen in der Höhle begrüßen. Gerade hatte er seine Hände gehoben, um den Bann auszusprechen, da hörte er es erneut, dieses Mal deutlicher. Es schien aus einer der gegenüberliegenden Höhlen zu kommen. Vielleicht eine Katze? Nein, keine Katze setzte sich einem solchen Wind aus. Es schien durch den Hall in einer Höhle verstärkt zu werden.
Kalen verzog seinen Mund. Was hatte er zu verlieren? Einen einsamen, langweiligen Abend bei einem schalen Tee auf einem Schaffell. Schon kehrte er entschlossen zurück ins Innere, um seine Stiefel anzuziehen und seinen Mantel zu holen. Die Dunkelheit würde sich bald über die Todessteine legen. Er griff nach einer Fackel und seinem Jagdmesser. Kalen schüttelte den Kopf über sich. Anstatt zu trinken, zu feiern und seine Haut an einem anderen Valaner zu wärmen, schlich er bei Nacht durch die Todessteine, um einem Geräusch nachzugehen. Doch seine Neugier war zu groß. Bei den verdammten Dämonen, was wimmerte nur so erbärmlich?
Kapitel 3 – Kalen
Schon einen Moment später bereute Kalen den Gedanken, seine Langeweile mit der Suche nach einem fremden Geräusch bekämpfen zu wollen. Er wünschte sich zurück auf die flauschigen Schaffelle, zu dem warmen Tee und wollte umkehren. Trotz des gefütterten Mantels und des warmen Schals kroch der eisige Wind in alle Ritzen seiner Kleidung. Kalen fror und begann vor Kälte zu zittern.
Da, schon wieder. Das Wimmern. Es kam aus einer Höhe in seiner Nähe und jagte ihm einen Schauer über den Rücken. So elend jammerte dort etwas, Kalen fühlte, wie sich die Haare auf seinen Armen aufstellten, und zog unwillkürlich die Schultern ein. Die Dunkelheit, die Kälte, die schaurige Höhle und das Geräusch, all das ließ sein Herz heftig schlagen und seine Glieder zitterten vor Angst. Er überlegte noch, ob er er lieber umkehren sollte, da hatten ihn seine schlotternden Beine schon bis zu der Höhle getragen, aus der das Geräusch zu hören war. Was konnte das nur sein? Vorsichtig betrat er die stockfinstere Höhle, schnippte mit einem Finger gegen die Fackel und sprach die notwendigen Worte. Die Fackel erhellte die kühle, windgeschützte Dunkelheit so weit, dass Kalen erahnen konnte, wohin er trat. Langsam tastete er sich voran.
Die Fackel warf lange, gespenstische Schatten an die Wand. Kalen war weit in die Höhle vorgedrungen, als er das Wimmern erneut hörte. Doch dieses Mal war es nicht Neugier, die das Geräusch in ihm weckte. Ein Gefühl von Horror, gemischt mit Angst, legte seine eisige Hand auf seinen Rücken. Diese Laute schienen nicht von einem Tier oder dem Wind verursacht zu werden. Vielmehr klang es nach dem hilflosen, schmerzerfüllten Klagen eines Kindes. Vielleicht sollte ich Unterstützung holen, dachte er, als ihm einfiel, dass er völlig alleine war. Weit und breit war kein Bruder, kein Oberer und auch sonst niemand, den er um Hilfe bitten konnte.
Den Kopf eingezogen, das Messer im Ärmel seines Mantels versteckt, schlich er weiter. Die Fackel hielt er wie eine Keule in der Hand, ständig bereit, damit zu zuschlagen. Die Höhle mündete in einen der Gänge, die über Jahrhunderte als Verbindungssystem gedient hatten. Jetzt galten sie als lebensgefährlich. Viele von ihnen waren eingestürzt, andere waren instabil und einsturzgefährdet. Zweifelnd, was sein nächster Schritt sein sollte, stand er mit einem Fuß im Eingang des Ganges, mit dem anderen noch in der Höhle. Das elende Wimmern drang erneut an sein Ohr. Eindeutig kam es aus dem Gang, der sich vor ihm öffnete.
„Ist da jemand?“, rief er in den Gang hinein und schlug sich sofort vor die Stirn. „Bei allen freien Wölfen von Valan, Kalen! Zweiundzwanzig bist du erst, und hast dein junges Hirn schon im Schnaps ertränkt? Wie kannst du nur in einer solchen Umgebung einfach in einen dunklen Gang rufen und auf dich aufmerksam machen, du Narr“, sprach er leise. Vorsichtig drehte er den Kopf und sah sich um. Es war ihm fast, als höre er die Antwort auf seine gerufene Frage in seinem Kopf. Jetzt begann die Fackel ebenso zu zittern wie die Hand, die sie hielt. Ganz langsam tastete er sich ein Stück weiter im Gang. Das Klagen wurde lauter, kam noch näher.
Der schmale Gang bog um die Ecke. Etwa zehn Schritte von Kalen entfernt war er eingestürzt. Eine Mauer aus Steinen, Schutt und Geröll versperrte das Weiterkommen.
Vorsichtig ging er zwei Schritte näher und leuchtete mit der Fackel. Am unteren Ende der Mauer wurde die Sicht verschwommen. Kalen presste die Augen zu engen Schlitzen zusammen, um zu sehen, ob es an der Dunkelheit in diesem Gang lag. Keine Veränderung. Die Sicht auf das untere Ende der Mauer blieb unklar. Er trat einen weiteren Schritt heran und schwenkte die Fackel, um besser sehen zu können. Da war es, direkt vor ihm. Das Geräusch, das ihn hierher geführt hatte. Als er schon fast an der Mauer war, umfasste etwas seine Stiefel. Erschrocken sprang er einen Schritt zurück und sah suchend auf den steinigen Boden. Doch dort war nichts zu erkennen. Sicher hatte er sich den Griff nur eingebildet. Ein weiteres Geräusch mischte sich unter das nahe Wimmern. Eine Art Fauchen war zu hören.
Ein Wort schlich sich in seinen Kopf. „Schattendämonen.“ Ein Zweites kam dazu. „Licht.“ Natürlich, dachte er. Bannmagier riefen Schattendämonen an, wenn sie mächtige Flüche aussprachen. Sie bewachten den Verfluchten, bis sich der Fluch in seinem ganzen Wesen ausbreiten konnte. Schattendämonen hatten die Fähigkeit, ein Gebiet in verschwommene Dunkelheit zu tauchen, damit das menschliche Auge nichts erkennen konnte. Schattendämonen waren niedere Höllenwesen, meist unsichtbar oder nur als huschende Schatten auszumachen. Ein einfacher Weg sie zu verscheuchen war: magisches Licht.
Der Spruch, verdammt in alle Höllen, dachte Kalen, während er angestrengt versuchte, sich zu erinnern. Wie aus dem Nichts stieg plötzlich der Spruch zwischen Angst und Neugier in ihm auf. Er war so ungeübt darin, magische Sprüche zu rezitieren, er musste ihn zweimal wiederholen.
Schließlich breitete sich ein schwacher Schein am unteren Ende der Mauer aus. Ein wütendes Fauchen begleitete den Vorgang. Schattendämonen waren Wächter, keine Kämpfer. Aufgebracht warfen sie kleine Kieselsteine nach ihm und schienen gegen den Boden zu treten, sodass Staub aufgewirbelt wurde. Mehr geschah nicht. Sie lösten sich einer nach dem anderen auf und gaben die Sicht frei. Was zum Vorschein kam, ließ Kalen wünschen, er hätte sich nie an den Lichtspruch erinnert.
Am Ende der Mauer kauerte ein schmächtiger Junge. Sein Körper war über und über mit Staub und Dreck bedeckt. Darunter zeichneten sich viele Wunden und getrocknetes Blut ab. Einige der Wunden stammten von Peitschen, andere sahen wie Brandwunden aus, eine breite, noch nicht ganz verheilte Narbe, vermutete Kalen, war von einer Kette verursacht worden, die man dem Jungen über die schmale Brust geschlagen hatte. Er wimmerte ganz leise und erbärmlich. Der Hall des Ganges trug das Wimmern weit hinaus und verstärkte es. Seine Hände und Füße steckten in eisernen Fesseln, die mit einer schweren Kette verbunden waren, und er war völlig nackt.
Entsetzt beugte sich Kalen zu dem Jungen hinunter. Wer tat so etwas, fragte er sich, bemüht, beim Anblick des geschundenen Körpers nicht würgen zu müssen. Wer richtete einen Jungen, der fast noch ein Kind war, so zu und ließ ihn in Ketten in einer von allen Geistern verlassenen Höhle tief in den Todessteinen zurück? Der Wind hätte ungünstiger drehen können und schon wären die leisen Klagelaute nicht verstärkt worden. Der Junge sah aus, als wäre er nur wenige Augenblicke vom Tod entfernt. Warum nur hatten ihn Schattendämonen bewacht?
„Wer … wer bist du?“, fragte Kalen leise. Er traute sich kaum, den verwundeten Körper anzufassen. Dort, wo keine Brandmale oder andere Verletzungen waren, waren überall kleine Bisse. Den Schattendämonen war es wohl langweilig geworden bei ihrer Wacht. „Hey, Junge? Kannst du mich hören?“, wollte er nun auf Valanisch wissen, um es gleich darauf in der Sprache Grünthals zu wiederholen. Der Junge roch nicht nach Wolf. Valaner konnte er auf keinen Fall sein. Der zweite Satz zeigte Wirkung. Langsam drehte der Kleine den Kopf und öffnete die Augen. Zwei große, blaue Augen starrten Kalen ängstlich an. Stumm schüttelte der Junge den Kopf. Wem würde das nicht die Sprache verschlagen, dachte Kalen mitfühlend.
„Hab keine Angst. Ich will dir nichts tun. Mein Name ist Kalen vom Taubengrund. Ich bin Priester im großen Tempel von Montsilvan. Es ist meine Zeit, die Handelshöhle zu betreiben. Der Wind hat dein Klagen bis zu meiner Höhle getragen.“
Kalen sprach schnell in der fremden Sprache und war sich sicher, nicht alles richtig auszusprechen. Zwar lernten alle Valaner von Kindesbeinen an die Sprache ihres einzigen Nachbarlandes, aber er hatte selten Gelegenheit, sie anzuwenden. Sicher hatte er einen starken Akzent. Ob der Junge ihn überhaupt verstand? Erleichtert nahm Kalen wahr, wie der Junge blinzelte und schwach nickte. Er hatte verstanden. „Wir müssen hier weg. Ich habe Medizin, und die Ketten werde ich dir am besten gleich hier entfernen“, sagte er und dachte: Große Worte, Jungpriester Kalen, als ob dir so schnell der passende Spruch einfallen würde. Ein Spruch, um magisch Verschlossenes zu öffnen, wie hieß er doch gleich? Er war sich sicher, er hatte ihn schon einmal gelesen. Verdammt seien all die durchzechten Nächte, dachte er verzweifelt. „Zwang“ – das Wort bohrte sich in seine Gedanken. Kalen schüttelte den Kopf. Das war der tatsächlich passende Spruch für diese Gelegenheit. Wieso war er ausgerechnet ihm eingefallen? Es grenzte an ein Wunder. Dann hob er die Hände und sagte den Spruch auf. Der erste Versuch schlug fehl. Nichts geschah. Kalen räusperte sich und sagte den Spruch erneut auf. Dieses Mal mit mehr Nachdruck. Er gab sich besondere Mühe bei der Betonung der Worte. Der zweite Versuch ließ eine der Fesseln in drei Teile zerbrechen und gab ein Handgelenk des Jungen frei. Schnell hatte Kalen auch die anderen drei Fesseln auf die gleiche Weise gelöst. Noch einmal wunderte er sich. Hatte er vielleicht doch einmal bei den Magielektionen aufgepasst? Aber der Anblick des leise wimmernden Jungen ließ ihn die Frage schnell vergessen.
Er beugte sich zu ihm hinunter, strich ganz vorsichtig mit zwei Fingern eine verklebte Haarsträhne zur Seite und sagte: „Ich muss dich jetzt anfassen, um dich in meine Höhle zu tragen, hast du verstanden?“ Kalen musste sich um eine klare Stimme bemühen.
Der Junge wirkte, als wäre er kurz davor, zu sterben. Eiter tropfte aus alten Wunden, Blut aus frischen. Kalen musste einen Felsbrocken in seinem Hals herunterschlucken und die Tränen mühsam unterdrücken. Was er hier sah, brach ihm das Herz. Wer tat so etwas? Und warum? Der Junge nickte schwach. Behutsam griff Kalen unter die dürren Beine und den geschundenen Rücken und hob den Jungen hoch. Er wiegt fast nichts, dachte er besorgt. Mit einer Hand zog er seinen Mantel schützend um den Befreiten. Langsam tastete er sich aus dem engen, dunklen Gang und aus der verlassenen Höhle. Inzwischen umfing schwarze Dunkelheit die Todessteine. Der Wind blies mit unnachgiebiger Härte durch die Schluchten. Kalen zog den Mantel noch enger um den Jungen und beeilte sich, zurück in seine Höhle zu kommen.
In der Handelshöhle angekommen, suchte Kalen sofort den Wohnteil auf und legte den Jungen auf den Schaffellen ab. Kalen blieb vor ihm stehen und stemmte die Arme in die Hüften. Der Junge war wirklich völlig verdreckt. Herabrieselnder Schutt und Dreck, den die Schattendämonen zum Vergnügen auf ihn geworfen hatten, klebten auf seinen Wunden, seiner Haut und bedeckten fast das ganze Gesicht und seine Haare. Kalen wollte so gerne etwas Freundliches sagen, etwas Aufmunterndes. Verdammt! Er war doch kein Heiler, was sollte er nur tun? Dann erinnerte er sich an die vielen Tinkturen und Salben, die er dabei hatte. Sie waren alle beschriftet. Wen kümmerte es schon, ob der Tempel dafür eine Flasche Wein oder ein paar Kräuter aus Grünthal bekommen würde. Dieser Junge brauchte sie viel dringender. Er räusperte sich und sagte: „Du siehst ja aus wie ein Frischling, der sich in einer Schlammgrube gesuhlt hat. Ich säubere zuerst deine Wunden, sonst kann ich sie nicht versorgen.“
Der schmale Kerl blinzelte nur. Kalen sprang auf, ging zum Eimer und füllte einen Holzbecher mit Wasser. Er musste etwas tun! Jetzt nur nicht still werden und nachdenken. Der Gedanke an die Grausamkeiten, die man seinem schwer verletzten Gast angetan hatte, war unerträglich. Kalen versuchte sie an einen nebligen Ort in seinem Kopf zu drängen, damit er handeln konnte.
„Du musst etwas trinken, lass dir helfen“, sagte er und hob das staubige, knochige Kinn etwas an, um dem Jungen beim Trinken zu helfen. „Kannst du jetzt wieder sprechen?“
Sein schmächtiger Gast schüttelte den Kopf. Kalen ließ eine kurze Weile vergehen, bis er fragte: „Kannst … kannst du … gar nicht sprechen? Du bist stumm?“
Der Junge nickte.
„Öffne deinen Mund“, sagte Kalen fast tonlos. Er fühlte die Vorahnung durch seinen Körper kriechen. Der Junge tat, wie ihm geheißen. Erleichtert atmete Kalen aus. Die Zunge war noch vorhanden. Sie hatten ihm vielleicht mit einem schwarzmagischen Spruch die Stimme genommen? Kalen nahm ein weiches Tuch aus seinem Gepäck, erwärmte Wasser auf der Feuerstelle und begann mit behutsamen Strichen, den Rücken des zierlichen Jungen zu säubern. Während er versuchte, die vielen Dreckschichten zu entfernen, murmelte er immer wieder: „Schrecklich. Kleiner, das ist so grauenhaft. Wer tut nur so etwas?“