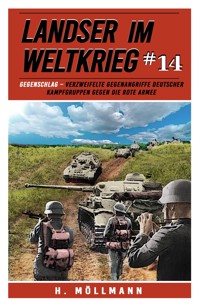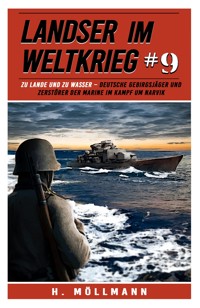4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Im Stahlgewitter von Market Garden - Ein packender Erlebnisbericht aus dem Weltkrieg Nach der Schlacht in der Normandie und dem raschen Vorstoß durch Frankreich glaubten die britischen und US-amerikanischen Generale, die deutschen Streitkräfte würden kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Daher suchten sie nach Möglichkeiten, den Krieg bis Weihnachten zu beenden. Als Mitte September 1944 im Zuge der Operation Market Garden fast 40.000 alliierte Fallschirmjäger in den Niederlanden hinter den deutschen Linien landeten, trafen sie auf einen Gegner, der alles andere als geschlagen war. Die Deutschen leisteten erbitterten Widerstand und lehrten die Alliierten eine wichtige Lektion: Unterschätze niemals deinen Gegner! H. Möllmanns Werk erzählt in romanhafter Form vom Abwehrkampf deutscher Soldaten, vom furchtbaren Ringen, das sich weniger als ein Jahr vor Kriegsende in den Niederlanden zutrug, aber auch von Lichtblicken der Menschlichkeit inmitten eines unmenschlichen Krieges. Dieses Buch dürfen Sie sich nicht entgehen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
H. Möllmann
Im Stahlgewitter von Market Garden
Ein Roman über deutsche Landser an der Westfront 1944
EK-2 Militär
Verpassen Sie keine Neuerscheinung mehr!
Tragen Sie sich in den Newsletter von EK-2 Militär ein, um über aktuelle Angebote und Neuerscheinungen informiert zu werden und an exklusiven Leser-Aktionen teilzunehmen.
Als besonderes Dankeschön erhalten Sie kostenlos das E-Book »Die Weltenkrieg Saga« von Tom Zola. Enthalten sind alle drei Teile der Trilogie.
Klappentext: Der deutsche UN-Soldat Rick Marten kämpft in dieser rasant geschriebenen Fortsetzung zu H.G. Wells »Krieg der Welten« an vorderster Front gegen die Marsianer, als diese rund 120 Jahre nach ihrer gescheiterten Invasion erneut nach der Erde greifen.
Deutsche Panzertechnik trifft marsianischen Zorn in diesem fulminanten Action-Spektakel!
Band 1 der Trilogie wurde im Jahr 2017 von André Skora aus mehr als 200 Titeln für die Midlist des Skoutz Awards im Bereich Science-Fiction ausgewählt und schließlich von den Lesern unter die letzten 3 Bücher auf die Shortlist gewählt.
»Die Miliz-Szenen lassen einen den Wüstensand zwischen den Zähnen und die Sonne auf der Stirn spüren, wobei der Waffengeruch nicht zu kurz kommt.«
André Skora über Band 1 der Weltenkrieg Saga.
Link zum Newsletter:
https://ek2-publishing.aweb.page
Über unsere Homepage:
www.ek2-publishing.com
Klick auf Newsletter rechts oben
Via Google-Suche: EK-2 Verlag
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Mit unserem Label EK-2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.
Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!
Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.
Schreiben Sie uns: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Jill & Moni
von
EK-2 Publishing
»Captain John Michaels, L Company, 01051112.«
Oberleutnant Junkermann seufzte. Er blickte den amerikanischen Hauptmann an, der ihm mit starrem Blick gegenübersaß.
»That's all I have to say!«, schloss der Amerikaner mit trotziger Miene, lehnte sich triumphierend in seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme.
Junkermann seufzte noch einmal.
»Okay«, schloss der deutsche Offizier auf Englisch. Er wischte sich mit der Hand durchs Gesicht.
»Herr Oberleutnant, Entschuldigung?«, mischte sich mit einem Mal die Stimme seines Gefreiten ein, der mit MP in Vorhalte die Tür bewachte.
Junkermann blinzelte den stämmigen Mann aus müden Augen an. Der Gefreite war für den Oberleutnant im Laufe der Jahre so etwas wie ein guter Freund geworden.
»Entschuldigen Sie, aber wollen Sie auch noch diesem Ami sein Spielchen durchgehen lassen?«
»Ja, will ich.«
»Bitte verzeihen Sie, aber der Feind lacht uns doch aus.«
»Ach, mein treuer Gefreiter Engels.« Junkermann lächelte besonnen. «Wie oft habe ich Ihnen von der Haager Landkriegsordnung erzählt?«
»Zu oft, Herr Oberleutnant. Zu oft.«
Junkermann grinste, alldieweil der Amerikaner verwirrt erst den Offizier, dann den Gefreiten anblickte.
»Ah ja, richtig«, erinnerte sich Junkermann, der ein guter Schauspieler war. »Ihnen kann ich es gar nicht oft genug erklären, Engels.«
»Jawohl, Herr Oberleutnant. Nicht oft genug.«
»So ist es fein. Jedenfalls wissen Sie, dass ich ein Mann von Ehre bin. Ich spreche mit den Gefangenen, ich tue mein Bestes. Aber ich werde nichts machen, was mich in Teufels Küche bringt.«
»Ich weiß, Herr Oberleutnant«, stöhnte der Gefreite und spielte damit auf andere Offiziere an, die im Umgang mit dem Feind weniger zimperlich waren …
Junkermann hatte an diesem Tag bereits Dutzende Gefangene vernommen. Alle hatten sie ihm einzig Name, Dienstgrad und Dienstnummer nennen wollen. Einige weitere Gefangene warteten noch in der Lobby des Hotels auf ihre Vernehmung. Junkermanns langjährige Diensterfahrung sagte ihm, dass einer der Kameraden in den olivfarbenen Uniformen schon reden werde.
Oberleutnant Junkermann war in Polen dabei gewesen, hatte an der Ostfront gedient. Nun war er hier. Das niederländische Oosterbeek, ein Vorort Arnheims, erschien ihm wie das Paradies inmitten dieses epochalen Kriegs, an dem sich die ganze Welt aufzureiben schien.
Junkermann blickte sich in dem kleinen Kellerraum um, in den er sich für die Verhöre der Gefangenen zurückgezogen hatte. Außer ihm, Captain Michaels und dem Gefreiten Engels befand sich keine weitere Person in dem feuchten Kellergemäuer. Feine Wassertropfen bildeten sich an den steinernen Wänden, rannen in langen Bahnen daran hinunter.
Junkermann rümpfte die Nase. Das Kellergewölbe des Hotels Hartenstein, in dem sich Feldmarschall Model mit seinem Stab niedergelassen hatte, machte kaum den Anschein einer piekfeinen Herberge, die dieser Ort tatsächlich war. Spinnweben, lang wie Schiffstaue, hingen von der unsauber verputzten Decke. Staub war allgegenwärtig. Junkermann aber musste zugeben, eine solche Atmosphäre war ihm nach Jahren an der Front lieber als die geschniegelten Stuben der oberen Stockwerke. Er wusste selbst nicht, warum.
Durch das kleine Kellerfenster drangen feine Sonnenstrahlen in den Raum, die in diesem Augenblick genau auf die Tischplatte zwischen Captain Michaels und Oberleutnant Junkermann schienen, und wie ein himmlischer Lichtwall beide Männer voneinander trennten. Junkermann fühlte sich Michaels dennoch mehr verbunden, als der amerikanische Hauptmann vielleicht glauben mochte. Auch Junkermann würde sein Land und seine Kameraden niemals verraten, sollte er einmal in Gefangenschaft geraten. Er konnte den Amerikaner demnach gut verstehen … konnte ihm nicht verübeln, dass dieser die Aussage verweigerte.
Der Spätsommer machte dieser Tage seinem Namen alle Ehre. Es war Anfang September, die Sonne strahlte in all ihrer Pracht, erwärmte das Land auf angenehme Weise. Die ersten Blätter verfärbten sich allmählich, doch die Temperaturen waren noch immer gut genug, um ein Bad im Rhein zu nehmen. Dennoch stand der Winter unweigerlich vor der Türe. Junkermann schüttelte es beim Gedanken an die kalte Jahreszeit … Er hatte einige schlimme Winter hinter sich.
Ungeachtet aber der prächtigen Wärme dieser Tage braute sich am Horizont etwas zusammen. Die Alliierten hatten nach ihrem raschen Raid quer durch Frankreich schlagartig eine Pause eingelegt. Siegestrunken sprach der Feind offen davon, den Krieg vor Weihnachten zu beenden.
»Nun, da haben wir Deutschen auch noch ein Wörtchen mitzureden«, sprach Junkermann seine Gedanken laut aus. Der amerikanische Offizier blickte ihn fragend an. Junkermann winkte lächelnd ab. Model hatte seinen Männern eingebläut, welche Wichtigkeit die Brücken über den Rhein für den Feind hatten. Und wie gesagt, irgendetwas braute sich drüben bei den Kameraden von der anderen Feldpostnummer zusammen, so viel war sicher. Darum war es derzeit so immanent wichtig, jeden aufgebrachten Gefangenen ins Hotel Hartenstein zu bringen und dort zu vernehmen.
Junkermann befahl Engels letztlich, den Amerikaner abzuführen und den nächsten zu holen. Der junge Landser schlug zur Bestätigung die Hacken zusammen, ergriff Michaels am Arm und bedeutete ihm, aufzustehen. Der Captain folgte den Weisungen des Deutschen ohne Murren aus dem Raum. Die Türe fiel krachend ins Schloss.
Junkermann seufzte ein weiteres Mal und wischte sich über den Mund. Er erhob sich von seinem Stuhl, wanderte einmal durch den Raum und spürte, wie das Leben in seine Beine zurückkehrte.
Der Oberleutnant warf einen traurigen Blick auf die Kaffeetasse, die er dem amerikanischen Hauptmann hatte bringen lassen, und die dieser nicht angerührt hatte. Die braune Brühe war mittlerweile kalt. Junkermann ergriff die Tasse, schüttete sich den kalten Kaffee die Kehle hinunter. Die Zeiten des Überflusses waren für die Wehrmacht vorüber, da konnte er es nicht verantworten, das kostbare Gesöff zu verschwenden.
Nach einigen Minuten öffnete sich die Türe erneut. Der junge Gefreite führte einen dürren, kleinen Amerikaner herein, der zwei Winkel auf dem rechten Arm trug – ein Corporal.
»Bitte, setzten Sie sich«, sagte Junkermann in gutem Englisch und wies auf den Stuhl vor sich. Der Oberleutnant sprach die Sprache des Feindes annähernd fließend, was ihm letztlich diesen Posten eingebracht hatte.
Zögerlich folgte der Amerikaner der Aufforderung. Junkermann blickte dem Mann in die Augen, bemühte sich jedoch, ein freundliches Gesicht zu wahren. Das fiel ihm nicht immer leicht, immerhin waren es die Amerikaner und Briten, die tagtäglich ins Deutsche Reich einflogen und deutsche Städte bombardierten. Auch Junkermann hatte Familie, auch sie lebten in einer deutschen Stadt, die regelmäßig vom alliierten Bombenterror heimgesucht wurde. Dieser Corporal jedoch war kein Pilot, und er konnte erst recht nichts für die Grausamkeiten, die der Krieg zu Tage förderte. Junkermann machte sich diesen Umstand immer wieder bewusst. Er gab Engels ein Zeichen mit der Hand, dessen Bedeutung der Landser mittlerweile gut kannte: Es war das inoffizielle Zeichen für Kaffee. Junkermann und Engels waren in diesem Punkt ein eingespieltes Duo, sodass der Gefreite wortlos den Raum verließ.
»Wie ist Ihr Name?«, fragte Junkermann in betont neutralem Tonfall. Ihm blieb nicht verborgen, dass dem jungen Amerikaner die Angst ins Gesicht geschrieben stand.
»Corporal Tom Morgan«, stotterte der US-Soldat. Er knetete seine Hände so kräftig, dass die Handrücken rötlich schimmerten.
»Ich bin Oberleutnant Junkermann«, stellte sich der Offizier einladend vor. »Ich werde Ihnen einige Fragen stellen, Herr Morgan.«
Der Corporal starrte Junkermann mit glasigen Augen an. Die Lippen des Mannes bebten, sein Antlitz flackerte. Engels kehrte mit zwei Tassen in den Händen zurück, die er auf den Tisch stellte. Wasserdampf stieg aus den Porzellangefäßen auf, der angenehme Geruch von Röstkaffee breitete sich in dem kühlen Gemäuer aus. Der Corporal starrte begierig auf den Kaffee, doch er rührte die Tasse nicht an.
»Trinken Sie«, erklärte Junkermann. »Sie müssen durstig sein.«
Langsam blickte der Amerikaner auf. In seiner Miene kämpfte Angst mit dem Verlangen nach Flüssigkeit, mit der Lust auf einen richtigen Kaffee. Junkermann neigte seinen Kopf auf die Seite, eine Reaktion des Amerikaners abwartend. Der dürre Corporal verharrte eine ganze Zeit lang in unruhiger Position, die Hand zuckte immer wieder zur Tasse vor, ergriff diese aber nie.
»Ist der vergiftet?«, fragte Morgan schließlich geradewegs heraus.
Junkermann lachte auf.
»Aber nein. Natürlich nicht.«
Junkermann war jenen, die er zu vernehmen hatte, stets mit Freundlichkeit begegnet. Es mochte andere geben, doch Junkermann wollte den Menschen – selbst seinen Feinden – so begegnen, wie auch er behandelt werden wollte. Und der Erfolg gab ihm Recht.
Zögerlich ergriff der Corporal die Tasse, schnupperte an der duftenden Brühe, als könne er eine mögliche Vergiftung alleine am Geruch erkennen. Einmal noch warf er Junkermann einen verstohlenen Blick zu, dann aber sprach er dem deutschen Offizier sein Vertrauen aus, indem er einen vorsichtigen Schluck aus der Tasse nahm. Sofort hellte sich die Miene des Amerikaners auf. Er nahm einen weiteren tiefen Schluck, leerte die Tasse schließlich ungeachtet der zweifelsohne hohen Temperatur des Getränks zur Hälfte.
Junkermann lächelte.
»Wo stammen Sie her?«, fragte der Oberleutnant, nachdem er seinem Gegenüber einige Sekunden gegeben hatte, sich dem Kaffeegeschmack hinzugeben.
»Aus Joplin.«
Junkermanns Miene bildete ein großes Fragezeichen. Gehört habe er von Joplin schon, meinte er, doch auf einer Karte könne er es keineswegs zeigen.
»Missouri«, fügte Morgan an, der Junkermanns Blick richtig gedeutet hatte.
»Ah.« Der Oberleutnant, der die ganze Zeit über gestanden hatte, setzte sich nun, blickte den Corporal geradeheraus an. »Sie sind ganz schon weit weg von zu Hause, Herr Morgan.«
Der Amerikaner nickte scheinbar betroffen. Seine Augen trübten sich, und einen Moment lang schien es, als sei er in einer fernen Welt.
»Haben Sie Familie daheim? Menschen, die auf sie warten?«
»Ja. Meine Eltern und meine Verlobte.«
»Wie heißt sie?«
»Eleonore. Sie ist das schönste Mädchen auf der Welt.« Morgans Augen strahlten. Junkermann grinste verschroben.
»Dann beneide ich Sie, Herr Morgan«
Der Amerikaner leerte seine Tasse, wirkte selbstsicherer und gelassener als zuvor.
»Nun«, erklärte der Oberleutnant, »Sie sind jetzt in Gefangenschaft. Für Sie ist der Krieg vorbei … Sie können sich daher relativ sicher sein, dass Sie es zurück nach Hause schaffen werden«. Junkermann setzte seine Kaffeetasse an. Ihm kam, nachdem er nun schon wieder bald 20 Stunden auf den Beinen war, jeder Tropfen des Heißgetränks wie eine Offenbarung vor. Müdigkeit drückte Junkermann gegen die Augen, doch er hielt durch, musste durchhalten. Zu wichtig war, was er hier tat.
»Darum beneide ich Sie. Ob ich meine Familie wiedersehen werde, steht hingegen in den Sternen«, schloss er seinen Gedankengang.
»Wer wartet auf Sie, Herr Oberleutnant?«
»Eine Frau und zwei kleine Kinder. Beide noch zu jung für die Schule … und dank Gott, zu jung für das hier.« Junkermann wies mit einer Handbewegung auf seine Uniform. Bilder seiner kleinen Familie schoben sich unweigerlich vor sein geistiges Auge. Sieben Monate war es nun her, dass er sie zum letzten Mal gesehen hatte.
»Dann wünsche ich Ihnen, dass auch Sie irgendwann nach Hause kommen«, proklamierte der Amerikaner, und meinte dies sichtlich ernst.
»Danke.« Junkermann lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Wissen Sie, das ist nicht Ihr Krieg, den Sie hier führen.«
»Doch, ist es. Wir kämpfen für die Freiheit der Welt … für unsere Freiheit«, erwiderte der Amerikaner entschlossen.
»Und mein Volk kämpft ums Überleben, denn scheinbar will ihm die Welt keinen Platz in ihr zugestehen. Mich interessiert, warum Sie 20.000 Meilen gereist sind, um gegen Männer zu kämpfen, die sie überhaupt nicht kennen.«
»Weil ich dem Ruf meines Landes gefolgt bin.«
»Dann sind wir schon zwei. Aber ich habe nichts gegen Sie. Ehrlich gesagt finde ich es bemerkenswert, dass wir beide, die eigentlich Feinde sein müssten, hier bei einer Tasse Kaffee zusammensitzen können, um eine Unterhaltung zu führen, statt uns bis aufs Blut zu bekämpfen.«
Morgan senkte sein Haupt.
»Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mich gut behandeln«, wisperte er.
»Eine Selbstverständlichkeit für mich.«
»Und ich danke Ihnen für den Kaffee.«
Junkermann winkte ab. »Dafür nicht.«
»Sicherlich wollen Sie im Gegenzug etwas von mir haben?«, fragte Morgan unverhohlen. Junkermann hob eine Augenbraue.
»Nein«, stellte der Oberleutnant stattdessen klar. »Nein, gar nichts. Fühlen Sie sich frei, jede Aussage zu verweigern, ganz so, wie es Ihnen das internationale Kriegsrecht zugesteht.«
Morgan überlegte lange. Er blickte schließlich in seine Kaffeetasse hinein, setzte sie noch einmal an und sog den jämmerlichen Rest der braunen Brühe aus ihr heraus.
»Sie wünschen sich, dass wir Deutschen diesen Krieg verlieren?«, setzte Junkermann zu einer Interpretation der Gedanken seines Gegenübers an. Morgan aber schüttelte vehement den Kopf.
»Ich will, dass dieser dämliche Krieg endet.«
»Das will ich auch.«
Wieder überlegte der Amerikaner eine ganze Zeit lang. Junkermann beschloss, ihn nicht weiter zu behelligen, damit Morgan sich seinen eigenen Gedanken stellen konnte. Schließlich flüsterte der Corporal so leise, dass Junkermann sich vorbeugen musste, um ihn zu verstehen: »Es ist etwas geplant. Etwas Großes. Die Operation wird Market Garden genannt, wie ich gehört habe. Mehr weiß ich nicht!«
»Operation Market Garden«, wiederholte Junkermann, der sich zufrieden zeigte.
*
Farbige Leuchtgranaten sausten schimmernden Sternschnuppen gleich zum Himmel auf, ließen das Firmament rot und gelb und grün erstrahlen. Wie Federn sanken die Leuchtkugeln langsam zur Erde hinab. Auf halber Höhe erloschen sie und plötzlich war alles wieder in absolute Finsternis gehüllt. Dumpf raunten die Abschüsse schwerer Waffen über die heckendurchzogene Landschaft Nordfrankreichs. Die dunklen Wipfel der Bäume wogen bedächtig im Wind. Die Luft war mit dem Geruch von Pulverdampf, Feuer und Schweiß geschwängert. Der Krieg wütete in all seinen Facetten.
Zwei blutjunge Landser lagen bäuchlings im hohen Gras. Eine alte Erle breitete ihr Blätterdach über ihnen aus, so als wolle sie die jungen Kerle beschützen.
Die Atmung der beiden Soldaten raste, ihre unerfahrenen Herzen pumpten wie verrückt. Sie trauten sich kaum, die Köpfe zu heben. Ihre Augen lugten unter den Stahlhelmen hervor, beobachteten das Vorgelände. Ihre Pupillen flackerten vor Aufregung.
Die Leuchtkugeln waren seit einigen Sekunden schon erloschen, und langsam gewöhnten sich ihre Augen wieder an die Dunkelheit. Flächen in allen Schwarz- und Grautönen zeichneten sich ab, die Konturen der Umgebung wurden deutlich. Vor ihnen eine kleine Baumreihe, halbrechts ein breiter Weg. Rechtsseitig in der Ferne ein Kastenwald, links flache Äcker, von Hecken durchzogen. Irgendwo dahinter musste ein Dorf liegen.
Der Weg, von dem die beiden Soldaten nur wenige Schritte entfernt lagen, führte in die eine Richtung ins Hinterland, in die andere gen Westen, geradewegs in die Arme des Feindes. Die beiden Landser aber wussten weder genau, wo sie waren, noch, wo sich der Rest ihrer Einheit aufhielt. War die Kompanie noch vor Ort? Oder längst weiter abgezogen, stets nach dem Osten folgend? Die Alliierten hatten nach ihrer erfolgreichen Landung in Frankreich eine großangelegte Bodenoffensive gestartet – und sie trieben die Verbände der Wehrmacht geradewegs vor sich her.
Mit einem Male kräuselten sich bunte Lichterwürmer am Himmel.
Der eine Landser fasste seinen Kumpel am Ärmel, wies mit schreckerfüllten Augen auf das fremde Leuchten.
»Pfadfinder!«, flüsterte der andere. »Die Tiefflieger der Amis suchen nach Zielen!«
Beide erschauderten. Sie hatten die feindliche Luftüberlegenheit bei Tage bereits zu spüren bekommen, und nun schien es, als würden die Feindflieger sie nicht einmal des Nachts in Ruhe lassen.
In der Ferne plötzlich ein Abschuss. Lautstark fegt der Schall der Detonation über die Köpfe der beiden Soldaten hinweg, dass sie furchtsam zusammenzuckten. Einige Minuten vergingen, in denen die beiden kaum zu atmen wagten. Dann sahen sie den schwelenden Brand im Vorfeld. Irgendwo auf dem Weg, einige hundert Meter vor ihnen, glühte ein getroffenes Fahrzeug vor sich hin. Sie vermochten nicht zu erkennen, ob es ein deutsches oder eines der Westmächte war. Still glomm der Metallkorpus vor sich hin. Erst hellrot, dann dunkelrot knisterte die Glut. Der Wind trug den Geruch von verbranntem Gummi an die Landser heran.
Die beiden Soldaten, die ängstlich bibbernd im Gras lagen und sich fort wünschten aus dieser dunklen Hölle, in der die Gefahr hinter jeder Ecke lauern mochte, lugten vorsichtig unter ihren Helmen hervor. Außer dem Grollen der Artillerie in der Ferne hörten sie kein Geräusch mehr. Die Stille der Szenerie war unheimlich.
»Verdammt noch mal«, flüsterte der eine, »wo ist der Rest des Zuges?«
»Keinen Schimmer«, zischte sein Kumpel mit bitterer Stimme.
Die beiden Landser hatten sich in ihrer Unerfahrenheit versprengen lassen. Ihr Zug war in einem Waldstück untergezogen, als plötzlich die Amerikaner angriffen. Der Zugführer wollte nicht ausweichen, denn zehn Mann waren unter der Führung eines Unteroffiziers auf Spähtrupp unterwegs. Hätte der Zug verlegt, wäre es ein Ding der Unmöglichkeit geworden, den Spähtrupp wieder aufzunehmen. Die Reste der Kompanie mochten sonst wo sein. Nicht einmal der Zugführer schien den Aufenthaltsort des Chefs, der anderen Züge oder des Trosses genau zu kennen. Der Rückwärtsstrudel der Wehrmachtstruppen würfelte alles durcheinander.
Als die Amerikaner den Zug attackierten, befahl der Zugführer die Verteidigung ihrer Stellungen. Der Gegner aber rückte mit Panzerspähfahrzeugen an. Ein Halten der Position war unmöglich. Im Chaos des Feindfeuers rannten die unerfahrenen Landser wild durcheinander wie die aufgeschreckten Hühner. Der Zugführer mochte noch so viel brüllen, er hatte die Kontrolle über seine Männer verloren.
Auch die beiden Landser, die nun abgeschnitten waren vom Rest ihrer Einheit, waren irgendwann aufgestanden und gerannt. In der Finsternis waren sie kopflos durch den Wald gestürzt, hatten nur aufeinander geachtet und schließlich die anderen Kameraden aus dem Blick verloren. Irgendwann waren sie ganz alleine, die Geräusche des Kampfes entfernten sich zunehmend, ehe sie ganz abflauten. Die beiden Landser waren sich nicht einmal mehr sicher, aus welcher Richtung die Abschüsse und Rufe zuletzt gekommen waren. Seitdem lagen sie im Gras unter der großen Erle, beobachteten das Vorgelände und wagten es nicht, sich zu rühren. Sie verfluchten sich selbst, verfluchten die ganze Kompanie für ihre Ahnungslosigkeit. Sie gehörten einer Ersatzkompanie an, zum großen Teil aus unerfahrenen Frischlingen bestehend, zu denen sie sich selbst auch zählten. Der Kämpfe der vergangenen Tage waren für viele die erste Begegnung mit dem echten Feind gewesen.
»Wir haben richtig Scheiße gebaut«, stellte der eine irgendwann nüchtern fest. Am Himmel tanzten die Leuchtfäden der feindlichen Pfadfinder.
»Der Feldwebel wusste schon, was er tat«, zischelte sein Kumpel reumütig. »Aber wir dachten, wir wissen es besser!«
»Und jetzt sitzen wir in der Tinte! Dabei hätten wir die Stellung halten können.«
»Ja. Panzerfäuste hatten wir sogar dabeigehabt.«
»Mist ist das alles.«
»Jammern nützt uns jetzt auch nichts mehr.«
»Aber was dann?«
Der Gefragte fasste sich mit einem Mal ein Herz. Mit zusammengekniffener Miene blickte er seinen Kumpel an und sprach: »Wir müssen los machen, bevor uns der Ami einsammelt. Wir folgen dem Weg nach dem Osten, was anderes bleibt uns nicht übrig.«
»Und wenn die Amis schon dort sind?«
»Ja, willst du hier bleiben bis in alle Ewigkeit?«
»Nein.« Die Antwort kam kleinlaut.
»Dann los!«
Von Aufbruchstimmung gepackt, rafften sich die beiden Landser auf. In gebückter Haltung näherten sich die beiden der Rollbahn.
»Wir bleiben abseits im Dickicht!«, mahnte der eine Landser, seinem treuen Kumpel am Kragen zupfend. Der nickte schweigend und gehorchte.
Das Gelände war wechselhaft, mal offen und flach, dann wieder mit Bodenwellen und Gestrüpp durchsetzt. Nicht immer gab es ausreichend Sichtschutz abseits der Straße, doch die Nacht sollte Nordfrankreich noch für einige Stunden verdunkeln.