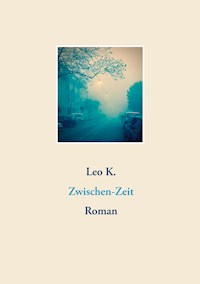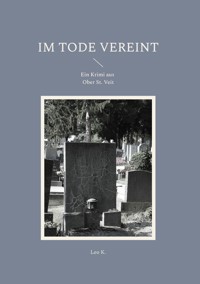
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein wahrhaft obskures Panoptikum von seltsamen Gestalten bevölkert Wiens westlichen Nobelbezirk und dessen Nachbarschaft. Der pensionierte Schulwart Vogelmayer steht dem Polizei-Chefinspektor Höbarth bei der Lösung eines Kriminalfalles zur Seite, in dem nichts so ist wie es auf den ersten Blick scheint. Der Autor beschreibt fragwürdige Machenschaften in der Arbeitswelt, liefert gleichzeitig ein Sittenbild der "Spezies (männlicher) Österreicher" und lädt einmal mehr dazu ein, mit seinen Anti-Helden auf die Reise zu gehen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch:
Ein wahrhaft obskures Panoptikum von seltsamen Gestalten bevölkert Wiens westlichen Nobelbezirk und dessen Nachbarschaft. Der pensionierte Schulwart Vogelmayer steht dem Polizei-Chefinspektor Höbarth bei der Lösung eines Kriminalfalles zur Seite, in dem nichts so ist wie es auf den ersten Blick scheint.
Der Autor beschreibt fragwürdige Machenschaften in der Arbeitswelt, liefert gleichzeitig ein Sittenbild der „Spezies (männlicher) Österreicher“ und lädt einmal mehr dazu ein, mit seinen Anti-Helden auf die Reise zu gehen...
„Manchmal braucht es ein ganzes Leben um zu erkennen, worin der Sinn des eigenen Lebens bestanden hat.“
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nachwort:
Danksagung:
Glossar:
1
Der Lokführer des Regionalexpress Nr. 1601 hatte an diesem Mittwoch, dem 26. August, keine Chance. Der von ihm geführte Zug von St. Pölten nach Wien Westbahnhof sollte fahrplanmäßig um 5:27 Uhr in Wien Hütteldorf eintreffen, der erste Personenzug an diesem Tag. Er war gerade im Begriff, die riesige unterirdische Weichenhalle bei Wolf in der Au an der Peripherie Wiens zu durchqueren, wo sich die alte Westbahnstrecke mit der neuen Hochleistungsstrecke vom Wiener Hauptbahnhof über das Tullnerfeld nach St. Pölten verschränkte.
Der Zug näherte sich mit ca. 140 km/h der Tunnelausfahrt, die sich dem Lokführer aufgrund der noch tief stehenden Morgensonne als gleißender, weißer Fleck darstellte, der rasend schnell näher kam. Erst knapp davor sah der Lokführer, dass sich etwas auf den Gleisen befand. In oft geübter Routine leitete er eine Notbremsung ein. Trotzdem war es ihm unmöglich, den Zug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen.
„Verflucht!“, ging es ihm durch den Kopf, „hier liegt ein Mensch auf den Schienen“. Dann war der Zug auch schon aus dem Tunnel draußen und seine Augen gewöhnten sich langsam an das Tageslicht. Dank einer Steigung an der Tunnelausfahrt kam der Zug bald zum Stillstand. Dem Menschen auf den Schienen war da freilich nicht mehr zu helfen...
Während der Lokführer eine Durchsage an die Fahrgäste machte, dass sie Ruhe bewahren sollten, und danach einen Notruf absetzte, versuchte er seine Gedanken zu ordnen.
Das Wiental war berüchtigt für die hohe Selbstmordrate, weiß Gott, woran das liegen mochte. Aber irgendetwas irritierte den Lokführer, er konnte es nicht in Worte fassen, und selbstredend stand er unter Schock. Er hatte bis jetzt alle Maßnahmen automatisch gesetzt und wartete nun ergeben auf das Eintreffen der Einsatzkräfte...
*
Am darauffolgenden Montag, es war der 31. August, regnete es den fünften Tag in Folge. Das Becken des zwischen 1894 und 1904 zu Tode regulierten Wienflusses, einst der gefürchtetste aller Wienerwaldbäche, führte Hochwasser. Der vor einigen Jahren eröffnete Radweg neben dem betonierten Flussbett war bereits seit Sonntag früh gesperrt. In den braunen Fluten trieben Unrat, Äste und sogar kleine Baumstämme.
Ein junge Frau saß im vollbesetzten Zug der U-Bahnlinie U4, der gerade in gemächlichem Tempo den Wienfluss kurz nach der Station Hütteldorf überquerte um dann die Rampe zur Station Ober St. Veit hinunterzufahren. Wie jeden Montag um diese Zeit war die Frau noch ein wenig unausgeschlafen und blickte müde aus dem Fenster in diesen grauen Morgen. Da erregte etwas im Wasser ihre Aufmerksamkeit. Das war kein Ast, nein es sah aus, als würde eine menschliche Hand aus dem Wasser ragen. Nein, das konnte keine Täuschung sein, da trieb ein Mensch im Fluss.
Die junge Frau sprang auf, tippte ihren Sitznachbarn an, nun sah es auch dieser. Schon befand sich der Zug unter der St. Veiter Brücke, die grausige Entdeckung war aus dem Blickfeld verschwunden. Dennoch kamen die beiden überein, dass sie ihre Beobachtung wohl der Polizei melden sollten...
*
Der pensionierte Schulwart Vogelmayer, ein hagerer Mann mit langen grauen Haaren und jugendlicher Attitüde, war an diesem 31. August genauso trüb gestimmt, wie es das Wetter war. Missmutig war er am späten Vormittag von zu Hause zur U-Bahn-Station Ober St. Veit gegangen, er wollte in Hietzing Einkäufe machen. Er hatte das Regenwetter schon satt und würde wohl einen weiteren Tag zu Hause bei Tee und vielleicht einer Lektüre verbringen, so sein Plan. Als er sich der Station näherte, fiel ihm auf der St. Veiter Brücke eine Kolonne mit Einsatzfahrzeugen auf. Sie hatten die Blaulichter eingeschaltet, auf der Westausfahrt war die Abbiegespur durch ein Polizeiauto blockiert und es hatte sich bereits ein Stau gebildet. Vogelmayer drängte sich durch eine Reihe Schaulustiger und blickte über das Geländer neben der Trafik hinunter ins Flussbett. Dort war eine Gruppe von Leuten mit Warnwesten und in Gummistiefeln damit beschäftigt, etwas, oder vielmehr jemanden aus dem Wasser zu bergen.
Genaueres war nicht zu sehen, außer dass Vogelmayer in einer bulligen Gestalt seinen alten Freund und Kartenspielpartner, Chefinspektor Höbarth erkannte. Vogelmayer ahnte bereits, dass dieser Tag nun nicht so geruhsam verlaufen würde wie er vor kurzem noch angenommen hatte, und er sollte Recht behalten.
Bereits zwei Stunden später erreichte Vogelmayer Höbarths Anruf. Dieser wollte am Telefon nicht viel preisgeben, immerhin deutete er etwas von zwei Ereignissen innerhalb von fünf Tagen an, die diesen für ihn bis dato ruhigen Sommer abrupt beendet hätten. Er würde ihm gerne ein wenig mehr erzählen, selbstverständlich im „informellen“ Rahmen, was so viel hieß wie im Zuge einer Kartenpartie beim Wirt‘n.
Schon einige Male hatte Vogelmayer dem Polizeibeamten Höbarth, der noch ein paar Jahre bis zur Pensionierung hatte, aber gedanklich längst in Pension war, schon mehrmals also hatte er seinem Freund mit Rat und Tat beigestanden, wenn dieser an einem Fall zu verzweifeln drohte. Dass Vogelmayer trotz seines Alters ein linker Rebell geblieben war während Höbarth stets seine Law-and-Order-Mentalität betonte, verlieh ihren Zusammenkünften eine besondere Note.
Vogelmayer machte sich also auf den Weg zur erwähnten Gaststätte und ärgerte sich beim Überqueren der Amalienstraße einmal mehr über die immer öfter im Stadtbild auftauchenden, einfach irgendwo, manchmal sogar mitten auf dem Gehsteig abgestellten Elektroroller. „Irgendwann werden die Leute das Gehen verlernt haben, vielleicht werden künftige Generationen ja ohne Beine auf die Welt kommen...“, murmelte er grimmig. Gerne würde er diese Ausgeburten moderner Bewegungsunfähigkeit vernichten, in diesem Falle war ihm allerdings schon jemand zuvor gekommen. Der E-Scooter war nämlich umgeworfen worden und gab im Rinnsal am Straßenrand ein Bild des Jammers ab.
Vogelmayer lachte sich ins Fäustchen und marschierte von dannen.
2
„So geht des, siehst es? So geht des! So muaß ma des mochn!“ Die aufgeregte Stimme des grantigen Wirts war die ständige Begleitmusik zu Vogelmayers und Höbarths Kartenpartie.
Während Vogelmayer die Karten mischte, wurde es nun gerade sehr laut in der kleinen Küche des namenlosen Tschocherls in der Linzer Straße nahe des Hütteldorfer Bahnhofs. „Schau da’ des in Internet an, wauns’d ned waaßt, wia des geht! I kaun da a ned ois erklärn, vastehst?“
Die offenbar frisch angelernte Kellnerin kam kurz nach vorn an die Schank um Gläser einzuräumen. Vogelmayer sah, dass sie Tränen in den Augen hatte. „Dieser Idiot!“, dachte er bei sich und meinte damit den Wirt, laut sagte er aber an Höbarth gewandt:
„Ich würde mir an Ihrer Stelle einmal dieses Motel neben der Baustelle genauer anschauen, wo der Mann zuletzt gearbeitet hat.“
Höbarth machte eine abwehrende Handbewegung: „Wir haben alles untersucht und alle seine Kollegen befragt. Alle sagen übereinstimmend, dass er ein depressiver Kerl gewesen ist, und dass ihn irgendetwas in den Selbstmord getrieben hat.“
Die Rede war von jenem Mann, der vor ein paar Tagen vor dem Tunnelportal bei Wolf in der Au, unweit von Hütteldorf, von einem Zug überfahren worden war. Alles deutete auf einen Selbstmord hin. Da eine Tasche mit seinen Papieren, darunter ein Baustellenausweis, neben dem Gleis gelegen war, konnte seine Identität rasch geklärt werden, wenn auch der Mann selbst bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden war.
Und an diesem Morgen nun hatte man aus dem Wienfluss eine Frauenleiche geborgen. Chefinspektor Höbarth hatte also im Moment viel zu tun und es lastete der Erwartungsdruck seines Vorgesetzten auf ihm, was zu seiner Laune nicht besonders beitrug.
Vogelmayer hatte die Karten ausgeteilt, Höbarth nahm sie auf und seine Gesichtszüge verdunkelten sich: „Na, super!“, ließ er mit hörbarem Zynismus vernehmen, und dann wiederholte er immer wieder, „des is super!“, um zu demonstrieren, wie unzufrieden er mit dem Blatt war, das ihm Vogelmayer da zugeteilt hatte. Dieser nahm’s gelassen, es war ja nur ein Spiel.
Unterdessen hatte der Wirt in der Küche wieder mit seiner Belehrung begonnen: „Schau, so geht des, siehst es? So geht des!
Merk’ da des amoi!“ Die ebenfalls in der Küche arbeitende Köchin warf etwas ein, da brüllte der Wirt los: „Tuats do ned palavern es Zwa! Draußen san de Leit! Du, schau amoi ausse, ob ned wer wos braucht...“
Die Kellnerin erschien im Lokal und ging zu dem Tisch, an dem Vogelmayer und Höbarth spielten – die beiden waren nämlich die einzigen Gäste an diesem tristen Nachmittag. Während die Frau noch ihr Taschentuch in der Schürzentasche verstaute, fragte sie:
„Möchten Sie vielleicht noch etwas trinken?“
Höbarth runzelte die Stirn und wollte schon verneinen, doch Vogelmayer kam ihm zuvor und sagte: „Bitte, ich hätte gerne noch so einen ausgezeichneten Kaffee, und dazu ein Croissant.“ Er wollte die Kellnerin aufmuntern, denn nun hatte sie etwas zu tun und war den lästigen Wirt für eine Weile los.
Höbarth bestellte nun seinerseits auch einen Kaffee und fuhr dann fort: „Warum sollte ich mir dieses Motel ansehen? Dort übernachten Fernfahrer, die am Wochenende ihre Sattelschlepper am Stadtrand abstellen müssen. Mehr ist dort nicht mehr los. Seit die Tankstelle aufgelassen wurde und es somit auch keinen Tankstellenshop mehr gibt, ist dort Ruhe eingekehrt. Na ja, bis auf den Straßenstrich, draußen am großen Parkplatz bei der Autobahn.“
„Nun, ich habe da so eine Vermutung“, begann Vogelmayer, unterbrach sich, als die Kellnerin die Kaffees und das Croissant servierte, und fuhr dann fort: „Ich will ihnen jetzt etwas erzählen...“
Wie so oft legte er eine Gedankenpause ein, nahm die Brille kurz ab um dann fortzufahren: „Ich glaube jedenfalls nicht an Zufälle, zwei Todesfälle in so kurzer Zeit – das hängt zusammen – irgendwie...“
Und er begann zu erzählen, wie er vor einer Woche bei einem Spaziergang im Lainzer Tiergarten nahe des Pulverstampftores vermeint hatte, einen – irgendwie erstickt klingenden - Schrei zu vernehmen. Beim in Sichtweite befindlichen Motel war ihm ein offenes Fenster im obersten Geschoß aufgefallen, aus dieser Richtung schien der Schrei gekommen zu sein. Er hatte ja der Sache keine weitere Bedeutung beigemessen, damals an diesem frühen Morgen, der erfüllt gewesen war von lautem Vogelgezwitscher und dem Verkehrslärm der nahen Autobahn – vielleicht war es ja nur Einbildung gewesen.
Höbarth sagte wieder „Super!“, doch diesmal war der Ton seiner Stimme nicht mehr zynisch, sondern eine Mischung aus Ärger und Verzweiflung, denn dies bedeutete für ihn möglicherweise schon wieder Arbeit. Außerdem meldete sich nun sein Magen und er rief dem Wirt zu, dass er jetzt etwas essen wollte. „Chef, was kannst’ empfehlen um diese Tageszeit?“, fragte er.
„Na I werd' schauen, was ma z‘sammpanschen können auf die Schnelle“, sagte der Wirt und verschwand in der Küche.
Inzwischen hatte ein neuer Gast das Tschocherl betreten, ein Stammgast, denn Höbarth grüßte ihn mit „Servas Ritchie“ und grinste. Eine Minute später betrat ein weiterer Mann das Lokal. Es wurde laut, die beiden Neuankömmlinge dürften schon ordentlich vorgeglüht haben. Der mit dem Namen Ritchie lehnte an der Schank und wollte etwas bestellen. Da gerade niemand vom Personal zu sehen war rief er laut „Hallo! Haaallo!“ Nach kurzer Pause noch einmal „Haaallo!“.
Eigentlich hatte Vogelmayer schon nach Hause gehen wollen, doch die Mitteilung, die er Höbarth gemacht hatte, schien auf diesen scheinbar einen großen Eindruck gemacht zu haben. Dies verpasste Vogelmayer so etwas wie einen Adrenalinstoß. Er musste sich jetzt belohnen und bestellte übermütig bei der eilig herbeigelaufenen Kellnerin einen Kaffee mit Cognac. Dies war nämlich eine Mischung, die er einst „in Wien eingeführt hatte“, wie er immer wieder nicht ohne Stolz anmerkte, um sich ein wenig über seine, wie er meinte provinziellen Mitmenschen zu stellen.
Höbarth bestellte, so wie die beiden Neuen, ein Viertel Schankwein.
Jetzt brachte der Wirt persönlich einen Teller Rahmbeuschel und stellte ihn vor Höbarth auf den Tisch. „Na, kost amoi, wia schmeckt da des?“
Höbarth kostete und seine Miene hellte sich auf. „Legendär!
Super! SSSuper, des schmeckt so!“, rief er aus und formte ein „o“ mit seinen Fingern.
Der Wirt grinste selbstzufrieden und sagte „isses in Ordnung, was?“
Gierig schlang Höbarth das Essen hinunter und dazwischen rief er immer wieder „ssuper! Sssuper“.
Ritchie und sein Kumpan redeten unterdessen auf Höbarth und Vogelmayer ein, dass sie Bauernschnapsen spielen wollten – natürlich um Geld! Vogelmayer lehnte ab: „Nein, um Geld spiele ich nicht, von mir aus um diese Runde, die wir grad trinken.“
Auch Höbarth verneinte. Als Polizist um Geld zu spielen, noch dazu in der Öffentlichkeit, war wohl keine so gute Idee. Ritchies Kumpan sagte lächelnd: „Ah, Recht haben Sie! Sie sind ja beide so gescheit! Spielen wir also um diese Runde, der Verlierer zahlt.“
Es kam, wie es kommen musste. Ritchie hatte das Glück des Tüchtigen oder des Betrunkenen auf seiner Seite. In Runde Eins rief er, nachdem Höbarth die Atout-Farbe „Treff“ gerufen hatte – „is g’spritzt de Treff“. Somit zählte in diesem Spiel alles doppelt.
„Du hast ja deine eigenen Karten noch gar nicht gesehen“, rief Höbarth erstaunt aus, darauf Ritchie: „is wurscht, is g‘spritzt de Treff!“.
Selbstredend gewann er die Partie. Und in Runde Zwei gab ihm das Schicksal zum Rufen des Atouts einen sogenannten „Herrenschnapser“ in die Hand – er hatte alle fünf Karten einer Farbe und so war die Partie gelaufen – Ritchie und sein Kumpan hatten gewonnen.
Wie es der Brauch war, stieg Ritchie auf den Tisch und rief Kraft der Promille in ihm aus: „Ich habe die Welt gesehen, meine Damen und Herren!“, wobei er seine rechte Hand verdächtig hoch anhob...
Vogelmayer wurde es jetzt doch zu blöd, zumal politische „Stammtischreden“ dräuten und Höbarth vermutlich in den zwei rotgesichtigen Gesellen Verbündete gegen ihn, Vogelmayer, haben würde. Er winkte die Kellnerin herbei und zahlte wie versprochen die Runde.
Gerne gab er ein üppiges Trinkgeld, worauf sie ihn fast verführerisch anlächelte. Vogelmayer fühlte eine wohlige Wärme um nicht zu sagen Schmetterlinge in ihm hochsteigen.
Dennoch verließ er eilig das Tschocherl und machte sich zu Fuß auf den Weg nach Hause – sein Weg durch die verregnete Peripherie Wiens führte ihn die Hochsatzengasse hinunter, unter der Westbahn durch und über die St. Veiter Brücke auf die andere Seite des Wienflusses, welcher sein Geheimnis noch nicht preisgeben wollte – doch sie würden diesem näherkommen, dessen war sich Vogelmayer nun sicher, denn er hatte heute, hier und jetzt seinem Freund Höbarth einen Hinweis geliefert.
Als er mitten auf der Brücke war, die über den Wienfluss und die U-Bahn führte, glaubte er aus den Augenwinkeln ein grün blinkendes Licht unten auf der U-Bahn-Trasse zu sehen. Doch Vogelmayer war zu müde um der Sache mehr Aufmerksamkeit zu schenken und ging weiter – er spürte die Wirkung des Cognacs und wollte nur noch schlafen.
3
Vogelmayer erwachte mit schwerem Kopf, er hatte nicht gut geschlafen. Die ganze Nacht hatte er immer wieder das Trommeln der Regentropfen am Fensterbrett vernommen. Sein erster Gedanke war, wie es heute wohl seinem Freund Höbarth gehen mochte, denn dieser hatte am Vortag wohl bedeutend mehr Alkohol getrunken als er selbst. Der nächste Gedanke war bei dem „Fall“, den Höbarth gerade bearbeitete, oder besser gesagt den beiden Fällen. Doch zuerst war es Zeit für ein Frühstück. Vogelmayer bereitete es mechanisch zu, und sobald der Kaffee und der Dinkelbrei ihre erste Wirkung getan hatten, fühlte er sich zu neuen Schandtaten bereit. Er würde auf eigene Faust ermitteln, dieser Vorsatz war in ihm während des Frühstücks gereift.
Der Regen hatte nachgelassen, der Himmel war grau und ein scharfer Wind pfiff durch die Gassen von Ober St. Veit. Vogelmayers Weg führte ihn wieder zur U4, er fuhr nach Hütteldorf und sodann mit der S-Bahn eine Station bis Wolf in der Au. Hier befanden sich die Staubecken des Wienflusses, die Ende des 19.
Jahrhunderts errichtet worden waren und Wien vor einem 1000-jährigen Hochwasser schützen sollten. Vogelmayers Weg führte über einen Damm, eines der Becken war geflutet, bei einer geöffneten Schleuse strömte Wasser mit großem Schwall in den Unterlauf des Wienflusses. Vogelmayer war hier schon oft gegangen und hatte Vögel beobachtet, die normalerweise auf dem jetzt überfluteten Areal ihre Nistplätze hatten. Was aus den Bewohnern dieses Stücks unberührter Natur wohl geworden war, als der große Regen kam? Er hielt kurz inne, dann setzte er seinen Weg fort, überquerte die Westausfahrt über eine Fußgängerbrücke und war bald beim Pulverstampftor des Lainzer Tiergartens, aus dessen Nähe er zu dem Motel und dem geöffneten Fenster hinüber gesehen hatte. Er ließ das Tor diesmal jedoch links liegen und folgte dem Weg entlang der Mauer in westliche Richtung.
Bald stand Vogelmayer vor dem Motel, das seit einigen Jahren ein trauriges Dasein fristete und demnächst einer großen Lagerhalle eines Lebensmittel-Logistik-Unternehmens weichen sollte – ein Vorhaben, das bei Vogelmayer naturgemäß auf Ablehnung stieß, denn damit wurde jede Menge Boden versiegelt und die heilige Ruhe des Lainzer Tiergartens gestört, so Vogelmayers Meinung. Früher, ja früher, hatte es hier eine Tankstelle gegeben und zum Motel hatte auch ein kleines Café gehört, das den Radfahrern und Wanderern auf ihrer „Tiergarten-Runde“ als Labungsstelle gedient hatte.
Der Zugang zum Motel war in ungepflegtem Zustand aber nicht versperrt. In einem Graben angehäufte Taschentücher und Plastikverpackungen zeugten vom nächtlichen Geschehen, das Höbarth tags zuvor angedeutet hatte. Das Motel selbst lag verlassen da. Es schienen kaum noch Fernfahrer zu übernachten, zuletzt hatten hier wohl nur Arbeiter gewohnt, die mit dem Rückbau bzw. Abbruch der Tankstelle beschäftigt waren - einer von ihnen lag nun im Kühlraum der Gerichtsmedizin.
Vogelmayer schlich um das Gebäude herum und stellte fest, dass jenes Fenster, das ihm unlängst aufgefallen war, immer noch gekippt war. Er befand sich nun auf der Terrasse auf der nur noch ein paar leere Tische unordentlich herumstanden. „Scheinbar wird den Hotelgästen nun nicht einmal mehr ein Frühstück serviert“, dachte sich Vogelmayer. Dann wandte er sich den Blumenbeeten und Sträuchern zu, die den ehemaligen Gastgarten des nun offenbar geschlossenen Cafés säumten. Da fiel ihm am vom Regen aufgeweichten Boden unter einer Hecke eine Flasche auf. In dieser steckte etwas, das sich bei näherer Betrachtung als Stück beschriftetes Papier herausstellte. „Eine Flaschenpost“, fuhr es ihm durch den Kopf – er hatte also Recht behalten, er war sich nun sicher, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war! Die Flasche hatte den Zettel vor dem Regen geschützt und so eine Nachricht konserviert. Vogelmayer blickte nach oben, jemand musste die Flasche aus dem bewussten Fenster geworfen und gehofft haben, dass sie jemand finden würde, dies war nun sonnenklar. War da oben jemand gefangen gehalten worden und hatte um Hilfe gerufen? Und er hatte den Schrei an jenem Morgen für Täuschung gehalten bzw. ignoriert! Vogelmayer beendete abrupt seine Spekulationen und Gedankenspiele.
Er beeilte sich nach Hause, denn die Flasche zu öffnen und die Nachricht zu lesen bzw. Schlüsse daraus zu ziehen, das würde er nun wohl besser seinem Freund Höbarth überlassen...
*
Revierinspektor Pfisterer und die anderen Beamten am Kommissariat hatten es sich gerade in ihrer Mittagspause gemütlich gemacht und verspeisten genussvoll ihre Wurstsemmeln, als die Tür aufflog und Höbarth sie mit den Worten begrüßte: „Es sad’s Trott‘ln, es sad’s soiche Trott‘ln, oba soiche Trott‘ln wos es sad’s!“
Dabei fuchtelte er mit einem Zettel in der Luft herum.
Dann pflanzte er sich vor seinen Leuten auf und brüllte sich fünf Minuten lang die Seele aus dem Leib. Dabei ging es inhaltlich im Grunde genommen nur darum, dass sie es bei ihrer Einvernahme der Bauarbeiter in dem Motel verabsäumt hatten, das Gebäude gründlich zu untersuchen. Ein „unbeteiligter Spaziergänger“ habe ihm, Höbarth, nun dieses Beweisstück überreicht.
Triumphierend blickte er dabei in die Runde, die von Vogelmayer gefundene „Flaschenpost“ in der Luft schwenkend.
Trotz Verschluss war das Papier in der Flasche feucht geworden, darauf noch Fingerabdrücke zu finden würde schwierig und vor allem teuer werden. Allerdings befanden sich auf dem Papier noch zwei gut lesbare Telefonnummern, die einen Hinweis auf die Identität der Frauenleiche aus dem Wienfluss bieten könnten.
Denn er, Höbarth, hatte die Nummern natürlich sofort angerufen. Gemeldet hatte sich bei der ersten Nummer niemand, bei der zweiten jedoch ein Mann mit fremdem Akzent. Der war zuerst perplex gewesen, einen Anruf von der österreichischen Polizei zu erhalten, hatte dann aber angegeben, dass er seine Frau seit einigen Tagen vermisse und sie telefonisch nicht erreichen könne. Es stellte sich heraus, dass er sich in Rumänien aufhielt. Er würde nach Wien reisen und man würde versuchen, mit seiner Hilfe die Frauenleiche zu identifizieren. „Das alles hätte bereits Tage früher passieren können, ja müssen", schnaubte Höbarth.
Nur mühsam beruhigte sich Höbarth wieder. Dann ordnete er an: „Schluss is‘ jetzt mit da Pause! Jetza tat’s wos arbeiten! Des Motel wird auf’n Kopf g´stellt, von oben bis unt’ und von unt’ bis oben. I wü Ergebnisse – is des kloa?! Ergebnisse!!!“
*
Vogelmayer war nachdenklich. Er hatte Höbarth seinen Fund überreicht, war auch Zeuge des Telefonats mit dem Mann in Rumänien gewesen und hatte sodann beschlossen, noch eine Runde zu drehen, denn es hatte zu regnen aufgehört. Kurz spielte er mit dem Gedanken, das Tschocherl vom Vortag aufzusuchen, denn das Lächeln der Kellnerin wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf. Doch er besann sich und fuhr mit der U-Bahn nach Hütteldorf. Er wollte zu einem seiner Plätze gehen, die er immer aufsuchte, wenn er an etwas zu „kiefeln“ hatte, also etwas verarbeiten musste.
Vogelmayer setzte sich also auf „seine“ Bank am Bahnhof Wien Hütteldorf, der in seiner Jugendzeit „Hütteldorf-Hacking“ geheißen hatte. Die Bank stand auf dem ersten Mittelbahnsteig von der Hütteldorfer Seite aus gesehen, und zwar mit Blickrichtung stadteinwärts. Hinter Vogelmayer befand sich eine Holzwand mit einem Fenster. Die Wand bildete eine Art Windfang, den Eingang zur seinerzeitigen Fahrdienstleitung des Bahnhofes – in einer Zeit, als die Signale und Weichen noch nicht vollautomatisiert gestellt wurden.
Als Vogelmayer noch in Pressbaum gelebt hatte, einer kleinen Marktgemeinde in der Nähe Wiens, wo sein Vater als Schulwart gearbeitet hatte, war er oft auf dem Heimweg von der Schule in der großen Stadt auf eben dieser Bank gesessen, hatte seine Hausaufgaben gemacht oder einen knallbunten Schundroman gelesen.
Die Schulwart-Profession hatte Vogelmayer von seinem Vater übernommen, obwohl er ja eigentlich viel lieber Rockmusiker oder wahlweise Förster geworden wäre. Der Vater hatte ihm derlei Flausen nachhaltig ausgeredet. Sein Vater war in der alten Volksund Hauptschule auf dem Pressbaumer Hauptplatz eine Respektsperson und gleichzeitig ein Original gewesen. Wenn jemand in der Pause auf dem Schulhof zu laut war , hatte der Alte aus dem Fenster gerufen: „Rruhe! Rrruhe! I kumm’ glei’ ausse, daun wird do a Ruah sei!”
Gleichzeitig aber hatte er im Schreibtisch seines Schulwart-Büros eine Lade voll gefüllt mit Bazooka-Kaugummis die er verschmitzt lächelnd um fünfzig Groschen an die Kinder verkaufte.
Unwillkürlich blickte Vogelmayer auf, sah sich um, ob er immer noch alleine hier saß, dann blickte er nach rechts in Richtung Himmelhof. Damals, Ende der 1970er Jahre, hatte sich dort oben eine Schi-Sprungschanze befunden. Sie war einem Brand zum Opfer gefallen und schon längst Geschichte, zumal die schneereichen Winter schon lange der Vergangenheit angehörten und somit auch der Schisport im Wiener Raum. Ein unangenehmes Gefühl beschlich Vogelmayer, es wurde ausgelöst durch den Geruch von Carbolineum, der von der Holzwand hinter ihm ausging. Früher hatte am Bahnhof alles danach gerochen, die Schwellen der Gleise, damals noch aus Holz, waren damit imprägniert und auch Telegrafenmaste, die Bretter der Türen, der Boden des Warteraums usw.