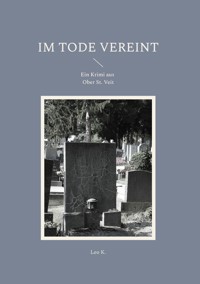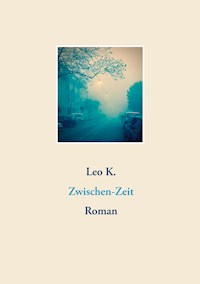
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Zwischen-Zeit" steht metaphorisch einerseits für den magischen Zeitpunkt zwischen Traum und Wirklichkeit, nämlich jene kurze Zeitspanne zwischen dem Dämmerland der Träume und dem Erwachen ins Bewusstsein, und andererseits für die Zeitenwende, an der die Menschheit meiner Meinung nach gerade steht. "Zwischen-Zeit" ist zweifellos ein merkwürdiger Roman. Es ist ein Roman, in dem Musik und Schienenstränge eine große Rolle spielen, ein Roman der von der Liebe in Zeiten des Klimawandels erzählt, und der unter anderem auch davon handelt, warum aus einem Wolf niemals ein Haustier werden kann. Nicht zuletzt ist dieses Buch, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehen mag, ein Plädoyer für das schönste, zerbrechlichste und filigranste Gut, das wir haben - nämlich unser Leben! Leo K. im Dezember 2020
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Leo K., Jahrgang 1962, lebt in Wien und ist freier Schriftsteller und Musiker und genießt es nach wie vor, „nicht von der Kunst leben zu müssen“. Neben seinem Hauptberuf als Techniker schreibt Leo K. für diverse Print- und Internet-Medien im Musik- und Politikbereich und ist seit seinem siebzehnten Lebensjahr als Bassist mit den verschiedensten Bands in Österreich und im benachbarten Ausland unterwegs.
Von Leo K. ist in diesem Verlag erschienen:
„ZOFF-ein Rock’N’Roll-Schundroman“ (©2013, 2.Auflage 2018)
Webpräsenz:
www.leo-k.org
https://www.reverbnation.com/leok
https://www.facebook.com/The1LeoK/
Für Ratna
Inhaltsverzeichnis
ANSTATT EINES VORWORTS
1 Dunkle Stunden
Zwiegespräch (Teil 1) Das Lebensgefühl der Achtziger Jahre (Versuch einer Annäherung)
2 MONSIEUR TRAIN TRAIN und die Liebe in Zeiten des Klimawandels
Zwiegespräch (Teil 2) Cruisin’ down the highway
3 Coolio
Zwiegespräch (Teil 3) Magic Moments
4 Kinder der Revolution
Zwiegespräch (Teil 4) Die Zeit des Erwachens
5 Kinder des Zölibats
6 Aus den Notizen des Dr. N.
Zwiegespräch (Teil 5) Through the Looking-Glass
7 Les Derniers
ANSTATT EINES VORWORTS
Hier liegt nun also der Nachfolger zu meinem Rock’N’Roll Schundroman vor, es sollte das „Opus Magnum“ werden, und dementsprechend hat die Arbeit daran auch ganze sieben Jahre gedauert. Im März 2020 sollte die „finale Phase“ der Fertigstellung beginnen und dann legte das Corona-Virus die Welt lahm und hat keinen Stein auf dem anderen gelassen. Eigentlich wäre dies der Zeitpunkt gewesen, alles bisher Gesagte und Geschriebene in den Mistkübel zu werfen, doch nein! Nach einer anfänglichen Schockstarre war für mich klar, dass gerade jetzt dieses Buch fertiggestellt werden musste, das nun doch kein Roman im herkömmlichen Sinne und schon gar keine Biographie ist, aber dennoch den einen oder anderen Charakter, der mir im Laufe des Lebens begegnet ist, porträtiert, und natürlich auch auf ganz aktuelle Entwicklungen Bezug nimmt. Ich nenne es nun scherzhaft das „Opus Magnus“ – eine Fantasiebezeichnung für etwas, das im Grunde genommen immer noch unvollendet ist und wohl nie vollendet werden kann.
Die verwendeten Lied-Texte geben Hinweis auf jene Anhaltspunkte und Guidelines im Leben, die in Momenten tiefster Verzweiflung als ewige Konstante bestehen bleiben, sozusagen Lieder als Lebensretter.
„Zwischen-Zeit“ steht metaphorisch einerseits für den magischen Zeitpunkt zwischen Traum und Wirklichkeit, nämlich jene kurze Zeitspanne zwischen dem Dämmerland der Träume und dem Erwachen ins Bewusstsein, und andererseits für die Zeitenwende, an der die Menschheit meiner Meinung nach gerade steht.
„Zwischen-Zeit“ ist zweifellos ein merkwürdiger Roman. Es ist ein Roman, in dem Musik und Schienenstränge eine große Rolle spielen, ein Roman der von der Liebe in Zeiten des Klimawandels erzählt, und der unter anderem auch davon handelt, warum aus einem Wolf niemals ein Haustier werden kann. Nicht zuletzt ist dieses Buch, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehen mag, ein Plädoyer für das schönste, zerbrechlichste und filigranste Gut, das wir haben – nämlich unser Leben!
Dank und Wertschätzung ergeht an all die Menschen mit denen ich gemeinsam Musik machen durfte und darf – Music is my life!
Mein besonderer Dank geht an Susi Minarz für die geleistete und unschätzbar wertvolle Arbeit als Lektorin.
Im Gedenken an meinen Freund Dr. Manfred Bauer, der mir literarisch zum Vorbild wurde und in großer Dankbarkeit all den Frauen in meinem Leben, die hier nicht einzeln genannt werden können und die mich rechtzeitig geerdet haben, ehe ich aus der Bahn flog...
You can never go back 2B4...
(McCafferty / Agnew / Murrison © 2014)
1 Dunkle Stunden
Money can’t buy
Es geschah in einer dieser Nächte nach einem dieser Auftritte. Ich durchlebte gerade eine erbärmliche Zeit.
She ain't here and you're asking why
Life's a bitch and then you die
Come on lover just let go
Is there something I should know
Was it just one of those nights
Something you don't remember, yeah
Just one of those crazy nights
Something I don't remember
(UFO, One of those Nights by Laurence Archer, Pete Way, Phil Mogg © 1991)
Zuerst war da die Enttäuschung mit dieser Vanessa gewesen, deren Preisschild so hell gestrahlt hatte, dass ich davon geblendet worden war – der Traum, in dem diese Luxus-Prinzessin die Hauptrolle spielte, zerplatzte an einem Donnerstagabend, Ende August 1992. Es war überdurchschnittlich warm, und ein Gewitter lag in der Luft – ich erinnere mich an die surreale Wolkenstimmung, die sich über dem grünen Berg zusammenbraute, als ich mit Tränen in den Augen auf dem Weg nach Hause war...
Freitag waren wir dann nach Germany aufgebrochen, ein Jugendzentrum in Bayern sollte zum Ort des Triumphes werden doch es kam anders. Zum einen war ich nicht gut drauf siehe oben. Unser Schlagzeuger meinte nur lapidar: „Es wird ein paar Tage weh tun, vergessen wirst Du sie aber nie!“ Er sollte Recht behalten, doch die nächste Seniorita wartete ohnedies bereits in den Kulissen auf ihren Auftritt...
Anyway - wir wohnten beim Schlagzeuger der befreundeten lokalen Band Toxx, die laut Plakat „Special Einhighzing“ machen würde. Der Typ lebte auf einem Alternativ-Bauernhof, wir übernachteten im Stadl und schliefen im Heu. Ich sehe noch vor mir, wie ich meine Goldketten und all den Rock’N’Roll-Kram sorgsam neben dem Schlafsack aufbewahrte und sich die anderen darüber lustig machten. Am Samstagmorgen gingen wir ins nahe Dorf in eine Kneipe frühstücken. Dort wollte ich ein Ei essen, doch mir zitterten die Hände derart, dass der gesamte Inhalt des Salzstreuers auf dem Ei landete. Dann machte ich den Fehler, am Vormittag schon einen Gin-Tonic zu trinken, was nicht wirklich zu einer guten Stimmung innerhalb der Band beitrug und schon gar nicht zu meinem Spielvermögen. Und zu guter Letzt stellte sich im Lauf des Tages heraus, dass neben uns und Toxx noch eine Truppe von Trommlern vor Ort war - und die stahlen uns mit der guten Laune, die sie verbreiteten, die Show, aber so was von...
Abbauen, heimfahren im Bandbus, die Jungs schliefen hinten, ich saß vorne bei unserem Fahrer und redete ein wenig mit ihm, damit er nicht einschlief, denn es war die Nacht zum Sonntag und nicht viel Verkehr auf der Autobahn. Irgendwann nickte auch ich ein, im Radio lief unterdessen ein Song von Annie Lennox, die gerade ihr erstes Solo-Album nach dem Ende der Eurythmics veröffentlicht hatte.
Money can't buy it, baby
Sex can't buy it, baby
Drugs can't buy it, baby
You can't buy it, baby *)
*) Annie Lennox © 1992
Diese Textzeilen fanden ihren Weg in meine Gehirnwindungen und ließen mich nicht mehr los. Am frühen Morgen zu Hause angekommen, nachdem der Truck beim Proberaum entladen worden war, legte ich mich daheim ins Bett. Es mochte ca. halb Acht gewesen sein und immer und immer wieder holten mich diese Textzeilen aus dem Halbschlaf in eine zu lange verdrängte Wirklichkeit, bis mir plötzlich speiübel wurde – ich schaffte es gerade noch zur Toilette, wo ich mich übergab – mir wurde in diesem Moment klar, dass ich mein Leben bisher praktisch weggeworfen hatte und nun grundlegend ändern musste! Der Grundstein zu diesem Buch wurde also bereits damals gelegt, denn es handelt – wie wir gesehen haben und noch sehen werden - von den Verästelungen in den Lebensläufen, den entscheidenden Wendepunkten und den Sackgassen der Geschichte. Voila, here we go!
Memorabilia
Ein uraltes Bild aus den 1870er Jahren in einer der verstaubten Sammelmappen meines Großvaters zeigte eine Ansicht von „Österreichs Erster Bergbahn“. Diese führte vom Halterbachtal auf die Sophienalpe. Am höchsten Punkt stand eine Dampfmaschine, die mittels eines großen Umlenkrads das Zugseil antrieb, mit dem ein offener Wagen, der wie eine Kutsche aussah, auf den Schienen hinauf gezogen wurde, während auf dem Gegengleis sein Zwilling Richtung Tal fuhr. Ein kurzweiliges Vergnügen der Aristokratie jener Zeit, während jener Vorfahr, der dieses Bild - vielleicht eine frühe Photographie oder doch ein gemaltes Bild? – hinterlassen hatte, hier bestenfalls als Maschinist tätig gewesen war und die feinen Damen in den Wagen nur aus der Ferne bewundern konnte.
Der Großvater selbst war eines von sieben Kindern. Als er 1904 in Wien in ärmlichsten Verhältnissen geboren wurde, gab man ihm keine sieben Jahre zum Leben, da er sehr früh an der Kinderlähmung erkrankt war. Da aber sein Vater, der Familienerhalter, aus dem ersten Weltkrieg schwer verwundet (mit einem Lungendurchschuss) heimkehrte, lag es nun an meinem Großvater, für alle anderen zu sorgen. Und dieser Verantwortung kam er denn auch nach. Er lernte zuerst ein Handwerk und wurde Tischler - sein von ihm gefertigter Sessel, das Gesellenstück, ist übrigens bis zum heutigen Tag bei mir in Verwendung. Am freien Sonntag ging man in den Wienerwald, um Holz zu sammeln, denn in der Zeit nach dem Krieg war dieses in Wien wie so vieles Mangelware, die Ausflüge auf die Sophienalpe und in den Lainzer Tiergarten dienten in jenen Tagen also dem verbotenen „Erwerb“ von Brennmaterial.
Einer späteren Berufung folgend wurde der Großvater an einem Freitag den Dreizehnten bei der Gemeinde Wien eingestellt (jawohl, dem Roten Wien) und gehörte zum Heer der Arbeiter, die an der Elektrifizierung der Wiener Stadtbahn mitwirkten. Dies war der Einstieg in die Elektrotechnik, die seitdem seine Geschicke und die der Nachkommen prägen sollte und dem Großvater schließlich eine Fixanstellung bei den Wiener E-Werken einbrachte. Nun durfte er auch die Frau heiraten, die er im „Arbeitersportverein“ beim Wandern kennengelernt hatte, und die er damit von ihrem Schicksal als Hilfsarbeiterin in der Wiener Tabakregie in Ottakring erlöste. Als sich die Verhältnisse änderten und der Ständestaat seine bösen Schatten über Wien warf, musste er seinen sozialistischen Grundsätzen abschwören und benötigte ein Glaubensbekenntnis, um die Stelle bei der Stadt Wien nicht zu verlieren. Die Römisch-Katholische Kirche verlangte von ihm und seiner Frau, die er ja in deren Sinn nicht „rechtmäßig“ geehelicht hatte, mit dem Kreuz in der Hand dreimal das Kirchengebäude zu umrunden - erst nach diesem Bußgang könne er in die Glaubensgemeinschaft aufgenommen werden. Da die Altkatholische Kirche auf derlei Schikanen verzichtete, wurde er eben Altkatholik.
Die Mitgliedschaft beim sozialistischen Schutzbund stellte er ruhend, als seine Frau guter Hoffnung war. Die Schutzbundpistole wurde an einem sicheren Ort verwahrt, eingemauert unter der dritten Stufe der Kellerstiege des soeben provisorisch fertiggestellten Hauses in Pressbaum.
Welch traurige Ironie des Schicksals, dass genau auf dieser dritten Stufe elf Jahre später ein Fliegerabwehrgeschütz stehen sollte, das einem amerikanischen Flugzeug den Garaus machen würde. Trotz Verbots war der Großvater samt seinem älteren Sohn in den Wald geschlichen, nur um zu sehen, dass den unglücklichen Gesellen aus dem Flugzeug nicht mehr zu helfen war, ihre Körper hingen leblos in den Baumkronen.
Dazwischen liegen Jahre, über die geschwiegen wurde, nur in weinseliger Laune erzählte der Großvater vom Krieg, noch seltener von der Zeit davor.
*
Auf dem Friedhof von Untertullnerbach, so erzählt man sich, gibt es am oberen Ende ein paar Gräber die nicht beschriftet sind. Dort sollen Kinder begraben worden sein, die dem Euthanasie-Programm zum Opfer gefallen sind. Oberhalb des Klosters im Irenental, wo sie untergebracht waren, an der sogenannten „Himmelwiese“, erinnert das Marterl von „Maria Rast“ heute noch den Wanderer an dieses dunkle Kapitel heimischer Geschichte.
Unweit davon befindet sich die Wilhelmshöhe. Der Urgroßvater war wegen seiner Schussverletzung in der dortigen „Lungenheilanstalt“ untergebracht. Die Anstalt war jedoch hoffnungslos überfüllt. Bei einem Besuch erzählte er hinter vorgehaltener Hand, dass in der Nacht alle Fenster weit geöffnet wurden, um kalte Luft hereinzulassen, dass immer wieder Betten wegen Platzmangel auf den Gang geschoben wurden, wo an Schlaf nicht zu denken war, und dass es nur eine Frage der Zeit war, wie lange sein „Kur-Aufenthalt“ hier dauern würde. Die Todesnachricht kam daher wenig überraschend...
*
David, der Bruder des Großvaters, war wie dieser überzeugter Gegner der Nazis. Er entzog sich der Einberufung zum Kriegsdienst, indem er „ins Gebirge“ ging. Er brach zu einer waghalsigen Bergtour im Gebiet des Gesäuses auf und kehrte niemals mehr zurück. Auf dem Bergsteigerfriedhof von Johnsbach erinnert eine Inschrift an den Vermissten.
*
Der Großvater selbst wurde nicht zum Kriegsdienst eingezogen, da er im Umspannwerk Wien-Auhof einen „kriegswichtigen“ Dienst versah. Dieser erwies sich in den letzten Kriegstagen dann als zunehmend gefährlich. Das Kriegsgefangenenlager neben dem Umspannwerk diente als menschlicher Schutzschild gegen die Bombenangriffe der Alliierten, dennoch wusste die Großmutter nie, ob ihr Mann lebend heimkehren würde. Als eines Tages ein Zug mit flüchtenden Nazis beim Wienerwaldsee beschossen wurde und dieser entgleiste und dadurch die Westbahnstrecke unterbrochen war, ging der Großvater nach dem Dienst einfach zu Fuß nach Hause nach Pressbaum. Natürlich nicht auf der Straße, sondern von Auhof entlang der Mauer des Lainzer Tiergartens bis Purkersdorf und von dort auf ihm wohlbekannten Wald- und Fahrwegen.
Die Ausbildung zum Elektrotechniker hatte es dem Großvater ermöglicht, seinen Volksempfänger so zu präparieren, dass er die „Feindsender“ hören konnte. Viele Jahre später hatte ich übrigens die in den Sesselleisten versteckten Antennenbuchsen entdeckt, die mit der „geheimen“ Antenne auf dem Dachboden verbunden waren, die den Empfang von Kurzwellensendern ermöglichte. So wusste der Großvater genau, wann die Zeit gekommen war, ein Leintuch am Fenster zu befestigen - das Signal an die Russischen Soldaten, die Wien südwestlich umrundeten, dass hier kein Widerstand geleistet wird. Die Russen erwiesen sich in der Folge zwar als besser als der Ruf, der ihnen vorauseilte. Einmal hatte sich der Großvater jedoch schützend vor die Frau Nachbarin stellen müssen, und dies, obwohl der Soldat sein Gewehr im Anschlag hatte. Der Großvater bewahrte sie davor, vergewaltigt zu werden. Er erklärte, dass ihr Mann im Krieg nur Sanitäter gewesen sei und er hätte aus seiner Waffe die ganzen Jahre keinen einzigen Schuss abgegeben. Die beiden Söhne des Großvaters, die von den Russen regelmäßig Schokolade erhielten, trugen das Ihrige dazu bei, und den Ausschlag gab schließlich „Pavel“, jener Offizier, der im Obergeschoß des großelterlichen Hauses residierte, dort bis zum Ende der Besatzungszeit 1955 verblieb und mit dem Großvater auch danach noch lange im Briefkontakt stand.
Die grüne Frau
Ein junger Herr steht stolz vor seinem Auto, Anzug, Hut, siegessicherer Blick, Wirtschaftswunderzeit! Das Schwarz-weiß-Bild strahlt dennoch eine gewisse Traurigkeit aus, die sich nur dem erschließt, der das drohende Unheil kennt, das sich hier anbahnt, und von dem hier erzählt werden soll, wiewohl die Hauptperson auf dem Bild gar nicht zu sehen ist.
Dort, wo Anton Wildgans einst jeden Abend dem Zug der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn entstieg, um nach getaner Arbeit in der Stadt zu seiner Familie heimzukehren, dort, in jenem engen Tal, das sich der Wienfluss im Sandstein des Wienerwaldes gegraben hat, finden gemäß Statistik die meisten Selbstmorde statt. Es scheint dies also ein Ort zu sein, der Verzweiflung und Ausweglosigkeit geradezu anzieht, und dort, in der Gegend jener Bahnstation, trugen sich die folgenden Begebenheiten zu:
Gertrud trug den Keim einer Erbkrankheit in sich, ihr Großvater hatte sich erhängt, als sie noch zur Schule ging, die Familie war in Untertullnerbach stigmatisiert. Schon als kleine Gerti wurde sie oft von Alpträumen geplagt, in denen ein roter Wollfaden eine zentrale Rolle spielte. Später, als sie für die Reifeprüfung lernte, verabreichte ihr ihre Mutter Beruhigungstabletten - in einer später als manisch erkannten Phase der Euphorie absolvierte Gertrud die Reifeprüfung mit Bestnoten. Eine Stelle als Buchhalterin in einer Firma, die Bekannten ihrer Eltern gehörte, war bereits anvisiert. Ein Abend in der Tanzschule, der länger als geplant dauerte, kam jedoch dazwischen. Spät am Abend am Wiener Westbahnhof, als sie den letzten Zug des Tages erwischen wollte, lief sie ausgerechnet ihrer zukünftigen Chefin über den Weg, die prompt „aufgrund Gertruds unschicklichen Lebenswandels“ die Zusage für die Stelle als Buchhalterin zurückzog. Gertrud verfiel in eine erste Depressionsphase. Dann kam es zu dem Zwischenfall in der Waldschenke. In diesem einst im Irenental beim Bahnhof Untertullnerbach befindlichen Lokal fand am Samstagnachmittag zur Herbst-Sonnenwende ein beschwingtes Fest statt – und es wurde Ribiselwein ausgeschenkt. Gertrud war mit ihren Eltern hingegangen, die hofften, dass ihre betrübte Tochter ein wenig Ablenkung finden würde. Als jedoch Gertruds Vater mit einer Kellnerin zu schäkern begann, kam es zum Streit, Gertruds Mutter ging verärgert nach Hause, und Gertrud selbst trank – den Ribiselwein und seine gefährliche Wirkung nicht kennend – ein Glas nach dem anderen. Gertruds Vater war mit besagter Kellnerin hinter dem Haus verschwunden und Gertrud geriet außer Kontrolle. Ein Gendarm sah sich nun veranlasst einzuschreiten. Mit den Worten „Wer ist diese Person?“, ging er auf sie zu. Sie fiel ihm um den Hals, „geh Herr Inspektor – seih’n s’net so g’schamig!“ gluckste sie nur…
Gertruds Mutter wurde indes unruhig, als lange nach Einbruch der Dunkelheit weder Mann noch Tochter zu Hause waren. Schließlich marschierte sie grimmig hinunter in den Ort und ging zum Gendarmerie-Posten. Dort fand sie Gertrud weinend in der Ausnüchterungszelle. Da Gertruds Eltern in jener Zeit noch über kein Telephon verfügten, war man am Posten übereingekommen, die junge Frau hier zu behalten, bis jemand von der Familie vorbeikommen würde. Natürlich wurde über diesen Vorfall eine Aktennotiz angelegt. Gertruds Mutter durfte schließlich mit ihrer Tochter nach Hause gehen, der völlig betrunkene Vater kam lange nach Mitternacht nach Hause und erlebte ein Donnerwetter. Am darauffolgenden Montag mussten sie noch einmal auf den Gendarmerieposten und Gertrud wurde angewiesen, sich von einem Amtsarzt untersuchen zu lassen.
Es folgte die erste Einweisung in die Psychiatrie, Wochen später der erste Elektroschock und bis an ihr Lebensende die Einnahme von Psychopharmaka.
Am prägendsten war für Gertrud aber die Begegnung mit Karl. Dieser war Jahrgang 1935 und entstammte einer Arbeiterfamilie, sein Vater war an den Februarunruhen 1934 beteiligt gewesen. Als die Geburt des Sohnes bevorstand war die Familie „aufs Land“ geflüchtet und hatte in Tullnerbach-Pressbaum bei Wien ein billiges Grundstück am Waldrand erworben und mit einfachsten Mitteln und bloßen Händen ein Haus gebaut. Dort war also der junge Karl aufgewachsen, im tiefsten Wienerwald. Als er in den frühen Fünfzigerjahren, der Zeit des beginnenden Aufschwunges, erstmals nach Wien kam, um eine höhere technische Schule zu besuchen, kam er sich mit seinen Flanellhemden, Strickjacken und genagelten Schuhen wie ein Bauernbub vor. Viel zu lachen hatte er nicht in jenen Tagen, seine Klassenkameraden pflegten abseits der Schule ihre Zeit in Kaffeehäusern zu verbringen und am Abend in der Tanzschule und vielleicht auch in zwielichtigen Schenken ihre ersten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht zu sammeln. Bei Karl reichte das Geld nicht für den Kauf eines Anzugs und auch sein Haarschnitt schien ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein. Eine Jugend ohne Freude also in jenen Tagen, wo Jazz, Swing und Rock’n’Roll Wien mit der ortsüblichen Verspätung erreichten.
Karls Tage waren indes lang zu jener Zeit. Sie begannen um halb fünf Uhr früh, sein Weg führte ihn zwei Kilometer entlang des Wienerwald-Stausees zum Bahnhof, sodann mit dem Zug der Westbahn nach Wien Hütteldorf, wo er in die elektrische Stadtbahn umstieg, die hier ihre Schleife machte. An einem jener Tage begegnete er im Pendler, so wurden die Züge genannt, die auf der Westbahn verkehrten, seiner späteren ersten Frau. Gertrud interessierte sich für den schüchternen, dunkelhaarigen und charismatischen jungen Mann, den sie da hin und wieder in einer Ecke sitzen sah und der partout nur aus dem Fenster sehen wollte. Gertrud stieg eine Station nach Karl in den Pendler, in Untertullnerbach, und sie hätte sonst was dafür gegeben, hätte Karl sie einmal angesprochen, doch das passierte nicht. Einmal ergab es sich jedoch, dass sie auf einer Sitzbank ihm schräg gegenüber einen Platz fand. So wurde sie Zeugin eines Gesprächs zwischen ihrem Schwarm und einem anderen Mann, dem sie entnahm, dass die beiden sich für die Jagd interessierten. Karl hatte die Schule gerade mit erfolgreicher Reifeprüfung abgeschlossen und seine Berufslaufbahn bei „Brown Boveri“ begonnen, wo er seine Tage mit dem Zeichnen von Schaltplänen zubrachte. Der anbrechende Herbst würde seine erste Jagdsaison sein, ein Jagdhund war bereits von seinen Eltern angeschafft worden. Und eines Tages, als der erste Schnee gefallen war und Karl mit dem Hund durch die Wälder rund um den Wienerwaldsee streifte, stand er plötzlich Gertrud gegenüber, die mit ihren Skiern einen Ausflug gewagt hatte. Ein zaghaftes erstes Gespräch, mehr ergab sich nicht, auch wenn in Gertruds romantischen Vorstellungen der grüne Jägersmann sie nun hätte in den Arm nehmen und küssen müssen - doch dazu kam es erst viel später…
Gertrud und Karl wurden ein Paar, vorerst blieb es aber dabei, hin und wieder am Abend gemeinsam auszugehen, Karl wollte sich nicht festlegen. Sein Einstieg in das Berufsleben hatte ihm einen neuen Bekanntenkreis gebracht und das Vergnügen der Jagd beschränkte sich nicht auf den Aufenthalt in den Wäldern, es wurde oftmals auch bis spät in die Nacht gezecht und getrunken. Mit Gertrud traf er sich weiterhin, und eines Abends brachte er sie so spät nach Hause, dass deren Eltern ihr den Einlass in die Wohnung verwehrten. Im Wald, begleitet vom Rauschen des Hochwinds, verbrachten sie ihre erste gemeinsame Nacht auf einem improvisierten Lager. Einige Wochen später stellte Karl Gertrud seinen Eltern vor, danach wurde ein Besuch bei den Eltern von Gertrud anberaumt, wo sich die beiden Familien kennenlernen sollten. Das Treffen verlief in gespreizter und beinahe frostiger Atmosphäre, es blieb Karls Vater, dem Erz-Sozialisten nicht verborgen, dass Gertruds Eltern in der Zeit des Dritten Reichs auf Seiten des NS-Regimes gestanden waren.
Wieder etwas später, es war im Oktober 1958, machten Karls Eltern zusammen mit Karl, Gertrud und Karls kleinem Bruder eine Wanderung von Pressbaum nach Gruberau zum Gasthaus Schusternazl, wo es aber nur eine kleine Jause gab, denn natürlich hatte man unterwegs um den Hunger zu stillen mitgebrachte Brote gegessen. Am späten Nachmittag dieses milden Herbsttages wurde Gertrud plötzlich schlecht, man vermeinte, sie hätte die Sonne nicht vertragen. Einige Tage später wurde ihr jedoch klar, dass sie schwanger war. Als sie es Karl mitteilte, war er sich wohl im ersten Moment der Tragweite noch nicht voll bewusst. Beim nächsten Besuch bei seinen Eltern stellte Karls Vater demonstrativ und fürsorglich Gertrud einen Sessel hin, sie möge Platz nehmen gebot er. Es war allein durch diese Geste unumstößlich und festgeschrieben, dass die beiden heiraten würden. Die Hochzeit sollte im kommenden Frühjahr stattfinden, noch vor der Geburt des Kindes.
Karl war mittlerweile stolzer Besitzer eines Automobils geworden und eben jenes wurde ihm alsbald zum Verhängnis. Ein Unfall, den er alkoholisiert verursacht hatte, und der einen Unbeteiligten das Leben kostete, brachte schweres Unheil über die eben erst gegründete Familie: Karl wurde verurteilt und musste eine Gefängnisstrafe antreten. Das eingangs erwähnte Foto, das ihren Ehemann stolz mit Anzug und Hut vor seinem Auto stehend zeigte, hatte Gertrud jahrelang in einer Erinnerungsschachtel aufbewahrt. Erst Jahrzehnte später sollte es ihren Söhnen beim Ordnen des Nachlasses in die Hände fallen.
Ein Gnadengesuch von Gertrud an den Bundespräsidenten im November 1958 betreffend eine Weihnachtsamnestie ihres Mannes wurde abgelehnt. Als der Mai nahte und die Geburt des Kindes bevorstand bekam Karl einen Tag Hafturlaub, so konnte er Gertrud heiraten, bei der Geburt des Kindes war er jedoch nicht dabei.
Karl saß die Haftstrafe in voller Länge ab, und das Leben danach war ein anderes. Gertrud war mit dem Kind alleine kaum zurechtgekommen und lebte bei ihren Eltern in Untertullnerbach. Karl hatte nicht nur seine Stelle bei „Brown Boveri“ verloren, sondern es wurde ihm auch der Ingenieurstitel aberkannt und seinen Führerschein würde er erst nach Jahren wiederbekommen. Die Ehe der beiden stand also unter keinem guten Stern. Karl fiel es vor allem schwer, zu seinem Sohn, dem kleinen Wilhelm, den alle nur Willi riefen, eine innige Beziehung aufzubauen. Gertrud versuchte indes noch zweimal, den Fortbestand der Familie zu retten. Zum einen bestand sie darauf, eine kirchliche Trauung nachzuholen, die nicht hatte stattfinden können, als Karl im Gefängnis war. Und sie hoffte, durch ein zweites Kind die Liebe Karls zurückzugewinnen. Als der kleine Burli im November 1962 das Licht der Welt erblickte, war indes die Situation bereits sehr verfahren, die kurz darauf stattfindende nachgeholte kirchliche Trauung war das letzte Ereignis, das in einem gemeinsamen Fotoalbum festgehalten war.
Gertrud entwarf in weiterer Folge für sich das Motto „und das Leben geht weiter!“ Sie fand nach jedem Aufenthalt „Am Steinhof“ wieder eine Stelle als Sekretärin, danach folgten wieder Jahre in geschlossenen Abteilungen wie der Baumgartner Höhe, dem Maria Theresien-Schlössl und an anderen finsteren Orten, die erst mit der Psychiatrie-Reform Anfang der Achtziger Jahre ihren Schrecken verloren. Der „gute Ehemann“ hatte darauf bestanden, die Ehe annullieren zu lassen, und beteuerte immer wieder, von der psychischen Krankheit seiner Frau nichts gewusst zu haben. Die beiden Kinder wurden kraft des Scheidungsurteils der Mutter weggenommen, die Söhne wurden getrennt und den Großeltern mütterlicher- bzw. väterlicherseits zugesprochen. Gertrud sah somit nur Willi regelmäßig, denn der lebte bei ihren Eltern. Den Burli sah sie jedoch nur einmal pro Monat, und dies erst nach Jahren, als sich ihr Zustand stabilisiert hatte. Zuvor war sie erfolglos zum Haus der Schwiegereltern gegangen, hatte am Gartentor geläutet und darum gebettelt, ihr Kind sehen zu dürfen. Der Großvater hatte nur geschimpft, sie solle ja kein Aufsehen erregen, und ihr mit der Gendarmerie gedroht. Als sie den kleinen Burli schließlich das erste Mal abholen durfte – sie trug dabei ein nagelneues grünes Kostüm, man schrieb Mitte der 60er Jahre - fragte dieser nur, wer denn „die grüne Frau“ sei, konnte er doch mit dem Begriff „Mutti“ nichts anfangen. Versöhnt wurde er dann, als er im Gasthaus „Fontana“ ein Schnitzel bekam und eine Schartner Bombe. Das Gasthaus „Fontana“ war von jeher Burlis Sehnsuchtsort, wenn er nächtens mit dem Auto von einem Ausflug mit dem Vater heimgebracht wurde, bewunderte er immer die bunten Neonreklamen, die den Wienerwaldsee in geheimnisvolles Licht tauchten. Diese grellen Neonreklamen passten so gar nicht zu den düsteren alten Straßenlaternen mit den grün-blau leuchtenden Quecksilberdampflampen, die kaum Licht spendeten. Diese Neonreklamen standen für den Burli für eine große weite Welt, die für ihn unerreichbar schien, so wie jetzt die rassige dunkelhaarige Kellnerin mit dem kurzen Rock und den knallrot lackierten Finger- und Zehennägeln, die dem Burli das Schnitzel brachte. Dieses Rot war das Gleiche wie das der bunten Sonnenschirme mit dem Emblem einer Limonadenfirma. Der Werbejingle „Keli Keli, Balla Balla“ fiel Burli ein und er sang ihn laut vor sich hin. Als er dies dann alles am Abend zu Hause ganz aufgeregt seinen Großeltern berichtete, waren diese ganz und gar nicht erfreut und schrieben Gertruds Eltern einen Brief, dass sie darauf achten sollten, dass das Kind nicht „schlechten Einflüssen“ ausgesetzt wird.
Gertrud setzte also alles daran, ihren Kindern eine „normale Mutter“ zu sein, doch der Burli blieb bei den gestrengen Eltern des Vaters verwahrt und Willi lebte in der Tristesse des Souterrains einer Villa am Postberg in Untertullnerbach bei Gertruds Eltern. Das Geld war zeitweise so knapp, dass Gertruds Vater zu Weihnachten spät nachts in den Wald schlich, bei Maria Rast einen Tannenbaum fällte und mit dem Schlitten heimbrachte, um dem kleinen Willi einen Weihnachtsbaum zu ermöglichen.
Irgendwann schaffte es die grüne Frau ins Wiener Wochenblatt, eine längst vergessene Gazette, als sie nämlich in einer Phase, die als manisch bezeichnet werden konnte, um drei Uhr Früh den Nachbarn aus der Wohnung klingelte mit den Worten „Trari Trara, das Postbüchl ist da!“ „Sie werden sich verkühlen“, erwiderte dieser verschlafen ob des leichten Aufzugs, in dem seine Nachbarin vor der Wohnungstüre stand. Doch damit nicht genug ersuchte sie den Nachbarn, sein Telefon benützen zu dürfen. Sie selbst hatte nämlich keines, wir schreiben Anfang der Siebziger Jahre. Und sie rief tatsächlich um drei Uhr Früh ein Taxi, um nach Untertullnerbach auf den Friedhof gebracht zu werden um dort ihren Großvater zu besuchen – dem Taxifahrer erschien die Sache suspekt und er rief die Polizei – und das Leben ging weiter.
Die Polizeiprotokolle verzeichneten noch einen „wundervollen“ Eintrag irgendwann in den 80ern, als eine Funkstreife, von besorgten Nachbarn gerufen, um Weihnachten herum eine Wohnung betrat und neben lauter Musik und einer beschwipsten Getrud außer Rand und Band einen Truthahn entdeckte, der kopfüber im Mistkübel gelandet war. „Das is’ mir zu blöd, den heute zu kochen“, so die erklärenden Worte. „Haben Sie Verwandte?“, fragte der Inspektor, „ja ja – ich rufe gleich meinen Sohn!“, rief sie aus, und als sich selbiger am anderen Ende der Leitung verschlafen meldete – es war spät nachts – erklärte sie ihm seelenruhig, „du hast zwei gerade Füße, komm einfach her!“ Den zweiten Sohn hatte sie schon am Nachmittag im Büro angerufen, dessen Abteilungssekretärin mit „Halli Hallo, ich will meinen Burli sprechen“ begrüßt und so für Aufsehen gesorgt...
Letztendlich hatten fünf erwachsene Männer größte Mühe, die Frau unter Aufbietung aller Kräfte zu bändigen: Ihre beiden Söhne, zwei Polizisten und ein Amtsarzt schafften durch eine Mischung aus gutem Zureden und Androhung von „Häf’n“, die grüne Frau zur Räson zu bringen. Es folgte eine „Schlafkur“, die ihr unter anderem den nicht enden wollenden Winter 1986/87 ersparte.
Als an der Wende zum neuen Jahrtausend dieses Leben dann doch zu Ende ging, verständigte der behandelnde Arzt des AKH die Söhne telefonisch, es stehe schlimm um die Mutter. Dem Jüngeren der beiden war, als er von der Lazarettgasse kommend durch den Vorgarten des Allgemeinen Krankenhauses eilte, als nehme er den Duft des Parfums der Mutter wahr, ein Duft, von Kindheitstagen an vertraut, als sie noch die grüne Frau gewesen war, die ihm in der „Fontana“ ein Schnitzel gekauft hatte. In diesem Moment wusste er, dass er zu spät war, und sie ihm hier inmitten des blühenden Blumengartens einen letzten Gruß geschickt hatte.
Von einem der falsch abgebogen ist
Nebel zogen über das Land und ließen den Wald unheimlich und schemenhaft aussehen, die Luft roch geradezu nach Feuchtigkeit. Der Wanderer mit dem schlohweißen Haar schritt zügig den Berg hinauf und endlich tauchten im Nebel die Lichter des Rasthauses auf. Damals, 1982, war hier vor dem Rasthaus, sozusagen mitten im Wald, eine Telefonzelle gestanden, mit Giebeldach im altmodischen Postgelb – diese Erinnerung holte den Herrn gerade jetzt ein, und er würde zu Hause kramen, es musste irgendwo alte Ansichten des Rohrhauses geben, wo die Telefonzelle abgebildet war.
Als er dann die Gaststube betrat, umfing ihn wohlige Wärme, aber es befiel ihn auch die ihm eigene Scheu vor fremden Menschen. Ja, hier hatte er einst vor gut 35 Jahren seinen ersten Jagatee getrunken. Alle Tische in der Stube waren besetzt, er musste sich wohl an einen Tisch zu jemand anderem dazusetzen. Rasch war ein Platz gefunden, die Serviererin hatte hilfreich vermittelt. Nun waren die Leute an diesem Tisch gar nicht mundfaul und fragten unseren Wandersmann, was er denn heute noch für eine Tour vor sich habe. Er erklärte, den Weg über die Aussichtswarte nehmen zu wollen, um dann den Kaltbründlberg in Richtung Gütenbachtal abzusteigen. Daraufhin meldete sich nun auch der Wirt zu Wort und warnte den Wandersmann, dass sich in diesem entlegenen Winkel viele Wildschweine tummeln würden. Er solle wohl Obacht geben, denn die Tiere seien unberechenbar und im Nebel könne es gut passieren, dass er sich unversehens einem solchen gegenüber sehe, und in seiner Ruhe gestört könnte das Tier...
Der Wanderer fiel nun dem Wirt ins Wort, „ja was soll denn des, was heißt ein Wildschwein? Und wenn fünf oder zehn so Viecher auftauchen, so is mir des ganz wurscht, ich geh einfach weiter, i hob ka Aungst“, so die großspurigen Worte. „Meine Vorfahren waren Wienerwaldmenschen, die haben sich als Köhler und Holzfäller verdingt und mussten sich tagtäglich nicht nur mit Wildschweinen, sondern auch mit Bären und Wölfen herumschlagen. Später dann, als die Kaiserin-Elisabeth-Westbahn errichtet wurde, haben sie sich in den Wirtshäusern bei den Raufereien mit den italienischen Gastarbeitern immer durchgesetzt, die mit den einheimischen Mädeln schäkern und tanzen wollten, har har!“ Er blickte triumphierend herum, doch niemand hatte Lust, sich auf eine Diskussion mit ihm weiter einzulassen. So hatte er alsbald gezahlt und stieg daraufhin wie er sich’s vorgenommen hatte zu der alten Aussichtswarte auf. Anders als zuvor auf der Straße zum Rasthaus war er hier nun ganz allein, keine Menschenseele war ihm begegnet seit er das Rasthaus verlassen hatte. Endlich war er bei dem Aussichtsturm angekommen, der gespenstisch aus dem Nebel ragte. Das schwere Holztor war verriegelt. „Egal“, dachte er sich, „es gibt heut’ ohnedies keine Aussicht bei dem Nebel.“ Sodann machte er sich an den Abstieg. Einmal vermeinte er, abseits des Weges in den Tiefen des Waldes die Umrisse eines großen Wildschweines zu sehen, doch konnte er keine Bewegung ausmachen. Der Nebel schien auch alle Geräusche zu verschlucken, es war merkwürdig still und ein unheimliches Gefühl begann den Wanderer zu beschleichen. Er verwünschte seine hochmütigen Worte von vorhin...
Eiligen Schrittes, immer schneller werdend, stieg er den Berg hinab und war froh, bald die befestigte Straße zum Gütenbachtor erreicht zu haben. Hier begannen sich die Nebel zu lichten, und als die Sonne durch die grauen Schlieren blinzelte, marschierte er schon auf der asphaltierten Straße durch das Gütenbachtal in Richtung Kalksburg und blickte in die Welt wie eh und je, mit einer Mischung aus Frohsinn und Unnahbarkeit - dabei erinnerte er sich an seine ersten Erfahrungen, die er in diesem Refugium gesammelt hatte, und die mehr als drei Jahrzehnte zurücklagen...
*
…zu jener Zeit, als er sich gerade auf die Reifeprüfung vorbereitete, war - wie beim Schüler Gerber - auch sein Dasein geprägt von Unsicherheit und Angst vor Versagen. Es war an einem lauen Frühsommertag, an dem er als junger Mann erstmals in seinem Leben das weitläufige Areal des Lainzer Tiergartens erkundete, um sich einen Tag Erholung vom Lernen zu gönnen. Überall entlang des Weges gab es Hinweisschilder, die Straße nicht zu verlassen und die Wildruhezonen zu respektieren. Hier in der freien Natur, wo keine Gefahr bestand, sich vor anderen Menschen zu blamieren, siegte die Neugierde über die Vernunft und der junge Mann bog ab und folgte einem schmalen Pfad ins Dickicht. Ganz plötzlich, nach einer Biegung des Weges, sah er sich einem riesigen Wildschwein gegenüber, das ihn mit großen Augen anstarrte und ein gefährlich klingendes Grunzen ausstieß. Das Tier musste gut zweihundert Kilo schwer gewesen sein, im Hintergrund konnte er eine Schar Frischlinge erkennen. Abrupt blieb er stehen, wohin nun? Davonzulaufen hatte keinen Sinn, das Tier wäre ihm hier in jeder Hinsicht überlegen. Verzweifelt blickte er um sich und sah zu seiner Rechten am Wegesrand einen Holzstoß, den Waldarbeiter nach ihren letzten Schlägerungen zurück gelassen hatten. Blitzschnell kletterte er nun auf diesen und ließ dabei das Tier nicht aus den Augen. Er saß nun in gut eineinhalb Metern Höhe über dem Boden und zitterte vor Angst. Das Tier schnaubte immer noch, lief dann auf den Holzstoß zu, schlug im letzten Moment einen Haken und war gleich darauf im tiefen Wald verschwunden, gefolgt von den Frischlingen. Erst nach langer Zeit fasste sich der junge Mann ein Herz und stieg vorsichtig von dem Holzstoß herab. Rasch kehrte er dann zurück zum markierten Weg und verließ den Tiergarten beim alten Diana Tor in Laab im Walde.
Für den Rückweg nach Hause hatte er sich nicht viel überlegt, nach Pressbaum war es weit, doch war ihm das Glück hold: ein Auto, das ihn überholte, blieb nach wenigen Metern stehen. Am Steuer saß eine Dame mit weißen Handschuhen und fragte den jungen Wanderer, ob sie ihn mitnehmen solle, denn bis Wolfsgraben oder Pressbaum sei es noch weit und er hätte so verzweifelt dreingesehen. Für einen Moment zögerte er, nahm dann aber das Angebot an und stieg in das Auto. Während der kurzen Fahrt erzählte die Dame, sie sei im Lainzer Tiergarten joggen gewesen und meinte auch, ihn gesehen zu haben, wie er eiligen Schrittes vom Kaltbründelberg herabgekommen war. Er nickte nur, sagte aber kein Wort. Die Frau hatte eine freundliche und warmherzige Art und sie konnte wohl auch als attraktiv bezeichnet werden. Er wusste in seiner jungen Unerfahrenheit nicht damit umzugehen und blieb aus lauter Sturheit stumm und abweisend. Er stieg nach wenigen Worten des Dankes aus, als sie die Abzweigung beim Wienerwaldsee erreicht hatten.
*
So denkt der Mann nun – viele Jahre später – im Hier und Jetzt, blickt zurück auf „verlorene Jahre an geborgter Zeit“: Das Wildschwein mit den bedrohlichen Augen, es hat damals vielleicht nur in seiner Einbildung existiert, doch konnte es wohl eine Warnung gewesen sein, auf dass seine Seele nicht vom Weg zum Frieden mit sich selbst abkommen sollte. Allein, er hatte die Warnung damals ignoriert, diesen Weg verlassen, hatte nie Nähe gesucht und zu viel Wärme stets gescheut. Er war immer auf der Suche gewesen, hatte aber nie gefunden, wonach er suchte.
I've been searchin' for something I might never find.
I've been looking for something I have left behind.
I've been searching every day in the rising sun.
I've been trying to find my way till the day is done.
I've been searching.
I've been reaching for something I might never touch.
And I've been dreaming of something that I want so much.
I've been counting all the tears in the falling rain.
I've been trying to hide my fears, but it's all the same.
And I don't know if I'll ever pass this way again.
I can't wait until tomorrow, it's something I might never see.
I can't wait until tomorrow for tomorrow never waits forme... *)
*) Gary Moore © 1982
RÜCKKEHR NACH BUCHELBACH
Eine Wienerwald-Wander-Geschichte
November 1982: Die Flamme der Kerze flackert noch einmal und erlischt; ich starre in die kalte Nacht hinaus.
Während stilgerecht dazu Whitesnake’s „Here I Go Again On My Own“ lautstark aus den Boxen meiner Stereo-Anlage erklingt, lasse ich den heutigen Tag Revue passieren: Ich habe mit meinem Vater und seiner Frau und deren Tochter eine schöne Wienerwald-Wanderung gemacht, dabei in einem kleinen Ort ein gutes einfaches Landgasthaus entdeckt, mich für die Strapazen mit einem herrlich zubereiteten Wildgericht belohnt und den Abend mit einem guten Tropfen versüßt.
Wie hat das Dorf gleich geheißen?
Egal - irgendwann komme ich wieder dorthin zurück...
*
Vierzehn Jahre später - 1996: Es ist November geworden - endlich findet die lang geplante, herbeigesehnte und oft verschobene Wanderung statt. Bis zuletzt fürchtete ich um das Zustandekommen. Wie es halt so ist: berufliche Termine, familiäre Verpflichtungen, etc. Nun hat es doch noch geklappt!
Es ist ein trüb verhangener Samstag, an dem wir gegen Mittag mit dem Auto in der Wienerwald-Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf, unserem Ausgangspunkt, eintreffen.
Wir, das sind mein Bruder, mein Freund Manfred, seine beiden Schäferhunde Riko und Aaron und meine Wenigkeit.
Das feucht-kalte Wetter veranlasst uns, gleich nach dem Aussteigen Handschuhe anzuziehen.
Der mitgebrachten Wanderbeschreibung folgend marschieren wir auf einer Dorfstraße dem Ende des Ortsteiles mit dem für mich stimmungsvollen Namen Hainbach entgegen. Dabei passieren wir einen nach links abbiegenden Steig Richtung Kreuzeck, Steinplattl und Parzerkreuz, der dem Rückweg unseres geplanten Rundkurses dienen soll, der teilweise unmarkiert verläuft, was der ganzen Tour einen zusätzlichen abenteuerlichen Flair verleiht. An der eben beschriebenen Abzweigung fällt mir eine bereits verwitterte Tafel auf, welche in unsere Marschrichtung weist und sonderbarerweise „Gföhler-Buchelbach“ als Destination angibt, eine Ortsbezeichnung die in der Beschreibung nicht aufscheint.
*
Buchelbach - dies ist einer jener typischen verschlafenen Wienerwald-Orte, gelegen an der Straße nach Sittendort, bestehend aus einigen wenigen Bauernhöfen und einem Gasthaus - Ausgangspunkt für Wanderungen auf den Roßgipfel, einen eigenwilligen Berg, der einen Geheimtipp unter Wienerwald-Freunden darstellt.
Ein Blick in die der Wanderbeschreibung beiliegende Skizze verrät, dass unsere Route nördlich am Roßgipfel vorbeiführen wird...
*
Die Gespräche meiner Gefährten vertreiben eine kurz aufblitzende Erinnerung und holen mich in die Realität zurück: Entlang der Straße erregen nämlich die Häuser der Brennholz-Händler mit ihren vorsintflutlich anmutenden Steyr-LKWs und Traktoren in den Höfen unser Interesse, und wir diskutieren über die angenehmen und unangenehmen Seiten im Berufsalltag dieser Menschen.
Nachdem die letzten Häuser hinter uns liegen, erkennen wir rechterhand einen markierten Weg, der in meiner Beschreibung jedoch nicht erwähnt ist, sodass wir ihn nach eingehender Diskussion ignorieren und auf der Straße weiterwandern.
Innerlich verfluche ich bereits meine Nachlässigkeit, nicht zusätzlich zur Beschreibung eine exakte Karte mitgenommen zu haben.
Nach einer langgezogenen Kurve entscheide ich, die Straße zu verlassen. Ein kaum erkennbarer Pfad führt nach rechts ins Dickicht. Die Geländeformation könnte darauf hindeuten, dass dies der beschriebene Aufstieg ins Weidenbachtal ist.
An dieser Stelle dürfte sich möglicherweise früher eine Klause befunden haben, nämlich eine Wehranlage: das aufgestaute Wasser wurde in alten Zeiten durch schwallartige Entleerung für den Holztransport auf dem Wasserweg genützt.
Wir nutzen dieses einem Damm ähnelnde Gebilde zum Überqueren des Hainbaches und steigen sodann steil durch Unmengen von nassem Laub zum Sattel zwischen Mitterriegel und Hainbachberg auf.
Uns ist warm geworden - und in der Meinung, nun auf dem richtigen Weg zu sein, schreiten wir nach kurzer Rast gemäß Beschreibung zum Forsthaus ab, welches wir alsbald zwischen den Bäumen durchscheinend auf einer Wiese erkennen können.
Die Forststraße, die wir in weiterer Folge erreichen, scheint ebenso mit der beschriebenen Route übereinzustimmen, sodass wir ihr folgen.
Doch da ist wieder etwas, das mich irritiert: Wie schon zuvor auf dem Sattel bemerke ich hin und wieder auf den Bäumen Weg-Markierungen mit der Nummer 448.
Laut Beschreibung GIBT ES HIER KEINE MARKIERUNG...
Wie so oft im Wienerwald endet die Straße im Nirgendwo und geht in einen Saumpfad über.
Aus nächster Nähe dringen Motorengeräusche zu uns, die ich anfangs fälschlicherweise der nahen Landstraße und damit dem geplanten Scheitelpunkt unserer Wanderung, dem Parzerkreuz, zuordne.
Bald stellt sich jedoch heraus, dass es die Motorsägen von Holzarbeitern sind, die wir gehört haben. Plötzlich lichtet sich der Wald und vor uns taucht ein verfallenes Gehöft auf.
Es gibt im Wienerwald viele dieser Zeugen der Vergänglichkeit, und man kann ihnen mit einer alten Karte bewaffnet nachspüren, sie oftmals auch vergeblich suchen, und ihren ehemaligen Standort nur mehr am Vorhandensein von Obstbäumen auf Waldlichtungen und Säumen erahnen.
Jetzt steigt jedoch der Gedanke in mir hoch, dass wir tatsächlich vom rechten Weg abgekommen sind: Leichte Unsicherheit beginnt sich bei uns breit zu machen, als ein kleiner Weiler vor uns auftaucht...
*
„Gföhler“ - diesen Namen habe ich, wie viele andere interessante Orts- und Flurnamen, beim Kartenstudium im Zuge von Tour-Vorbereitungen oder einfach bei Wanderpausen gelesen, diese Namen in meiner Phantasie zu Landschaften werden lassen und sodann den unbezwingbaren Wunsch verspürt, diese auch in der Realität zu durchwandern.
„Gföhler“ - dieser merkwürdige Name bezeichnet eine kleine Ansiedlung hinter dem Roßgipfel - zwischen Grub, Buchelbach und Klausen-Leopoldsdorf gelegen - der wir uns nun nähern...
*
Ein Wochenendhaus am Waldesrand, dessen rauchender Schornstein und eine seltsam altmodische, orange leuchtende Gartenlaterne auf die Anwesenheit von Menschen schließen lassen, nimmt unsere Aufmerksamkeit in Anspruch.
Ein freundlich wirkender älterer Herr in Jagdkleidung tritt gerade vor das Haus, sodass wir die Gelegenheit ergreifen, ihn nach dem Weg über Parzerkreuz und Steinplattl nach Klausen-Leopoldsdorf zu fragen.
„Ja, da sind sie hier falsch...etwas zu weit gegangen...den Weg, den Sie erwähnen, kenne ich nicht, aber da unten liegt dann Buchelbach … und über die Straße nach Gruberau zum „Schusternatz“...und dann ‘rüber ...na ja, das sind so ca. sechs bis acht Kilometer, vielleicht...“
Ich rechne kurz nach: dies wären etwa zwei Stunden Gehzeit, nicht exakt die Strecke, die ich eigentlich vorgehabt habe, aber was solls!
Wir bedanken uns, gehen weiter, und gelangen schließlich auf eine große Wiese, wo wir beschließen, eine Bank am Wegesrand für die längst fällige Jause zu nützen. Die Sonne blinzelt ein wenig durch den Dunst und lässt eine fröhliche Stimmung aufkommen.
Die Jause! „Nichts geht über das Einnehmen einer einfachen Mahlzeit in freier Natur“, ruft unser Freund Manfred aus.
Wir lassen uns die Brote mit Wurst, Käse und Gemüse schmecken, wobei auch die Hunde nicht zu kurz kommen, genießen abschließend (als Zugeständnis an „die moderne neue Zeit“) ein Getränk aus der Dose, sowie den einen oder anderen Apfel.