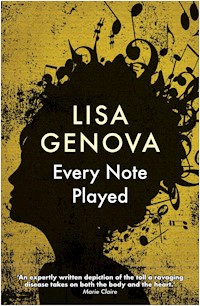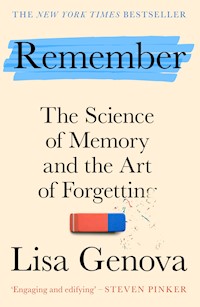11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Virtuos, aufwühlend und zutiefst berührend - der neue Roman der Bestsellerautorin von STILL ALICE
Karinas Traum war eine glanzvolle Karriere als Pianistin. Für ihre große Liebe Richard verzichtete sie darauf. Als die Ehe scheitert, ist er ein gefeierter Star, und Karina fühlt sich um ihr Lebensglück betrogen. Jahre später erfährt sie, dass Richard unheilbar krank ist, und fasst einen Entschluss: Sie wird ihren Exmann zu sich holen. Doch was zunächst aus Pflichtgefühl geschieht, wird schon bald zu einer ungeahnten Chance. Karina begreift, dass Versöhnung so viel mehr sein kann als Frieden schließen, denn manchmal öffnet sie das Herz für einen lang ersehnten Neuanfang ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Virtuos, aufwühlend und zutiefst berührend – der neue Roman der Bestsellerautorin von STILL ALICE Karinas Traum war eine glanzvolle Karriere als Pianistin. Für ihre große Liebe Richard verzichtete sie darauf. Als die Ehe scheitert, ist er ein gefeierter Star, und Karina fühlt sich um ihr Lebensglück betrogen. Jahre später erfährt sie, dass Richard unheilbar krank ist, und fasst einen Entschluss: Sie wird ihren Exmann zu sich holen. Doch was zunächst aus Pflichtgefühl geschieht, wird schon bald zu einer ungeahnten Chance. Karina begreift, dass Versöhnung so viel mehr sein kann als Frieden schließen, denn manchmal öffnet sie das Herz für einen lang ersehnten Neuanfang … »Genovas neuster Roman ist einer ihrer stärksten – ein sprachgewandtes und berührendes Porträt zweier Menschen, die im Angesicht einer verheerenden Diagnose ihren Frieden finden.« KIRKUS REVIEWS »Lisa Genova gelingt es auf beeindruckende Weise, die Gedanken und Gefühle ihrer Figuren lebendig werden zu lassen.« USA TODAY
ÜBER DIE AUTORIN
Nach ihrem Psychologiestudium hat Lisa Genova an der Universität Harvard in Neurowissenschaft promoviert. Ihr Debütroman, »Mein Leben ohne Gestern«, zunächst im Eigenverlag veröffentlicht, hat sich inzwischen zu einem internationalen Bestseller entwickelt, stand lange auf der New-York-Times-Bestsellerliste und wurde von Lesern und Rezensenten begeistert aufgenommen. Die Autorin schreibt bereits an ihrem zweiten Roman.
LISA GENOVA
IM TRAUMHÖRE ICH DICHSPIELEN
ROMAN
Übersetzungaus dem amerikanischen Englischvon Anke Kreutzer
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Every Note Played«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Lisa Genova
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the original publisher, Gallery Books, an Imprint of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anne Fröhlich, Bremen
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: lynea | secondcorner | Shebeko
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-6071-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine Eltern
In liebender Erinnerung an
Richard Glatzer
Kevin Gosnell
Chris Connors
Chris Engstrom
Warum verweilst du im Gefängnis,
wenn doch die Tür weit offen steht?
Rumi
PROLOG
Richard spielt den zweiten Satz von Schumanns Fantasie in C-Dur, Opus 17, das letzte Stück seines Klavierabends im Adrienne Arsht Center in Miami. Das Konzert ist ausverkauft, und doch fühlt sich die Energie im Saal nicht aufgeladen an. Dies ist nicht das Lincoln Center oder die Royal Albert Hall oder eines der anderen ehrfurchtgebietenden, berühmten Häuser der Welt, vielleicht liegt es daran.
Ohne einen Dirigenten und ein Orchester sind aller Augen auf ihn gerichtet. So gefällt es ihm am besten. Er liebt es, die ungeteilte Aufmerksamkeit zu genießen, mag den Adrenalinstoß, der Star zu sein. Solo zu spielen ist seine Form des Fallschirmspringens.
Doch er merkt, dass er die Noten schon den ganzen Abend nicht von innen heraus spielt. Er schweift mit den Gedanken ab, zu dem Steak, das er im Hotel zu Abend essen wird, oder er überprüft verlegen seine Körperhaltung, kritisiert sich für seine mangelnde Ausdruckskraft. Statt selbstvergessen in der Musik aufzugehen, kreist seine Aufmerksamkeit um ihn selbst.
In technischer Hinsicht ist seine Darbietung makellos. Nicht viele zeitgenössische Pianisten meistern diese herausfordernd schnelle und komplexe Partie fehlerfrei. Normalerweise liebt er es, dieses Stück zu spielen, besonders die pompösen Akkorde des zweiten Satzes, wuchtig und triumphal. Und doch ist er heute emotional nicht bei der Sache.
Er vertraut darauf, dass den meisten Zuhörern, wenn nicht gar allen, das geschulte musikalische Gespür fehlt, um den Unterschied herauszuhören. Wahrscheinlich haben die meisten Zuhörer Schumanns Fantasie in C-Dur, Opus 17, sogar noch nie im Leben gehört. Es bricht ihm immer wieder das Herz, dass sich Millionen von Menschen den ganzen Tag Justin Bieber reinziehen, ohne ein einziges Mal im Leben Schumann oder Liszt oder Chopin zu hören.
Verheiratet zu sein ist mehr, als nur einen Ring zu tragen. Dieser Satz kommt ihm plötzlich in den Sinn. Karina hat ihn vor ein paar Jahren zu ihm gesagt. Heute Abend trägt er nur einen Ring. Er spielt sein Programm herunter und kann nicht sagen, wieso. Er bringt das letzte Stück hinter sich und weiß, dass er morgen Abend noch eine zweite Chance bekommen wird, bevor er nach Los Angeles weiterfliegt. Noch fünf Wochen auf Tournee. Bis er wieder heimkommt, ist es Sommer. Gut. Er liebt den Sommer in Boston.
Er spielt die letzte Phrasierung des Adagio im dritten Satz, von feierlichem Ernst und zarter Hoffnung getragen. An dieser Stelle ist er oft zu Tränen gerührt, offen für diesen unübertrefflich zarten Ausdruck empfindsamer Verletzlichkeit, doch heute bleibt er ungerührt. Er fühlt keine Hoffnung.
Er spielt die letzte Note, und der Ton klingt auf der Bühne nach, bevor er sich verflüchtigt und verstummt. Für einen Moment hängt Stille über dem Saal, dann platzt die Seifenblase unter dem einsetzenden Applaus. Richard steht auf und wendet sich dem Publikum zu. Er verneigt sich, bis er mit den Fingern den Saum seines Smokings streift. Die Leute springen von ihren Plätzen. Im Saal flammt jetzt gedimmtes Licht auf, und er kann ihre Gesichter sehen, ihr Lächeln, ihre Begeisterung, ihre ehrfürchtige Bewunderung. Er verbeugt sich noch einmal.
Alle lieben ihn.
Und niemand.
EINS
Wäre Karina fünfzehn Kilometer weiter westlich oder östlich aufgewachsen – in Gliwice oder in Bytom statt in Zabrze –, ihr ganzes Leben hätte einen vollkommen anderen Verlauf genommen. Schon als Kind hat sie daran nicht den geringsten Zweifel gehegt. Beim Schicksal zählt, wie bei Immobilien, auch die Lage.
In Gliwice hatte jedes Mädchen das angestammte Privileg, Ballettunterricht zu nehmen, und zwar bei Fräulein Gosia – eine bis zur Verhängung des Kriegsrechts gefeierte Primaballerina beim Polnischen Nationalballett. In dem ansonsten trostlosen Ort war es der Stolz eines jeden Mädchens, zu einer so herausragenden Lehrerin zu gehen. Diese Mädchen wuchsen gewissermaßen in ihren Trikots und mit dem tüllgesponnenen Traum auf, Gliwice eines Tages auf Spitzenschuhen trippelnd zu verlassen. Auch wenn Karina nicht weiß, was aus diesen Mädchen aus Gliwice im Einzelnen geworden ist, ist sie sich beinahe sicher, dass die meisten von ihnen – wenn nicht alle – dort hängen geblieben sind, als Lehrerinnen oder Bergarbeiterfrauen, und ihre unerfüllten Ballerina-Träume an ihre Töchter weitergegeben haben, Fräulein Gosias nächste Schülerinnengeneration.
Hätte Karina ihre Kindheit und Jugend in Gliwice verbracht, wäre sie mit größter Wahrscheinlichkeit nicht Ballerina geworden. Sie hat Plattfüße, fast ohne Wölbung und schrecklich breit; auch sonst ist sie eher stämmig gebaut, hat einen langen Oberkörper und kurze Beine, scheint eher fürs Kühemelken geschaffen als für pas de bourrées. Sie wäre nie der Star unter Fräulein Gosias Schülerinnen gewesen. Karinas Eltern hätten schon lange vor den ersten Spitzenschuhen aufgehört, für ihre Ballettstunden auf kostbare Eier und Kohle zu verzichten. Hätte ihr Leben in Gliwice begonnen, wäre sie immer noch in Gliwice.
Für die Kinder in Bytom, an derselben Straße weiter nach Osten, gab es keinen Ballettunterricht. Die Kinder von Bytom hatten die katholische Kirche. Die Jungen bereiteten sich auf das Priesterseminar vor, die Mädchen aufs Kloster. Nach einer Kindheit in Bytom wäre Karina vielleicht Nonne geworden. Ihre Eltern wären so stolz auf sie gewesen. Vielleicht wäre ihr ein genügsames, ehrwürdiges Leben beschieden, hätte sie Gott gewählt.
Doch was aus ihrem Leben wurde, hat nie wirklich in ihrer Hand gelegen. Sie ist in Zabrze aufgewachsen, und in Zabrze wohnte Herr Borowitz, der Klavierlehrer. Er blickte nicht wie Fräulein Gosia auf eine ruhmreiche Karriere zurück, und er hatte auch kein professionelles Studio. Vielmehr fand der Unterricht in seinem Wohnzimmer statt, das nach Katzenpisse, vergilbten Büchern und Zigaretten stank. Doch Herr Borowitz war ein guter Lehrer. Er war mit Leib und Seele bei der Sache, fordernd und fördernd, und vor allem lernte jeder Schüler bei ihm, Chopin zu spielen. In Polen wird Chopin genauso verehrt wie Papst Johannes Paul II und Gott. Polens heilige Dreifaltigkeit.
Karina ist zwar nicht mit dem geschmeidigen Körper einer Ballerina zur Welt gekommen, dafür aber mit den starken Armen und langen Fingern einer Pianistin. Sie kann sich noch an ihre erste Stunde bei Herrn Borowitz erinnern. Da war sie fünf. Die glänzenden Tasten, der augenblickliche Wohlklang, wenn man sie drückte. Es gefiel ihr sofort. Anders als die meisten Kinder, brauchte man sie nie zum Üben anzuhalten. Ganz im Gegenteil. Hör auf zu spielen, und mach deine Hausaufgaben. Hör auf zu spielen, und deck den Tisch. Hör auf zu spielen, du musst ins Bett. Der Lust zu spielen konnte sie nie widerstehen. Bis heute hat sich das nicht geändert.
Schließlich war das Klavierspiel ihr Freifahrschein aus dem repressiven Polen, nach Amerika, ans Curtis Conservatory und zu allem, was dann folgte. Diese eine Entscheidung – Klavier spielen zu lernen – hat wie der erste Dominostein alles Weitere in Gang gesetzt. Sie wäre in diesem Moment auch nicht zu Hannah Chus Abschlussparty unterwegs, hätte sie nie Klavier spielen gelernt.
Sie parkt ihren Honda hinter einem Mercedes, dem letzten in einer Conga-Line von Autos, und mindestens drei Blocks von Hannahs Haus entfernt – näher kommt sie wohl nicht heran. Sie sieht auf die Uhr am Armaturenbrett. Sie kommt eine halbe Stunde zu spät. Gut. Sie wird sich kurz blicken lassen, Hannah gratulieren und wieder verschwinden.
Ihre Absätze klackern auf dem Pflaster wie ein Metronom, und in ihrem Takt spinnt sie den Gedanken weiter. Ohne das Klavier hätte sie Richard nie kennengelernt. Wie hätte ihr Leben ausgesehen, wäre sie ihm nie begegnet? Wie viele Stunden hat sie schon in dieser Fantasie geschwelgt? Sie würden sich zu Tagen, Wochen, wenn nicht mehr, summieren lassen. Noch mehr Zeitverschwendung. Was alles hätte sein können. Und niemals sein wird.
Vielleicht wäre sie ja ganz zufrieden, hätte sie ihr Heimatland nicht verlassen, um Pianistin zu werden. Sie würde noch bei ihren Eltern wohnen, in ihrem alten Kinderzimmer schlafen. Oder sie wäre mit einem langweiligen Mann aus Zabrze verheiratet, einem Kohle-Kumpel, der sein Geld mit harter, aber anständiger Arbeit verdiente, während sie als Hausfrau und Mutter fünf Kinder großzuziehen hätte. Beide schaurigen Szenarien erscheinen ihr nun gar nicht mehr so trostlos, und zwar aus einem Grund, den sie sich nur widerwillig eingesteht: Sie wäre dann weniger einsam.
Oder wenn sie statt ans Curtis Conservatory an die Eastman School of Music gegangen wäre? Sie hatte die Wahl und hat nach dem Zufallsprinzip entschieden. Dann hätte sie niemals Richard kennengelernt. Sie hätte nie einen Schritt zurück gemacht und mit dem arroganten, leichtsinnigen Optimismus einer Fünfundzwanzigjährigen darauf gebaut, dass sich das Rad der Fortuna ein zweites Mal drehen und den mächtigen goldenen Pfeil direkt auf sie richten würde. Seit Jahren wartet sie nun schon auf eine zweite Chance. Manchmal gibt einem das Leben nur eine.
Andererseits gäbe es ihre Tochter Grace nicht, wäre sie Richard nie begegnet. Karina stellt sich eine Realität vor, in der sie ihre einzige Tochter nicht empfangen hätte, und diese Variante hat so viel Reiz, dass sie sich sehnsüchtig darin verliert. Sie erschrickt und schämt sich für einen so furchtbaren Gedanken. Sie liebt Grace über alles in der Welt. Allerdings ändert das nichts daran, dass auch Grace eine entscheidende Weggabelung bedeutet hat, genau wie damals die von Gliwice, Bytom und Zabrze. Links abbiegen hat Karina zu Grace gebracht und an Richard gebunden. Die folgenden siebzehn Jahre hat sie an der Leine gelegen, an manchen Tagen hat es sich sogar wie ein Galgenstrick angefühlt. Nach rechts ist sie nicht gegangen. Wer weiß, wo sie da gelandet wäre.
Das Bedauern folgt ihr auf Schritt und Tritt wie ein treuer Hund, als sie jetzt über einen gewundenen Steinpfad in den Garten der Familie Chu strebt. Hannah hat eine Zusage von der University of Notre Dame bekommen, ihre erste Wahl. Schon wieder eine Klavierschülerin auf dem Absprung. Wenn sie erst einmal studiert, wird Hannah nicht weiterspielen. Wie die meisten von Karinas Schülern hat sie nur Stunden genommen, weil sich der Vermerk »spielt Klavier« im Lebenslauf gut macht. Die Eltern leitet dasselbe Motiv, nur unverhohlener und um ein Vielfaches stärker. Zu diesem Zweck hat Hannah pro forma ihren Unterricht absolviert, und ihre halbe Stunde pro Woche war für Lehrerin wie Schülerin eine leidige Pflicht.
Nur wenigen von Karinas Schülern macht das Musizieren wirklich Freude, ein paar von ihnen haben sogar Talent und Potential, doch keiner liebt es genug, um es ernsthaft zu verfolgen. Man muss es lieben. Und wie könnte sie es ihnen verübeln? Diese Jugendlichen sind viel zu eingespannt und darauf fixiert, ans »beste« College zu kommen, als dass sie ihre Passion so pflegen könnten, dass sie sich entfalten kann. Ohne Sonne und Wasser würde auch kein Samen eine Blüte treiben.
Doch Hannah ist nicht irgendeine von Karinas Klavierschülerinnen. Vom sechsten Lebensjahr an bis zum Ende der Mittelschule war sie die beste Freundin von Grace. Spielverabredungen, Übernachtungen, Pfadfindererlebnisse, Fußballtraining, gemeinsame Ausflüge zum Shoppen und ins Kino – die meiste Zeit ihrer Kindheit war Hannah für Grace wie eine kleine Schwester. Als Grace dann auf die Highschool kam und Hannah an der Mittelschule blieb, haben sich die Mädchen naturgemäß verschiedenen Freundeskreisen zugewandt, die jeweils ihrem Alter entsprachen. Ein Zerwürfnis hat es nie gegeben, vielmehr sind sie langsam auf ihre benachbarten, doch getrennten Inseln gespült worden. Ab und zu haben sie sich noch getroffen.
Hannahs Immatrikulation – für das Mädchen ein Meilenstein – sollte für Karina eigentlich keine besondere Bedeutung haben, doch ihr Verlust trifft sie ungleich härter als der von anderen Klavierschülern. Er ruft Erinnerungen an das letzte Jahr wach, und Karina durchlebt noch einmal das Ende von Graces Kindheit. Sie legt ihre Glückwunschkarte auf Hannahs Gabentisch und seufzt.
Obwohl Hannah am anderen Ende des weitläufigen Gartens ist, entdeckt Karina sie sofort; sie steht lachend an der Kante des Sprungbretts, hinter ihr eine Warteschlange nasser Mädchen und Jungen. Im Pool sind andere Jugendliche, vor allem Jungen, die ihren Namen rufen und sie zu irgendetwas anfeuern. Karina bleibt stehen, um zu sehen, um was es geht. Hannah springt ab und landet mit einer Arschbombe im Wasser, sodass die Eltern dicht am Beckenrand eine Fontäne abbekommen. Sie protestieren und wischen sich das Wasser von Gesicht und Armen, doch sie lächeln. Es ist ein heißer Tag und die kleine Dusche vermutlich erfrischend. Karina sichtet Pam, Hannahs Mom, unter ihnen.
Jetzt, da Hannah nach Indiana zieht, wird Karina Pam vermutlich gar nicht mehr sehen. Ihr gemeinsames Glas Wein an Donnerstagabenden ist schon seit Graces Wechsel an die Highschool passé. Im Lauf der letzten Jahre ist ihre Freundschaft auf ein paar wenig befriedigende Augenblicke vor oder nach Hannahs wöchentlicher Klavierstunde zusammengeschmolzen. Unter dem Druck, ihre drei Kinder nach einem schwindelerregenden Terminplan zu außerschulischen Aktivitäten quer durch die Stadt zu chauffieren, war Pam oft zu gehetzt, um auch nur für einen Moment hereinzukommen, und hat daher meist bei laufendem Motor im Wagen gewartet. Also hat Karina ihr jeden Dienstag um halb sechs von der Haustür aus zugewinkt.
Fast wäre Karina heute nicht gekommen. Es macht sie verlegen, alleine aufzutauchen. Von Natur aus introvertiert, hat sie sich über ihre Ehe sehr bedeckt gehalten, erst recht über ihre Scheidung. Falls auch Richard, wie sie annimmt, ihre schmutzige Wäsche nicht in der Öffentlichkeit gewaschen hat, kennt niemand die Details. Die Gerüchteküche musste sich also ohne Fakten etwas zusammenbrauen. Es muss immer einer im Recht und der andere im Unrecht sein. Verstohlenen Blicke, plötzliches Verstummen bei ihrem Erscheinen, aufgesetztes Lächeln – Karina weiß, in welchem Licht sie erscheint.
Besonders die Frauen haben sich auf seine Seite geschlagen. Sie sehen in ihm die hehre Gestalt des begnadeten Künstlers. Er hat eine elegantere Frau an seiner Seite verdient, eine Partnerin, die sein Ausnahmetalent zu würdigen weiß, eine Frau, die ihm das Wasser reichen kann. Sie unterstellen ihr, auf seinen Erfolg eifersüchtig zu sein, verbittert über seinen Status, seinen Ruhm. Sie ist nichts weiter als eine Nullachtfünfzehn-Klavierlehrerin aus der Vorstadt, die desinteressierten Sechzehnjährigen beibringt, Chopin zu spielen. Ihr fehlt es eindeutig an der nötigen Selbstachtung, um mit einem so großen Mann verheiratet zu sein.
Sie haben keine Ahnung. Sie haben nicht die leiseste Ahnung.
Grace hat gerade ihr erstes Studienjahr an der University of Chicago absolviert. Karina hatte gehofft, sie würde über den Sommer nach Hause kommen und mit ihr zu Hannahs Party gehen, doch stattdessen hat sie sich für ein Praktikum bei ihrem Mathematikprofessor entschieden und bleibt auf dem Campus. Irgendwas mit Statistik. Karina ist stolz darauf, dass ihre Tochter für das Praktikum ausgewählt wurde, denn es ist eine großartige Chance. Aber es ändert nichts daran, dass sie dieses ungute Gefühl im Magen hat, dieses allzu vertraute Gefühl der Enttäuschung. Grace hätte sich entscheiden können herzukommen, den Sommer bei ihrer Mutter zu verbringen, aber das hat sie nicht. Karina weiß, wie unsinnig es ist, gekränkt zu sein, ja, sich im Stich gelassen zu fühlen, aber gegen ihre Emotionen kommt ihr Verstand nicht an. So ist sie nun mal, und daran lässt sich nicht so leicht etwas ändern.
Ihre Scheidung ist im September von Graces letztem Highschool-Jahr amtlich geworden, und genau ein Jahr danach ist Grace tausend Meilen weit weggezogen. Zuerst ist Richard gegangen, dann Grace. Karina fragt sich, wann sie sich an die Stille in ihrem Haus gewöhnen wird, an die Leere, die Erinnerungen, die in den Räumen hängen wie Gemälde an den Wänden. Ihr fehlt die Stimme ihrer Tochter am Handy, das Gekicher ihrer Freundinnen, ihre Schuhe in jedem Raum, ihre Haargummis, Handtücher und Kleidungsstücke auf dem Boden, das angelassene Licht. Ihre Tochter fehlt ihr.
Richard fehlt ihr nicht. Nachdem er gegangen war, hat sie keinen Verlust verspürt, sondern eher den Einzug von etwas Neuem. Das Vakuum, das sein kolossales Ego hinterließ, ist von himmlischem Frieden mehr als ausgefüllt worden. Sie hat ihn damals so wenig vermisst wie heute.
Doch solche Familienanlässe alleine aufzusuchen, bringt sie aus dem Gleichgewicht, als säße sie mit einer Pobacke auf einem zweibeinigen Schemel. In diesem Sinne fehlt er ihr. Für ihre Stabilität. Sie ist fünfundvierzig und geschieden, single. In Polen wäre das eine Schande. Doch sie ist nun schon ihr halbes Leben in Amerika. In dieser säkularen Kultur ist ihre Situation ganz normal und kein Grund, sich zu schämen. Trotzdem schämt sie sich. Das Mädchen kann Polen verlassen, aber Polen nicht das Mädchen.
Nachdem sie unter den anderen Eltern keine bekannten Gesichter entdeckt hat, holt sie tief Luft und macht sich auf den langen, unbehaglichen Weg zu Pam. Karina hat absurd viel Zeit darauf verwendet, sich für diese Party zurechtzumachen. Welches Kleid, welche Ohrringe, welche Schuhe? Sie hat sich das Haar aufgeföhnt. Sie hat sich gestern sogar eine Maniküre gegönnt. Warum? Jedenfalls nicht, um auf Hannah oder Pam oder die anderen Eltern Eindruck zu machen. Und es werden auch keine alleinstehenden Männer da sein – nicht, dass sie daran überhaupt interessiert wäre.
Sie weiß, warum. Keiner hier soll bei ihrem Anblick denken: Arme Karina. Ihr Leben ist verpfuscht, und man sieht’s ihr an. Und der andere Grund ist Richard. Pam und Scott Chu sind auch mit ihm befreundet. Wahrscheinlich haben sie auch Richard eingeladen. Sie hätte Pam fragen können, ob Richard auf der Gästeliste steht, nicht weil das eine Rolle spielte, sondern nur, weil sie gern vorgewarnt wäre. Aber sie hat sich die Frage verkniffen.
Allein bei der Vorstellung, dass auch er hier sein könnte, am Ende gar mit seinem neuesten spindeldürren, spätpubertierenden Flittchen am Arm, das ihm jedes wichtigtuerische Wort von den Lippen abliest, stellen sich ihr die Nackenhaare auf. Karina presst ein paarmal die Lippen aufeinander, um sicherzugehen, dass ihr Lippenstift nicht zu dick aufgetragen ist.
Sie lässt den Blick durch den Garten schweifen. Bei Pam und der kleinen Schar Eltern am Poolhaus kann sie ihn nicht entdecken. Karina sucht das Wasser, die Grillinsel, den Rasen mit den Augen ab. Er ist nirgends zu sehen.
Sie trifft am Poolhaus ein. Als sie sich zu der Runde um Pam und Scott gesellt, verstummen plötzlich alle und tauschen vielsagende Blicke. Die Zeit steht still.
»He, was habt ihr?«, fragt Karina.
Die anderen sehen Pam an.
»Ähm …« Pam zögert. »Wir sprachen gerade von Richard.«
»Tatsächlich?« Karina wartet und wappnet sich innerlich gegen eine Demütigung. Niemand sagt ein Wort. »Was ist mit ihm?«
»Er hat seine Tournee abgesagt.«
»Ach so.« Keine weltbewegende Sache. Er hat auch früher schon mal Konzerte und Tourneetermine abgeblasen. Einmal konnte er den Dirigenten nicht leiden und weigerte sich, mit ihm zusammen die Bühne zu betreten. Ein andermal musste im letzten Moment Ersatz für ihn gefunden werden, weil er sich an einer Flughafen-Bar betrunken und seinen Flieger verpasst hatte. Sie ist neugierig, was es diesmal ist. Doch Pam und Scott und die anderen starren sie mit ernster Miene an, als hätten sie von ihr eine mitfühlendere Reaktion erwartet.
Ihr zieht sich der Magen zusammen. Sie fühlt sich wie ein aufgebrachter Demonstrant, der in einer belebten Straße auf eine Seifenkiste steigt, um seinem Ärger Luft zu machen, ist empört, weil man sie auf diese Weise angeht. Besonders von Pam hätte sie mehr Verständnis erwartet. Richards abgesagte Tournee ist nicht ihr Problem. Sie hat sich von ihm scheiden lassen. Sein Leben geht sie nichts mehr an.
»Du weißt wirklich noch nichts davon?«, fragt Pam.
Wie ein Publikum, das andächtig einem Theaterstück folgt, warten sie alle reglos und mit angespannten Gesichtern auf ihre Antwort.
»Was habt ihr? Was ist los? Liegt er im Sterben, oder was?«
Ihr nervöses, trockenes Lachen stößt auf keine Resonanz. Sie sieht sich in der Runde nach Verbündeten um, jemandem, der trotz ihrer etwas deplatzierten Bemerkung Nachsicht übt und ihr den Anflug von schwarzem Humor vergibt. Doch alle sehen sie entweder entgeistert an oder schauen betreten weg. Alle außer Pam, die kaum merklich nickt.
»Karina, er hat ALS.«
ZWEI
Richard liegt nach einer erholsamen Nacht ausgeschlafen im Bett und starrt unverwandt und ohne zu blinzeln auf einen Kringel abblätternder Farbe an der gewölbten Decke über seinem Bett. Er spürt, wie es kommt, wie es unsichtbar heraufzieht, gleich aufgeladenen Ionen, die vor einem nahenden Gewitter in der Atmosphäre sirren, und ihm bleibt nichts anderes übrig, als still zu liegen und darauf zu warten, dass es durch ihn hindurchzieht.
Er ist zuhause in seinem Schlafzimmer, anstatt in New York im Mandarin Oriental aufzuwachen. Gestern Abend hätte er in der David Gaffen Hall im Lincoln Center ein Solokonzert geben sollen. Der Saal mit seinen fast dreitausend Sitzen ist schon seit Monaten ausverkauft. Wäre er jetzt im Mandarin, würde er gleich das Frühstück bestellen. Möglicherweise für zwei.
Aber er ist nicht im Mandarin in New York und ebenso wenig in der Gesellschaft einer hübschen Frau. Er liegt allein in seinem Bett in seiner Eigentumswohnung an der Commonwealth Avenue in Boston. Und obwohl er Hunger hat, wartet er.
Trevor, sein Agent, hat eine Pressemitteilung herausgegeben und als Grund für die Absage der Tournee eine Sehnenscheidenentzündung angegeben. Richard versteht nicht, was er mit dieser irreführenden Information bezweckt. Irgendwann müssen sie die Kröte sowieso schlucken. Die Bombe tickt, und früher oder später wird sie hochgehen. Zugegeben, anfänglich hat er wirklich an eine Sehnenscheidenentzündung geglaubt, eine frustrierende, unangenehme, doch häufige Beeinträchtigung, die durch Schonung und Physiotherapie wieder verschwindet. Selbst wenige Wochen Abstinenz vom Klavier frustrierten ihn – nicht auszudenken, wie sein Spiel darunter leiden würde. Das ist sieben Monate und eine Ewigkeit her. Was gäbe er darum, eine Sehnenscheidenentzündung zu haben!
Vielleicht kann und will sich sein Agent der Wahrheit immer noch nicht stellen. Im Herbst soll Richard mit dem Chicago Symphony Orchestra spielen. Den Auftritt hat Trevor noch nicht abgesagt, nur für den Fall, dass es Richard bis dahin besser geht. Richard kann Trevor verstehen. Er selbst kann ja, nunmehr sechs Monate nach der Diagnose, immer noch nicht vollständig erfassen, was er hat und wie es mit ihm weitergehen wird. An vielen Tagen ist er, wenn er liest oder eine Tasse Kaffee trinkt, beschwerdefrei. Er fühlt sich vollkommen normal, und dann vergisst er entweder, dass es die letzten sieben Monate gegeben hat, oder ihn packt eine trotzige Zuversicht.
Der Neurologe hat sich geirrt. Es ist ein Virus. Ein eingeklemmter Nerv. Borreliose. Sehnenscheidenentzündung. Das Problem ist ausgestanden. Ihm fehlt nichts.
Und dann spielt er Rachmaninovs Prelude in Gis Moll, und seine rechte Hand kommt nicht mit und jagt dem Tempo hinterher. Oder ihm fällt die halb volle Tasse Kaffee aus der Hand, weil sie plötzlich zu schwer ist. Oder er kommt aus Kraftmangel mit dem Nagelknipser nicht zurecht. Er betrachtet die grotesk langen Nägel seiner linken Hand, dann die ordentlich manikürten seiner rechten.
Es ist kein vorübergehendes Problem.
Er wird im Herbst nicht in Chicago spielen.
Er hat nichts an, hat schon immer nackt geschlafen. All die Jahre neben Karina in ihren hochgeschlossenen Flanellpyjamas und Strümpfen. Er versucht, sie sich nackt in Erinnerung zu rufen, kann aber nur die Bilder von anderen Frauen heraufbeschwören. Normalerweise würde ihn das erregen, und im Moment wäre die angenehme Ablenkung der Masturbation willkommen, doch die fürchterliche Erwartung dessen, was auf ihn zukommt, hält ihn in Angst und Schrecken, und sein gutes Stück liegt so schlaff und reglos da wie der Rest von ihm.
Unter dem Bettzeug fühlt er sich in seiner eigenen Körperwärme wie in einem wohligen Kokon. Als er die Decke energisch zurückschlägt, macht er sich auf die schockierend kalte Luft an seiner Haut gefasst. Er will es sehen, wenn es kommt.
Er blickt an seinen Armen herunter, mustert jedes Fingergelenk, besonders an Zeige- und Mittelfinger seiner rechten Hand. Er begutachtet Brust und Bauch, um eventuelle Unregelmäßigkeiten beim Heben und Senken festzustellen, wenn er atmet. Jetzt betrachtet er die Beine und Füße bis zu den Zehen; seine Sinne sind so geschärft wie bei einem Jäger, der die kleinste Regung im Gebüsch erspäht.
Er wartet, sein Körper gleicht einem Wasserkocher kurz vor dem Siedepunkt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann muss es sprudeln. Natürlich hofft er, dass es ausbleibt. Doch widersinnigerweise wartet er auch darauf, wartet, bis ihm das vertraute Gefühl durch Rumpf und Glieder tanzt.
Die erste Blase steigt an die Oberfläche und platzt an seiner linken Wade. Dort blubbert es ein paar Sekunden lang – der Auftakt –, springt dann auf seinen rechten Quadrizeps über, kurz oberhalb des Knies. Als Nächstes flattert die rechte Daumenbeere. Immer und immer wieder.
Besonders das ist ihm unerträglich, dieses Zucken in seinem dominanten Daumen, trotzdem sieht er wie gebannt hin. Er fleht ihn wortlos an, diesen mikroskopisch kleinen Feind da drinnen. Durch reinen Zufall – denn er weiß, dass er dagegen völlig machtlos ist – zieht sich das Zucken in diesem Moment aus der Hand zurück und wühlt sich wie eine Maus in ihrem Gang zwischen Haut und Bindegewebe hindurch zu seinem rechten Bizeps. Wandert zu seiner Unterlippe weiter. Diese kurzen Zuckungen setzen sich wie Wellenkräusel von einem Körperteil zum nächsten fort, bis es überall heftig sprudelt.
Manchmal verharrt das Zucken an einer Stelle. Gestern hat es sich in einem münzgroßen Segment seines linken Trizeps festgesetzt und dort stundenlang in Abständen pulsiert. Es kam nicht davon los, traktierte wie besessen ein und dieselbe Stelle, und er war schon in Panik, dass es nie vergeht.
Dabei weiß er mit absoluter Sicherheit, dass es irgendwann aufhören wird. Irgendwann hört das Zucken in jeder Muskelgruppe – in Armen, Beinen, Zwerchfell, Mund – für immer auf, und so sollte er froh, ja, dankbar sein, dass es noch zuckt. Das Zucken heißt, seine Muskeln sind noch da und noch in der Lage zu reagieren.
Vorerst jedenfalls.
Seine Motorneuronen werden von einem Cocktail von Toxinen, zu dem weder sein Arzt noch irgendein Forscher auf der Welt das Rezept kennt, vergiftet, und sein gesamtes Motorneuronensystem befindet sich in einer Todesspirale. Seine Neuronen sterben, und die Muskeln, die von ihnen gespeist werden, verkümmern buchstäblich aus Mangel an Reizen. Jedes Zucken ist das Stammeln, Japsen, Betteln eines Muskels – darum, ihn zu retten.
Es gibt keine Rettung für seine Muskeln.
Aber noch sind sie nicht tot. So wie das Blinken der Tankanzeige in seinem Wagen, wenn er auf Reserve fährt, sind diese Faszikulationen ein Frühwarnsystem. Nackt und frierend auf seinem Bett ausgestreckt, stellt er ein paar Berechnungen an. Nur mal angenommen, er hat noch etwa acht Liter im Tank, wenn seine Warnleuchte aufblinkt, und sein BMW macht im Stadtverkehr zehn Kilometer pro Liter, dann schafft er noch achtzig Kilometer, bevor ihm der Treibstoff ausgeht. Er stellt es sich konkret vor: Der letzte Tropfen Benzin ist verbraucht. Der Motor stottert, der Wagen bleibt stehen. Endstation.
Die rechte Seite seiner Unterlippe zuckt. Ohne die biologischen Zusammenhänge zu begreifen, fragt er sich, wie viel Muskelsprit noch in seinem Körper ist, und wünscht sich, er könnte das Zucken quantifizieren.
Wie viele Kilometer bleiben ihm noch?
DREI
Während Karina über fünf Blocks zur Commonwealth Avenue läuft, nimmt sie ihre Umgebung nur bruchstückhaft war – die Spatzen, die unter einer Parkbank an den Krümeln eines heruntergefallenen Muffins picken, ein grimmiges Drachentattoo auf der nackten Brust eines Mannes und das aggressive Surren der Rollen seines Skateboards auf dem Asphalt, als er an ihr vorbeizischt, ein junges asiatisches Paar, das Hand in Hand, Hüfte an Hüfte, vorüberschlendert. Eine mit Zigarettenrauch parfümierte Brise, ein schreiendes Baby im Kinderwagen, ein bellender Hund. Die Choreografie der Fußgänger und Autos an jeder Kreuzung. Karina ist tief in Gedanken.
Ihr Herz pocht schneller als für ihr Schritttempo angemessen, was sie beunruhigt. Oder, was näher liegt: Sie war zuerst beunruhigt, und ihr Herzschlag hat darauf reagiert. Sie geht schneller, um die äußerliche Bewegung an ihre innere Befindlichkeit anzupassen, aber das führt nur zu dem Gefühl zu hetzen, als wäre sie spät dran. Überflüssigerweise sieht sie auf die Uhr. Sie kann weder zu früh noch zu spät kommen, wenn er von ihrem Besuch nichts weiß.
Sie ist schweißnass. Als sie an der nächsten Ecke an einer roten Ampel stehen bleibt, holt sie ein Papiertaschentuch hervor und tupft sich damit unter der Bluse die Achseln. Sie kramt nach einem zweiten, findet aber keins. Stirn und Nase wischt sie sich mit den Händen ab.
Sie trifft an Richards Adresse ein, bleibt an den Eingangsstufen stehen und blickt zu den Fenstern im dritten Stock auf. Hinter ihr ragen die Türme der Trinity Church und die imposante Glasfassade des John Hancock Building über den Dächern der Brownstone-Bauten auf der anderen Seite der Comm Ave auf. Er hat einen fantastischen Blick.
Diese Straße in der Back Bay ist besonders privilegiert, hier ist die Bostoner Crème de la Crème unter sich, ähnlich wie ihre Nachbarn am Beacon Hill. Richard wohnt im selben Block wie ein Großteil von Bostons illustrer Elite – der Vorstandsvorsitzende von BioGO, ein Chirurg vom städtischen Krankenhaus, der Eigentümer – in vierter Generation – einer zweihundert Jahre alten Kunstgalerie in der Newbury Street. Richard verdient ordentlich Geld, ungewöhnlich viel für einen Pianisten, doch diese Adresse ist entschieden eine Nummer zu groß für ihn, wahrscheinlich seine Version der Midlife-Crisis, sein blitzender roter Porsche. Er muss sich bis zur Halskrause verschuldet haben.
Seit Graces Abschlussfeier hat sie ihn nicht mehr gesehen, das ist über ein Jahr her. Und hier ist sie noch nie gewesen. Na schön, sie ist zwei Mal vorbeigefahren, beide Male im Dunkeln, und beide Male hat sie sich eingeredet, auf dem Heimweg vom Zentrum diesen Umweg zu machen, um dem dichten Verkehr auszuweichen. Im Schritttempo ist sie vorübergeschlichen und hat durch die Fenster nur einen flüchtigen Blick auf hohe Decken und wohnlich warmes Licht erhascht. Dann hat sie Gas gegeben, bevor die Autos hinter ihr anfingen zu hupen.
Es ärgert sie, dass Richard derjenige war, der ausziehen und ein neues Leben anfangen konnte, in einem anderen, unbelasteten Domizil. In ihrem vormals gemeinsamen Heim verfolgen sie in jedem Zimmer die Erinnerungen an ihn, und die seltenen guten sind ebenso verwirrend wie die häufigen schlechten. Sie hat ihre Matratze und ihr Geschirr ausgewechselt und anstelle ihres Hochzeitsfotos an der Wohnzimmerwand einen hübschen Spiegel aufgehängt. Aber was bringt das schon? Sie ist immer noch genau da, wo er sie verlassen hat, immer noch in ihrer beider Haus, in dem er seinen energetischen Abdruck hinterlassen hat wie einen Rotweinfleck auf einer weißen Bluse. Selbst wenn man sie hundert Mal wäscht, bekommt man diesen bräunlichen Schatten nicht heraus.
Sie könnte umziehen, jetzt, wo Grace ans College gegangen ist. Aber wohin? Und wozu? Ihre Sturheit – Grundbaustein ihrer Persönlichkeit – lässt nicht zu, dass sie sich diese Frage ernsthaft stellt, statt sie als baren Unfug abzutun. Und so bleibt sie, wo sie ist, in den vier Zimmern ihres Kolonialstil-Hauses, das Zeuge einer zerbrochenen Ehe ist.
Als sie sich trennten, hatte Grace schon den Führerschein und konnte allein zum »Haus« ihres Vaters hinüberfahren, seiner Junggesellenbude. Karina steigt die Eingangsstufen des Brownstone-Baus hinauf und hat einen sauren Geschmack im Mund. Oben vor der Tür meldet sich ihr Magen zu Wort. Ihr ist schlecht, sie fühlt sich elend. Doch nicht sie ist krank, ruft sie sich ins Gedächtnis. Richard ist hier der Kranke.
Die Säure stößt ihr auf. Wozu ist sie hergekommen? Was soll sie sagen oder tun? Soll sie Mitgefühl, Verständnis zeigen? Hilfe anbieten? Muss sie mit eigenen Augen sehen, wie schlecht es ihm geht, so wie Autofahrer gaffen, wenn sie an einem Unfall vorbeikommen – und einen Blick auf die Blechtrümmer erhaschen wollen, bevor sie weiterziehen?
Wie wird er aussehen? Sie hat keinen anderen Anhaltspunkt als Stephen Hawking. Eine Handpuppe ohne die Hand; gelähmt, ausgemergelt, unfähig, ohne Geräte zu atmen, Gliedmaßen, Rumpf und Kopf in einem Rollstuhl positioniert wie die weiche Stoffpuppe eines kleinen Mädchens, die Stimme computergeneriert. Wird sie Richard so vor sich sehen?
Vielleicht ist er gar nicht zuhause. Vielleicht ist er im Krankenhaus. Sie hätte anrufen sollen. Vor einem Anruf hatte sie mehr Angst als davor, unangemeldet bei ihm vor der Tür zu stehen. Irgendwo in einem Winkel ihres Bewusstseins glaubt sie, für seine Krankheit verantwortlich zu sein, auch wenn sie weiß, dass solche Gedanken narzisstisch und absurd sind. Wie oft hat sie ihm den Tod an den Hals gewünscht? Jetzt wird er tatsächlich sterben, und sie ist eine schreckliche, verachtenswerte Frau und hat für solche Wünsche und ihre kranke Genugtuung dabei die Hölle verdient.
Sie steht vor der Türklingel und ist zwischen dem Entschluss, es durchzuziehen, und dem Impuls, auf der Stelle kehrtzumachen, hin und her gerissen. Hätte sie etwas von einer Spielerin, würde sie auf Umkehr setzen. Sie überwindet ihre Erstarrung und drückt zu ihrer eigenen Überraschung die Klingel.
»Hallo?«, ertönt Richards Stimme durch die Sprechanlage.
Karina pocht das Herz bis zum Hals, und ihre Kehle ist wie zugeschnürt. »Ich bin’s, Karina.«
Sie streicht sich das Haar hinter die Ohren und zupft an ihrem BH-Träger, der ihr unangenehm am verschwitzten Körper klebt. Sie wartet darauf, dass er den Summer betätigt und sie hereinlässt, doch nichts geschieht. Die Fenster in der Tür sind von blickdichten Gardinen verhängt, sodass man nicht sehen kann, ob jemand kommt. Dann hört sie Schritte. Die Tür geht auf.
Richard sagt nichts. Sie hätte gedacht, dass er verblüfft ist, sie zu sehen, doch da hat sie sich getäuscht. Sein Gesicht ist reglos – nur in seinen Augen erkennt sie den Anflug eines Lächelns, doch nicht wirklich vor Freude, sie zu sehen. Eher ist es Befriedigung, sich in einer Annahme bestätigt zu sehen, und schon jetzt wird ihr klar, dass dieser Besuch eine fatale Idee von ihr war. Er sagt immer noch nichts, und dieser nonverbale Eiertanz, der vielleicht zwei Sekunden währt, zieht sich quälend in die Länge, sprengt die Grenzen von Raum und Zeit.
»Ich hätte anrufen sollen.«
»Komm rein.«
Während sie ihm die drei Treppenabsätze hinauf folgt, beobachtet sie seinen Gang: sicher, fest und normal. Seine Linke gleitet den Handlauf entlang, und obwohl er ihn nie loslässt, sieht es nicht so aus, als benötige er den Halt. Es ist keine Behindertenhilfe. Von hinten sieht er vollkommen gesund aus.
Es war ein Gerücht.
Es war idiotisch von ihr.
In seiner Wohnung angelangt, führt er sie in die Küche, dunkles Holz, schwarze Arbeitsflächen und Edelstahl, modern und maskulin. Er bietet ihr einen Hocker an der Kücheninsel an, mit Blick ins Wohnzimmer – sein Steinway-Flügel, eine braune Ledercouch, der Orientteppich aus ihrem Haus, auf einem Schreibtisch am Fenster ein Laptop, ein Bücherregal – spärlich, ordentlich, aufs Wesentliche konzentriert. Richard, wie er leibt und lebt.
Auf der Kücheninsel steht eine Garde von mindestens zwei Dutzend Flaschen Wein Spalier, eine davon entkorkt, in dem Glas vor ihm noch ein Rest roter Flüssigkeit. Er liebt Wein, sieht sich gern als Connaisseur, beschränkt sich aber gewöhnlich auf besondere Gelegenheiten, wie nach einem Konzert oder um einen Erfolg zu feiern oder auf das Wochenende anzustoßen – oder er trinkt wenigstens zu einem Essen. Es ist Mittwoch und noch nicht einmal zwölf.
»Die sind aus dem Keller. Dieser Château Mouton Rothschild 2000 ist exquisit.« Er holt ein Glas aus dem Schrank. »Trinkst du ein Glas mit?«
»Nein, danke.«
»Diesen« – er zeigt mit der Hand zwischen ihnen hin und her – »unerwarteten Besuch, oder was auch immer es ist, sollten wir begießen, meinst du nicht?«
»Ist das gut, wenn du so viel trinkst?«
Er lacht. »Die sind nicht alle für heute. Morgen, und morgen, und dann wieder morgen.«
Er greift nach einer schönen schwarzen Flasche mit einem geprägten goldenen Schaf darauf, die bereits geöffnet ist, und schenkt ihr ungeachtet ihrer Antwort großzügig ein. Sie nippt und lächelt – unbeeindruckt – pflichtschuldig.
Wieder lacht er. »Du hast immer noch den erlesenen Geschmack eines Farmtiers.«
Das stimmt. Sie kann immer noch keinen Unterschied zwischen einer teuren Flasche Mouton und einem Krug kalifornischem Tafelwein erkennen und ist daran auch nicht interessiert, womit sie Richard immer in den Wahnsinn getrieben hat. Und in seiner typischen herablassenden Art hat er sie gerade als dämliche Kuh bezeichnet. Karina beißt die Zähne zusammen und verkneift sich den Konter, den sie ihm, wenn sie jetzt den Mund aufmachte, zusammen mit dem Hundert-Dollar-Wein ins Gesicht spucken würde.
Er schwenkt, riecht, nippt, schließt die Augen, wartet, schluckt und leckt sich die Lippen. Er öffnet Mund und Augen und blickt sie an, als habe er gerade einen Orgasmus oder eine göttliche Offenbarung gehabt.
»Wieso weißt du das nicht zu schätzen? Er hat die perfekte Reife. Probier noch mal. Riechst du nicht die Kirsche?«
Sie nimmt eine zweite Kostprobe. Er schmeckt ganz gut. Kirsche riecht sie nicht. »Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal zusammen Wein getrunken haben.«
»Vor vier Jahren, im November. Ich war gerade aus Japan zurück, kaputt vom Flug. Du hast polnische Kohlrouladen gemacht, und wir haben eine Flasche Château Margaux dazu geköpft.«
Sie starrt ihn an, verblüfft und fasziniert. Sie hat nicht die leiseste Erinnerung an diesen Abend, der offenbar bei Richard so lebhafte, angenehme Eindrücke hinterlassen hat, und fragt sich, ob er für sie selbst einfach nicht wichtig genug war, um ihn sich einzuprägen, oder ob er unter anderen Erfahrungen, die damit nicht zusammenpassen, einfach verblasst ist. Schon seltsam, wie eine Lebensgeschichte je nachdem, wer sie erzählt, in ein anderes Genre fallen kann.
Sie blicken sich in die Augen. Er sieht ein wenig älter aus, als sie ihn in Erinnerung hat. Älter trifft es vielleicht nicht. Trauriger. Und sein Gesicht wirkt kantiger. Er ist zwar schon immer dünn gewesen, doch er hat eindeutig abgenommen. Und sich einen Bart stehen lassen.
»Wie ich sehe, rasierst du dich nicht mehr.«
»Wollte mal was Neues ausprobieren. Gefällt’s dir?«
»Nein.«
Er grinst und nimmt noch einen Schluck Wein. Er tippt schweigend mit dem Finger an den Rand seines Glases, und sie weiß nicht, ob er sich gerade überlegt, wie er sie provozieren kann, oder ob er sich zurückhält. Zurückhaltung wäre neu.
»Du hast also deine Tournee abgesagt.«
»Wie hast du das erfahren?«
»Im Globe stand, wegen einer Sehnenscheidenentzündung.«
»Bist du deshalb gekommen? Um dich nach meiner Sehnenscheidenentzündung zu erkundigen?«
Er wirft ihr einen Köder hin, zwingt sie, Farbe zu bekennen, und wieder klopft ihr das Herz viel zu schnell. Sie hebt das Weinglas an die Lippen und nimmt einen Schluck, um seiner Frage, was der wahre Grund ihres Besuchs ist, und der Antwort darauf auszuweichen.
»Früher hab ich gedacht, dass du manchmal abgesagt hast, um Aufmerksamkeit zu erheischen.«
»Karina, ich versetze in den kommenden drei Wochen mehrere Tausend Menschen, die vorhatten, mir einen ganzen Abend lang ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Absagen ist das Gegenteil von Aufmerksamkeit erheischen.«
Wieder blicken sie sich in die Augen, und die Energie, die zwischen ihnen fließt, ist eine Mischung aus enger Verbundenheit und Kräftemessen.
»Andererseits hat es deine Aufmerksamkeit erregt.« Er lächelt.
Er steckt die Nase in sein Glas und saugt den Duft ein, bevor er den letzten Schluck nimmt. Er wendet sich den Flaschen auf der Theke zu und zieht einen Wachsoldaten aus der zweiten Reihe.
Er setzt den Ring des Korkenziehers auf den Flaschenhals und beginnt zu drehen, doch sein Griff ist so schwach, dass er nicht weiterkommt. Er nimmt den Öffner wieder ab, betrachtet den Verschluss und streicht mit dem Finger darüber. Dann wischt er den Finger an der Hose ab, als wäre er nass.
»Diese hartwachsversiegelten Korken sind verdammt schwer zu öffnen.«
Er setzt den Öffner wieder auf und unternimmt mehrere Versuche, doch seine Finger rutschen ein ums andere Mal ab, ohne den Drehmechanismus zu beherrschen. Ohne groß nachzudenken, will sie ihm gerade Hilfe anbieten, als er aufhört und den Öffner quer durch den Raum schleudert. Reflexartig duckt sich Karina, auch wenn sie außerhalb der Schusslinie ist.
»Da hast du’s«, wirft er ihr vor, »um das zu sehen, bist du doch hier, nicht wahr?«
»Ich weiß nicht. Ich wusste es nicht.«
»Jetzt zufrieden?«
»Nein.«
»Deshalb bist du hergekommen. Um mich so gedemütigt zu sehen.«
»Nein.«
»Ich kann nicht mehr spielen, jedenfalls nicht gut genug, und ich werde es auch nie wieder können. Deshalb wurde meine Tournee abgesagt, Karina. Ist es das, was du hören wolltest?«
»Nein.«
Sie starrt ihm in die Augen, und hinter all seinem Zorn entdeckt sie einen Ausdruck blanker Angst.
»Wieso bist du dann gekommen?«
»Ich dachte, es wäre das Richtige.«
»Na, sieh mal an, mit einem Mal die Musterkatholikin, die sich Gedanken macht, was richtig und was falsch ist. Mit Verlaub, meine Liebe, du könntest Richtig nicht mal von Falsch unterscheiden, wenn man’s dir sonst wohin stecken würde.«
Angewidert von ihm und wütend, dass sie es nicht besser gewusst hat, schüttelt sie den Kopf und steht auf. »Ich bin nicht hergekommen, um mir deine unflätigen Beleidigungen anzuhören.«
»Klar doch, das musste ja kommen. Hab ich doch schon mal gehört. Niemand beleidigt dich, auch wenn du das Wort rauf und runter betest. Damit hast du Grace eine Gehirnwäsche verpasst, deshalb redet sie nicht mehr mit mir.«
»Versuch nicht, das mir in die Schuhe zu schieben. Wenn sie nicht mit dir redet, dann liegt es vielleicht daran, dass du ein Arschloch bist.«
»Oder daran, dass ihre Mutter ein rachsüchtiges Miststück ist.«
Karina packt die Flasche, die er nicht öffnen konnte, am Hals und zerschlägt sie an der Kante der Küchentheke. Sie lässt den zerbrochenen Flaschenhals fallen und tritt von der Weinlache auf dem Boden zurück.
»Der riecht nach Kirsche«, sagt sie mit zittriger Stimme.
»Geh, auf der Stelle.«
»Ich bereue, dass ich überhaupt hergekommen bin.«
Sie knallt die Tür hinter sich zu und rennt die drei Treppen hinunter, als wäre der Teufel hinter ihr her. Sie hat die besten Absichten gehabt. Wieso ist es so gründlich schiefgegangen?
Wieso ist überhaupt alles so gründlich schiefgegangen?
Wut und Schmerz brechen von allen Seiten über sie herein, und plötzlich geben ihr die Beine nach. Sie setzt sich auf die oberste Eingangsstufe, dem prächtigen Ausblick zugewandt – den Joggern auf der Comm Ave, den Tauben im Park, den Türmen der Trinity Church und dem blauen Glas des Hancock – und bricht, ohne sich um neugierige Blicke zu kümmern, in Schluchzen aus.
VIER
Zum ersten Mal seit drei Wochen, seit dem 17.August, dem Tag, an dem sein rechter Zeigefinger als letzter Finger an seiner rechten Hand den Kampf aufgegeben hat und ihm nicht mehr gehorchte, setzt sich Richard an den Flügel. Er hat es täglich getestet. Am 16.August konnte er mit dem rechten Zeigefinger gerade noch eine Taste anschlagen. An diese Fähigkeit hat er sich geklammert, hat diese kümmerliche Bewegung – ein ungeheurer mentaler und physischer Kraftakt – gefeiert, auch wenn es eher ein klägliches Tippen als ein Anschlag war. Seine ganze Hoffnung hat er in diesen Finger gesetzt, der noch vor acht Monaten über die Tasten tanzen und die anspruchsvollsten, athletischsten Stücke spielen konnte, ohne ein einziges Mal aus dem Takt zu kommen, der jede Note mit dem perfekten Kraftaufwand anschlug.
FORTISSIMO!
Diminuendo.
Sein Zeigefinger, jeder Finger seiner rechten Hand, war ein fein kalibriertes Instrument. Falls ihm bei einer Probe auch nur ein einziger Fehlgriff unterlief, falls einem seiner Finger für einen Moment das Selbstvertrauen, die Kraft oder die Erinnerung fehlte, wenn er durcheinander kam und einen Schnitzer machte, hielt er augenblicklich inne und fing noch einmal ganz von vorne an. Für einen Fehlgriff null Toleranz. Keine Entschuldigung für seine Finger.
Vor acht Monaten verfügte seine rechte Hand noch über fünf der virtuosesten Finger der Welt. Heute ist sein ganzer rechter Arm bis in die Fingerspitzen gelähmt.
Er hebt die leblose Hand mit der Linken hoch und legt sie auf die Tasten – den rechten Daumen auf das eingestrichene C, den kleinen Finger auf das G. Er spürt die kühle Glätte der Tasten, es ist eine sinnliche, verführerische Berührung. Die Tasten wollen gestreichelt werden, bieten sich ihm an, doch er kann die Einladung nicht erwidern, und plötzlich ist es der grausamste Moment in seinem Leben.
In ungläubigem Entsetzen starrt er seine tote Hand auf den schönen Tasten an. Tot erscheint sie nicht nur, weil sie sich nicht rührt. Es ist auch keine Krümmung in seinen Fingern. Seine ganze Hand ist zu gerade, zu flach, ohne Tonus, ohne Persönlichkeit und Potential. Sie ist ohnmächtig, atrophisch, schlaff. Sie sieht wie eine Attrappe aus, eine Wachsprothese. Unmöglich ist das seine Hand.