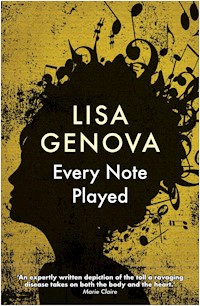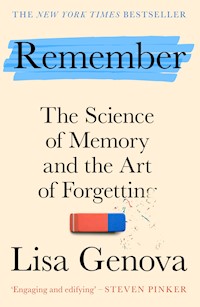7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sarah hat alles, wovon sie immer träumte: einen tollen Job, drei wunderbare Kinder, ein schönes Haus und einen liebevollen Mann. Nur eins hat Sarah nicht: Zeit. Bis zu jenem Morgen, an dem ihre Welt zusammenbricht.
Auf dem Weg zur Arbeit hat Sarah einen Unfall. Als sie Tage später aus dem Koma erwacht, kann sie ihre linke Körperhälfte nicht mehr steuern. Die einst so selbstständige Frau ist auf einmal von anderen abhängig. Und dazu gezwungen, ihr Leben dramatisch zu entschleunigen. Doch während es Sarah allmählich besser geht, stellt sie sich immer öfter die Frage: Will ich mein altes Leben überhaupt zurück?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
ÜBER DIE AUTORIN
Nach ihrem Psychologiestudium hat Lisa Genova an der Universität Harvard in Neurowissenschaft promoviert. Ihr Debütroman, »Mein Leben ohne Gestern«, hat sich inzwischen zu einem internationalen Bestseller entwickelt, stand lange auf der New-York-Times-Bestsellerliste und wurde nun mit prominenter Besetzung fürs Kino verfilmt. Auch ihre beiden folgenden Romane »Mehr als nur ein halbes Leben« und »Der Liebe eine Stimme geben« schafften es auf die New-York-Times-Bestsellerliste und wurden von Lesern und Rezensenten begeistert aufgenommen.www.lisagenova.com
LISA GENOVA
MEHR ALS NUR EIN HALBES LEBEN
ROMAN
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Veronika Dünninger
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Left Neglected«
Für die Originalausgabe: Copyright © 2011 by Lisa Genova
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the original publisher, Gallery Books, a Division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2011 by Bastei Lübbe AG, Köln Textredaktion: Beate Christmann, Pulheim Umschlaggestaltung: Gisela Kullowatz Umschlagmotiv: © istockphoto/danez E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-1035-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Chris und Ethan
PROLOG
Ich glaube, irgendein kleiner Teil von mir wusste, dass ich ein unhaltbares Leben führte. Von Zeit zu Zeit flüsterte er: Sarah, bitte, schalte einen Gang zurück. Du brauchst das alles nicht. Du kannst nicht so weitermachen. Aber der Rest von mir – stark, schlau und entschlossen zu leisten, leisten, leisten – wollte kein Wort davon hören. Und wenn solche Gedanken es hin und wieder doch einmal schafften, sich in mein Bewusstsein zu schleichen, verbot ich ihnen den Mund, schalt sie und schickte sie auf ihr Zimmer. Stille, leise Stimme, siehst du nicht, dass ich eine Million Dinge zu erledigen habe?
Selbst meine Träume begannen, mir auf die Schulter zu klopfen, versuchten, meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Weißt du überhaupt, was du da tust? Ich werde es dir zeigen. Aber keiner der Träume war beim Aufwachen noch zu greifen, und wie ein glitschiger Fisch, den ich mit bloßen Händen gefangen hatte, entglitten sie mir und schwammen davon, bevor ich sie mir genau ansehen konnte. Seltsam, dass ich mich jetzt an sie alle erinnern kann. Ich denke, in den Nächten unmittelbar vor dem Unfall hatten meine Träume versucht, mich wachzurütteln. Nach alldem, was passiert ist, glaube ich wirklich, sie waren ein Fingerzeig, von einer spirituellen Quelle gesandt. Botschaften von Gott. Doch ich ignorierte sie. Ich nehme an, ich brauchte etwas weniger Flüchtiges und eher Konkretes.
Zum Beispiel einen traumatischen Schlag gegen den Kopf.
ERSTES KAPITEL
»Überlebende, fertig?«
Jeff – der verwirrend gut aussehende TV-Moderator der Reality-Spielshow – lächelt, zieht das Warten in die Länge, weiß, dass er uns in den Wahnsinn treibt.
»Los!«
Ich renne durch den Regenwald. Käfer prallen gegen mein Gesicht, während ich vorwärtspresche. Ich bin eine menschliche Windschutzscheibe. Die Käfer ekeln mich an.
Ignorier sie. Beeil dich.
Scharfe Zweige schlagen mir entgegen und schlitzen mein Gesicht, meine Hand- und Fußgelenke auf, schneiden mich. Ich blute. Es brennt.
Ignorier es. Beeil dich.
Ein Zweig verheddert sich in meiner liebsten, teuersten Seidenbluse und reißt sie von der Schulter bis zum Ellenbogen auf.
Na toll, jetzt kann ich sie zu meiner Frühbesprechung nicht mehr anziehen. Kümmer dich später darum. Beeil dich, beeil dich.
Ich erreiche den Strand und entdecke die Treibholzplanken. Ich soll ein Floß bauen, aber ich sehe kein Werkzeug. Ich taste mit den Händen im Sand, doch ich kann kein Werkzeug finden. Dann fällt mir die Karte ein, die Jeff uns eine Sekunde lang gezeigt hat, bevor er sie in Brand steckte. Er hat gegrinst, während sie verbrannte. Leicht für ihn, so zufrieden zu sein, mit seinem vollen Bauch und seinen aprilfrischen Kleidern. Ich habe seit Tagen nichts gegessen oder geduscht.
»Mom, ich brauche Hilfe«, wimmert Charlie an meiner Seite. Er sollte gar nicht hier sein.
»Nicht jetzt, Charlie. Ich muss eine rote Flagge und einen Werkzeugkasten finden.«
»Mom, Mom, Mom!«, beharrt er. Er zerrt an meinem aufgeschlitzten Ärmel und reißt ihn bis zum Aufschlag ein.
Na toll, jetzt ist die Bluse endgültig ruiniert. Und ich nehme nicht an, dass ich vor der Arbeit noch Zeit haben werde, mich umzuziehen.
Über dem flachen Strand, etwa hundert Meter vor mir, entdecke ich einen verschwommenen roten Klecks. Ich renne darauf zu, und Charlie folgt mir, während er verzweifelt fleht: »Mom, Mom, Mom!«
Als ich hinuntersehe, sind da überall glänzende grüne und braune Scherben. Glas. Kein Seeglas. Neues Glas, scharf und gezackt. Der ganze Strand ist mit zerbrochenen Flaschen übersät.
»Charlie, bleib stehen! Lauf mir nicht nach!«
Geschickt weiche ich den Glasscherben aus, während ich weiterrenne. Doch dann höre ich, wie Charlie durchdreht und Jeff lacht, und ich mache einen falschen Schritt. Eine grüne Glasscherbe bohrt sich tief in die Sohle meines linken Fußes. Er tut höllisch weh und blutet stark.
Ignorier es. Beeil dich.
Ich erreiche die rote Flagge. Stechmücken schwärmen um meine Nasenlöcher, meinen Mund und meine Ohren, sodass ich spucken und würgen muss. Das ist nicht die Art von Protein, nach der ich mich sehne. Ich bedecke mein Gesicht mit den Händen, halte den Atem an und messe von der roten Flagge aus zwölf Schritte nach Westen ab.
Dann grabe ich mit den Händen zwischen einem wilden Schwarm Stechmücken, finde den Werkzeugkasten und humpele zurück zu den Treibholzplanken. Dort hockt Charlie und baut eine Burg aus Glasscherben.
»Charlie, hör auf damit. Du wirst dich schneiden.«
Aber er hört mich nicht, sondern macht einfach weiter.
Ignorier ihn. Beeil dich.
Ich habe das Floß ungefähr zur Hälfte zusammengebaut, als ich die Wölfe heulen höre.
Lauter. Lauter.
Beeil dich!
Das halbe Floß ist nicht stark genug, um uns beide zu tragen. Charlie schreit, als ich ihn hochziehe und von seiner Glasburg wegreiße. Er tritt um sich und trommelt wild auf mich ein, während ich ihn auf das halbfertige Floß verfrachte.
»Wenn du auf der anderen Seite bist, geh und hol Hilfe!«
»Mommy, lass mich nicht allein!«
»Hier ist es nicht sicher. Du musst los!«
Ich schiebe das halbe Floß aufs Wasser hinaus, und die starke Strömung erfasst es. Sobald Charlie außer Sichtweite ist, beginnen die Wölfe, meine Hose und meine Lieblingsbluse zu zerfetzen, reißen mir die Haut auf und fressen mich bei lebendigem Leib. Jeff lächelt, während ich im Sterben liege, und ich denke: Warum wollte ich dieses idiotische Spiel bloß spielen?
Mein menschlicher Wecker, mein neun Monate alter Sohn Linus, weckt mich mit einem plärrenden »Baaabaaa!« über das Babyfon, bevor ich sterbe.
FREITAG
Auf dem echten Wecker ist es 5.06 Uhr, ungefähr eine Stunde vor der Zeit, auf die ich ihn gestellt habe. Ich finde mich damit ab, jetzt aufzustehen, und schalte den Weckmodus aus. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal von dem »Biep, biep, biep« aufgewacht bin und nicht von den Geräuschen eines meiner drei Kinder. Und die Schlummertaste ist eine sogar noch fernere Erinnerung. Das morgendliche Verhandeln um eine kurze, aber luxuriöse verlängerte Auszeit im Bett. Nur noch neun Minuten, dafür werde ich mir die Beine nicht rasieren. Noch neun Minuten, dafür werde ich das Frühstück ausfallen lassen. Noch neun Minuten, den morgendlichen Sex. Auf diesen Knopf habe ich schon lange, lange Zeit nicht mehr gedrückt. Na ja, Charlie ist sieben, das heißt, es muss ungefähr sieben Jahre her sein. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Heutzutage stelle ich den Wecker abends nur noch, weil ich weiß, weil ich einfach weiß, dass das eine Mal, an dem ich es nicht tue, das eine Mal, wenn ich beschließe, mich darauf zu verlassen, dass meine kleinen Engel mich wecken werden, der Morgen sein wird, an dem ich irgendeinen wichtigen Termin oder einen Flug habe, den ich nicht verpassen darf, und genau dann werden sie alle zum ersten Mal lange schlafen.
Ich stehe da und sehe auf Bob hinunter, der ausgestreckt auf dem Rücken liegt, mit geschlossenen Augen, schlaffem Gesicht und offenem Mund.
»Beuteltierchen«, sage ich.
»Ich bin wach«, antwortet er, die Augen noch immer geschlossen. »Er ruft dich.«
»Er sagt ›Baba‹, nicht ›Mama‹.«
»Soll ich ihn holen?«
»Ich bin schon auf.«
Ich schlurfe barfuß über den kalten Hartholzboden den Flur hinunter zu Linus’ Zimmer. Als ich die Tür öffne, sehe ich ihn an den Stäben seines Gitterbettchens stehen, an seinem Schnuller nuckelnd, eine zerschlissene Decke in einer Hand, seinen geliebten und noch zerschlisseneren Bunny in der anderen. Er lächelt über das ganze Gesicht, als er mich sieht, sodass ich auch lächeln muss, und beginnt, gegen das Gitter zu hämmern. Er sieht aus wie ein entzückender Baby-Häftling an seinem letzten Tag im Gefängnis, der fertig gepackt hat, bereit ist und nun auf seine Freilassung wartet.
Ich nehme ihn hoch und trage ihn hinüber zum Wickeltisch, wo seine gute Laune augenblicklich zu einem Wimmern umschlägt. Er krümmt den Rücken und rollt sich auf die Seite, sträubt sich mit allem, was er hat, gegen das, was jeden Tag fünf- oder sechsmal mit ihm geschieht. Ich werde nie verstehen, wieso er es so abgrundtief hasst, sich die Windeln wechseln zu lassen.
»Linus, hör auf damit!«
Ich muss ein Übermaß an Kraft aufbieten, um ihn auf dem Wickeltisch festzuhalten und gleichzeitig in eine frische Windel und Kleider zu zwängen. Ich versuche es mit ein paar Bauchküssen und singe Leuchte, leuchte, kleiner Stern, um ihn wieder fröhlich zu stimmen, aber er bleibt während des ganzen Vorgangs ein störrischer Gegner. Der Wickeltisch steht neben dem einzigen Fenster in seinem Zimmer, was manchmal hilfreich ist, um ihn abzulenken. Sieh mal das kleine Vögelchen! Aber draußen ist es noch dunkel, und nicht einmal die Vögel sind schon wach. Es ist noch Nacht, mein Gott.
Linus schläft nachts nicht durch. Gestern Nacht habe ich ihn wieder in den Schlaf gewiegt, nachdem er um 1.00 Uhr schreiend aufgewacht war, und Bob ging um kurz nach 3.00 Uhr zu ihm. Mit seinen neun Monaten spricht Linus noch nicht, nur Baba-Mama-Dada-Gebrabbel. Daher können wir ihn nicht fragen, was das Problem ist, und wir können auch nicht vernünftig mit ihm reden oder ihn bestechen. Jede Nacht ist es ein Ratespiel, auf das Bob und ich keine große Lust haben, und wir gewinnen nie.
Meinst du, er zahnt? Sollten wir ihm Tylenol geben? Wir können ihn doch nicht jeden Abend mit Medikamenten vollpumpen. Vielleicht hat er eine Entzündung im Ohr. Vorhin habe ich gesehen, wie er sich am Ohr gezogen hat. Er zieht sich doch ständig am Ohr. Hat er seinen Schnuller verloren? Vielleicht hat er schlecht geträumt. Vielleicht ist es das Alleinsein. Sollen wir ihn zu uns ins Bett holen? Das wollen wir eigentlich gar nicht erst einführen, oder? Was haben wir denn bei den anderen beiden gemacht? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Motiviert von entnervter Erschöpfung, beschließen wir hin und wieder, ihn einfach zu ignorieren. Heute Nacht werden wir ihn weinen lassen, bis er aufhört. Aber der kleine Linus hat eine bemerkenswerte Ausdauer und Lungen, die nie aufgeben. Wenn er sich etwas erst einmal in den Kopf gesetzt hat, gibt er hundert Prozent – ein Charakterzug, der ihm, denke ich, im Leben sehr zugutekommen wird, daher bin ich nicht völlig überzeugt davon, dass wir ihm das mit Gewalt abgewöhnen sollten. Im Allgemeinen weint er über eine Stunde lang, während Bob und ich wach liegen und das Weinen weniger ignorieren als vielmehr darauf lauschen und nach leichten Veränderungen in der Tonhöhe oder dem Rhythmus suchen, die ein Hinweis darauf sein könnten, dass das Ende naht – ohne dergleichen je zu finden.
Eines der beiden anderen Kinder, meistens Lucy, klopft dann schließlich an unsere Tür und kommt herein.
»Linus weint.«
»Das wissen wir, Schatz.«
»Kann ich ein Glas Milch haben?«
Jetzt bin ich auf, um mit Lucy zusammen ihre Milch zu holen, und Bob ist auf, um Linus zu beruhigen. Plan vereitelt. Baby siegt. Punktestand: Eltern mit MBA-Abschluss in Harvard, beide in hohem Maße verhandlungssicher und führungsstark: null. Neun Monate altes Baby ohne ordentliche Schulbildung oder Erfahrung auf dem Planeten: zu viele für mein erschöpftes Gehirn, um noch mitzuzählen.
Sobald er angezogen und von dem verhassten Wickeltisch gehoben wurde, herrscht bei Linus augenblicklich wieder eitel Sonnenschein. Kein Schmollen, kein Nachtragen, nur Leben für den Augenblick. Ich gebe meinem kleinen Buddha einen Kuss, drücke ihn an mich und trage ihn nach unten. Charlie und Lucy sind schon auf. Ich kann Lucy in ihrem Zimmer herumlaufen hören, und Charlie liegt auf einem der Bohnensacksessel im Wohnzimmer und sieht sich SpongeBob Schwammkopf an.
»Charlie, es ist zu früh zum Fernsehen. Schalt das aus.«
Aber er ist völlig gefesselt und hört mich nicht. Zumindest hoffe ich, dass er mich nicht hört und nicht absichtlich auf Durchzug schaltet.
Lucy kommt aus ihrem Zimmer, angezogen wie eine Verrückte.
»Wie findest du meinen Stil, Mom?«
Sie trägt eine rosa-weiß getupfte Weste über einem langärmeligen orangefarbenen T-Shirt und Samtleggings mit Leopardenmuster unter einem hauchdünnen rosa Ballettröckchen, dazu Ugg-Boots und sechs Spangen, die wahllos in ihrem Haar befestigt sind, alle in unterschiedlichen Farben.
»Du siehst fabelhaft aus, Schatz.«
»Ich habe Hunger.«
»Na, dann komm mit.«
Wir gehen in die Küche, und Lucy klettert auf einen der Barhocker am Tresen der Kücheninsel. Ich fülle zwei Schälchen mit Frühstückscerealien, eins für Lucy und eines für Charlie, und ein Fläschchen mit Babymilch für Linus.
Ja, meine Kinder sind Peanuts-Figuren. Charlie, sieben, und Lucy, fünf, bekamen ihre Namen, ohne dass wir an den Comic dachten oder uns darauf bezogen. Charlie wurde nach Bobs Vater benannt, und der Name Lucy gefiel uns beiden einfach. Dann, als ich wider Erwarten noch ein Kind erwartete – Jahre nachdem wir jedes Stück Babyausstattung gespendet oder bei eBay versteigert hatten, Jahre nachdem wir das Ende der Windeln und Kinderwagen und Barney-Figuren gefeiert hatten –, mussten wir uns wieder einen Namen einfallen lassen und waren ratlos.
»Ich bin für Schroeder«, schlug ein Arbeitskollege vor.
»Nein, auf jeden Fall Linus. Oder Woodstock«, sagte ein anderer.
Erst in dem Augenblick wurde mir das Muster bewusst, das wir mit unseren ersten beiden Kindern begonnen hatten. Und der Name Linus gefiel mir.
Ich gebe Linus sein Fläschchen, während ich zusehe, wie Lucy die ganzen bunten Marshmallows, die »Charms«, zuerst isst.
»Charlie, komm schon!! Dein Müsli wird matschig!«
Lucy isst noch zwei Löffel Charms.
»Charlie!«
»Okay, okay.«
Charlie stemmt sich auf den Hocker neben Lucy hoch und sieht auf sein Schälchen, als wäre es die schlimmste Hausaufgabe aller Zeiten.
»Ich bin müde«, seufzt er.
»Warum bist du denn dann auf? Geh wieder ins Bett.«
»Okay«, sagt er und geht wieder hoch in sein Zimmer.
Lucy trinkt die Milch aus ihrem Schälchen, wischt sich mit dem Ärmel den Mund ab, hüpft herunter und verschwindet, ohne ein Wort zu sagen. Hastig, um endlich frei zu sein wie seine Schwester, trinkt Linus sein Fläschchen aus und macht dann ohne jede Hilfe ein Bäuerchen. Ich setze ihn auf dem Boden ab, der mit Spielzeug und Krümeln von Goldfisch-Crackern übersät ist. Ich schnappe mir einen Ball und werfe ihn ins Wohnzimmer.
»Na los, hol den Ball!«
Begeistert darüber, dass man mit ihm spielt, krabbelt er dem Ball hinterher wie ein verspielter junger Hund.
Wenigstens für einen Moment allein, esse ich Charlies nicht angerührtes matschiges Müsli – denn einer muss es ja tun –, dann trage ich das ganze Geschirr zur Spüle, wische den Tresen ab, setze Kaffee auf, packe Brotdosen und Snacks für Charlie und Lucy und die Windeltasche für Linus. Ich unterschreibe einen Zettel für Lucy und erlaube ihr, mit zum Plimouth-Planetarium zu fahren. Neben der Frage Werden Sie als Begleitperson mitfahren können? kreuze ich Nein an. In Charlies Rucksack finde ich eine Mitteilung seiner Lehrerin:
Liebe Mrs. Nickerson, lieber Mr. Nickerson,
letzte Woche wurden die Zeugnisse versandt, und ich hoffe, dass Sie inzwischen etwas Zeit hatten, sich Charlies anzusehen. Ich würde gern einen Termin vereinbaren, um mit Ihnen beiden persönlich über Charlie zu sprechen.
Bitte rufen Sie mich an, sobald es Ihnen möglich ist.
Mit freundlichen Grüßen
Ms. Gavin
Charlies Zeugnis ist nicht das, was sich eine Mutter für ihr Kind erträumt, vor allem nicht, wenn diese Mutter selbst immer – wirklich immer – nur die besten Zeugnisse bekommen hat. Bob und ich wussten, dass es Probleme geben würde, Raum für Verbesserungen bei Dingen wie Lesen und Aufmerksamkeit. Das letzte Jahr bereitete uns ein wenig darauf vor. Aber im Kindergarten wurden Charlies unterdurchschnittliche Noten in einigen Kategorien sowohl von seiner Lehrerin als auch von Bob leichthin abgetan. Er ist eben ein Junge! Er wird sich an das Stillsitzen und den langen Tag schon noch gewöhnen, wenn er in die erste Klasse kommt. Ich erlebe es jedes Jahr. Machen Sie sich keine Sorgen.
Na ja, jetzt ist er in der ersten Klasse, und ich mache mir Sorgen. Er hat in den meisten Kategorien entweder ein »M« für »Muss sich verbessern« oder eine »3« für »Unter den Erwartungen« bekommen. Selbst Bob wurde blass, als er die Spalte voller Dreien und Ms durchging. Was immer mit Charlie los ist, bei ein paar allgemeinen Floskeln über sein Geschlecht werden wir es diesmal nicht belassen können. Was stimmt nicht mit ihm?
Von den Lucky Charms ist mir jetzt schlecht. Ich hätte diesen ganzen Zucker nicht essen sollen. Ich klappe meinen Laptop neben der Kaffeemaschine auf dem Tresen auf und sehe nach meinen E-Mails, während ich dastehe und auf das Koffein warte, das mein süchtiges Gehirn braucht. Ich habe vierundsechzig neue Nachrichten. Gestern Abend war ich bis Mitternacht auf, um meinen Posteingang aufzuräumen, das heißt, diese ganzen E-Mails sind in den letzten fünf Stunden eingegangen. Einige sind von Büros an der Westküste, spätabends abgeschickt. Mindestens zwei Dutzend sind von Büros in Asien und Europa, wo man längst mitten im Arbeitstag ist. Ein paar als »dringend« markierte E-Mails sind von einem jungen und nervösen Analysten in Boston.
Ich vertiefe mich allzu lange in das Lesen und Beantworten, ohne unterbrochen zu werden. Als sich meine Ohren schließlich wieder einschalten, hören sie nichts. Wo sind die Kinder?
»Lucy? Linus?«
Nur die Bohnensäcke sehen sich im Wohnzimmer SpongeBob Schwammkopf an. Ich stürme die Treppe hoch und in Lucys Zimmer. Sie sind beide da, was heißt, dass Lucy vergessen hat, das Türchen am Fuß der Treppe einzuklinken, und Linus ganz allein hochgekrabbelt ist. Gott sei Dank hat er nicht versucht, die Treppe wieder hinunterzuklettern, denn seine bevorzugte Methode dabei ist mit dem Kopf voran. Aber bevor ich Gott dafür danken kann, dass er unversehrt ist, bevor ich dafür auf den Holzboden klopfe, dass ich wenigstens an das gedacht habe, was hätte passieren können, und bevor ich Lucy ordentlich dafür zusammenstauchen kann, dass sie das Türchen nicht eingeklinkt hat, verschärfen sich auf einmal all meine Sinne und richten sich auf Linus. Er sitzt auf dem Boden, erkundet nichts und hat den Mund verdächtig geschlossen. Lucy sitzt ein paar Schritte weiter und bastelt Schmuck. Perlen liegen auf dem ganzen Boden verstreut.
»Linus!«
Ich packe ihn mit der linken Hand am Hinterkopf und stecke ihm den rechten Zeigefinger in den Mund. Er wehrt sich, reißt den Kopf zur Seite und presst den Mund noch fester zusammen.
»Linus, mach den Mund auf! Was hast du da drin?«
Ich kann sie spüren, stochere mit dem Finger in seinem Mund herum und fördere eine kaugummirosa Plastikperle zutage, etwa so groß wie eine Cranberry. Verletzt, beraubt und nicht ahnend, dass sein Leben in Gefahr war, heult Linus los. Bob steht jetzt im Türrahmen, geduscht, angezogen und mit besorgter Miene.
»Was ist passiert?«, fragt er.
»Er wäre eben fast an dem hier erstickt.«
Ich zeige ihm die todbringende Perle in meiner hohlen Hand.
»Nö, zu klein. Alles okay.«
Trotzdem, rings um Lucy liegen noch jede Menge größerer Perlen auf dem Boden verstreut, dazu ein paar Münzen, Haargummis und ein Flummi. Lucys Zimmer ist eine Todesfalle. Was, wenn Linus beschlossen hätte, an einer Vierteldollarmünze zu lutschen? Was, wenn ihm eine der größeren orangefarbenen Perlen besonders verlockend erschienen wäre? Was, wenn ich zu spät gekommen wäre? Was, wenn Linus auf dem Boden läge, ohne zu atmen, mit blauen Lippen?
Wenn Bob meine Gedanken lesen könnte – was er vermutlich kann –, dann würde er mir empfehlen, gar nicht erst daran zu denken. Er würde mir raten, damit aufzuhören, mir das Schlimmste auszumalen, und mich zu entspannen. Alles ist gut. Alle Kinder nehmen Dinge in den Mund, die sie nicht in den Mund nehmen sollten. Sie essen Farbsplitter und Kreide und schlucken Schmutz, Kieselsteine und alle möglichen anderen Dinge, von denen wir nicht einmal etwas ahnen. Sie klettern sogar unbeaufsichtigt Treppen hoch. Kinder sind zäh, würde er sagen. Sie überleben.
Aber ich weiß es besser. Ich muss mir das Schlimmste nicht ausmalen, um daran zu denken. Ich kann mich daran erinnern. Manchmal überleben die Kinder. Und manchmal tun sie es nicht.
Als die zutiefst abergläubische, gottesfürchtige, leicht zwangsneurotische Typ-A-Perfektionistin, die ich bin, klopfe ich, die Perle in meiner Faust, an den hölzernen Bettpfosten, danke Gott dafür, dass er Linus behütet hat, und gebe seiner Schwester die Schuld.
»Lucy, dieses Zimmer ist eine Katastrophe. Du musst diese ganzen Perlen einsammeln.«
»Aber ich mache eine Kette«, jammert sie.
»Komm, ich helfe dir, Gänschen«, sagt Bob, jetzt auf den Knien, während er Perlen aufklaubt. »Warum suchst du dir für heute nicht eine von den Ketten aus, die du schon gemacht hast? Und dann kannst du mit mir und Linus nach unten kommen.«
»Charlie hat sich noch nicht angezogen und noch nicht gefrühstückt«, füge ich mich in die Routine und reiche das elterliche Staffelholz weiter an Bob.
Nach einer schnellen Dusche stehe ich nackt vor dem großen Spiegel im Schlafzimmer und mustere meinen Körper, während ich mir die Arme und Beine mit Körperlotion eincreme.
M. Muss sich verbessern.
Ich liege noch immer ungefähr fünfzehn Pfund über meinem Vor-Linus-Gewicht, das, wenn ich ehrlich sein soll, auch schon zehn Pfund über meinem Vor-Charlie-Gewicht lag. Ich greife mit einer Hand in den schlaffen und runzligen Brotteig, der einmal mein straffer Bauch war, und gleite mit einem Finger über die rostfarbene Linie, die unverblasst ein paar Zentimeter über meinem Bauchnabel beginnt und bis zu meinem Schamhaar verläuft. Dann gleite ich weiter zu den Fettschichten, die meine Hüftknochen polstern. Die Knochen haben sich seitlich verschoben, um Platz für Linus zu schaffen – mein größtes Baby –, sodass ich jetzt breitere Hüften und eine Schublade voller Hosen habe, die ich nicht mehr zuknöpfen kann.
Das Fitnessstudio, in dem ich Mitglied geworden bin, ließe sich treffender als meine bevorzugte Wohlfahrtsorganisation bezeichnen: Ich gehe nie hin. Ich sollte meine Mitgliedschaft dort wirklich kündigen, anstatt dem Laden im Grunde jeden Monat einhundert Dollar zu spenden. Dann stehen da noch die Fitnessgeräte im Keller, aufgestellt wie Statuen, und sammeln Staub an: der Crosstrainer, die Bowflex und die Rudermaschine, die Bob mir zu Weihnachten geschenkt hat, als ich im achten Monat schwanger war (war er verrückt?). An diesen sperrigen Geräten komme ich jedes Mal vorbei, wenn ich Wäsche wasche – was bei drei Kindern oft der Fall ist. Ich husche immer blitzschnell an ihnen vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen, als hätten wir irgendeine Art emotional aufgeladene Auseinandersetzung gehabt und ich würde ihnen nun die kalte Schulter zeigen. Es klappt. Sie belästigen mich nie.
Ich verreibe die restliche Lotion in meinen Händen.
Sei nicht zu hart zu dir selbst, denke ich, da ich weiß, dass ich dazu neige.
Linus ist erst neun Monate alt. Der Spruch »neun Monate rauf, neun Monate runter« aus The Girlfriends’ Guide to Getting Your Groove Back schießt mir durch den Kopf. Die Autorin geht davon aus, dass ich Zeit für Dinge wie Maniküre, Shoppen und Verkaufsmodeschauen habe und dass ich meine Figur zu meinem Hauptanliegen gemacht habe. Es ist nicht so, dass ich meine Figur nicht wiederhaben will. Nein, es steht auf meiner Liste. Nur steht es bedauerlicherweise so weit unten, dass ich es kaum noch sehen kann.
Bevor ich mich anziehe, halte ich einen Moment inne, um mich ein letztes Mal zu mustern. Meine helle Haut ist mit Sommersprossen übersät, dank meiner schottischen Mutter. Als kleines Mädchen habe ich die Sommersprossen immer durch eine Linie miteinander verbunden, um Sternbilder und Tätowierungen zu zeichnen. Mein Lieblingsbild war immer der perfekte fünfzackige Stern, den die Sommersprossen auf meinem linken Oberschenkel bilden. Aber das war damals in den Achtzigerjahren, bevor ich irgendetwas über Sonnenschutz wusste, damals, als ich und all meine Freundinnen Babyöl-Flaschen zum Strand schleppten und wir uns im wahrsten Sinne des Wortes in der Sonne brutzeln ließen. Jetzt sagen die Ärzte und die Medien alle, dass meine Sommersprossen Altersflecken und Zeichen für Sonnenschäden sind.
Ich verberge den Großteil dieser Schäden mithilfe eines weißen Mieders und meines schwarzen Power-Hosenanzugs von Elie Tahari. Im besten Sinne fühle ich mich in diesem Hosenanzug wie ein Mann. Perfekt für die Art von Tag, die mir bevorsteht. Ich reibe mein Haar mit dem Handtuch trocken und verteile einen Klecks Glanz-und-Halt-Haargel darin. Rotbraun, dicht und gewellt bis zu den Schultern, ist an meinem Haar nichts Maskulines. Vielleicht bin ich dick, sommersprossig und wie ein Mann angezogen, aber ich liebe mein hübsches Haar.
Ich trage rasch etwas Grundierungscreme, Rouge, Eyeliner und Wimperntusche auf, dann gehe ich nach unten und stürze mich wieder ins Getümmel. Lucy lümmelt jetzt auf einem der Bohnensacksessel herum und singt zu Dora the Explorer mit, Linus steckt neben ihr in seinem Pack-’n’-Play-Laufstall und nuckelt am Kopf eines Plastik-Schulbusfahrers. In der Küche sitzt Bob allein am Tisch, trinkt Kaffee aus seinem Harvard-Becher und liest das Wall Street Journal.
»Wo ist Charlie?«, frage ich.
»Zieht sich an.«
»Hat er gefrühstückt?«
»Müsli und Saft.«
Wie schafft er das bloß? Bob mit allen drei Kindern unter seiner Aufsicht ist eine völlig andere Geschichte als Sarah mit allen drei Kindern unter ihrer Aufsicht. Bei Bob sind sie gern bereit, sich eine Weile selbst zu beschäftigen, und lassen ihn in Frieden, bis er mit einer neuen Aktivität im Angebot auf sie zukommt. Ich hingegen besitze so viel Anziehungskraft wie ein Lieblingsrockstar ohne seine Bodyguards: Sie haben mich im Griff. Ein typisches Beispiel: Linus kauert zu meinen Füßen, quengelt und bettelt darum, auf den Arm genommen zu werden, während Lucy aus einem anderen Zimmer »Mom, ich brauche Hilfe!« brüllt und Charlie mir fünftausend hartnäckige Fragen darüber stellt, was mit dem Müll geschieht.
Ich schnappe mir meinen Becher und setze mich Bob gegenüber an den Tisch für unsere Frühbesprechung. Ich nehme einen Schluck Kaffee. Er ist kalt. Egal.
»Hast du die Nachricht von Charlies Lehrerin gesehen?«, frage ich.
»Nein, was ist denn?«
»Seine Lehrerin will mit uns über sein Zeugnis reden.«
»Gut, ich will wissen, was da los ist.«
Er greift in seine Kuriertasche und zückt sein iPhone.
»Meinst du, sie kann sich vor dem Unterricht mit uns treffen?«, fragt er.
Ich schnappe mir meinen Laptop vom Küchentresen und setze mich wieder.
»Ich könnte am Mittwoch und Freitag früh, vielleicht auch am Donnerstag, wenn ich etwas verschiebe«, erwidere ich.
»Ich kann am Donnerstag. Hast du ihre E-Mail-Adresse?«
»Ja.«
Rasch schicke ich Ms. Gavin eine Mail.
»Gehst du heute zu seinem Spiel?«, fragt er.
»Nein, du?«
»Ich werde vermutlich nicht rechtzeitig zurück sein, vergessen?«
»Ach ja. Ich kann auch nicht, mein Tag ist randvoll.«
»Okay. Ich wünschte nur, einer von uns könnte da sein, um ihn zu sehen.«
»Ich auch, Schatz.«
Ich glaube, dass er es wirklich aufrichtig meint, aber ich kann nicht umhin, seine Worte »Ich wünschte nur, einer von uns« zu nehmen und in Gedanken in ein »Ich wünschte, du« zu übersetzen. Und während das Getriebe meines inneren Dolmetschers geölt wird, verwandelt es »könnte« in »sollte«. Die meisten Frauen in Welmont mit Kindern in Charlies Alter verpassen nie ein Fußballspiel und verdienen sich keinen speziellen Gute-Mutter-Status dafür, dass sie dort sind. Gute Mütter tun das einfach. Dieselben Mütter bejubeln es als außergewöhnliches Ereignis, wenn einer der Dads früher aus dem Büro kommt, um ein Spiel zu sehen. Die Väter, die am Spielfeldrand stehen und anfeuern, werden als tolle Dads gefeiert. Väter, die die Spiele verpassen, arbeiten. Mütter, die die Spiele verpassen – so wie ich –, sind schlechte Mütter.
Eine Standarddosis mütterlicher Schuldgefühle sinkt auf den Grund der Suppe aus kaltem Kaffee und Lucky Charms in meinem Magen. Nicht unbedingt ein Frühstück für Helden.
»Abby kann bleiben und ihm zusehen«, sage ich, um mich zu beruhigen.
Abby ist unser Kindermädchen. Sie arbeitet für uns, seit Charlie zwölf Wochen alt war und mein Mutterschaftsurlaub endete. Wir hatten mehr als Glück, sie zu bekommen. Abby war damals zweiundzwanzig, frisch vom College, mit einem Abschluss in Psychologie, und lebte nur zehn Minuten von uns entfernt in Newton. Sie ist klug, gewissenhaft, hat tonnenweise Energie und liebt unsere Kinder.
Bevor Charlie und Lucy alt genug für die Vorschule waren, hat Abby montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr auf sie aufgepasst. Sie hat ihre Windeln gewechselt, sie in den Schlaf gewiegt, ihnen Geschichten vorgelesen, ihre Tränen abgetupft, ihnen Spiele und Lieder beigebracht, sie gebadet und gefüttert. Sie hat die Einkäufe erledigt und das Haus geputzt. Sie ist zu einem festen Mitglied unserer Familie geworden. Ich kann mir unser Leben ohne sie nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, entweder Bob oder Abby zu behalten, dann gab es schon Zeiten, wo es mir schwergefallen wäre, Bob zu wählen.
In diesem Frühjahr hat uns Abby das Unvorstellbare gesagt: Sie würde uns verlassen, um auf dem Boston College ihren Magister in Erziehungswissenschaften zu machen. Wir waren fassungslos und brachen in Panik aus. Wir durften sie nicht verlieren. Daher handelten wir einen Deal aus: Da Charlie und Lucy bereits sieben Stunden täglich zur Schule gingen, wären wir bereit, Linus ab September für dieselbe Anzahl von Stunden in eine Kindertagesstätte zu geben. Das würde heißen, dass wir sie nur nachmittags von 3.00 Uhr bis 18.30 Uhr bräuchten, und wir würden einen Teil ihrer Studiengebühren übernehmen.
Natürlich hätten wir auch das Internet durchforsten und jemanden finden können, der vermutlich gut und auf jeden Fall billiger gewesen wäre. Oder wir hätten jemanden über eine Kindermädchen-Agentur anheuern können. Aber Abby kennt unsere Kinder bereits. Sie kennt ihre Routinen, ihre Launen, ihre Lieblingssachen. Sie weiß, wie sie mit Charlies hartnäckigen Fragen und Lucys Wutanfällen umgehen soll, und sie vergisst nie – aber auch wirklich nie –, Bunny mitzunehmen, wohin Linus auch geht. Und sie liebt sie bereits. Wie kann man zu viel dafür bezahlen, dass man zweifelsfrei weiß, dass die eigenen Kinder geliebt werden, wenn man selbst nicht da sein kann?
Charlie galoppiert in die Küche, außer Atem.
»Wo sind meine Pokémon-Karten?«
»Charlie, du bist ja noch im Pyjama. Vergiss Pokémon. Geh und zieh dich an«, sage ich.
»Aber ich brauche meine Pokémon-Karten.«
»Hose, Hemd, Schuhe, und schalt dein Licht aus«, fordere ich ihn auf.
Charlie wirft entnervt den Kopf zurück, ergibt sich aber und schießt wieder die Treppe hoch in sein Zimmer.
»Irgendwas mit dem Haus?«, fragt Bob.
»Rufst du heute den Typen wegen des Garagentors an?«
»Ja, er steht schon auf meiner Liste.«
Unser automatischer Toröffner ist eins der neueren Modelle, und er hat einen visuellen Sensor, der verhindert, dass das Tor zugeht, wenn er registriert, dass irgendetwas unter dem Tor ist, zum Beispiel ein kleines Kind. Theoretisch ist es ein tolles Sicherheitsfeature, trotzdem scheint es uns in den Wahnsinn zu treiben. Eines der Kinder – und wir haben Charlie im Verdacht – schlägt immer wieder auf der rechten Seite gegen das Auge, sodass es nicht auf einer Höhe mit der linken Seite ist und die Kinder nicht sehen kann. Und wenn es schielt, funktioniert es überhaupt nicht.
Als wir klein waren, spielten mein Bruder Nate und ich mit unserem automatischen Garagentor gern Indiana Jones. Einer von uns drückte auf den Knopf der Fernbedienung, und dann guckten wir, wer sich am längsten zu warten traute, bevor wir losrannten und uns im letzten Augenblick unter dem sich schließenden Tor hindurchrollten. Damals gab es noch keine Sicherheitsfeatures. Dieser Garagentoröffner funktionierte völlig blind. Es hätte uns auch den ganzen Spaß verdorben, wenn das Risiko, zerquetscht oder zumindest schmerzhaft zusammengedrückt zu werden, ausgeschaltet worden wäre. Nate war richtig gut darin, er duckte und rollte sich immer in letzter Sekunde hindurch. Gott, ich vermisse ihn noch immer.
Charlie stürmt in die Küche, in T-Shirt, Shorts und ohne Schuhe.
»Mom, was ist, wenn der Erde die Schwerkraft ausgeht?«
»Was habe ich dir gesagt, dass du anziehen sollst?«
Keine Antwort.
»Es ist November, du brauchst eine Hose, ein langärmeliges Hemd und Schuhe«, sage ich.
Ich werfe einen Blick auf die Armbanduhr. 7.15 Uhr. Er steht noch immer da, und ich nehme an, er wartet auf eine Antwort auf die Frage über die Schwerkraft.
»Na los!«
»Komm schon, Junge, wir suchen dir was Besseres«, schlägt Bob vor, und sie schwirren zusammen ab.
Ich packe die beiden anderen Kinder in Mützen und Jacken, verschicke noch ein paar E-Mails, schnalle Linus in seinen Schalensitz fürs Auto, höre meinen Anrufbeantworter auf der Arbeit ab, packe meine eigene Tasche, schreibe eine Nachricht für Abby wegen des Fußballspiels, kippe den letzten Rest kalten Kaffee hinunter und treffe schließlich Bob und einen passend angezogenen Charlie vor der Haustür.
»Fertig?«, fragt Bob und sieht mich an.
Wir ballen beide die Fäuste, bringen sie in Position.
»Fertig.«
Heute ist Freitag. Bob setzt die Kinder dienstags und donnerstags an der Schule und der Kindertagesstätte ab, und ich bringe sie montags und mittwochs hin. Der Freitag ist immer offen. Wenn nicht einer von uns einen stichhaltigen Grund vorbringt, weshalb er unbedingt vor der Schule zur Arbeit muss, knobeln wir es aus. Schere schneidet Papier. Papier wickelt Stein ein. Stein zertrümmert Schere. Wir nehmen das Knobeln beide sehr ernst. Ein Sieg ist etwas Wundervolles. Ohne Kinder im Auto sofort zur Arbeit zu fahren ist himmlisch.
»Eins, zwei, dreeii!«
Bob hämmert seine geschlossene Faust auf mein Friedenszeichen und grinst triumphierend. Er gewinnt weitaus öfter, als er verliert.
»Verdammter Glückspilz.«
»Es ist alles nur Geschick, Schatz. Schönen Tag noch«, sagt er.
»Dir auch.«
Wir küssen uns zum Abschied. Es ist unser typischer morgendlicher Abschiedskuss. Ein flüchtiges Küsschen. Eine gut gemeinte Gewohnheit. Als ich den Blick senke, sehe ich Lucys runde blaue Augen, die genau aufpassen. Ein Bild davon schießt mir durch den Kopf, wie ich selbst meine Eltern beobachtet habe, wenn sie sich küssten, als ich noch klein war. Sie gaben sich einen Begrüßungs- und einen Abschieds- und einen Gutenachtkuss, und zwar so, wie ich eine meiner Tanten geküsst hätte, und ich war immer schrecklich enttäuscht davon. Es war nie etwas Aufregendes dabei. Ich versprach mir, dass ich – wenn ich eines Tages heiraten sollte – Küsse haben würde, die etwas bedeuteten. Küsse, von denen ich weiche Knie bekommen würde. Küsse, die den Kindern peinlich sein würden. Küsse wie die von Han Solo, wenn er Prinzessin Leia küsst. Ich habe meinen Vater meine Mutter nie so küssen sehen. Warum nicht? Ich habe es nie verstanden.
Jetzt verstehe ich es. Wir leben nicht in irgendeinem George-Lucas-Blockbuster-Abenteuer. Unser morgendlicher Abschiedskuss ist nicht romantisch, und er ist mit Sicherheit nicht sexuell. Es ist ein Routinekuss, aber ich bin froh, dass wir ihn haben. Er bedeutet trotzdem etwas. Er ist genug. Und er ist alles, wofür wir Zeit haben.
ZWEITES KAPITEL
»Mom, kann ich ein Stück haben?«, fragt Lucy.
»Aber sicher, Schatz, welches Stück möchtest du denn?«
»Kann ich deine Augen haben?«
»Du kannst eins haben.«
Ich rupfe mir den linken Augapfel aus der Augenhöhle. Er fühlt sich ein bisschen wie ein russisches Ei an, nur wärmer. Lucy reißt ihn mir aus der Hand und springt damit davon, lässt ihn auf dem Boden hüpfen wie einen Flummi.
»Sei vorsichtig damit; ich brauche ihn wieder!«
Ich sitze am Küchentisch und starre mit meinem einen Auge auf Hunderte von Zahlen in meiner Excel-Tabelle. Ich klicke mit dem Cursor eine Leerzelle an und gebe noch mehr Daten ein. Während ich tippe, wird mein Auge von irgendetwas außerhalb meines Blickfelds, genau über dem Laptopbildschirm, abgelenkt. Mein Vater, in seiner kompletten Feuerwehruniform, sitzt mir gegenüber im Sessel.
»Hi, Sarah.«
»Gott, Dad, du hast mich zu Tode erschreckt.«
»Du musst mir deinen Blinddarm geben.«
»Nein, der gehört mir.«
»Sarah, widersprich mir nicht. Ich brauche ihn.«
»Niemand braucht seinen Blinddarm, Dad. Du hast keinen neuen gebraucht.«
»Warum hat er mich dann umgebracht?«
Ich blicke hinunter auf meinen Computer. Eine PowerPoint-Folie erscheint auf dem Bildschirm. Ich lese sie.
Gründe, weshalb der Blinddarm deines Vaters durchgebrochen ist:
Er hatte zwei Tage lang Bauchschmerzen und hat nichts dagegen unternommen, außer ein bisschen Pepto-Bismol und etwas Whiskey zu trinken.Er hat die starke Übelkeit mit einem Achselzucken abgetan und nicht auf sein leichtes Fieber geachtet.Du warst auf dem College, deine Mutter war in ihrem Schlafzimmer, und er hat nicht die Feuerwehr oder den Notruf verständigt.Der Blinddarm hat sich entzündet und mit Gift infiziert.Wie jedes andere Lebewesen auch, das allzu lange missachtet wird, hielt der Blinddarm es schließlich nicht mehr aus und tat, was getan werden musste, um die Aufmerksamkeit deines Vaters zu bekommen.Ich blicke zu meinem Vater auf. Er wartet noch immer auf eine Antwort.
»Weil du ignoriert hast, was du gefühlt hast.«
»Ich bin vielleicht tot, aber ich bin immer noch dein Vater. Gib mir deinen Blinddarm.«
»Er hat keine Funktion. Ohne ihn bist du besser dran.«
»Eben.«
Er starrt mich unverwandt an, überträgt seine Gebanntheit wie ein Funksignal durch mein eines Auge in mein Bewusstsein.
»Ich werde schon klarkommen. Mach dir keine Sorgen um mich«, verspreche ich.
»Wir machen uns alle Sorgen um dich, Sarah.«
»Ich komme schon klar. Ich muss nur noch diesen Bericht zu Ende schreiben.«
Ich sehe auf den Bildschirm, und die Zahlen sind verschwunden.
»Scheiße!«
Ich sehe auf, und mein Vater ist verschwunden.
»Scheiße!«
Charlie kommt in die Küche gerannt.
»Du hast ›Scheiße!‹ gesagt«, verkündet er voller Freude, mich zu verpetzen, selbst wenn er mich nur bei mir selbst verpetzen kann.
»Ich weiß, tut mir leid«, entschuldige ich mich, mein eines Auge noch immer auf den Bildschirm geheftet, während ich hektisch nach irgendeiner Möglichkeit suche, diese ganzen Daten zu retten. Ich muss diesen Bericht zu Ende schreiben.
»Das ist ein Schimpfwort.«
»Ich weiß, tut mir leid«, wiederhole ich, während ich alles anklicke, was sich anklicken lässt.
Ich sehe nicht zu ihm hoch, und ich wünschte, er würde den Wink verstehen. Aber das tut er nie.
»Mom, du weißt doch, dass ich nicht gut zuhören kann?«
»Ja. Du treibst mich in den Wahnsinn.«
»Kann ich deine Ohren haben?«
»Du kannst eins haben.«
»Ich will beide.«
»Eins.«
»Beide, ich will beide!«
»Na, meinetwegen!«
Ich reiße mir die Ohren vom Kopf und werfe sie wie ein Paar Würfel über den Tisch. Charlie befestigt sie wie Kopfhörer über seinen eigenen und legt den Kopf schief, als würde er versuchen, auf irgendetwas in der Ferne zu lauschen. Er lächelt zufrieden. Ich versuche, es auch zu hören, aber dann fällt mir ein, dass ich gar keine Ohren mehr habe. Er sagt etwas und rennt weg.
»Hey, meine Ohrringe!«
Aber er ist bereits außer Sichtweite. Ich wende mich wieder meinem Computerbildschirm zu. Wenigstens ist er weg, und ich kann sicher sein, dass ich mich jetzt in aller Ruhe konzentrieren kann.
Die Haustür geht auf, und Bob steht auf der anderen Seite des Tischs. Als er mich ansieht, hat er eine Mischung aus Traurigkeit und Abscheu in seinen Augen. Er sagt etwas.
»Ich kann dich nicht hören, Schatz. Ich habe Charlie meine Ohren gegeben.«
Wieder sagt er etwas.
»Ich verstehe nicht, was du sagst.«
Er wirft seine Kuriertasche hin und kniet sich neben mich. Dann klappt er meinen Computerbildschirm zu und packt mich an den Schultern, fast tut er mir weh.
Er brüllt mich an. Ich kann ihn noch immer nicht hören, aber an seinem eindringlichen Blick und den blauen Adern, die an seinem Hals hervortreten, sehe ich, dass er mich anbrüllt. Was immer er mir zu sagen versucht, er brüllt es in Zeitlupe, damit ich es von seinen Lippen ablesen kann.
»Mach auf?«
Ich sehe zur Tür.
»Ich verstehe nicht.«
Er brüllt es immer wieder, schüttelt meine Schultern.
»Wach auf?«
»Ja!«, brüllt er und hört auf, mich zu schütteln.
»Ich bin wach.«
»Nein, das bist du nicht.«
MONTAG
Welmont ist ein wohlhabender Vorort von Boston, mit baumgesäumten Straßen, Landschaftsgärten, einem Fahrradweg, der sich durch die Stadt schlängelt, einem privaten Country Club und Golfplatz, einem Zentrum mit Modeboutiquen, Wellnesscentern, einem Gap-Geschäft und Schulen, mit denen jeder prahlt, den besten des Bundesstaates. Bob und ich haben uns für diese Stadt wegen ihrer Nähe zu Boston entschieden, wo wir beide arbeiten, und wegen des erfolgreichen Lebens, das sie verspricht. Wenn irgendwo in Welmont noch ein Haus für unter einer halben Million Dollar zu haben ist, steht mit Sicherheit irgendein gewiefter Bauunternehmer in den Startlöchern, um es zu kaufen, abzureißen und etwas zu bauen, was dreimal so groß und teuer ist. Fast jeder in der Stadt fährt einen Luxuswagen, macht Urlaub in der Karibik, ist Mitglied des Country Clubs und besitzt einen Zweitwohnsitz am Cape oder in den Bergen nördlich von Boston. Unserer ist in Vermont.
Bob und ich kamen frisch von der Harvard Business School, ich schwanger mit Charlie, als wir hierherzogen. Mit 200000 Dollar Studienschulden am Hals und ohne Ersparnisse war es ein beängstigendes Vorhaben, sich Welmont und alles, wofür es steht, zu leisten. Aber wir zogen beide Erfolg versprechende Jobs an Land und hatten ein unerschütterliches Vertrauen in unsere Verdienstmöglichkeiten. Acht Jahre später können wir mit den Durchschnittsbürgern von Welmont in jeder Hinsicht mithalten.
Die Grundschule von Welmont liegt nur etwa drei Meilen beziehungsweise zehn Minuten von unserem Haus in der Pilgrim Lane entfernt. Als ich an einer Ampel halten muss, werfe ich rasch einen Blick in den Rückspiegel. In der Mitte sitzt Charlie und spielt irgendetwas auf seinem Nintendo DS. Lucy starrt aus dem Fenster, während sie zu irgendeinem Hannah-Montana-Song auf ihrem iPod vor sich hin summt. Und mit dem Rücken zu mir, in seinem Auto-Schalensitz, nuckelt Linus an seinem Schnuller und sieht sich Elmos Welt in dem Spiegel an, den Bob an der Kopfstütze der Rückbank befestigt hat; das Video selbst läuft hinter ihm auf dem DVD-Player, der bei meinem Acura SUV zur Standardausstattung gehört. Niemand weint oder beklagt sich oder bittet mich um irgendetwas. Ach, die Wunder der modernen Technik!
Ich bin noch immer wütend auf Bob. Ich habe um 8.00 Uhr eine Besprechung zur europäischen Personalpolitik. Sie ist für einen wichtigen Kunden, und ich stehe unter Stress deswegen, und jetzt mache ich mir zu allem Übel auch noch Sorgen, dass ich es nicht rechtzeitig schaffen werde, weil heute Montag ist – und damit mein Tag, um die Kinder zur Schule und zur Tagesstätte zu bringen. Als ich Bob das gesagt habe, hat er nur einen Blick auf seine Armbanduhr geworfen und gemeint: Keine Sorge, du schaffst das schon. Aber ich war nicht auf der Suche nach einer Zen-Einstellung.
Charlie und Lucy sind für das Vor-Schulbeginn-Programm der Schule angemeldet, das jeden Morgen von 7.15 Uhr bis 8.20 Uhr in der Turnhalle stattfindet. Dort können die Kinder von Eltern, die vor 9.00 Uhr zur Arbeit müssen, unter der Aufsicht eines Lehrers herumhängen, bevor der Schultag offiziell um 8.30 Uhr beginnt. Mit nur fünf Dollar pro Tag und Kind ist das Vor-Schulbeginn-Programm ein echtes finanzielles Gottesgeschenk.
Als Charlie in den Kindergarten kam, wunderte ich mich, nur wenige Kinder aus Charlies Klasse im Vor-Schulbeginn-Programm zu sehen. Ich war davon ausgegangen, dass alle Eltern in der Stadt dieses Angebot benötigten. Dann nahm ich an, dass die meisten von ihnen Kindermädchen hatten, die bei ihnen im Haus lebten. Manche haben tatsächlich eins, aber offenbar haben die meisten Kinder in Welmont Mütter, die sich entschieden haben, aus dem Berufsleben auszuscheiden und Vollzeit-Moms zu sein – alles Frauen mit einem Collegeabschluss, manche sogar mit einem Doktortitel. Darauf wäre ich nie im Leben gekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, meinen Beruf aufzugeben, all die Jahre mit Aus- und Fortbildung vergeudet zu haben. Ich liebe meine Kinder, und ich weiß, dass sie wichtig sind, aber das sind meine Karriere und das Leben, das wir uns dank dieser Karriere leisten können, auch.
Auf dem Schulparkplatz halte ich, schnappe mir ihre beiden Rucksäcke – die, ich schwöre es, mehr wiegen als die Kinder selbst –, steige aus und öffne die hintere Tür wie ein Chauffeur. Wem will ich eigentlich etwas vormachen? Nicht wie ein Chauffeur. Ich bin ein Chauffeur. Niemand rührt sich.
»Na los, aussteigen!«
Den Blick immer noch auf ihre elektronischen Geräte geheftet und als hätten sie alle Zeit der Welt, klettern Charlie und Lucy nacheinander aus dem Wagen und steuern im Schneckentempo auf die Schulpforte zu.
Ich lasse Linus im Wagen und scheuche sie vor mir her, während der Motor und Elmo weiterlaufen.
Ich weiß, jemand aus 60 Minutes oder Dateline NBC würde mir deswegen eine ordentliche Standpauke halten, und inzwischen rechne ich jeden Tag insgeheim damit, dass Chris Hansen hinter einem parkenden Volvo hervorschießt und mich überrumpelt. Ich habe mir meine Argumente bereits zurechtgelegt. Erst einmal wiegt der Auto-Schalensitz, in dem alle Babys unter einem Jahr von Gesetzes wegen fahren müssen, unvorstellbare neunzehn Pfund. Dazu kommt Linus, der fast genauso viel wiegt wie der Autositz, und das erbärmliche ergonomische Design des Griffs, sodass es physisch unmöglich ist, ihn irgendwohin zu tragen. Ich würde gern einmal ein Gespräch mit dem ungeheuer starken und offensichtlich kinderlosen Mann führen, der diese Dinger entworfen hat. Linus sieht sich zufrieden Elmo an. Warum soll ich ihn stören? Welmont ist eine sichere Stadt. Und ich werde nur ein paar Sekunden fort sein.
Es ist ein ungewöhnlich warmer Morgen für die erste Novemberwoche. Noch gestern trugen Charlie und Lucy draußen Fleecemützen und Handschuhe, aber heute sind es fast zehn Grad, und sie brauchen kaum ihre Jacken. Zweifellos aufgrund des Wetters ist der Spielplatz der Schule voller tobender Kinder, was morgens nicht typisch ist. Das erregt Charlies Aufmerksamkeit, und schon bevor wir den Haupteingang erreichen, rennt er davon.
»Charlie! Komm hierher!«
Meine Ermahnung bremst ihn nicht einmal. Er steuert schnurstracks auf das Klettergerüst zu, ohne noch einmal zurückzusehen. Ich nehme Lucy auf den linken Arm und laufe ihm nach.
»Ich habe keine Zeit dafür«, sage ich zu Lucy, meiner gefügigen kleinen Verbündeten.
Als ich das Klettergerüst erreiche, ist die einzige Spur von Charlie seine Jacke, die zerknautscht auf einem Haufen Holzspäne liegt. Ich schnappe sie mir mit der Hand, in der ich bereits zwei Rucksäcke halte, und suche den Spielplatz ab.
»Charlie!«
Ich brauche nicht lange, um ihn zu entdecken. Er sitzt ganz oben auf dem Kletterturm.
»Charlie, komm herunter, aber sofort!«
Er scheint mich nicht zu hören, die Mütter in der Nähe hingegen schon. In ihren Designer-Sweatshirts, -T-Shirts und -Jeans, Tennisschuhen und Clogs scheinen diese Mütter alle Zeit der Welt zu haben, um morgens auf dem Schulspielplatz herumzuhängen. Ich spüre die Verurteilung in ihren strengen Blicken und stelle mir vor, was sie sich alles denken müssen.
Er will an diesem herrlichen Morgen doch nur draußen spielen, wie alle anderen Kinder auch.
Ist es denn zu viel von ihr verlangt, ihn ein paar Minuten spielen zu lassen?
Seht ihr, wie er gar nicht auf sie hört? Sie hat ihre Kinder nicht im Griff.
»Charlie, bitte komm herunter und komm mit. Ich muss zur Arbeit.«
Er bewegt sich nicht vom Fleck.
»Okay. Ich zähle bis drei. Eins!«
Er brüllt wie ein Löwe zu einer Gruppe Kinder herunter, die von unten zu ihm hochsehen.
»Zwei!«
Er rührt sich nicht.
»Drei!«
Nichts. Ich könnte ihn umbringen. Ich sehe hinunter auf meine acht Zentimeter hohen Cole-Haan-Absätze, während ich mich einen geistig umnachteten Moment lang frage, ob ich in ihnen klettern könnte. Dann sehe ich auf meine Cartier-Armbanduhr. Es ist 7.30 Uhr. Ich habe genug.
»Charlie, sofort, oder es gibt eine Woche lang keine Videospiele!«
Das hilft. Er steht auf, dreht sich um und gibt sich geschlagen, aber anstatt mit den Füßen nach der nächsten Sprosse unter sich zu tasten, geht er in die Knie und springt in die Luft. Ein paar anderen Müttern und mir stockt der Atem. In diesem Sekundenbruchteil stelle ich mir gebrochene Beine und eine durchtrennte Wirbelsäule vor. Aber er springt lächelnd vom Boden auf. Gott sei Dank ist er aus Gummi. Die Jungen, die diesem todesmutigen Stunt zugesehen haben, jubeln voller Bewunderung. Die Mädchen, die in der Nähe spielen, scheinen ihn gar nicht zu bemerken. Die Mütter schauen weiter zu, um zu sehen, wie ich den Rest dieses Dramas bewältige.
Da ich weiß, dass noch immer Fluchtgefahr besteht, setze ich Lucy auf dem Boden ab und nehme Charlie bei der Hand.
»Aua, nicht so fest!«
»Dein Pech.«
Er zerrt an meinem Arm, so fest er kann, lehnt sich zur Seite und versucht sich loszureißen – wie ein aufgeregter Dobermann an einer Leine. Meine Hand ist jetzt verschwitzt, und er beginnt mir wegzurutschen. Ich halte ihn fester. Er zerrt heftiger.
»Nimm mich auch bei der Hand«, jammert Lucy.
»Ich kann nicht, Schatz, komm schon.«
»Ich will deine Hand halten!«, kräht sie, ohne sich zu rühren, knapp am Rande eines Wutanfalls. Ich überlege schnell.
»Halt Charlies Hand.«
Charlie leckt die ganze Innenfläche seiner freien Hand ab und hält sie ihr hin.
»Igitt!«, kreischt Lucy.
»Na schön, hier.«
Ich schiebe die beiden Rucksäcke und Charlies Jacke bis zu meinem Ellenbogen nach oben und schleppe mich mit einem Kind an jeder Hand in die Grundschule von Welmont.
Die Turnhalle ist überheizt, und es bietet sich das übliche Bild. Die Mädchen sitzen alle an der Wand, lesen oder unterhalten sich oder sitzen einfach nur da und sehen den Jungen zu, die Basketball spielen und in der ganzen Halle herumtoben. Sobald ich seine Hand loslasse, rennt Charlie davon. Ich habe nicht die Willenskraft, ihn zurückzupfeifen, damit er sich ordentlich verabschiedet.
»Mach’s gut, mein Lucy-Gänschen.«
»Tschüs, Mommy.«
Ich gebe ihr einen Kuss auf ihren entzückenden kleinen Kopf und werfe die Rucksäcke auf den Haufen Schultaschen auf dem Boden. Hier drinnen halten sich keine Mütter oder Väter auf. Die anderen Eltern, die ihre Kinder morgens herbringen, kenne ich nicht. Ich kenne ein paar der Kinder dem Namen nach und weiß vielleicht, welche Eltern zu welchem Kind gehören – zum Beispiel die Frau, die Hilarys Mom ist. Doch die meisten stürzen schnell zur Tür herein und wieder hinaus, ohne Zeit für Smalltalk. Obwohl ich über niemanden von ihnen viel weiß, fühle ich mich diesen Eltern innerlich verbunden.
Die einzige Mutter, die ich bei dem Vor-Schulbeginn-Programm namentlich kenne, ist Heidi, Bens Mom, die jetzt ebenfalls auf dem Weg nach draußen ist. Heidi, immer in einem Kittel und lila Crocs, ist eine Art Krankenschwester. Ich weiß ihren Namen, weil Ben und Charlie Freunde sind, weil sie Charlie nach dem Fußball manchmal zu Hause absetzt und weil sie eine angenehme Ausstrahlung und ein aufrichtiges Lächeln hat, das im letzten Jahr oft eine ganze Menge Mitgefühl verströmt hat.
Ich habe auch Kinder. Ich kenne das.
Ich habe auch einen Job. Ich kenne das.
Ich bin auch spät dran. Ich kenne das.
Ich kenne das.
»Wie geht’s dir?«, fragt Heidi, während wir den Flur hinuntergehen.
»Gut, und dir?«
»Gut. Ich habe dich schon eine ganze Weile nicht mehr mit Linus gesehen. Er muss so groß geworden sein.«
»Oh mein Gott, Linus!«
Ohne ein Wort der Erklärung für Heidi stürze ich los, den Flur entlang, aus der Schule und die Stufen hinunter zu meinem laufenden Wagen, der zum Glück noch immer da steht. Ich kann den armen Linus wimmern hören, bevor ich die Tür auch nur berührt habe.
Bunny liegt auf dem Boden, und das DVD-Menü steht unbewegt auf dem Bildschirm, aber meine mütterlichen Ohren und mein Herz wissen, dass es bei seinem Weinen nicht um ein geliebtes Stofftier oder einen roten Muppet geht. Sobald das Video zu Ende war und Linus aus seiner magischen Trance zu sich kam, musste er begriffen haben, dass er gefangen war und allein im Wagen saß. Verlassen. Die Urangst Nummer eins eines jeden Babys in seinem Alter ist es, verlassen zu werden. Sein rotes Gesicht und sein Haaransatz sind nass von Tränen.
»Linus, entschuldige, entschuldige!«
Ich schnalle ihn ab, so schnell ich kann, während er immer noch schreit. Ich hebe ihn hoch, drücke ihn an mich und reibe ihm den Rücken. Er schmiert mir einen Rotzfleck auf den Hemdkragen.
»Schscht, ist ja gut, es ist alles gut.«
Es klappt nicht. Um genau zu sein, nehmen die geballte Kraft und Lautstärke seiner Schluchzer nur noch zu. Er ist nicht gewillt, mir so leicht zu verzeihen, und das kann ich ihm nicht verdenken. Aber wenn ich ihn nicht trösten kann, dann kann ich ihn genauso gut zur Kindertagesstätte bringen. Ich schnalle seinen verzweifelten Körper wieder auf den Autositz, setze ihm Bunny auf den Schoß, drücke auf die Starttaste des DVD-Players und fahre – während er Zeter und Mordio schreit – zur Kindertagesstätte Sunny Horizons.
Dort übergebe ich einen noch immer schluchzenden Linus und eine Windeltasche einer der Erziehungshelferinnen in der Tagesstätte, einer freundlichen jungen Brasilianerin, die neu im Sunny Horizons ist.
»Linus, schscht, es ist alles gut. Linus, bitte, Schatz, es ist alles gut«, versuche ich ihm ein letztes Mal gut zuzureden. Ich hasse es, ihn so zurückzulassen.
»Keine Sorge, Mrs. Nickerson. Es ist besser, wenn Sie einfach gehen.«
Wieder im Wagen, atme ich einmal tief aus. Endlich bin ich auf dem Weg zur Arbeit. Der Uhr auf dem Armaturenbrett zufolge ist es 7.50 Uhr. Ich werde mich verspäten. Wieder einmal. Ich beiße die Zähne zusammen, umklammere das Lenkrad und fahre vom Sunny Horizons los, während ich in meiner Tasche nach meinem Handy krame.
Meine Tasche ist peinlich groß. Je nachdem, wo und mit wem ich zusammen bin, dient sie mir als Aktenmappe, Handtasche, Windeltasche oder Rucksack. Egal, wo und mit wem ich zusammen bin, mit diesem Teil komme ich mir immer wie ein Sherpa vor. Während ich nach dem Telefon taste, berühre ich meinen Laptop, Buntstifte, Kugelschreiber, meine Brieftasche, Lippenstift, Schlüssel, Goldfisch-Cracker, einen Saftkarton, Visitenkarten, Tampons, eine Windel, Quittungen, Heftpflaster, eine Packung feuchte Tücher, einen Taschenrechner und Schnellhefter voller Unterlagen. Mein Handy berühre ich nicht. Ich stelle die Tasche auf den Kopf, kippe den Inhalt auf dem Beifahrersitz aus und suche danach.
Wo zum Teufel ist es? Ich habe ungefähr fünf Minuten Zeit, um es zu finden. Mir ist bewusst, dass meine Augen deutlich mehr auf den Beifahrersitz und den Boden achten als auf die Straße. Der Typ, der rechts an mir vorbeischießt, zeigt mir den Mittelfinger. Und spricht in sein Handy.
Auf einmal sehe ich es, aber nur vor meinem geistigen Auge. Auf dem Küchentisch. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich bin auf dem Mass Pike, ungefähr zwanzig Minuten von der Arbeit entfernt. Ich überlege eine Sekunde, wo ich abfahren und ein Münztelefon finden könnte. Aber dann denke ich: Gibt es überhaupt noch Münztelefone? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwo eins gesehen habe. Vielleicht könnte ich bei einer Drogerie oder einem Starbucks halten. Irgendein netter Mensch dort würde mir bestimmt sein Handy leihen. Nur für eine Minute. Sarah, deine Besprechung dauert die ganze nächste Stunde. Sieh einfach zu, dass du hinkommst.
Während ich wie ein NASCAR-Fahrer auf Crack die Straße entlangrase, versuche ich in Gedanken, meine Notizen für diese Besprechung zu ordnen, aber es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Ich kann nicht klar denken. Erst als ich in das Prudential-Parkhaus einbiege, wird mir bewusst, dass meine Gedanken mit Linus’ Video wetteifern.
Elmo will mehr über Familien lernen.
DRITTES KAPITEL
Ich sitze in der ersten Reihe des Wang Theatre, genau rechts von der Mitte. Ich sehe auf meine Armbanduhr und dann wieder hoch, recke den Hals, halte zwischen den Gesichtern in den überfüllten Gängen nach Bob Ausschau. Eine kleine ältere Frau kommt auf mich zu. Zuerst denke ich, die Frau muss mir irgendetwas Wichtiges zu sagen haben, aber dann wird mir klar, dass sie es auf den freien Platz links von mir abgesehen hat.
»Dieser Platz ist besetzt«, sage ich und lege eine Hand darauf.
»Sitzt hier schon jemand?«, fragt die Frau, die braunen Augen düster und verwirrt.
»Es kommt noch jemand.«
»Hä?«
»ES KOMMT NOCH JEMAND.«
»Ich kann nichts sehen, wenn ich nicht vorn sitze.«
»Es tut mir leid, aber hier sitzt schon jemand.«
Die schlammfarbenen Augen der Frau werden auf einmal klar und blicken durchdringend.
»Da wäre ich mir nicht so sicher.«
Ein Mann zwei Reihen hinter uns steht von seinem Platz auf und geht den Gang entlang, vielleicht, um zur Toilette zu gehen. Die alte Frau bemerkt es und lässt mich allein.
Ich berühre den Kragen meines Schlangenledermantels. Ich will ihn nicht ausziehen. Im Theater ist es kühl, und ich fühle mich schön darin. Aber ich will auch nicht, dass jemand Bob seinen Platz wegschnappt. Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr und meine Eintrittskarte. Ich bin genau dort, wo ich sein soll. Wo ist Bob? Ich ziehe meinen Mantel aus und lege ihn auf Bobs Platz. Ein kalter Schauder läuft mir den Rücken hinauf bis zu den Schultern. Ich reibe mir meine nackten Arme.
Dann halte ich wieder nach Bob Ausschau, aber schon bald werde ich von der Pracht des Theaters überwältigt – den prunkvollen roten Samtvorhängen, den hoch aufragenden Säulen, den griechischen und römischen Marmorstatuen. Ich richte meinen Blick nach oben. Die Decke ist offen und bietet einen atemberaubenden Blick in den Nachthimmel. Während ich noch immer verzückt bin von den Sternen über mir, spüre ich auf einmal das sanfte Gewicht eines Schattens auf mein Gesicht fallen. Ich erwarte, Bob zu sehen, aber stattdessen ist es Richard, mein Chef. Er wirft meinen Mantel auf den Boden und lässt sich auf den Platz neben mir fallen.
»Ich wundere mich, Sie hier zu sehen«, sagt er.
»Natürlich bin ich hier. Ich bin schon ganz gespannt auf die Vorstellung.«
»Sarah, die Vorstellung ist vorbei. Sie haben sie verpasst.«
Was? Ich wende mich zu all den Leuten um, die bereits in den Gängen stehen. Ich sehe nur ihre Hinterköpfe; alle sind im Aufbruch.
DIENSTAG
Es ist halb vier, und ich habe eine halbe Stunde frei bis zu meiner nächsten Besprechung – die erste Lücke des Tages. Ich beginne, den Salat mit Hühnchen zu essen, den mir meine Assistentin zum Mittagessen bestellt hat, während ich das Büro in Seattle zurückrufe. Während ich Salat kaue und das Telefon klingelt, beginne ich, die E-Mails zu überfliegen, die sich in meinem Posteingang angesammelt haben. Der Geschäftsführer nimmt ab und bittet mich um ein Brainstorming. Es geht darum, welcher unserer viertausend Berater verfügbar und am besten geeignet sein könnte für ein Informationstechnologie-Projekt, das nächste Woche hereinkommt. Ich unterhalte mich mit ihm, während ich abwechselnd Antworten auf ein paar E-Mails aus England zu Leistungsbeurteilungen tippe und meinen Salat esse.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich gelernt habe, zwei völlig verschiedene berufliche Gespräche auf einmal zu führen. Doch ich tue es schon lange, und ich weiß, dass es keine gewöhnliche Kunst ist, nicht einmal für eine Frau. Außerdem habe ich gelernt, geräuschlos zu tippen und zu klicken, sodass die Person am anderen Ende der Leitung nicht abgelenkt wird oder – noch schlimmer – beleidigt ist. Und ehrlich gesagt entscheide ich mich immer, nur diejenigen E-Mails zu beantworten, die meinen Geist nicht fordern, die nur mein Ja oder Nein erfordern, während ich telefoniere. Es kommt mir ein bisschen so vor, als hätte ich eine gespaltene Persönlichkeit: Sarah spricht am Telefon, während ihr verrücktes Alter Ego tippt. Immerhin arbeiten wir beide als ein Team.