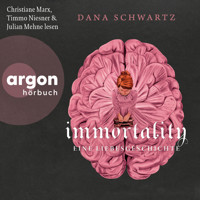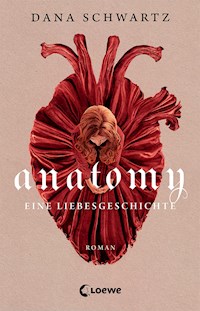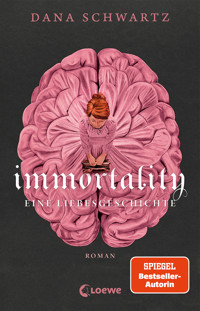
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Königshof voller Geheimnisse. Eine junge Ärztin, die ihnen auf die Schliche kommt. Lady Hazel Sinnett ist am Boden zerstört. Unsicher, ob Jack noch lebt, lenkt sie sich mit Arbeit ab und behandelt weiterhin Patienten. Da erhält sie den Auftrag, die Leibärztin der kranken Prinzessin Charlotte zu werden. Am Königshof findet Hazel sich in einer glanzvollen Welt wieder, in der nichts ist, wie es scheint. Jeder hat etwas zu verbergen, vor allem der mysteriöse Club der Todesgefährten. Und schon bald steht mehr als nur Hazels Zukunft als Chirurgin auf dem Spiel … Kehre zurück in die mysteriöse Welt des SPIEGEL-Bestsellers Anatomy In der spannenden Fortsetzung der fesselnden Nr. 1-New York Times-Bestseller-Dilogie widmet sich Dana Schwartz wieder hochaktuellen Themen wie Feminismus und Medizin. Dieser historische Roman überzeugt mit Raffinesse, einer starken Protagonistin, Romantik, und düsteren Szenen – Gänsehaut-Momente garantiert! Die fesselnde Fortsetzung der Nr. 1-New York Times-Bestseller-Dilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Prolog
1Edinburgh, 1818Das wird wehtun. …
2Hazel Sinnett träumte …
3Hawthornden Castle, Hazels …
4An dem Tag, …
5Die neue Abhandlung …
6Hazel saß in …
7Die Zelle besaß …
8Hazel saß tagelang …
9Der junge Mann …
10Die Kutschfahrt nach …
11Sie können nicht …
12Zum Glück erreichte …
13Hazel verfiel in …
14Auf Elizas Drängen …
15In dem roten …
16Aus der Vogelperspektive …
17Das Geräusch des …
18Als Hazel die …
19Fast jeden Tag …
20Seit Napoleons Niederlage …
21He!«
22Wie versprochen, suchte …
23Jack saß in …
24Der Sommer war …
25Warten Sie! Hazel, …
26Hazel wartete eine …
27Simon war gerade …
28Nach nur einer …
29Die düstere Stimmung …
30Gaspar hatte Hazel …
31Jack wartete am …
32In ihrer Brust …
Anmerkungen und Danksagung
Für alle,
[1] »Nicht jeder ist wie du«, sagte Elinor, »und begeistert sich für totes Laub.«
Jane Austen,
Prolog
Paris, 1794
Auf dem Platz drängten sich die Menschen, die im Morgengrauen aufgestanden waren, um Blut zu sehen. Sie standen um das Holzpodest, auf dem man die Guillotine aufgebaut hatte, und zwängten sich unter Einsatz ihrer Ellbogen nach vorne, möglichst nahe ans Geschehen. Die wenigen Glücklichen, die es bis ganz in die erste Reihe geschafft hatten, hielten Taschentücher in die Höhe und tauchten sie, sobald die Köpfe anfingen zu rollen, in die Blutlachen. Souvenirs. Ein Erbstück, das sie an ihre Kinder und Kindeskinder weitergeben konnten. Siehst du? Ich war dort, würden sie dann sagen, während sie das Stück Stoff auseinanderfalteten. Ich war bei der Revolution dabei. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie die Verräter ihre Köpfe verloren.
Der morgendliche Sonnenschein spiegelte sich in dem weißen Stein des Gerichtsgebäudes. Wenngleich seine Hände gefesselt waren, gelang es Antoine Lavoisier, die Ärmelaufschläge seines Hemds zu richten. Für seinen Gerichtstermin an jenem Morgen hatte er sein schlichtestes Hemd ausgewählt – ein einfaches flachsfarbenes Ding, das er für seine Arbeit im Labor anzog, in dem Wissen, dass es mit Schweiß oder mit einer der Hunderten chemischen Lösungen aus den Glasphiolen befleckt werden könnte. Seine Frau Marie-Anne hatte schon Dutzende Male damit gedroht, es wegzuwerfen. Heute hatte er es in der Hoffnung getragen, er könnte dem Richter und dem grölenden Mob draußen beweisen, dass er ein Mann des Volkes war. Doch so viel, wie es ihm genützt hatte, hätte er sich genauso gut in Seidenbrokat kleiden können.
»Bitte«, hatte er den Richter angefleht. (Das verdammte Wort war ihm fast im Hals stecken geblieben. Wäre seine Situation nicht ganz so verzweifelt gewesen, hätte er es niemals über sich gebracht zu betteln.) »Bitte«, wiederholte er, »Frankreich braucht meine Arbeit. Stellen Sie sich nur vor, was ich alles für die Nation – für die Republik – tun könnte, wenn ich noch mehr Zeit hätte, meine wissenschaftlichen Studien fortzuführen. Bei der Erforschung von Sauerstoff, von Wasserstoff und des Verbrennungsvorgangs habe ich schon so viel erreicht! Lassen Sie mich wenigstens zurück in meine Wohnung gehen, um meine Unterlagen zu sortieren. Darin befinden sich in jahrelanger Arbeit erstellte Kalkulationen. Ungeahnte Möglichkeiten …«
Der Richter unterbrach ihn mit einem krampfartigen, verschleimten Husten. »Genug davon«, sagte er. »Die Republik braucht weder Gelehrte noch Chemiker, die das Volk bestohlen haben. Und der Lauf der Gerechtigkeit kann nicht länger aufgehalten werden.« Er schlug mit seinem Hammer auf den Tisch. »Schuldig.«
Lavoisier seufzte. »Zu traurig«, murmelte er so leise, dass ihn niemand über das Geschrei und Gejubel der schadenfrohen Menge hinweg hören konnte. Offiziell war Antoine Lavoisier des Steuerbetrugs und des Verkaufs untauglichen Tabaks angeklagt worden. Er habe, so lautete der Vorwurf, das einfache Volk betrogen, indem er dem Tabak Wasser zufügte, um ihn schwerer zu machen. Doch er wusste, dass er wegen etwas völlig anderem vor Gericht stand: nämlich dafür, dass er adlig und Wissenschaftler war. Dafür, dass er im vergangenen Jahrzehnt zusammen mit seiner Frau in ihrer Wohnung Salons für Intellektuelle und Künstler abgehalten hatte, bei denen Marie-Anne Tee, schlagfertige Antworten und von ihren Dienstboten zubereitetes Gebäck serviert hatte.
Frankreich veränderte sich, hatte sich viel schneller verändert, als er es für möglich gehalten hätte. Die Luft war von Mordlust erfüllt, von einem rasenden Verlangen nach etwas, das Gerechtigkeit genannt wurde, aber wie Grausamkeit wirkte. Ein halbes Dutzend seiner Freunde hatte bereits den Kopf wegen fadenscheiniger Strafanzeigen verloren, die über Nacht aufgetaucht waren. Der Rest seines Freundeskreises war nach London oder Italien geflohen. Auch er und seine Frau hätten nach England entkommen können, doch sie hatten ihre Experimente nicht aufgeben wollen. Ihr Labor. Sie waren so nah dran gewesen.
Jetzt war es zu spät.
Vor nur wenigen Monaten hatte Lavoisier miterlebt, wie selbst die Königin wie Gerümpel in einem offenen Käfig durch die Straßen von Paris gekarrt worden war. Damit die treuen Bürgerinnen und Bürger der Republik in ihr Gesicht blicken und sie mit faulem Obst und Kohl bewerfen konnten. Lavoisier hatte sich zwingen müssen hinzusehen. Bei seiner letzten Begegnung mit der Königin war er in Versailles zu Gast gewesen und hatte König Ludwig und seinem Hof eine neue Art der chemischen Verbrennung vorgeführt. Marie-Antoinette hatte ein Kleid aus gelbem Satin getragen und ihr gepudertes, hoch auftoupiertes Haar war mit Straußenfedern und Perlen geschmückt gewesen. Sie hatte gelacht, daran erinnerte er sich noch. Sie hatte über die kleinen Explosionen gelacht, die er auslöste. Der blaue, dann grüne und schließlich violette Rauch sollte blenden und belustigen. Ihr Gesicht war jung und ihre Wangen rosig gewesen.
An dem Tag, als sie die Königin zur Guillotine geführt hatten, war ihm ihr Gesicht hager und faltig erschienen – wie das einer um Jahrzehnte gealterten Frau. Ihr Haar war gänzlich weiß und so dünn geworden, dass an einigen Stellen ihre Kopfhaut durchschimmerte. Als der Wagen an Lavoisier vorbeifuhr, waren ihre Augen leer und ausdruckslos gewesen – als wäre sie schon vor langer Zeit gestorben.
Eine Wache mit einem Bajonett begann, Lavoisier zum Podest zu zerren. Einige Schaulustige versuchten, ihn zu Fall zu bringen oder ihm im Vorbeigehen einen Fausthieb zu verpassen, aber Lavoisier bekam davon kaum etwas mit, so konzentriert ließ er den Blick über die Tausende von Gesichtern schweifen, auf der Suche nach seiner Frau Marie-Anne.
»Da!«, schrie er.
Die Sonne erleuchtete sie von hinten und ihr Haar verlieh ihr einen goldenen Strahlenkranz. Sie stand unweit der Holzstufen, die zum Podest hinaufführten, und beobachtete die Menge mit entschlossener Miene. Die Wache schaute verwirrt zu Lavoisier zurück, unsicher, warum er geschrien hatte.
In ebendiesem Moment erblickte Marie-Anne ihren Mann und bewegte sich sogleich gegen den Strom der Körper auf ihn zu.
Die Wache schubste Lavoisier und versuchte, ihn weiter vorwärtszudrängen.
Er widersetzte sich. »Die republikanische Justiz kann doch gewiss noch so lange warten, bis ich meine Frau zum Abschied geküsst habe?« Die Wache seufzte, blieb jedoch stehen und erlaubte dem Paar, sich zu umarmen. Marie-Anne flüsterte ihrem Mann etwas ins Ohr. Niemand bemerkte, wie sie ihm ein kleines Fläschchen in die Hand drückte.
Die Klinge der Guillotine war braun vor Blut. An diesem Morgen hatten bereits zwei Enthauptungen stattgefunden und das Stroh auf dem Podest war rot verklebt. Jemand hielt schon einen Korb bereit, um Lavoisiers Kopf aufzufangen, wenn er von seinem Hals purzelte. Andere hoben ihre weißen Taschentücher in die Höhe, in der Hoffnung, ein paar Blutspritzer damit aufzufangen.
Marie-Anne Lavoisier sah nicht zu, wie ihr Mann die schmalen Holzstufen hinaufstieg. Sie wollte nicht wissen, ob er zitterte oder seine Beine unter ihm wegknicken würden. Es hieß, dass manche sich sogar selbst besudelten.
Stattdessen bewegte sie sich rasch durch die Menge, weg von dem Platz und in Richtung ihrer Wohnung, um dort noch möglichst viele Unterlagen ihres Mannes zu retten, ehe die Aasgeier eintrafen und alles plünderten, was sie an Wertvollem ergattern konnten. Das neue Regime beschlagnahmte alles, was es in die Hände bekam. Marie-Anne tröstete sich mit dem Gedanken, dass die Banausen, die die Arbeiten ihres Mannes stahlen, sie vermutlich nicht verstehen würden.
Sie tauchte in eine kleine Gasse ab. Ihre Schritte waren schnell und sicher. Die Menge hinter ihr schnappte aufgeregt nach Luft. Was sie schrien, konnte sie nicht ausmachen. Und dann kam das unverkennbare Geräusch der Klinge, die durch die Luft sauste. Marie-Anne Lavoisier sprach ein kurzes Gebet für ihren Mann und ihr Land und lief weiter.
1
Edinburgh, 1818
Das wird wehtun. Tut mir leid.« Hazel Sinnett sah keinen Sinn darin zu lügen.
Der Junge biss fester auf das Stück Leder, das sie zu genau diesem Zweck mitgebracht hatte, und nickte. Ein junges Mädchen hatte am Vorabend an Hazels Tür geklopft und sie angefleht, mit ihr zu kommen. Ihr älterer Bruder habe sich vor Wochen den Arm beim Arbeiten in der Werft gebrochen, doch der Bruch sei so schlecht verheilt, dass er nun den Arm nicht mehr bewegen könne. Als Hazel gleich am Morgen zu der schäbigen Wohnung in der Nähe von Mary King’s Close gekommen war, hatte sie festgestellt, dass der Arm des Jungen geschwollen und heiß und die zum Platzen angespannte Haut mit gelben und grünen Flecken übersät war.
Hazel legte ihre chirurgischen Instrumente bereit: ein Skalpell, um den Arm aufzuschneiden und das Schlimmste der Infektion abfließen zu lassen; Nadel und Faden, mit denen sie den Schnitt wieder zunähen würde; und die Stoffstreifen sowie Holzstücke, mit denen sie den Arm ruhigstellen würde, sobald sie ihn abermals gebrochen und wieder gerichtet hatte. Dieser letzte Schritt würde am meisten schmerzen.
Der Patient hieß Martin Potter und war vermutlich etwa in ihrem Alter – so um die siebzehn oder achtzehn –, doch seine Haut war bereits ledern und sein Gesicht hatte die harten Züge eines Erwachsenen. Hazel nahm an, dass er seit seinem zehnten Lebensjahr in den Docks von Leith arbeitete.
»Martin, richtig? Ich bin Hazel. Dr.Sinnett. Miss Sinnett«, stellte sie sich vor. »Und ich werde dir, so gut ich kann, helfen.«
Martin antwortete mit einem so kleinen Nicken, dass es vielleicht auch bloß ein Schaudern war.
Der Lärm lachender und herumtollender Kinder im oberen Geschoss unterbrach die angespannte, nervöse Stille. Martin nahm den Lederstreifen aus dem Mund. »Meine Geschwister«, erklärte er fast entschuldigend. »Wir sind zu acht, ich bin der Älteste. Rose kennen Sie ja schon. Sie hat Sie hergeholt. Jemand hatte ihr von einer Lady erzählt, die für ihre Doktordienste nicht viel verlangt.«
»Acht Geschwister! Eure arme Mutter«, entfuhr es Hazel. »Wir sind nur zu dritt. Ich und meine beiden Brüder.«
Hazel wurde bewusst, was sie da sagte, noch ehe sie die Worte ganz ausgesprochen hatte. Sie waren zu dritt gewesen: George, Hazel und der kleine Percy. George, der Goldjunge, sportlich und stark, intelligenter als Hazel und wahrlich liebenswürdig; Hazel, die sich immer wieder etwas Neues einfallen ließ, wofür ihre Mutter sie kritisieren konnte; und Percy, der verzogene kleine Prinz, der im Grunde zum Schoßhund ihrer Mutter geworden war.
Aber sie waren nicht zu dritt. Nicht mehr. George war vor ein paar Jahren gestorben, als in der Stadt das Römische Fieber grassierte, einer von Tausenden, die umkamen, bevor man überhaupt verstanden hatte, um welche Art von Krankheit es sich handelte. Er war so jung, so stark, so gesund gewesen, dass sich Hazel, selbst als er erkrankte, mehr Gedanken darüber gemacht hatte, ob er noch am selben Wochenende wieder genug bei Kräften wäre, um mit ihr draußen im Garten kegeln zu spielen, oder ob sie darauf noch eine Woche würde warten müssen. Doch dann hatte ihn die Krankheit so schnell, wie sie gekommen war, dahingerafft und Hazel war eines Morgens zu dem heftigen Schluchzen ihrer Mutter erwacht. George war tot.
Früher hatte es ihr bei dem Gedanken an George jedes Mal die Kehle zugeschnürt. Dann hatte sie sich wegdrehen und tief durchatmen müssen, um die Tränen zu unterdrücken, die ihr in den Augen stachen. Aber in den letzten Jahren war ihre Erinnerung zu einer Narbe geworden, die immer wieder neu verheilt war, bis sie glänzte, sich glatt anfühlte und kaum mehr wehtat. Ein beständiger, wenn auch nur noch dumpfer Schmerz. Jacks Tod hingegen war weiterhin eine offene Wunde. Doch sie konnte jetzt nicht an Jack denken. Nicht, während sie arbeitete.
»Bist du bereit?«, fragte Hazel. Martins geschwollener und schiefer Arm war Ablenkung genug.
In Gedanken blätterte Hazel durch die Seiten der Bücher, die sie auswendig gelernt hatte und in denen die richtige Stellung des Armknochens sowie der Bänder beschrieben war, die ihn mit dem Muskel verbanden. Hazel hob das Skalpell an. »Bereit? Los geht’s.«
Die Klinge drang knapp unterhalb des Ellbogens ein. Sogleich sickerte eine dünne gelbe Flüssigkeit aus der Wunde – die Entzündung, die dafür gesorgt hatte, dass Martins Arm angeschwollen und heiß geworden war. Martin zuckte zusammen.
Der Eiter floss weiter heraus – literweise, so hatte es den Anschein –, ohne dass Hazel noch mehr tun musste. »Ich werde ein Stück Stoff brauchen. Habt ihr irgendeinen Lappen, den ich benutzen könnte?«
Kaum hatte Hazel die Frage gestellt, waren auch schon laute Schritte treppab zu hören. Zwei junge Mädchen mit völlig verfilzten dunkelbraunen Locken stürmten auf Hazel zu, beide je einen spülwassergrauen Lappen in der Hand. Sie waren offenbar Zwillinge, nicht älter als acht.
»Ich hab einen«, sagte eines der Mädchen und hielt Hazel ihren Lappen hin.
Ihre Schwester rammte ihr fest den Ellbogen in die Rippen.
»Nein, ich hab einen!«
Hazel nahm dankbar beide Lappen entgegen und benutzte sie sogleich, um die Flüssigkeit aufzusaugen, die weiterhin aus der Schnittwunde sickerte. »Danke, Mädchen.« Dann fragte sie: »Ist das euer Bruder?« Die Zwillinge nickten eifrig, während sie dastanden und mit kleinen, offenen Mündern fasziniert auf den gebrochenen Arm ihres älteren Bruders starrten, unfähig, den Blick davon loszureißen. Martin bemerkte es und nahm mit seiner guten Hand das Stück Leder aus dem Mund.
»Sue, May, verschwindet von hier. Ich hab euch doch gesagt, dass ihr oben bleiben sollt, schon vergessen?«
Die Mädchen taten so, als könnten sie ihn nicht hören. Eines von ihnen – Sue, vielleicht – streckte einen Zeigefinger aus, um die Verletzung ihres Bruders zu betatschen.
Hazel schlug ihr die Hand weg, bevor sie die Wunde berühren konnte. »Euer Bruder hat recht. Ihr müsst wieder nach oben gehen, wenn ihr wollt, dass es Martin bald besser geht.«
Die Mädchen kicherten, rührten sich aber nicht vom Fleck. Der Anblick des gelben Eiters, dessen Ausfluss ein wenig nachgelassen hatte, doch inzwischen zu grünlichen Klumpen verdickt war, schien sie nicht zu schrecken. Hazel beschloss, es mit einer anderen Strategie zu versuchen. »Mädchen«, sagte sie, während sie in ihrer Tasche kramte und ein paar Münzen herausholte. »Könntet ihr losgehen und eine Orange für euren Bruder besorgen? Damit Martin wieder gesund wird, ist es äußerst wichtig, dass er eine Orange isst. Könnt ihr das für mich tun?«
So fasziniert die Mädchen auch von der Operation gewesen waren, die Münzen beeindruckten sie offensichtlich noch mehr. Sie schnappten sich sofort das Geld, als rechneten sie damit, Hazels Hand könnte sich jeden Moment schließen, und schon stürmten sie aus der Tür, um ihre Aufgabe zu erfüllen, ehe die junge Ärztin noch ihre Meinung änderte.
Im Raum kehrte wieder Ruhe ein. Hazel drückte den Rest der eitrigen Flüssigkeit aus der Wunde und reinigte sie mit Wasser und dem Alkohol aus einer kleinen Flasche, die sie aus der Sammlung ihres Vaters stibitzt hatte. »Na schön«, meinte Hazel. »Jetzt nähen wir die Wunde wieder zu.«
Eine junge Frau, die als Chirurgin arbeitete, musste zwar mit vielen Hindernissen kämpfen, doch es gab auch einen Vorteil: Sie hatte einen Großteil ihrer Kindheit mit Sticken verbracht und damit, die ordentlichen, sauberen Stiche zu perfektionieren, die eines Tages – so hatte es die Mutter versichert – schöne Geschenke für die zukünftige Schwiegermutter ergeben würden. Daher war Hazel mittlerweile eine regelrechte Koryphäe im Nähen von Wunden.
Ihr älterer Bruder hatte Unterricht in Latein, Geschichte und Mathematik erhalten. Bei naturwissenschaftlichen Fächern war Hazel gezwungen gewesen, heimlich an Türen zu lauschen und mit geborgten Übungsbüchern zu lernen, die George an sie weiterreichte. Hazels eigene Erziehung hingegen hatte aus Geigen- und Klavierunterricht bestanden. Französisch und Italienisch waren auch dabei gewesen. Und während sich der Wintergarten mit der reglosen und drückenden Hitze des späten Nachmittags füllte, hatte sie stundenlang dasitzen und sticken müssen.
Später, als sie sich in den Kleidern ihres Bruders und unter falschem Namen in die Vorlesungen der Anatomists’ Society geschlichen und sich als Junge ausgegeben hatte, war sie in ausnahmslos allen Fächern Klassenbeste gewesen. Dennoch waren es ihre Stiche, bei denen selbst der bekanntlich strenge und ungerührte Dr.Straine ihr Können hatte anerkennen müssen.
»Na ja!«, hatte einer der Jungen in der Klasse gespottet, nachdem Dr.Straine eingeräumt hatte, dass Hazels Arbeit an dem ihr zugeteilten toten Kaninchen tadellos war. »Hazelton hat winzige Hände wie ein Mädchen! Ich würde viel lieber schlechter nähen und dafür größere Hände haben, wenn ihr wisst, was ich meine.« Der Rest der Klasse hatte gelacht, bis Dr.Straine sie alle mit einem vernichtenden Blick zum Schweigen brachte. Und auch Hazel hatte ihr Kichern unterdrückt.
Der Arm des Jungen war in Sekundenschnelle geschlossen und die Naht ordentlich und gleichmäßig. Hazel musste über ihre eigene Arbeit lächeln. Vermutlich würde nicht einmal eine Narbe zurückbleiben. Martin spuckte das Stück Leder aus. »Sind Sie fertig?«, fragte er. »Sie haben’s hingekriegt, ja? Mit mir ist jetzt alles in Ordnung?«
»Nicht ganz.«
Er sah auf seinen Arm hinunter. »Aber ich bin doch wieder zugenäht!«
»Dein Arm war kompliziert gebrochen«, erwiderte Hazel und hob vorsichtig den Ellbogen des Jungen an. »An mehreren Stellen, so wie es sich anfühlt. Wenn wir ihn jetzt nicht richten, wirst du ihn vielleicht nie wieder benutzen können. Oder er wird amputiert werden müssen.«
Martin kniff die Augen zusammen. »Dann machen Sie schon.« Hazel stemmte sich gegen den Tisch und packte seinen Arm. Um den Knochen erneut brechen zu können, musste sie sich im richtigen Winkel positionieren. Hazel holte tief Luft und atmete scharf aus, während sie zog und mit aller Kraft starken Druck auf den Knochen ausübte.
Das Knacken hallte durch den kleinen Raum.
Noch ehe ihr Patient aufschreien konnte, brachte Hazel den Arm wieder in die richtige Stellung, wo er korrekt heilen konnte. Sowohl Hazels als auch Martins Stirn waren schweißgebadet. Das Haar des Jungen hing ihm nass über den Ohren und in beiden Achseln breitete sich ein feuchter Fleck aus.
»Das war’s«, sagte Hazel. Sie wischte das Skalpell an ihrer Schürze ab und steckte es zurück in ihre Tasche, bevor sie sich daranmachte, Martins Arm zu schienen. »Aber du darfst den Arm mindestens eine Woche lang nicht bewegen. Wechsle den Verband über der Naht, wenn es gelblich durchsickert, aber nicht vorher, und sag deiner Mutter, dass du mindestens einen Monat lang unter keinen Umständen zur Werft gehen kannst. Du könntest ohnehin keine der Arbeiten dort verrichten.«
Martin ließ den Arm vorsichtig kreisen, um zu prüfen, wie fest der Verband war. »Hab keine Mutter«, antwortete er, während er weiter seinen Arm betrachtete.
»Was willst du damit sagen? Alle deine Schwestern, die Mädchen?«
»Mum ist bei der Geburt der Zwillinge gestorben. Is’ ’n Wunder, dass sie’s überhaupt gesund rausgeschafft haben. Als sie gekommen sind, wollte ich eine Hebamme holen, aber Mum meinte, sie hätt das schon ’n halbes Dutzend Mal gemacht und wüsste, was sie tun müsste. Außerdem …«, fügte er hinzu, »… hätten wir uns eh keinen teuren Doktor leisten können.« Er sah Hazel mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Misstrauen an. »Deshalb kümmere ich mich jetzt um uns. Um uns alle. Ich kann eine Woche lang von der Arbeit fernbleiben, länger nicht.«
In dem Moment erschienen Martins Zwillingsschwestern wieder in der Tür. Eine von ihnen hielt eine winzige, kreisrunde Orange in der Hand, die sie für einen Penny an einem der Stände entlang der High Street gekauft hatten. »Wir haben sie«, bekundete sie. »Wir haben die Orange. Äußerst wichtig.«
»Äußerst wichtig«, wiederholte ihre Schwester.
»Ja«, sagte Hazel. »Könntet ihr eurem Bruder und mir einen großen Gefallen tun und sie für uns schälen?«
Die Mädchen machten sich eifrig an die Arbeit und bohrten ihre winzigen Fingernägel in die Haut der Orange. Das Innere der Frucht kam ein wenig schief zum Vorschein und Saft tropfte aus der zerrupften Schale, doch eins der Mädchen hob sie hoch und hielt sie Hazel wie einen kostbaren Juwel hin.
»So, jetzt kommt der schwierigste Teil«, erklärte Hazel. »Ihr werdet die Orange gerecht aufteilen und eurem Bruder helfen müssen, sein Drittel zu essen, ohne dass er seine Hände benutzt. Wisst ihr, was Drittel sind? Genug für euch drei.«
Als Antwort machten sich die Mädchen ans Werk und schließlich steckte eine von ihnen ein Stück der Frucht in Martins dankbar geöffneten Mund.
»Weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal eine Orange hatten«, meinte der Junge und ein wenig Saft lief aus seinem Mundwinkel übers Kinn.
»Nun, gutes Essen wird dir helfen, gesund zu werden«, sagte Hazel. »Dafür ist das hier.« Sie zeigte auf einen kleinen Stapel Münzen, den sie auf den Tisch gelegt hatte. »Damit du dich mindestens eine Woche lang ausruhen kannst.«
Martin verzog das Gesicht und machte Anstalten, die Münzen wegzuschieben, doch kaum hatte er den Arm um nur wenige Zentimeter angehoben, zuckte er vor Schmerz zusammen und nahm ihn wieder herunter. »Ich brauch keine Wohltätigkeit«, murrte er, die Stimme plötzlich kälter und Furcht einflößender als noch vor ein paar Augenblicken, als Hazel ihm eine Klinge an die Haut gehalten hatte.
»Das ist keine Wohltätigkeit«, erwiderte Hazel. »Das ist Teil der Behandlung. Was hätte es sonst für einen Sinn gehabt, dass ich hierherkomme und deinen Arm richte, wenn du das morgen alles wieder mit einem Tag Arbeit auf den Docks zunichtemachst?«
Martin biss die Zähne zusammen. Seine Schwestern standen in der Ecke des Zimmers, klebrig von dem Orangensaft, teilten sich die Fruchtstücke und saugten an der Schale. »Dafür danke ich Ihnen nicht«, sagte er schließlich und zeigte mit dem Kopf auf das Geld. »Aber danke, dass Sie meinen Arm gerichtet haben.«
»Gern geschehen«, antwortete Hazel schlicht. Sie nahm ihre lederne schwarze Doktortasche und nickte erst Martin und anschließend seinen Schwestern leicht zu. »Meine Damen«, sagte sie. Dann verließ Hazel Sinnett die Wohnung, trat wieder auf die Straßen von Crichton’s Close und marschierte mit der aufgehenden Sonne im Rücken schnellen Schrittes in Richtung ihres nächsten Hausbesuchs. Sie musste noch einen weiteren Knochen richten, zwei Zähne ziehen und einen Fall von Syphilis behandeln. Und MrsBedes Baby würde auch schon bald auf die Welt kommen. Sie hatte viel zu tun.
Aus den Notizen von Hazel Sinnett zu:Eine Abhandlung über moderne Medizin (unveröffentlicht):
Obwohl die Geschwindigkeit, mit der das Römische Fieber erkrankte Menschen dahinrafft, von Patient zu Patient variiert, sind die Symptome immer gleich – was wohl beruhigend ist. Zuerst vermelden die Erkrankten eine mehrere Tage währende Müdigkeit, trotz derer sie nicht schlafen können, sowie Fiebrigkeit. Alsdann erscheinen Pusteln (Bubonen) auf dem Körper, typischerweise auf dem Rücken, den Oberarmen und den Beinen.
Die Bubonen füllen sich mit Blut, werden rötlich violett und platzen schließlich. Entgegen der landläufigen Meinung erhielt das Römische Fieber seinen Namen nicht, weil es seinen Ursprung in Italien hat (die frühesten Fälle wurden in London und Bayern identifiziert). Vielmehr beruht der Name darauf, dass nach dem Aufplatzen der Bubonen die Blutspritzer auf den Hemden der Patienten an die zahlreichen Stichwunden erinnern, die Julius Cäsar erlitt, als er auf den Stufen des römischen Senats erstochen wurde.
Wenngleich noch kein Heilmittel und auch keine Präventionsmaßnahmen gefunden wurden, hat sich in meiner Praxis gezeigt, dass Krautblumenwurzel die Symptome lindern und den Tod abwenden kann. Ich habe Krautblumenwurzel sowohl als Salbe aufgetragen wie auch als Tee verabreicht und werde über die wirksamere Anwendungsmethode berichten. Ebenso werde ich mich mithilfe einschlägiger Literatur darüber kundig machen, ob sich eine Erkrankung am Römischen Fieber durch eine Impfung verhindern ließe. (Ich bin mir dessen noch nicht sicher genug, um es an Patienten oder an mir selbst zu testen.)
Krautwurzeltee: mehrere Stängel der Krautwurzelpflanze trocknen und zermahlen, dann in heißem Wasser mit Honig und Zitrone ziehen lassen. Für die Salbe: das trockene Kraut zermahlen und Öl und heißes Kerzenwachs hinzufügen.
Zusätzliche Behandlung bei Römischem Fieber: am Abend Kardamom-Samen und warme Milch zur Stärkung verabreichen.
2
Hazel Sinnett träumte von Fingern. Hageren, spindeldürren Fingern mit Knöcheln so knubbelig wie Walnüsse und graugrünem Fleisch, das sich in dünnen Streifen von ihnen abschälte. Manchmal waren die Finger gar nicht Teil einer Hand, sondern lebendige Wesen, die auf einem flachen Tisch wie Insektenbeine zuckten. Manchmal erschienen ihr in ihren Träumen Dr.Beechams Finger, so wie sie in der Anatomists’ Society ausgesehen hatten, als der berühmte Chirurg seine Lederhandschuhe ausgezogen hatte, um ihr zu zeigen, was sich darunter wirklich verbarg: geschwollene, an seiner Hand festgenähte Finger, von denen manche schwarzviolett waren.
Finger, die abgefallen und wieder neu befestigt worden waren. Ein kleiner Finger, der so aussah, als wäre er nie seiner gewesen.
Nein. Sie erwachte nie keuchend oder schreiend und mit an die schweißgebadete Stirn geklatschten Haaren aus ihren Träumen. Sie spürte nie ihr Herz rasen. Sie redete oder rief nie im Schlaf. Ihre Kammerzofe Iona musste nie mit einem kühlen Tuch oder einer beruhigenden Tasse Tee herbeieilen. Hazels Albträume jagten ihr keine Angst mehr ein.
Eines Nachts hatte sie von einem einzelnen Zeigefinger geträumt, an dessen Gelenken der Knochen durchschien und der wie eine Raupe auf sie zukroch, während noch das Blut von ihm tropfte. Als sie aufwachte, überlegte Hazel, welche Stiche sie wohl ausgewählt hätte, um ihn wieder an eine Hand zu befestigen.
Sie hatte schlichtweg keine Zeit mehr dafür, sich zu fürchten oder sich vor Blut oder Verwesung zu ekeln: Als Chirurgin zu arbeiten, bedeutete, dass jede Sekunde wichtiger war als die vorherige. Ein bloßer Augenblick, der kurze Moment, in dem sie zurückschreckte oder ein Keuchen unterdrückte, könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Sie hatte zu arbeiten. Und in den vergangenen Monaten war sie äußerst beschäftigt gewesen.
»Vorsicht!«
Hazel rettete den Teller mit ihrem Frühstückstoast vom Tisch, ehe Iona ihn mit ihrem Bauch auf den Boden fegen konnte. Obwohl die Kammerzofe schon im fünften Monat schwanger war – Hazel unterzog sie regelmäßigen Untersuchungen und Beratungsgesprächen –, schien sie sich nicht bewusst zu sein, welchen Schaden sie anrichten konnte, wenn sie sich durch beengte Räume bewegte.
»Mhm?«, fragte Iona, während sie herumwirbelte und einen leeren Teller zu Boden beförderte. Zum Glück drehte er sich nur wie ein Kreisel um sich selbst und blieb dann unversehrt liegen.
»Nein, nein, ich kümmere mich darum!«, rief Hazel, als sie sah, wie Iona Anstalten machte, sich zu bücken und ihn aufzuheben.
»Dieser vermaledeite Bauch«, schimpfte Iona und rieb ihn gedankenverloren. »Schon so groß wie eine Hammelschulter. Und wenn ich mir vorstelle, dass er noch größer wird. Wie viele Monate, haben Sie gesagt, sind es jetzt noch?«
»Vier«, antwortete Hazel. »Und ich möchte nicht, dass du noch viel länger auf Hawthornden arbeitest, hast du mich gehört? Du musst schon bald Bettruhe wahren, vor allem, wenn der kleine Liebling in derselben Geschwindigkeit wie bisher weiterwächst. Und da ich dieses Kind auf die Welt bringen werde, tust du, was ich dir sage.«
»Charles sagt, dass alle Säuglinge in seiner Familie kräftig sind. Kommen mit vollem Haar und vollständigem Gebiss auf die Welt«, erklärte Iona und pflanzte sich laut stöhnend auf den Stuhl neben Hazel.
»Gott, steh uns bei«, murmelte Hazel.
»Und«, fügte Iona hinzu, »ich arbeite so lange im Haus, wie es mir gefällt, Miss.« Sie hatte das Kind noch nicht einmal geboren und redete bereits mit Hazel, als wäre sie schon Mutter. Dabei waren sie beinahe gleich alt. »Wer soll sonst dafür sorgen, dass Sie etwas essen, wenn Sie bis spät in die Nacht arbeiten?«
Hazel verzog das Gesicht. »Das mache ich nur, bis ich mit meiner Abhandlung fertig bin. Danach werde ich mich an normale Arbeitszeiten halten.«
»Oh ja, Ihre Abhandlung.« Iona verdrehte die Augen und biss in ein Stück Toast. In den vergangenen Monaten hatte Hazel über fast nichts anderes geredet: über ihr hochgestecktes Ziel, ein neuartiges, von ihr selbst bebildertes Handbuch über Anatomie und einfache Hausmittel zu verfassen.
Es sollte ein im Stil eines Haushaltshandbuches geschriebener Ratgeber werden – die Art Buch, die jeder mit der Fähigkeit zu lesen verstehen würde, mit Zeichnungen des menschlichen Körpers und seiner Bestandteile sowie mit hilfreichen Ratschlägen zu häuslichen Behandlungen. Dr.Beechams Abhandlung über die Anatomie oder: Vorbeugung und Heilung moderner Krankheiten war natürlich ein Meisterwerk, ein Lebenswerk (oder das Werk mehrerer Leben, wie sich Hazel ins Gedächtnis rief), nur war es leider ein so dicker Wälzer, dass es einen Mann erschlagen könnte, wenn es von einem hohen Regal fiel. Zudem war es nahezu unzugänglich für jeden ohne ein spezielles Interesse für Physiologie. Hazels Buch würde anders sein. Es würde sich an die Handbücher über gesellschaftliche Etikette und das Führen eines gastlichen Hauses anlehnen – kurz: an jene Bücher, die wie von Zauberhand im Wohnzimmer einer jungen Frau erschienen, sobald sie das fünfzehnte Lebensjahr erreichte.
Einfache Leute haben Körper, war Hazels Überlegung. Es gibt keinen Grund, warum sie nicht verstehen sollten, wie diese Körper funktionieren. Und so viele Menschen können sich keinen Arzt leisten und die Ärzte, die sie sich leisten können, sind entweder Scharlatane oder schlecht ausgebildet. Für Hazel war es völlig offensichtlich, dass ein einfacher Ratgeber mit wirksamen Hausmitteln Leben retten könnte.
Das Problem war natürlich, dass Hazel, so nobel ihre Absichten auch waren, unbeabsichtigt ein gewaltiges Unterfangen begonnen hatte. Ein ausführliches Buch zu schreiben, das verbreitete Beschwerden und deren Behandlung beschrieb, könnte Jahre in Anspruch nehmen. Und damit nicht genug: Hazel wollte auch noch detaillierte Schaubilder und Beschreibungen der wichtigsten Apparate und Organe des Körpers einfügen. Die Zeichnungen der Organe in Beechams Buch waren so ordentlich wie Schnittmuster. Hazel war schockiert gewesen, als sie zum ersten Mal in einen geöffneten Körper geblickt und gesehen hatte, was sich wirklich unter der Haut verbarg: eine feuchte dunkle und blutende Masse Fleisch. Zu wissen, dass Menschen nicht mehr als das waren, dass die Seele irgendwo in diesem übel riechenden, unübersichtlichen Brei steckte, war furchterregend. Doch es musste nicht furchterregend sein. Es ließ sich erklären und Hazel könnte diejenige sein, die genau das mit Bildern und Diagrammen und in der Alltagssprache der einfachen Menschen tat.
Seit Jacks Prozess und Hinrichtung durch den Strick war es für Medizinstudenten nahezu unmöglich geworden, an frische Leichen heranzukommen. Hazel musste mit alten Notizen und Zeichnungen arbeiten, die sie angefertigt hatte, als sie für die königliche Arztprüfung gelernt hatte. Natürlich hatte sie diese letztendlich gar nicht abgelegt. Stattdessen war sie Dr.Beecham in seinen Operationssaal gefolgt und hatte ihn dabei beobachtet, wie er das Auge eines lebenden Patienten in einen anderen Mann »verpflanzt« und dann versucht hatte, Jack Currers schlagendes Herz aus seinem Körper zu entnehmen. Zwar hatte sie den Doktor aufgehalten, doch das hatte nicht gereicht. Sie hatte nicht genug getan, um Jacks Leben zu retten. Jack war nicht mehr da.
Allein der Gedanke an ihn durchfuhr Hazel wie ein elektrischer Schock, als hätte sie etwas Metallisches und Lebendiges verschluckt. Er fehlte ihr so sehr, dass sie es tief in ihrem Innern spüren konnte, ein hungriges Verlangen in jeder ihrer Fasern. Sie vermisste das Gefühl seiner Arme um ihren Körper, seinen Geruch, die Art, wie sein Dreitagebart über ihre Haut strich, wenn er sie auf die Stirn küsste, und sie wollte ihn für immer ganz fest an sich drücken. Jack war nicht mehr da. Er war nicht mehr da und wozu sollte es gut sein, an ihn zu denken? Er war ein Loch in ihrem Bauch, ein Verlangen, das sie nicht stillen konnte, aber dessen flammende Hitze abzustumpfen schien, wenn sie arbeitete und sich auf die anstehenden Aufgaben konzentrierte:
Ihre Aufzeichnungen zusammentragen, durchgehen und in einer lesbaren Handschrift ins Reine schreiben. Die Lücken in ihrer Forschung identifizieren. Kleinschrittig und systematisch den Kreislauf darstellen, der das Blut durch alle Gliedmaßen befördert. Zeichnungen der Arme, Beine, Hände und Füße anfertigen. In den langen, ausgedehnten Stunden, nachdem Iona Hazel das Abendessen gebracht hatte und ehe sie mit dem Frühstückstablett an die Tür des Laboratoriums klopfte – wenn Hazel im Kerzenschein hochkonzentriert die Blutgefäße der Hand nachzeichnete, die sie extra aus Paris hatte kommen lassen –, hatte Hazel fast das Gefühl, Jack könnte hier sein. Draußen bei einem Ausritt oder drüben im Schloss, wo er noch schlief, in Sicherheit und nah genug, dass sie ihn rufen konnte.
Dann verwandelte sich das Verlangen, das Hazels Welt zu verzehren drohte, von einem lodernden Feuer in eine kleine Flamme, eine flackernde Kerze, die sie nur noch aus den Augenwinkeln sehen konnte. Du kannst zwar nicht mit ihm reden, aber er ist da, wenn du ihn brauchst, sagte die Kerze. Er ist nicht weit, noch in Hörweite. Nur so ertrug sie Jacks Verlust: Indem sie so tat, als hätte sie ihn gar nicht verloren, als könnte sie jeden Moment auf das Hauptgebäude zumarschieren, wo er sie beim Tee mit seinen überstehenden Eckzähnen und seinem zerzausten Haar, in dem stets ein wenig Sägespäne hingen, anlächeln würde. Die Erinnerung an Jack in etwas zu verwandeln, worum sie sich nicht mehr zu sorgen brauchte – das war der Trick, der ihr bloß dann gelang, wenn sie sich gänzlich auf das Schreiben ihres Buches konzentrierte.
Ihre Arbeit war zu wichtig, als dass sie sich davon ablenken lassen durfte. Sie wusste, dass es die Wahrheit war, und wenn sie es sich nur oft genug vorsagte, würde sie es vielleicht eines Tages sogar glauben.
Während des Frühstücks blätterte Hazel in einer Zeitung und rieb die Tinte zwischen ihren Fingern. Dabei dachte sie darüber nach, wie teuer die Materialien und die Druckpresse wohl wären, die es ihr eines Tages ermöglichen würden, ihr eigenes Buch zu veröffentlichen. Die Tinte färbte ihre Fingerspitzen schwarz. Es war eine willkommene Abwechslung von dem rötlichen Kastanienbraun des getrockneten Blutes, mit dem sie für gewöhnlich überzogen waren.
Iona schnappte nach Luft und Hazel sprang auf die Füße. »Was hast du? Stimmt etwas mit dem Baby nicht? Spürst du irgendwelche Krämpfe oder Schmerzen?«
Iona starrte auf die Zeitung und zeigte auf ein Bild auf der Titelseite. »Ist das die Prinzessin? Ja, das ist sie! Es ist Charlotte! Was steht da, Miss?«
Hazel ließ sich wieder auf ihren Stuhl sinken und zog die Seite näher zu sich heran. Iona konnte zwar lesen, doch nur sehr langsam und mühevoll, und Hazel hatte es schon lange aufgegeben, ihr damit in den Ohren zu liegen, dass sie mehr üben müsse. (»Ihr vornehmen Damen habt vielleicht Zeit, den ganzen Tag lang eure Romane zu lesen, aber gemeine Leute haben zu tun«, hatte sie einmal verächtlich erwidert.) Romane interessierten Iona nicht, Klatsch und Tratsch über die Prinzessin von Wales, die zukünftige Königin von England und das einzige Kind des Prinzregenten, hingegen schon. »Hier steht«, sagte Hazel mit noch pochendem Herzen von ihrem Schrecken, »dass Prinzessin Charlotte beschlossen hat, ihre Verlobung mit Wilhelm von Oranien aufzulösen.«
Iona blickte untröstlich. »Ach nein!«, rief sie aus. »Sie waren doch so ein hübsches Paar! Und jünger wird sie auch nicht. Wenn sie nicht bald ein Kind bekommt, wer weiß, ob sie dann überhaupt je eines haben kann.«
»Sie ist nicht viel älter als wir! So um die, na ja, einundzwanzig? Sie hat noch eine Menge Zeit, Iona.«
Die Zofe rieb sich vielsagend über den Bauch. »Weniger Zeit, als Sie glauben, Miss. Steht da irgendwo, warum? War er ein Schürzenjäger? Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wetten, ihr ist jemand anderes ins Auge gefallen? Der Herzog von Gloucester, wenn Sie mich fragen.«
Hazel musste unwillkürlich lachen. »Ich weiß es nicht. Darüber steht hier nichts. Es muss wohl etwas mit ihrer Krankheit zu tun haben. Vielleicht ging es ihr nicht gut genug, um nach Holland zu reisen. Warum kümmert dich das überhaupt? Als gutes schottisches Mädchen habe ich dich den Namen des Königs und des Prinzen mehr als einmal verfluchen hören, wenn du dachtest, es würde niemand mitbekommen.«
Iona wurde rot, doch ihre Miene blieb unverändert. »Ja«, gab sie überheblich zurück. »Aber nur weil ich den König und England wegen allem, was sie uns angetan haben, verachte, heißt das nicht, dass ich die Prinzessin nicht mögen kann.«
»Wenn du meinst.«
Jeder schien von der Prinzessin angetan zu sein, nicht nur Iona. All die Frustration und der Unmut über die Monarchie, all das Mitleid und die Abscheu, die die Leute für den armen, wahnsinnigen König George empfanden, und die unverhohlene Abneigung gegen den geckenhaften Prinzregenten lösten sich in Wohlgefallen auf, wenn es um Prinzessin Charlotte ging.
»Sie haben sie schon einmal getroffen, nicht wahr?«, fragte Iona. Es war eine Aufforderung, eine kleine Anekdote zu erzählen, die Hazel schon des Öfteren zum Besten gegeben hatte, doch von der Iona offenbar nicht genug bekommen konnte.
»Ja«, sagte Hazel. »Es war eine sehr kurze Begegnung, als ich in London war. Noch vor Georges Tod. Das letzte Mal, als meine Mutter mich mitnahm, um neue Kleider zu kaufen. Ich war noch nicht offiziell in die Gesellschaft eingeführt und besuchte daher keine Bälle oder Anlässe dieser Art. Aber Mercer Elphinstone – ein Mädchen aus Edinburgh, mit dem ich ein wenig Zeit verbracht hatte – war mit der Prinzessin befreundet. Sie gab einen Nachmittagstee und dort traf ich die Prinzessin.«
»Und?«, drängte Iona, genau wie zu erwarten gewesen war, mit weit aufgerissenen Augen.
»Und«, fuhr Hazel fort, »ich erinnere mich noch daran, dass sie sehr schön, sehr elegant und sehr freundlich war. Sie trug hoch taillierte Kleider, bevor es irgendjemand sonst wagte, und sah fantastisch aus. Und, ob du es glaubst oder nicht, sie trug Unterhosen. Ich erinnere mich noch, dass ich die Spitzen unter ihrem Kleid hervorblitzen sah. Ein Skandal! Später sagte Mutter mir, die Prinzessin hätte die falsche Gabel für den Salat benutzt, und ich fand das so lustig, dass ich den ganzen Weg bis nach Edinburgh nicht mehr aufhören konnte zu lachen. Darüber, dass es überhaupt so etwas wie eine richtige Gabel für Salat gab, dass die Prinzessin die falsche benutzt hatte und dass es jemandem wie meiner Mutter auffallen würde.«
»Und doch«, sagte Iona schlau, »tragen Sie mir immer auf, den Tisch mit den richtigen Gabeln zu decken, Miss, und wissen immer, welche Sie benutzen müssen.«
»Nun ja«, erwiderte Hazel und tupfte sich mit ihrem Taschentuch die Lippen ab, »manche Dinge werden wohl irgendwann zur Gewohnheit.« Es stimmte. Die Lektionen, die ihre Mutter ihr als Kind durch stundenlange Wiederholung eingebläut hatte, wirkten weiterhin nach. Doch nach Georges Tod war der Benimmunterricht der Mutter zu einem jähen Ende gekommen – eine tiefe Schwermut hatte Lady Sinnett befallen, sie verließ ihr Zimmer nur noch selten, und selbst wenn, so redete sie kaum mehr als einen Satz mit ihrer Tochter. Seitdem hatte Hazel sich selbst erzogen, sich in Sachen gekleidet, die ihr zufällig in die Hände fielen oder die sie sich auf eigene Faust schneidern ließ, und sich mit den Büchern aus der Bibliothek ihres Vaters gebildet. Daher waren ihre Manieren unausgereift und etwas seltsam. Wenngleich sie größtenteils wusste, wie sich ein Mädchen ihres gesellschaftlichen Ranges zu benehmen hatte, musste sie immer wieder feststellen, dass sich in den Jahren, die sie so gut wie allein verbracht hatte, einige Regeln geändert hatten.
Dennoch wählte sie an diesem Morgen das richtige Reitgewand und den dazu passenden Hut aus, um einen Hausbesuch in einem der eleganten weißen Steingebäude in Edinburghs New Town abzustatten. Manche Dinge, so vermutete sie, ließen sich nun einmal nicht ändern.
Es war nur ein kurzer Ritt, und noch ehe die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hatte, trottete Hazel über die Steinstraßen von New Town. Vor knapp einem Jahrhundert hatten die Wohlhabenden genug von den engen Gassen und dem Gestank der überfüllten Innenstadt im Schatten von Edinburgh Castle gehabt. Und so war eine zweite Stadt, New Town, mit ordentlich gepflegten öffentlichen Plätzen und Reihen von makellos weißen Stadthäusern mit neoklassizistischen Säulen aus dem Boden geschossen. Die beiden Edinburghs wurden von den Princes Street Gardens getrennt. Wo einst ein Meeresarm gewesen war, in dem sich Abwässer und Abfälle aller Art sammelten, befanden sich nunmehr elegante Rasenflächen und ein Park, in dem nur diejenigen wandeln durften, die eine hohe jährliche Gebühr zahlten – wenngleich zurzeit die Rede davon war, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hazel gefiel die Idee, und zwar nicht nur, weil sie wusste, wie sehr sich ihre Mutter darüber empören würde.
Als Hazel angefangen hatte, Hausbesuche zu machen, hatte sie zunächst überwiegend die armen Arbeiterfamilien von Edinburgh aufgesucht. Solche, die sich niemals einen Privatarzt würden leisten können und eine so schreckliche Angst davor hatten, in einem der entsetzlichen Armenkrankenhäuser zu landen, dass sie bereitwillig die Hilfe einer jungen Chirurgin in Anspruch nahmen, über die sie nur Gerüchte gehört hatten. In den letzten Monaten war sie jedoch immer häufiger auch nach New Town geritten.
Nachdem Hazel die Wahrheit über Dr.Beechams Arztpraxis in Edinburgh erfahren hatte – dass er seinen Lebensunterhalt damit verdiente, Auferstehungsmänner, Bettler und Kinder zu entführen, um Körperteile für seine reichen Klienten zu stehlen –, war er aus der Stadt verschwunden. Diejenigen, die die Wahrheit nicht kannten – und außer Hazel und Jack kannte sie niemand –, setzten in Windeseile immer neue Gerüchte in die Welt: Er habe sich in eine Frau in Schweden verliebt. Er sei nach Russland berufen worden, um den Zar Alexander zu behandeln. Er sei auf einer Schiffsreise nach Indien gestorben.
Hazel hingegen kannte die Wahrheit: Wenn Beecham tatsächlich unsterblich war, wie er behauptete, konnte er nur eine gewisse Zeit lang an ein und demselben Ort bleiben, ohne dass sein stets gleichbleibendes Äußeres Fragen aufwarf. In jeder Generation musste er mindestens einmal untertauchen, um dann mit einem neuen Namen wieder auf der Bildfläche zu erscheinen, oder, wenn es lang genug zurücklag, mit einer Geschichte, er wäre ein entfernter Verwandter eines früheren Beecham, in der Hoffnung, dass noch lebende Zeitgenossen nur eine flüchtige Ähnlichkeit mit dem Arzt auffiel, den sie einst gekannt hatten.
Niemand konnte sagen, wo er war. Er hätte überall auf der Welt sein können. Ihn zu finden, würde unmöglich sein. Ihn zu zwingen, sich der Justiz zu stellen, damit er wenigstens dem Anschein nach für alle seine Morde zur Rechenschaft gezogen werden konnte, erst recht. Monatelang hatte Hazel immer wieder in Gedanken durchgespielt, was sie alles zu Dr.Beecham hätte sagen können, wie ihre letzte Unterhaltung in der Anatomists’ Society hätte verlaufen können. Hätte sie mit irgendeiner Kombination von Wörtern sein Mitgefühl erwecken können? Hätte sie ihn überreden können, sich der Justiz zu stellen? Hätte sie irgendetwas sagen können, um ihm begreiflich zu machen, dass das, was er tat, grausam war, dass ein Arzt nicht das Recht hatte, ein menschliches Leben zum Vorteil eines anderen zu opfern?
Wenn Hazel zu lange darüber nachdachte, spürte sie jedes Mal geballte Wut in ihrem Magen. Das Beste, was sie nunmehr tun konnte, so sagte sie sich, war es, den Menschen in ihrer Stadt zu helfen.
Und nach Beechams Verschwinden hatten auch viele seiner wohlhabenden Patienten niemanden mehr, der sie behandeln konnte. Oder zumindest niemand Respektablen.
Mediziner zu finden, war nicht schwer, junge Männer, die ihren Abschluss an der medizinischen Fakultät der Universität machten oder die mit einem Zylinder auf dem Kopf und makellosen Ledertaschen, auf die ihre Initialen aufgedruckt waren, aus London anreisten. Doch die Chirurgie war ein völlig anderes Feld. Diese Männer, nun ja, diese Männer waren praktisch Metzger. Und gegen eine Prise Schnupftabak würden sie jedes Geheimnis ihrer Patienten preisgeben.
Doch in manchen Fällen war ein Metzger einfach vonnöten.
Auf die ein oder andere Art hatte sich in der feinen Gesellschaft herumgesprochen, dass Lord Almonts Nichte darin bewandert war, gewöhnliche Krankheiten zu behandeln, und dass ihre Nähte klein und regelmäßig waren und so gut wie keine Narben hinterließen. Ein weiblicher Chirurg war zwar, gelinde gesagt, eine Kuriosität. Aber wenn man schon jemanden in die privatesten Räume seines Domizils vorließ, nun, dann doch lieber jemanden, der in den richtigen Kreisen verkehrte. Sie wussten vielleicht nicht, wie gut Hazels medizinische Ausbildung war, konnten sich jedoch zumindest damit trösten, dass sie wusste, welche Handschuhe man in der Oper trug. Zudem war ihr Ruf bereits beschädigt und wem konnte man seine pikanten Geheimnisse besser anvertrauen als jemandem, dem ohnehin niemand Glauben schenken würde?
So trudelten nach und nach zu Hazels großem Erstaunen, auch wenn es sonst niemanden überraschte, selbst leise Gesuche der feinen Gesellschaft auf Hawthornden ein: Hazel Sinnett möge ihre Kinder und Enkelkinder zur Welt bringen, vertraulich ihren Intimbereich nach Begegnungen mit Mätressen untersuchen, ohne ihren Ehefrauen davon zu erzählen, und ihnen die Zähne ziehen, die schwarz und brüchig geworden waren.
Und aus ebenjenem Grund befand sich Hazel in diesem Moment auch in dem privaten Salon von Richard Parlake, dem Earl von Hammond, und untersuchte den rosigen, übel riechenden Mund seines geliebten Sohnes und Erben Richard Parlake III.
Der jüngere Richard, ein zappeliger Junge von etwa zwölf Jahren, war alles andere als erfreut darüber, von einer Frau behandelt zu werden. Er war mürrisch und weigerte sich, Hazel anzusehen, als sie den Raum betrat, und seinen Hut abzunehmen. Selbst als Hazel ihm bedeutete, sich auf das violette Sofa zu setzen und den Mund aufzumachen, behielt er ihn an. Als sie sich hinter ihn stellte, um die beanstandeten Zähne zu untersuchen, stieß sie ihm den Zylinder »aus Versehen« vom Kopf und auf den Boden.
»Huch«, sagte sie und trat ihn unter das Sofa. Zum Glück war der Fall recht einfach: zwei gesprungene Zähne, die bereits locker waren.
Der ältere Richard Parlake, ein Mann, der sich einiges auf seine schulterlange silberne Mähne einbildete, stellte sich sogleich direkt hinter Hazel und konnte sich nur mit Mühe davon abhalten, ebenfalls in den Mund seines Sohnes zu greifen und Hazels Finger auf den entsprechenden Zahn zu lenken. »Es liegt am Zucker«, erklärte er und stimmte mit einem Nicken seiner eigenen Weisheit zu. »Dieser viele Zucker, den junge Burschen heutzutage in ihren Tee tun. Lässt ihre Zähne schwarz werden, aber niemand hört auf das, was ich zu diesem Thema zu sagen habe.«
Hazel bestätigte dies mit einem leisen Stöhnen und versuchte, hinter den Mann zu greifen und die Kneifzange aus ihrer Doktortasche zu holen, die sie auf den kleinen Tisch neben ihnen gestellt hatte. »Könnten Sie bitte beiseitetreten, Eure Lordschaft …«
Er ignorierte sie. »Ich habe Dickie gewarnt – habe ich dich nicht gewarnt, Dickie? Zucker wird noch unser aller Tod sein. Wenn die Männer von Edinburgh sich wie die Highlander ernähren würden … Also, die wissen, was eine vernünftige Mahlzeit ist. Fleisch! Kein bisschen Zucker. Kein bisschen Zucker im Tee. Ich kann es kaum ertragen. Würdevolle Männer sollen wir sein und nicht, Sie wissen schon, Frauen.« Er sah Hazel entschuldigend an. Sie tat so, als hätte sie ihn nicht gehört, und fuhr mit der Untersuchung der kariösen Zähne seines Sohnes fort.
Der Earl bemerkte, wie ihm die Unterhaltung entglitt, und lehnte sich weiter nach vorne. »Wie geht es dir, Dickie?«
Da der Junge den Mund noch immer geöffnet hatte, antwortete er seinem Vater mit einem Gurgeln. Der Earl klopfte seinem Sohn kräftig auf den Rücken und sorgte beinahe dafür, dass der Junge an dem Lappen erstickte, den Hazel ihm in den Mund gesteckt hatte. »Guter Junge«, sagte der Earl fröhlich, der sich des von ihm verursachten Chaos keineswegs bewusst war.
»Sir, ich muss Sie bitten, mehrere Schritte auf Abstand zu bleiben. Ich brauche Licht, um sicherzugehen, dass ich den richtigen Zahn ziehe«, sagte Hazel. Ihr Patient, Dickie, blickte sie mit weit aufgerissenen Augen dankbar an.
Der Earl murmelte etwas, folgte aber ihrer Anweisung. Dennoch rief er Hazel mit verletztem Stolz zu: »Wissen Sie, wir haben an Dr.von Ferris geschrieben, damit er Dickie behandelt. Haben Sie von Dr.von Ferris gehört? Vorgeblich der beste Chirurg in ganz Europa. Er behandelt George III. höchstpersönlich! Eigentlich wollten wir, dass er kommt und Dickies Zähne zieht. Der Mann ist so ein Genie, dass er bestimmt sogar eine Möglichkeit gefunden hätte, die Zähne zu retten.«
Hazel hatte in der Tat von Dr.von Ferris gehört. Es hatte den Anschein, dass Jahr um Jahr ein neuer, unglaublich aufgeblasener Arzt aus Dänemark, Deutschland oder Russland mit einer Doktortasche und dem Ruf eines Genies ihre kleine Insel aufsuchte. Hazels Ansicht nach schien sich ihre Brillanz auf eine außergewöhnliche Fähigkeit zu beschränken, Dummköpfen Geld aus der Tasche zu ziehen. Diese Sorte Arzt verlangte Hunderte von Pfund dafür, Leuten zu empfehlen, mehr Kartoffelschalen zu essen oder gar weniger, und verbrachte mehr Zeit auf Bällen, die man ihnen zu Ehren veranstaltete, als in Operationssälen. Hazel sah von Ferris genau vor sich: vermutlich um die sechzig, mit einem Bierbauch von den vielen Banketten, die man für ihn ausrichtete, und den Unmengen Wein, die man ihm schenkte – die Sorte Arzt, die eine gepuderte Perücke trug und samtweiche Hände hatte.
»Wie schade, dass er es nicht einrichten konnte«, antwortete Hazel.
»In der Tat!«, klagte der Earl. »Mein Brief muss wohl auf dem Weg nach London verloren gegangen sein.«
Hazel bezweifelte ernsthaft, dass dieser Doktor, wenn er auch nur halb so berühmt war, wie der Earl zu glauben schien, sich die Mühe gemacht hätte, nach Edinburgh zu reisen, um zwei Zähne zu ziehen – eine Aufgabe, mit der jeder halbwegs kompetente Barbier fertigwurde und bei der die Chancen recht gut standen, dass selbst ein unfähiger Barbier sie bewerkstelligen konnte.
Hazel drückte Dickie noch ein wenig weiter nach hinten, um im Licht des Fensters die Zähne auszumachen, die sie ziehen musste. Das Zahnfleisch wirkte nur leicht entzündet. Hazel hielt die Zange behutsam in der Hand, packte dann so schnell wie ein Haken schlagender Fuchs den ersten kranken Zahn und drehte. Dickie schrie, doch noch ehe er den Laut ausstoßen konnte, hatte Hazel auch schon den zweiten Zahn fest im Griff. Eine weitere Drehung und sie war fertig. Die beiden Zähne klapperten in ihrer Hand und Dickie rieb sich schockiert den Kiefer.
»Sieh mal, das hat doch jetzt nur ganz kurz wehgetan, aber diese Zähne haben dir bestimmt schon seit einer ganzen Weile Schmerzen bereitet«, flüsterte Hazel dem Jungen zu. »Das ist die Sache bei solcherlei Problemen: Ein kleiner, scharfer Schmerz jetzt erspart dir später eine Menge Schmerzen, die mit der Zeit immer stärker werden.« Sie wandte sich an seinen Vater. »Zwei Schilling, bitte.«
Wie die meisten wohlhabenden Leute bezahlte der Earl nur äußerst widerwillig für einen Dienst, den man ihm geleistet hatte. Mit verzogenem Gesicht ließ er die Münzen in Hazels Handfläche fallen. Sie schloss die Finger um das Geld und die beiden kleinen kariösen Zähne, an deren spitzen Wurzeln noch das Blut klebte.
»Ein in Wein getränkter Lappen sollte heute Abend und morgen an sein Zahnfleisch gedrückt werden«, verordnete sie. »Lassen Sie nach mir schicken, sollte die Blutung bis zum Morgengrauen nicht gestillt sein.«
»Jaja«, erwiderte der Earl zerstreut. Dickie stöhnte. Hazel schüttelte die Zähne und die Münzen in ihrer Hand, während sie bereits in Gedanken einen Eintrag für ihre Abhandlung über die Mechanik des Zähneziehens verfasste.
3
Hawthornden Castle, Hazels Familiensitz, war auf Felsklippen erbaut, die einen kleinen Fluss überblickten, mehrere Kilometer jenseits des lärmenden und schmutzigen Herzens von Edinburghs Old Town, die wie ein rauchender Schornstein in der Ferne sichtbar war. Die meisten Möbel waren mit Laken bedeckt, in deren Falten sich der Staub sammelte. Spinnweben hatten den vorderen Salon in Besitz genommen und Hazel fand, dass es die Mühe nicht wert war, sie in Schach zu halten. Jetzt, da sie allein war, ließ Hazel die Hälfte der Zimmer im Schloss unbeleuchtet und unbeheizt – es hatte keinen Sinn, die Kerzen oder das Feuerholz zu verschwenden.
Im Sommer war Hazels jüngerer Bruder Percy in Eton unten in England aufgenommen worden – eine ausgezeichnete Schule, hatte ihr Vater in seinen Briefen geschrieben, als er von der Neuigkeit hörte. Lady Sinnett, die nicht bereit war, mehrere Tagesritte von ihrem heiß geliebten kleinen Jungen getrennt zu sein, hatte daraufhin beschlossen, sich dauerhaft in einem Stadthaus in Slough niederzulassen, wo sie vom Fenster aus die grauen Türme der Schule sehen konnte. Hazel hatte deswegen beinahe Mitleid mit Percy.
Eigentlich war Hazel davon ausgegangen, dass die Kunde von ihrer Untergrundpraxis irgendwann auch ihre Eltern erreichen würde: ihre Mutter in London und ihren Vater auf St.Helena, wo er weiterhin als Captain der Royal Navy stationiert war. Doch selbst nach mehreren Wochen und schließlich Monaten kam kein Wort der Zurechtweisung.
Als Chirurgin zu arbeiten, war vielleicht kein größerer Skandal als die Tatsache, dass Hazel letztes Jahr Bernards Heiratsantrag abgelehnt hatte. Von diesem Moment an war sie in Lady Sinnetts Augen ein aussichtsloser Fall geworden, eine starrsinnige Tochter, für die es keinerlei Hoffnung mehr gab. Geradezu beschämend. Niemand würde ein Mädchen heiraten wollen, das ihre Zeit damit verbrachte, Eiterbeulen aufzustechen, Gliedmaßen aufzuschneiden und Patienten von Edinburghs verarmter und unmodischer Old Town zu behandeln, wo der Gestank von Urin und Kohlequalm schwer in der Luft hing.
Ach, sei’s drum, dachte Hazel. Wenn ihr Ruf schon ruiniert war, richtete es nur wenig mehr Schaden an, ihn noch weiter zu ruinieren.
Lady Sinnett hatte von ihrer Tochter kaum Abschied genommen, als sie in die Kutsche nach England gestiegen war, die bereits unter dem Gewicht ihrer drei riesigen, auf dem Dach befestigten Reisekoffer durchgehangen hatte. Seit dem Tod ihres ältesten Sohnes George trug sie Schwarz, und obwohl es ein drückend heißer Augusttag gewesen war, war sie in dicken schwarzen Samtkrepp und mit einem Schleier über dem Gesicht gekleidet. Während die Pferde wieherten, bedachte Lady Sinnett Hazel mit einem kühlen Blick. Sie hob ihren Schleier an, stieg aus der Kutsche und trat ein paar vorsichtige Schritte an ihre Tochter heran. Für einen kurzen Moment fragte sich Hazel, ob ihre Mutter ihr einen Kuss geben würde.
»Deine Schuhe sind schmutzig«, sagte Lady Sinnett schlicht. »Erde.« Hazel sah auf ihre Stiefel hinunter. Es waren die verschmutzten Stiefel, in denen sie mit Jack auf den Friedhof geschlichen war, um Leichen zu stehlen, die sie dann in ihrem Laboratorium studieren konnte. Es war ihr nicht in den Sinn gekommen, die Erde abzukratzen. Denn sie war immer davon ausgegangen, dass sie und Jack irgendwann einmal zu den Friedhöfen zurückkehren würden.
Bevor Hazel etwas erwidern konnte, hatte Lady Sinnett schon die Kutschtür zugezogen und Hazel blickte ihr nach, als sie den von Bäumen gesäumten Weg hinunter verschwand.
Von dem Tag an war Hazel so gut wie allein auf Hawthornden Castle. (Cook blieb, um für Hazel zu kochen, obwohl Lady Sinnett sie angefleht hatte, mit dem Rest des Personals nach England zu kommen. »Ich bin in Schottland geboren und ich werde in Schottland sterben«, hatte die Köchin geantwortet. »Da kann nichts draus werden, wenn ich versuche, mit Gemüse zu kochen, das zwischen englischen Steinen gewachsen ist, oder mit Milch von dürren Kühen, die englisches Unkraut fressen.«) Hazels Kammerzofe blieb natürlich ebenfalls, doch sie erwartete ihr erstes Kind und Hazel bestand darauf, dass sie sich möglichst oft in ihrem Cottage am oberen Ende der Straße ausruhte.
Hazel störte es nicht, in dem halb unter Laken verhüllten und kalten Hawthornden Castle zu leben. Zudem verbrachte sie sowieso kaum Zeit im Schloss. Wenn sie keine Hausbesuche in der Stadt machte, arbeitete sie in ihrem Labor.
Hazel hatte ihr Laboratorium Stück für Stück eingerichtet. Sie hatte Möbel, Fackeln und Bücher hinüberbringen lassen, bis es behaglich genug war, um über mehrere Tage dort bleiben zu können, während sie an ihrer Abhandlung arbeitete und akribisch jedes Symptom, das sie diagnostizierte, und jede Behandlung, die sie durchführte, aufzeichnete. Das Labor war einst das Verlies von Hawthornden Castle gewesen und war in den Berghang gehauen, auf dem das Haus saß. Drinnen war die Luft kühl und roch nach Kälte und Schmutz. Nur durch ein hohes Fenster fiel ein wenig natürliches Licht ein, weshalb Hazel Dutzende Kerzen um ihren Tisch stehen hatte, um bis spät in die Nacht lesen zu können.
Sie brachte ihren mit verblasstem rotem Stoff bezogenen Lieblingssessel, in dem sie bequem lesen konnte, von ihrem Schlafzimmer hier herunter sowie ein Familienporträt aus dem Arbeitszimmer ihres Vaters, das sie auf ein Regal stellte. George war, als das Gemälde entstanden war, noch am Leben gewesen und Percy ein Kleinkind. Ihre Mutter wirkte nahezu glücklich. (Hazel gefiel sich in dem Porträt überhaupt nicht – sie selbst war darauf etwa zwölf Jahre alt und ihr Haar zu winzigen Locken gedreht, die in ihrer Erinnerung zu fest gewesen waren und ihre Kopfhaut zum Jucken gebracht hatten.)
Um Mitternacht an ihrem achtzehnten Geburtstag las Hazel gerade ein medizinisches Journal über die möglichen Nachteile eines Aderlasses bei Cholera-Patienten. Als die Uhr schlug, sah sie zu den in Öl gemalten Gesichtern ihrer Familie auf, die auf sie hinabblickten. Es war fast, als wären sie alle hier bei ihr und würden ihr einen schönen Geburtstag wünschen.
In der darauffolgenden Woche traf ein Brief von ihrem Vater ein (der Postdienst von den Inseln sei für seine Verspätungen berüchtigt, entschuldigte er sich im Voraus) und eine weitere Woche später trudelte ein Katzenbild ein, das Percy für sie gezeichnet hatte. (Sie und Percy hatten nie eine Katze besessen und auch niemals darüber geredet, dass sie beide eine besondere Vorliebe für sie hätten, weshalb ihr die Auswahl des Tieres ein wenig willkürlich vorkam. Dennoch hängte Hazel die Zeichnung über ihren Schreibtisch, um sie während der Arbeit betrachten zu können.)
Doch eigentlich fieberte sie einem ganz anderen Brief entgegen, der nichts mit ihrer Familie zu tun hatte. Schon seit Monaten wartete Hazel darauf, von Jack zu hören, dem einzigen Jungen, den sie je geliebt hatte. Jack Currer, der im Theater wohnte und nachts als Auferstehungsmann arbeitete, Kadaver ausgrub und diese an Ärzte verkaufte, die zum Studium großen Bedarf an Leichen hatten. Jack Currer, der sie zu mitternächtlichen Ausgrabungsexpeditionen auf Friedhöfe mitgenommen und sie in einem Grab geküsst hatte und in dessen Nähe es ihr jedes Mal den Atem verschlug und sie das Gefühl hatte, als könnte ihr das Herz jeden Augenblick aus der Brust springen. Jack, dem die von Dr.Beecham begangenen Morde angehängt worden waren, der zum Tode verurteilt und auf Haymarket Square gehängt worden war. Und der vielleicht, vielleicht, so hoffte ein verborgener Teil von Hazel, eine Möglichkeit gefunden hatte, seine Hinrichtung zu überleben.
Hazel wusste, dass es lächerlich war zu glauben, dass die violettschwarze Flüssigkeit aus dem Fläschchen, das Dr.Beecham ihr gegeben hatte, einen Mann unsterblich machen könnte. Es lief jedem wissenschaftlichen Prinzip entgegen, das man ihr beigebracht hatte, jeder Lektion in jedem Buch. Der menschliche Körper war nicht für die Ewigkeit gedacht. Er sollte verwesen, Energie konsumieren und aufbrauchen und am Ende seine gottesfürchtige Seele an eine ewige Ruhestätte im Himmel entlassen. Es existierte kein Elixier, kein Tonikum – wie Beecham es genannt hatte –, welches Sterblichkeit ungeschehen machen konnte.
Und doch.
Und doch lebte Beecham noch.
Beecham, der Hazel wie ein Mann mittleren Alters erschienen war, hätte mindestens hundert Jahre alt sein müssen. Aber natürlich nur, wenn das, was er behauptete, der Wahrheit entsprach, rief sich Hazel jedes Mal in Erinnerung, wenn sie sich dabei ertappte, wie ihr Geist in Träumereien abschweifte. Vielleicht war Beecham einfach nur ein armer Irrer. Vielleicht hatte er einen Weg gefunden, junge, gesunde Körperteile in die Körper von kränklichen Patienten zu verpflanzen, die bereit waren, für neue Augen, eine neue Leber oder neue Hände zu bezahlen. Doch das bedeutete nicht, dass Beecham tatsächlich der ursprüngliche Dr.Beecham war, der vor hundert Jahren das Licht der Welt erblickt hatte, und nicht dessen Enkel, wie die Leute glaubten. Und es bedeutete erst recht nicht, dass Beecham ewig leben würde oder einen Weg kannte, der es einem ermöglichte, den Strick zu überleben.
Schon jetzt, nicht einmal ein Jahr später, begann die Erinnerung an ihre Unterhaltung mit Beecham zu verblassen. War das Tonikum violett oder goldfarben gewesen? War der Stöpsel ein Korken gewesen? Hatte er Unsterblichkeit bei jedweder Verletzung versprochen oder lediglich Immunität gegen Krankheit? Die stärkste Erinnerung, die ihr noch blieb, war ein bloßes Gefühl: Wut und Entsetzen, die ihr Gehirn fluteten und ihre Sicht trübten, dieses Gefühl, am Bug eines Schiffes zu stehen, während das Meer unter ihren Füßen toste.
Vor ein paar Monaten war ein Brief ohne Absender und Unterschrift eingetroffen, in einer Handschrift, die ihr, so hatte sie sich eingeredet, vertraut vorkam.
Mein schlagendes Herz gehört noch immer dir. Und ich werde auf dich warten.
Ich werde auf dich warten.
Unten auf der Seite hatte der Verfasser noch hinzugefügt: in Amerika. Hazel hatte den Brief wochenlang in ihrem Korsett an ihre Brust gedrückt mit sich herumgetragen, bis das Papier angefangen hatte, sich an den Rändern aufzulösen, und die Tinte abblätterte. Er musste von Jack sein. Es musste