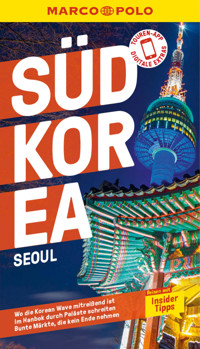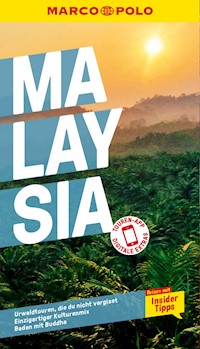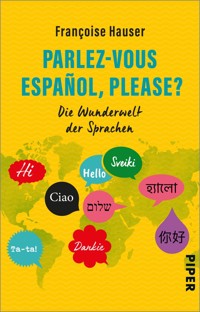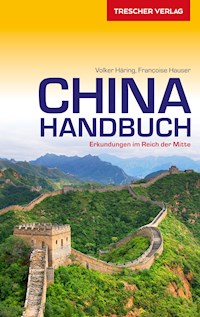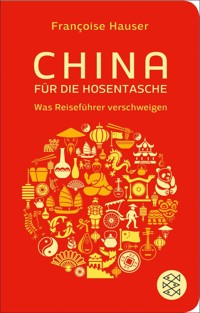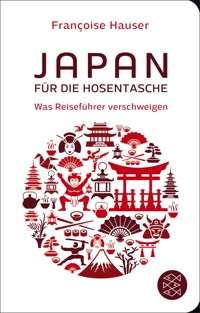9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wer die Suppe schlürft, beweist in Deutschland mangelnde Kinderstube – und in Japan perfekte Tischmanieren. Der Handkuss gilt in Österreich als charmant, in Saudi-Arabien ist er jedoch ein Garant für den Rausschmiss. Und wer weiß bei uns schon, dass man in China Geschenke niemals im Beisein des Schenkenden auspacken darf? Françoise Hauser versammelt Fettnäpfchen aus aller Welt und zeigt auch, wie sie sich umgehen lassen. Ein ebenso unterhaltsames wie aufschlussreiches Buch, das in keinem Reisegepäck fehlen sollte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
ISBN 978-3-492-96308-4© Piper Verlag GmbH, München 2014 Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, www.kohlhaas-buchgestaltung.deCovermotiv: Vario ImagesFotos: Françoise HauserDatenkonvertierung: Uhl + Massopust, Aalen
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Fettnäpfchen: Wo sie herkommen und wie man sie zielsicher ansteuert
Wer sich jemals in China bei Tisch geschnäuzt, in Indien die linke Hand zur Begrüßung ausgestreckt oder in den USA einen richtig dreckigen Witz erzählt hat, der weiß: Interkulturelle Begegnungen haben viel mit der letzten Fahrt der Titanic gemeinsam. Wartet man mit den Kurskorrekturen, bis die Spitze des Eisbergs sichtbar ist, hat man sich längst an dessen unsichtbaren Unterwasserausläufern den Rumpf aufgeschlitzt. Und mal ehrlich: Jeder, der bereits im Ausland unterwegs war, hat wohl schon mal die heiße Erkenntnis verspürt, gerade kapital einen versenkt zu haben. Wenn sich eben noch herzlich nette Menschen scheinbar grundlos zurückziehen, die neuen und wirklich freundlichen Bekannten auf einmal einen angeekelten Gesichtsausdruck bekommen, wenn der Kellner schlagartig unhöflich wird oder die potenziellen Geschäftspartner keinerlei Willen mehr zum Vertragsabschluss zeigen – dann hat man sich wohl ungewollt kolossal danebenbenommen.
Alternativ ist es auch ein unglaublich peinliches Erlebnis, anderen beim zielsicheren Endspurt aufs Fettnäpfchen zuzusehen: Der wird doch nicht wirklich in China einen Schlitzaugenwitz erzählen? Hat der jetzt allen Ernstes den Amerikaner zwischen Vorsuppe und Hauptspeise in die Nacktsauna eingeladen? Es schmerzt, anderen dabei zuzuschauen, wie sie in Korea nach einem üppigen Mahl penibel getrennt die Rechnung begleichen, in Dubai Luftküsschen an die weiblichen Angestellten verteilen oder in Italien an der Rezeption mal so richtig dozieren, wie sich aus dem Saftladen noch ein ordentliches Hotel machen ließe.
Die Möglichkeiten, sich im Ausland zu blamieren, sind vielfältig, und selbst wer meint, sich vor der Reise gut auf die Besonderheiten des Ziellandes vorbereitet zu haben, ist vor peinlichen Benimm-Ausrutschern nicht gefeit. Doch warum eigentlich? Können wir uns nicht einfach die Grundlagen einer anderen Kultur aneignen und damit solcherlei Fehltritte von vornherein verhindern? Denn dass Kulturen unterschiedlich sind und in anderen Ländern auch andere Regeln gelten, wissen wir schließlich alle.
Kultur! Kultur?
Doch was bedeutet Kultur in diesem Zusammenhang? Ab wann befindet man sich in einer anderen Kultur und wo genau liegen ihre Grenzen?
An diesem Begriff arbeiten sich seit vielen Jahrzehnten Sozialwissenschaftler, Anthropologen, Kulturwissenschaftler, Psychologen und wer nicht noch alles ab, sodass es eine Vielfalt von verschraubten Definitionen gibt. Tatsache ist aber: So ganz genau lässt sich eine Kultur nicht abgrenzen – weder gefühlt noch wissenschaftlich. Es geht schon damit los, dass sich jede Kultur in Unterkulturen spaltet, und das nicht zu knapp. Vergleichen Sie doch mal das korrekte Begrüßungsritual unter bayrischen Stammtischmitgliedern mit dem einer Gruppe Berliner Punker. Auch das unterschichtige Offenbacher »Wos ged, Alder« lässt die Passanten nur wenige Straßenzüge weiter im Frankfurter Speckgürtel die Augenbrauen nach oben ziehen. Wissenschaftler differenzieren daher gerne nach Alter, Geschlecht, Einkommen, Herkunft und vielen anderen Kriterien. Im Alltag ist das allerdings weniger praktikabel. De facto würde das bedeuten, immer erst nach Ausbildung und Kontostand fragen zu müssen, bevor man sich die Hände reicht (oder eben nicht).
Nicht minder schwierig ist die Frage: Wo liegen die Grenzen zwischen individuellen Marotten und der gemeinsamen Kultur? Und vor allem: Woran erkennt man sie? Je fremder die Kultur, desto eher tappt der Fremde in die Kulturfalle und schreibt alles Ungewohnte und Unverständliche, jede skurrile Verhaltensweise der lokalen Kultur zu: So geht das hier also! Wer zu schnelle Rückschlüsse zieht, schlürft in Frankreich fortan die Suppe, nur weil er beim ersten Restaurantbesuch in Paris neben einem Rüpel gesessen hat, oder er liegt regional richtig, aber sozial total daneben: Wer die komplizierten Handschlag-Rituale der Gangs von New York beherrscht, ist auf einer Professoren-Party in Harvard ja nicht zwingend im Vorteil.
Doch zurück zur Frage: Wo also beginnt eine fremde Kultur? Grenzen sind bei der Suche nach der Antwort nur eine unzuverlässige Orientierungshilfe. Gehört die Frittenbude hinter der belgischen Grenze schon zu einer anderen Kultur? Der Mann an der Fritteuse spricht zwar hervorragend deutsch, allerdings mit Eupener Akzent, außerdem besitzt er einen belgischen Pass und eine Vorliebe für Kirschbier hat er auch. Welche Regeln gelten denn nun im Umgang mit ihm? Und wie verhält man sich korrekt gegenüber Menschen, die viele Jahre in einer anderen Kultur verbracht haben oder deren Eltern aus einem anderen Land stammen?
Kurzum, Definitionen von Kultur und Kulturräumen mögen wissenschaftlich hochinteressant sein, von praktischem Nutzen für unterwegs sind sie eher nicht. Am besten hält man es im Ausland mit der Regel: Wenn es sich anders anfühlt und anders aussieht, dann ist es wohl so. Und falls dies nicht zutrifft: Es ist trotzdem alles anders, nur merken Sie es dann erst später.
Feste Regeln, bitte
Ein bisschen Hoffnung gibt es dennoch, quasi eine Benimm-Krücke, mit der man Aufenthalte in fremden Ländern passabel bewältigen kann. Die sogenannten Kulturstandards. Dabei handelt es sich um die zentralen Regeln und Normen einer Kultur, die vorgeben, welches Verhalten als normal, annehmbar oder völlig daneben gilt. Die gute Botschaft ist: Man kann sie lernen, zumindest die wichtigsten, und mit ein wenig Übung gelingt es vielleicht sogar, sie aktiv und passiv zu beherrschen. Die schlechte Botschaft ist: Man kann sie nicht ohne Weiteres erkennen. Die meisten Menschen wissen noch nicht einmal so ganz genau, welches ihre eigenen Kulturstandards sind, schließlich hält man diese Verhaltensweisen einfach für »normal«: Öffnet ein Mann in Deutschland einer Frau die Tür, dann ist das höflich, in Australien jedoch Anzeichen einer steinzeitlichen Haltung in Sachen Gleichberechtigung. Auch innerhalb Deutschlands findet man solche Unterschiede: Sparen und aufs Geld achten ist normal, finden die meisten Schwaben. Selbstverständlich gibt man dort die Flasche Sonnenblumenöl für 39 Cent oder die Flasche Cola, die man sich vom Nachbarn geliehen hat, auch wieder zurück – schon weil Pfand dafür anfällt! Die meisten Schwaben kämen gar nicht auf den Gedanken, dass sich diese Haltung im Ruhrpott als Geiz manifestieren könnte.
Diese nie hinterfragte Normalität, die vor dem Hintergrund einer anderen Kultur ihre Bedeutung verändert, treibt wahrscheinlich mehr Besucher (und ihre Gastgeber) in den Wahnsinn, als die sichtbaren kulturellen Unterschiede.
Der Vorteil der Kulturstandards ist, dass man nicht immer wieder von Neuem darüber nachdenken muss, wie man in dieser oder jener Situation passend reagiert. Wie wichtig diese Standards sind, stellt man erst in Situationen fest, in denen es keine festen Verhaltens-Vorlagen gibt. Denn wie verhält man sich korrekt nach einem aus dem Alkohol geborenen One-Night-Stand? Wie reagiert man richtig, wenn man feststellt, dass der neue Chef just jener Typ ist, den man am Abend zuvor in der Kneipe angeblafft hat? Oder, ganz schlicht und einfach, welche Begrüßung ist angemessen, wenn man demselben Mitarbeiter zum dritten Mal am gleichen Vormittag im Büro-Flur begegnet? Solche Situationen riechen förmlich nach Blamagen und sind Steilvorlagen für Fettnäpfchen, für die es noch nicht einmal interkulturelle Spannungen braucht, um sie gesellschaftlich in eine hochexplosive Handgranate zu verwandeln.
Im Ausland erweitert sich das Repertoire an Peinlichkeiten und Fauxpas naturgemäß noch um ein Vielfaches. Schaut man jedoch genauer hin, zeigt sich, dass gewisse Arten von Fettnäpfchen ganz besonders beliebt sind:
Der Regelverstoß
Visitenkarten werden in Fernost mit zwei Händen übergeben und angenommen. Diese Regel wird in einer klar definierten Situation angewandt und hat erst einmal keine ideologische Bedeutung. Oder anders gesagt: Man bricht sich keinen ab und muss auch keine persönlichen Gewissenskonflikte bewältigen, um sie zu befolgen.
Wenn es um solche einfachen Regeln geht, zeigt sich schlicht, wer beim Hinflug die Zeit zur Lektüre eines interkulturellen Führers genutzt und wer lieber alle Blockbuster des Inflight-Entertainments durchgeklickt hat. Weil man diese Regeln so schön auswendig lernen kann, sind sie bei interkulturellen Seminaren sehr beliebt. Außerdem ist es doch ein beruhigendes Gefühl, wenigstens einen kleinen Teil des Aufenthalts ohne soziale Unfälle bewältigen zu können. Auch die Menschen im Ausland wissen diese kleine Geste zu schätzen. Vor allem, wenn man danach nur noch von einem Fettnapf zum nächsten trottelt.
Die Ekelfalle
Gegrillte Meerschweinchen, Kakerlaken am Spieß, Schildkröten in der Suppe oder Katzenragout: Die Welt ist voller Spezialitäten, die man zu Hause nicht mal dem Hund vorsetzen würde. Leider gebietet es die Höflichkeit in den meisten Kulturen, dass man sie sich trotzdem mit viel Lob und geheuchelter Anerkennung einverleibt: »Richtig lecker, dieses Flughund-Ragout!« Sind die Zutaten an sich wenig erschreckend, lässt sich über Lagerung und Zubereitung noch allerhand wettmachen: 14 ungekühlte Stunden auf einem tropischen Dritte-Welt-Markt gehen auch am leckersten Steak nicht unbemerkt vorüber. Neben diesen kulinarischen Fallen gibt es noch eine körperliche Variante, denn auch um die Körperhygiene ist es in Kulturen mit extremen Wetterlagen nicht immer optimal bestellt. Logischerweise verleitet die Kombination aus fehlendem Badezimmer und Minustemperaturen nicht wirklich zur täglichen Dusche, und Wasserknappheit lässt Menschen in der Wüste vielerorts seltener zu Waschlappen und Seife greifen. In diesem Fall heißt es dann »Nase zu und durch« – und keine unbedachten Bemerkungen zu diesem Thema fallenzulassen.
Die Altlast
Es gibt Standards, die widersprechen einfach jedem westeuropäischen Höflichkeitsgefühl. Da kann man als Deutscher hundert Mal wissen, dass es im südlichen Afrika unhöflich ist, anderen Menschen lange in die Augen zu schauen, unsere Erziehung sagt uns etwas anderes: Wer dem Blick ausweicht, hat etwas zu verbergen. Und schon glotzen wir, grundehrlich, jedem ins Gesicht. Auch der Hinweis, dass es hier und da auf der Welt weder nötig noch höflich ist, zu einer Einladung pünktlich zu erscheinen, kollidiert heftig mit allem, was man in den ersten zwei Jahrzenten als Westler eingebläut bekommt. Wenigstens annähernd pünktlich, das müsste doch okay sein … oder?, fragt man sich. Das Leben belohnt einen dann reichlich für das frühe Erscheinen: zum Beispiel mit dem Anblick der Gastgeber in Feinrippunterhemd und Lockenwickler …
Die Missdeutung
Ganz besonders tückisch sind Situationen, von denen alle Beteiligten sicher zu wissen glauben, wie sie zu entschlüsseln sind – und doch in ihrer Interpretation meilenweit auseinanderliegen! Dummerweise dechiffrieren Menschen nämlich die Welt auch im Ausland vor dem Hintergrund ihrer eigenen Kultur – und steuern damit gezielt auf das nächste Fettnäpfchen zu. Ein Klassiker ist beispielsweise das fernöstliche Nein. Sagt der Chinese: »Da muss ich noch mal drüber nachdenken«, dann meint er »Nein«. Der Deutsche denkt sich jedoch: »Kann gut sein, dass er noch zustimmt.«
Die Nationalisten-Falle
»Willst du meine Heimat in den Dreck ziehen?« Schon die kleinste angedeutete Kritik verwandelt den einheimischen Saufkumpan in einen bedrohlichen Lokalmatador, der sich tief in seiner Ehre verletzt fühlt, nur weil man über die Frisur einer Landsmännin herzieht – oder eine ähnlich nichtige Kleinigkeit. Eine grobe Handreiche ist hier die Regel: Je ärmer und simpler, desto nationalistischer. Oft sind es jene, die sonst nichts haben, auf das sie stolz sein könnten, die sich am wohligen Feuer des Nationalismus wärmen und erst so richtig aufblühen, wenn ihnen die Landesflagge um die Nase flattert.
Die Rückkopplung
Dies ist eine der tückischsten Varianten, quasi der Fettnapf für Fortgeschrittene! Die Schwierigkeiten beginnen damit, dass ein anderer einen Fauxpas begeht. Würde man ihn darauf aufmerksam machen, verhielte man sich jedoch inakzeptabel und würde damit die peinliche Situation verstärken. Engländer und Chinesen haben dafür jeweils einen treffenden Ausdruck, der sich in keinem der beiden Fälle mit dem Wort »peinlich« angemessen ins Deutsche übertragen lässt: »Embarrassing« oder »bu hao yisi« ist bei ihnen eine solche Situation. Um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, schaut man vermeintlich ungerührt zu, wie der Besucher gegen die herrschenden Regeln in aller Öffentlichkeit ein Taschentuch zückt, weil man den Unwissenden in der beschämenden Situation nicht noch weiter belasten will.
Von Fettnäpfen, Hühneraugen und Ziegelsteinen
Wieso treten wir eigentlich in ein »Fettnäpfchen«, wenn uns etwas Peinliches im Umgang mit unseren Mitmenschen passiert? Ein möglicher Ursprung dieser Redewendung ist die mittelalterliche Sitte, neben dem Küchenofen ein Stück geräucherten Speck oder Schinken hängen zu lassen. Das durch die Hitze abtropfende Fett wurde mit einer kleinen Schüssel aufgefangen, schließlich konnte man damit noch kochen oder die Schuhe putzen. Vor allem nachts trottelte der eine oder andere schon mal gegen den Fettnapf und hinterließ eine unangenehme Bescherung.
Einer anderen Variante nach lässt sich der Ausdruck von der Fettschüssel herleiten, die in Bauernhäusern oft neben der Tür stand, damit sich die Bewohner und Gäste bei schlechtem Wetter die Schuhe nachfetten konnten. Egal welche Variante nun richtig ist, ein verschütteter Napf Fett ist eine ziemliche Sauerei, und auch die Vorstellung, ein Gast würde ungeschickt in das Fettbehältnis steigen und die Schweinerei am Ende noch durchs ganze Haus tragen, ist ziemlich ekelig.
Im Rumänischen benutzt man dasselbe Bild wie im Deutschen, dort treten die Menschen in die Töpfe (a călca în străchini), während sich auf Spanisch eine beeindruckende Auswahl auftut: Man kann mit dem Bein reintreten (meter la gamba), ein Brett ziehen (tirarse una plancha), in den Mörteltrog treten (meter el cuezo) sowie den Huf reinstecken (meter la pezuña) oder wahlweise auch die Hand (meter la pata), wer dies öfter tut, ist ein Metepatas, ein Ausdruck, der sich gar nicht angemessen ins Deutsche übertragen lässt. Angesichts der vielen Ausdrücke fragt man sich: Verhalten sich die Spanier besonders ungeschickt? Oder haben sie einfach nur genug Selbsthumor, darüber ausführlich zu reden? Denn der Spanier strauchelt auch gerne (dar un traspié) und sollte im Haus des Erhängten den Galgenstrick nicht erwähnen (mentar la soga en casa del ahorcado). Genauso bildhaft ist der Ausdruck »ins Schleudern geraten« (pegar un patinazo). Auf Griechisch begeht man schlicht einen dummen Fehler (κάνωγκάфα), während sich die Engländer den Fuß in den Mund stopfen (to put one’s foot in one’s mouth) oder einen Ziegelstein fallen lassen (to drop a brick).
Die Franzosen wiederum – wie könnte es anders sein – beziehen sich aufs Essen: Hier steigt man mit dem Fuß in den Teller (mettre les pieds dans le plat). Alternativ kann man auch eine Dummheit begehen (faire une gaffe). Dieser Begriff unklarer Herkunft hat es in viele Sprachen Europas geschafft: Auch in Italien begeht man eine Gaffe (fare una gaffe), genauso wie in Polen (popełnić gafę), wo allerdings auch noch die Möglichkeit einer Ungeschicklichkeit oder Taktlosigkeit besteht (popełnić niezręczność/nietakt). Auf Slowenisch macht man sich einfach nur lächerlich (osmešiti se) oder blamiert sich (blamirati se). Die Russen wiederum treten jemandem aufs Hühnerauge (наступитьнамозоль). Doch nicht alle sind so bildlich. Auf Niederländisch begeht oder schlägt man bloß einen dummen Fehler (een flater slaan, een flater begaan). Die Schweden wiederum treten ins Klavier (trampa i klaveret). Was auf den ersten Blick ein ziemlich zerstörerisches Bild heraufbeschwört, bezieht sich allerdings eher auf den gesellschaftlichen Misston, denn der Ausdruck ist eine verkürzte Form des Satzes »das klingt wie mit Holzpantinen ins Klavier getreten« (det låter trampade i klaveret med träskorna).
In China wiederum lässt der etwas angestaubte Ausdruck chu yangxiang 出洋相 (grob übersetzt: wie ein westlicher Ausländer wirken) tief blicken: Westler galten im Alten China per se als peinlich und tollpatschig – und ehrlich gesagt hat sich daran bis heute nicht viel geändert. Neutraler sind die Ausdrücke shílĭ失礼 »gegen die (konfuzianischen) Sitten verstoßen« oder, meine illustre Lieblingsvariante, langbei 狼狈: Der Bei 狈 ist dabei ein Fabeltier mit extrem kurzen Vorderbeinen, das sich nur fortbewegen kann, wenn es sich auf einen Wolf (Lang 狼) stützt. Wolf und Bei geben zusammen ein unbeholfenes und peinliches Paar ab.
Globetrottel aller Welt, blamiert euch!
Fettnäpfe gibt es, wie wir im vorigen Kapitel bereits gesehen haben, also genügend – doch wer sind eigentlich die Menschen, die auf Reisen zielsicher vom einen zum nächsten tappen? Hier gibt es eine beeindruckende Bandbreite, die sich in diverse Unterspezies einteilen lässt:
Der Vielreisende
Heute Rom, morgen Ruanda, übermorgen Saigon – und all das natürlich immer im faltenfreien Anzug. Er hat schon alles gesehen, nichts kann ihn mehr beeindrucken. Seine Uhr zeigt mindestens drei Zeitzonen gleichzeitig an und über den Jetlag kann er nur trocken husten. Großkotzig dominiert er jede Diskussion: Phnom Penh? Ach ja, da war er auch schon, Paris ist schon lange nicht mehr das, was es mal war, und Nigeria ist sowieso in Geschäftsfragen indiskutabel. Er kann jede Skurrilität übertrumpfen, schließlich kennt er alle Hotelbars der Welt persönlich und die horizontalen Damen aus der Seitengasse daneben auch. Wenn er von Stunden spricht, sind natürlich Flugstunden gemeint – und zwar in der Businessclass. Kommt er doch in die Verlegenheit, Holzklasse fliegen zu müssen, erkennt man ihn am angeekelten Gesichtsausdruck. Bei Gesprächen an der Hotelbar muss er hier und da auch mal ein wenig das Revier markieren: »Mit dem einarmigen Piloten im Zweisitzer über den Kriegsgebieten des Sudan …, da macht ihr Euch kein Bild …« In Sachen Fettnäpfchen ist der Vielreisende dank seiner unübersehbaren Arroganz und mangelnder Fremdsprachenkenntnisse jenseits des Englischen eine verlässliche Größe. Oft weiß er nämlich gar nicht mehr so ganz genau, in welchem Land er sich gerade befindet, da kann man die Kulturstandards schon mal durcheinanderbringen. Macht aber nichts, morgen ist er sowieso schon wieder woanders.
Der Gutmensch
Zielstrebig steuert er in Bombay, Sao Paulo und Nairobi die Slums an, um sich mit den Menschen dort zu verbrüdern. Wenn er diese Exkursionen überlebt, ist dies nur der Tatsache geschuldet, dass es die lokalen Gangster und Banden gar nicht fassen können, dass sich ein wohlhabender Tourist allen Ernstes in diese Ecke wagt und sie ihn deshalb für wichtig halten. Taschendiebe sind für den Gutmenschen bedauernswerte Kreaturen, die von der Gesellschaft in die Kriminalität gezwungen wurden und denen er verzeiht, wenn sie ihn berauben. Den Verlust des Geldes verschmerzt er gerne, es ist ja sowieso nur ein Symbol des Kapitalismus, doch insgeheim ist er schon ein bisschen enttäuscht, dass ihn die Armen nicht als Ihresgleichen angenommen haben.
Äußerlich erkennt man ihn an den ausgebeulten Leinenhosen aus der Khaosan Road in Bangkok oder vom Indianermarkt in Otavalo, und natürlich am bequemen Schuhwerk, gerne auch mit Fußbett und aus der Haut glücklicher Kühe gefertigt. In Laos und Vietnam trägt er aus Solidarität mit den armen Massen jedoch auch Flipflops. In den öffentlichen Verkehrsmitteln wird das Ticket zur politischen Demonstration. Mit dem Stehplatz auf der 25-stündigen Nachtfahrt von Mombasa nach Nairobi dokumentiert er die Scham ob seines westlichen Reichtums, während alle anderen Passagiere über die Frage grübeln: »Kann sich dieser Ausländer wirklich kein anständiges Ticket leisten?« Dass der Gutmensch trotz seiner vergleichsweise guten Info-Lage bereitwillig in alle Fettnäpfchen tritt, lässt sich mit einer gewissen Naivität erklären: Was die Menschen wirklich beschäftigt, hat er vor lauter rosa Brille nicht verstanden, sodass seine Kontaktversuche immer ein wenig putzig wirken.
Der Adaptionist
Für Reisende, die sich im Ausland freiwillig oder unfreiwillig als Deutsche zu erkennen geben, haben die Adaptionisten nur Verachtung übrig. Damit ihnen das bloß nicht passiert, unterhalten sie sich ausschließlich, auch untereinander, in der jeweiligen Landessprache, wenn es sein muss auch auf Chinesisch. Dass das Gesprächsniveau dadurch auf das Niveau einer PEKiP-Spielgruppe sinkt, ist kein Hinderungsgrund. Pikanterweise outen sich die Adaptionisten gerade durch diesen verkrampften Versuch der sprachlichen Mimikry als Deutsche – keine andere Nationalität käme auf einen solchen hirnrissigen Gedanken!
Die Freude an der Anpassung ist nicht nur in linguistischer Hinsicht grenzenlos: Weibliche Adaptionisten entdecken trotz eines plakativ nach außen getragenen Feminismus nach drei Wochen Orient die Erotik des Schleiers, oder flanieren im Sari durch Indien. Männer hingegen entwickeln eine Vorliebe für schlecht gewickelte Turbane oder Wasserpfeifen. In Sachen Fettnapf verhalten sich die Adaptionisten vorbildlich: Sie übernehmen mit wehenden Fahnen und wahllos alle Kulturstandards, denen sie begegnen. Wenn sie mit den Einheimischen trotz allen Entgegenkommens nie so recht warm werden, dann liegt es meist daran, dass sie ihnen nicht nur entgegenkommen, sondern diese weit überholen. Adaptionisten in Japan sind japanischer als der Tenno, und auch in Pakistan, Dubai oder sonst wo auf der Welt sind sie der Lokalbevölkerung suspekt – schon weil sie in keinster Weise den Erwartungen der Einheimischen an Europäer gerecht werden. Schlimmer noch, sie weigern sich, billige Souvenirs zu kaufen, laufen jede Strecke zu Fuß und geben grundsätzlich nie mehr als fünf Euro pro Übernachtung aus.
Der Offene
Katzenragout? Na klar, immer her damit! Der Offene probiert alle Nationalgerichte, lässt sich auf indische Hochzeiten einladen, die sich über zwei Tage erstrecken, er schläft im brasilianischen Dschungel im Baumhaus und schafft es als Einziger, sich konsequent an einheimischen Imbissständen zu ernähren, ohne von Montezumas Rache geplagt zu werden. Der Offene nimmt alles mit, hat einen Heidenspaß dabei und weiß nach der Reise zwar nicht mehr über die Welt als vorher, kann sich aber mit einer großen Weltkarte mit vielen kleinen Nadeln brüsten.
Der Besserwisser
Die Tropen könnten so schön sein – wenn nur die Leute nicht alles falsch machen würden! Italien ohne Italiener, wäre das nicht herrlich? Hier müsste nur mal einer …! Besserwisser erläutern den Bahnarbeitern am Bahnhof von Neapel, wie das mit dem An- und Abkoppeln richtig geht, verteilen Postkarten ihrer Heimatstadt und sind immer bereit, spontane Referate zu halten. Sogar großflächige Konflikte wie jene im Nahen Osten könnten sie lösen, wenn man sie nur ließe! In dieser Disziplin kämpfen Deutsche und US-Amerikaner um den Spitzenplatz.
Der Senior-Reisende
Italiener sind charmante Chaoten, Afrikaner sind »Neger« und Asiaten kann man sowieso nicht trauen: Das Weltbild älterer Reisender wird hier und da nicht mehr so ganz den aktuellen Gegebenheiten gerecht. Das wäre eine gefährliche Haltung, profitierten sie nicht von der Tatsache, dass gerade in den Ländern, die sie so schmählich beschimpfen, ältere Menschen meist sehr in Ehren gehalten werden und die Servicekräfte deshalb zähneknirschend aber lächelnd alle sprachlichen Ausrutscher tolerieren. Außerdem kaufen Senioren die fast echt persischen Teppiche aus dem überteuerten Souvenirshop und entfernen sich nie weit von den touristischen Pfaden. Dennoch: Im ganz normalen Alltag in der Fremde sind sie ein nimmer versiegender Quell an Peinlichkeiten. Die Senioren haben den höchsten Reiseleiterverschleiß, vor allem wenn eine pädagogische Laufbahn hinter ihnen liegt. Der Ausdruck »pensionierter Oberstudienrat« gehört deshalb zu den Schreckensvokabeln aller Tourguides.
Kolonialherren
Was wäre Afrika ohne die Franzosen, wo stünden die Inder heute ohne die Briten? Genau! Und mal ehrlich, war früher, in Deutsch-Kamerun und in der wilhelminischen Kolonie Tsingtau nicht sowieso alles besser organisiert? Die verkappten Kolonialherren sprechen grundsätzlich von »Chinks« wenn es um Chinesen geht, treffen »Pakis« in Pakistan und glauben noch immer fest an die Überlegenheit der weißen Rasse. In Sachen Fettnapf sind die Kolonialisten daher ganz oben mit dabei. Dass sie ihre Reisen meist ohne körperliche Schäden überstehen, liegt daran, dass sie vorrangig in der gehobenen Hotellerie verkehren und dort gut geschultem Personal begegnen, das seine Aggressionen abends am Sandsack auslebt, anstatt den Kolonialherren den Cocktail über den Kopf zu schütten.
Der Safari-Hut
Er reist stets gut vorbereitet und hat dennoch keinen Schimmer vom Reiseland: Der Safari-Hut erlebt die Welt als permanentes Abenteuercamp. Weil er jedoch immer mit Familie unterwegs ist, sinkt er vor Freude auf die Knie, wenn er doch überraschend in eine Situation gerät, in der er das Taschenmesser einmal ausprobieren darf.
Wie schlimm es um den Safari-Hut bestellt ist, erkennt man an der Anzahl der Taschen seiner Survivalweste und an der Straffung der hochgezogenen Tennissocken am nackten Bein. Auch am Schweizer Taschenmesser mit mindestens 20 Funktionen und der allzeit bereiten Taschenlampe ist er gut zu identifizieren. Ein fast zur Unkenntlichkeit zerfleddertes Deutsch-Englisch-Lexikon muss ebenfalls ins Gepäck. Trotzdem gehört er zur aussterbenden Spezies von Reisenden, die wirklich und allen Ernstes noch Sätze wie »When do I become a sausage« sagt. Von den Einheimischen wird er als willkommene Abwechslung betrachtet, als skurrile Laune der Natur, der man die diversen Fauxpas gerne ob ihres Unterhaltungsfaktors verzeiht.
Die Horde
Ob auf Mallorca oder in der Türkei, die Horde fällt im Ausland ein wie ein Stamm Termiten. Auf dem Weg vom Hotel in die Disko und zurück tapst die Horde nicht in Fettnäpfchen, sie walzt sie nieder! Tourismus-Profis der betroffenen Länder räumen daher vorher alle kulturellen Hürden aus dem Weg und lassen sie, natürlich gegen Bares, im kulturfreien Raum wüten. Außerdem haben Horden die seltene Gabe, sich auch betonverkleidete Strände schönzusaufen, dafür mag man sie in der Touristik ganz besonders. Verirrt sich ein Hordenmitglied versehentlich allein ans Tageslicht, ist sein Weg gepflastert von Fehlverhalten, da ihm jegliches Wissen über Land und Leute fehlt. Woher sollte er das auch haben, zu Hause glänzt er ja auch nicht gerade mit Raffinesse und Intellektualität. Sprachlich haben Hordenmitglieder jedoch wenig Probleme: Nach dem zweiten Eimer Sangria versteht man sie sowieso nicht mehr, egal in welchem Idiom.
Austauschschüler
Blutjung, rudimentäre Sprachkenntnisse und wenig Welterfahrung: Austauschschüler haben quasi ein Abonnement für Blamagen und Fettnäpfchen. Was nicht daran liegt, dass sie besonders dumm sind. Sollten sie sich in der ungewohnten Umgebung wider Erwarten gut anstellen, geben ihre neuen pubertierenden Freunde alles, um sie doch noch zum nächsten Fauxpas zu lotsen. Beliebt und bewährt sind Tricks wie obszöne Ausdrücke oder Gesten als vermeintliche Grußformel auszugeben (Wenn du im Laden was kaufst, sag einfach »Va te faire foutre« dazu, das sagt man bei uns in Frankreich so) und Ähnliches. Dank des G8-Abiturs und der allgemeinen Straffung der Studienzeiten zählen auch die nunmehr blutjungen Auslandsstudenten seit Kurzem wieder zu dieser Spezies.
Falls Sie sich in dieser Klassifikation nicht wiederfinden, kann das zwei Gründe haben: Entweder sind Sie einfach unauffällig und nett und tappen deshalb auch nur selten in Fettnäpfchen, oder Sie wissen nicht, dass Sie zu einer dieser Gruppen gehören. Sicher ist: Wer glaubt, eine Auslandsreise ohne Fauxpas bewältigt zu haben, war mit großer Wahrscheinlichkeit einfach nicht sensibel genug, die ungläubigen Blicke und das Gekicher der Einheimischen wahrzunehmen. Versprochen!
So blamieren Sie sich richtig!
Echten Globetrotteln gelingt es mühelos, die Charakteristika mehrerer Unterspezies auf sich zu vereinen – wer hat gesagt, dass man nicht doppelt trotteln darf? Zum Beispiel Hordenmitglieder, die wie Kolonialherren auftreten, Austauschschüler mit Adaptionisten-Tendenzen, Vielreisende, die selbstverständlich auch auf Pauschalreisen mit Safariausrüstung unterwegs sind, und so weiter und so fort …
Du und ich: Die erste Begegnung
Fettnapf 1: Sich verbeugen | Fettnapf 2: Die Hand schütteln | Fettnapf 3: Beides gleichzeitig tun | Fettnapf 4: Sich in die Augen schauen
»Sie sehen aus, als ob Sie gleich ins Bett wollten«, ließ Prinz Philip, Duke von Edinburgh, im Jahr 2003 den nigerianischen Präsidenten Olusegun Obasanjo wissen, als dieser ihn bei einem Staatsbesuch vor Ort im traditionellen Gewand begrüßte. Mit diesem unschlagbaren Intro zementierte der Ehemann von Queen Elisabeth nicht nur seinen Ruf als »Prinz Peinlich«, sondern demonstrierte auch gleich noch, dass sich selbst die höflichen Briten hier und da im Ton vergreifen (obwohl man auf der Insel gerne auch die deutschen Vorfahren Prinz Philips dafür verantwortlich macht). Über das weitere Gespräch ist nichts übermittelt, beste Freunde sind Prinz Philip und Präsident Obasanjo aber wahrscheinlich nicht geworden.
Immerhin braucht Obasanjo die Bemerkung nicht persönlich zu nehmen, denn dies ist nicht Prinz Philips erster verbaler Ausrutscher gewesen: Ebenfalls gerne erinnert man sich in Großbritannien an seinen Besuch bei Helmut Kohl 1997, den er mit den Worten »Guten Tag, Herr Reichskanzler« einläutete, oder seine Frage an das schwarze Mitglied des House of Lords, Lord Taylor of Warwick, den er mit einem »Und aus welcher exotischen Ecke der Welt kommen Sie?« bedachte. (Was jedoch im Nachhinein wenig Beachtung fand, da sich besagter Lord in einem gigantischen Skandal diskreditierte, in dessen Folge er seine Anwaltszulassung verlor und wegen falscher Ausgabenabrechnungen im Knast landete.)
Alles in allem ist Prinz Philip der Beweis, dass man, bei effizienter Arbeitsweise, schon mit wenigen Worten zu Beginn einer Begegnung echte Zeichen setzen kann. Nur wenige Sekunden dauert es, bis sich Menschen bei neuen Bekanntschaften ein Urteil bilden, das fortan nur noch schwer umzustoßen ist. Der Grund dafür ist so einfach wie einleuchtend: Für den Menschen ist es seit jeher wichtig, Freund und Feind schnell zu unterscheiden, und zwar bevor einem die Keule über den Kopf gezogen wird. Ist der erste Eindruck erst versemmelt, braucht es viel Mühe und Aufwand, bis die Scharte wieder ausgebügelt ist.
Da dürfte es für Prinz Philip und all die anderen Menschen, die sich notorisch im Ton vergreifen, tröstlich zu wissen sein, dass das gesprochene Wort nur einen kleinen Teil des ersten Eindrucks ausmacht. Haltung, Mimik und Gestik spielen eine viel größere Rolle. Andererseits ist auch das keine wirklich gute Neuigkeit – denn wer kann schon von sich behaupten, all die Gesten zu beherrschen, die einen im jeweiligen Land zum Insider oder Outsider machen? Niemals wird es einem Europäer beispielsweise gelingen, eine perfekte japanische Verbeugung hinzubekommen, deren Winkel je nach der eigenen Position und der des anderen sowie dem Alter und anderen sozialen Aspekten variiert. Und wer weiß schon, dass man in Schwarzafrika niemandem (schon gar nicht dem Vorgesetzten!) direkt ins Gesicht blicken sollte? Wo die US-Amerikaner im festen Blick Charakterstärke erkennen, sehen viele Afrikaner schlicht Unverschämtheit. Andersherum sind vermeintlich schüchterne Sambier oder Südafrikaner, die bei der Begrüßung eines Fremden aufmerksam dessen Schuhe studieren, einfach nur höflich.
Auch die gelungene Maori-Begrüßung des Hongi dürfte dem Ortsfremden schwerfallen: Dabei werden Stirn und Nase aufeinandergedrückt (gegenseitig versteht sich!), sodass man den Atem des anderen spürt (und JA, es gibt Touristen, die versuchen das allen Ernstes nachzuahmen und wundern sich, wenn sie dafür nicht gleich beim ersten Treffen mit einer Einladung in einen echten Maori-Haushalt belohnt werden).
So blamieren Sie sich richtig!
Ende der Leseprobe