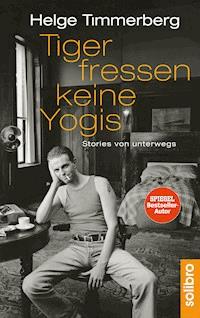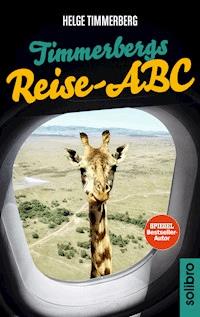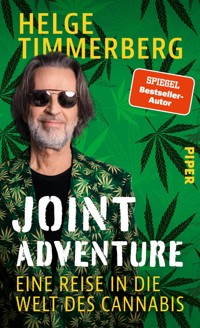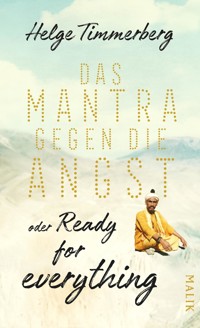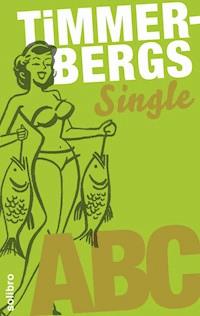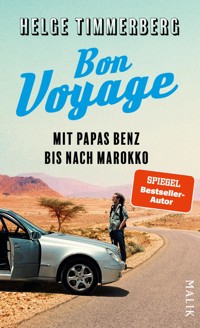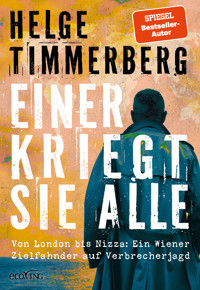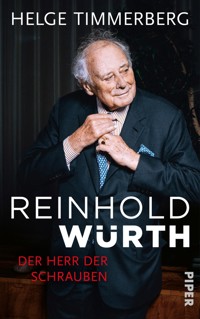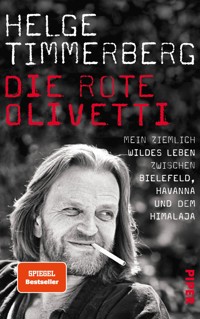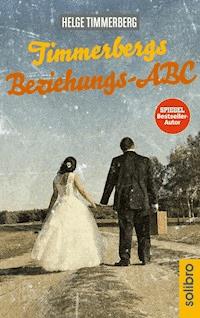9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Auf den Rücken eines Elefanten bekommt mich übrigens keiner mehr, solange es noch alternative Fortbewegungsmittel gibt, und was die ausgiebigen Schiffspassagen angeht, die bei meinem hochgeschätzten Vorbild eine so große Rolle spielen: Da muß ich ebenfalls passen. Die Romantik der christlichen Seefahrt ist in den Häfen zu finden, nicht dazwischen. Nee, Herr Verne, da werden wir nachbessern müssen. Aber noch etwas unterscheidet uns wesentlich: Einer von uns ist nie losgefahren. Und ich bin das nicht.» «Marco Polo und Thomas Cook würden dieses Buch lieben.» Stern «Um Abenteuerluft zu schnuppern, muß man nicht unbedingt wegfahren. Man kann auch einfach Helge Timmerberg lesen.» Cosmopolitan
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Helge Timmerberg
In 80 Tagen um die Welt
Illustriert von Harry Jürgens
Für Andreas Wald
PROLOG
Ein Mann stirbt und kommt in den Himmel. Es gefällt ihm da nicht sonderlich. Er geht deshalb zu Gott und sagt: «Hey Chef, nichts gegen dich und deinen Laden hier. Aber man hört so viel von der Hölle. Ich würde gern mal ’nen Blick einwerfen, nur für einen Tag. Geht das?» – «Klar geht das», antwortet Gott. Der Typ zieht gleich los, kommt zur Hölle und klopft an. Der Teufel persönlich macht ihm auf. Der Teufel sieht wie Elvis Presley aus. Glimmeranzug, Gelfrisur, und er spricht Englisch. «Brother», ruft er, «good to see you! Come in for a little sightseeing tour.» Der Teufel zeigt dem Typen end lose Strände mit Beach vol leyball, Cocktailbars und Sonnenuntergängen. «Alles klar», sagt der Gast. «Ich bin morgen wieder da. Ich muß nur noch schnell im Himmel auschecken.» Er eilt also zurück und teilt Gott seine Entscheidung mit. «Kein Problem», sagt Gott, «aber dieses Mal buchst du One-way, dieses Mal gibt es keine Rückfahrkarte.» Der guten Seele ist das scheißegal, sie packt ihren Kram und klopft am nächsten Tag wieder an der Hölle an. Und wieder macht der Teufel persönlich auf. Aber jetzt sieht er tatsächlich wie der Teufel aus. Ein ekelhafter, gräßlicher, mieser, durch und durch bösartiger Herr der Unterwelt steht mit Hörnern, Schwanz und Mundgeruch in der Tür. Und er nimmt den Gast auch nicht in den Arm, wie er es gestern zur Begrüßung tat, jetzt packt er ihn und zerrt ihn rein, und statt der Strände und Bikinimädchen sind nur noch Feuer und Folterknechte zu sehen, die Seelen am Spieß über den Flammen drehen. Schmerz, Schreie, Pein statt Reggae und Sonnenschein. «Hey Mann», sagt da der Typ zum Teufel, «wart mal ’nen Moment. Nee, wirklich, ohne Scheiß, das sah hier aber gestern ganz anders aus.» Der Teufel ist untröstlich: «Oh, yesterday, that was for tourists. This here is for residents.»
TEIL EINS
DIE DÄMONEN
1.Kapitel
Berlin– München
Das Wohnzimmer der einsamen Männer
Die Welt ist rund und kunterbunt, aber hin und wieder auch ungesund. Schon mal mit ’nem Heißluftballon geflogen? Sie lösen die Leinen, und das Ding geht nach oben wie ein Fahrstuhl. Ab fünf Meter beginnt die Höhenangst, ab fünfzig Meter die helle Panik. Der Korb, in dessen Rand ich meine Hände krallte, vermittelte die Sicherheit eines fliegenden Katzenklos. Vom Wind verweht und schockerstarrt, hoffte ich schwer, daß der Herr Pilot wußte, was er tat. Der Herr Pilot trug einen Cordanzug und war einer der reichsten Männer Deutschlands, weil er eine der reichsten Frauen Deutschlands geheiratet hatte. Der Schlaumeier zog an Schnüren und regulierte die Gaszufuhr für ein Feuerchen, das zwischen uns und dem Ballon brannte. Milliardenschwer entschwebte er mit mir auf die Augenhöhe von Wildgänsen. Und was ist, wenn jetzt so ein Schwarm auf Hitchcock macht? Krieg der Vögel. Eine Wolke spitzer Schnäbel jagt dem Ballon hinterher, und am Horizont dräut eine Gewitterfront. Wie man wieder runterkommt, erklärte der Cordpilot so: «Landung heißt bei uns kontrollierter Absturz.» Was soll’s, wenn es schiefgeht, reisen wir halt nicht in achtzig Tagen, sondern in achtzig Leben um die Welt. Der Korb knallt auf den Boden und kippt um. Du knallst gegen den Korb und kippst mit um. Danach ist die Ray Ban kaputt. Das ist Landen mit dem Heißluftballon.
Auf den Rücken eines Elefanten bekommt mich übrigens auch niemand mehr, solange es noch alternative Fortbewegungsmittel gibt, und was die ausgiebigen Schiffspassagen angeht, die bei meinem hochgeschätzten Vorbild eine so große Rolle spielen: Da muß ich ebenfalls passen. Die Romantik der christlichen Seefahrt ist in den Häfen zu finden, nicht dazwischen. Das Meer selbst ist langweilig oder, andere Möglichkeit, so romantisch wie Dauerkotzen. Oder, noch ’ne Möglichkeit, zu teuer. Zehnmal so teuer wie Fliegen. Nee, Herr Verne, da werden wir nachbessern müssen.
Auch bei der Route, wenn wir schon mal beim Mekkern sind, lohnt es sich hier und da, nicht in Ihre Fußstapfen zu treten. Was zur Hölle soll ich in Singapur? Bangkok ist gegenwärtig die Drehscheibe für Weltreisende in Südostasien. Ab Hongkong sitzen wir dann wieder in einem Boot. Aber noch etwas unterscheidet uns wesentlich: Einer von uns ist nie losgefahren. Und ich bin das nicht.
Den einen läßt der Herr in seinen Träumen reisen, die anderen schickt er in den ICE. 230km/h, aber das Betriebsgeräusch eines Puschen, Schienen statt Schicksal, und man kann sich bewegen. Ein großer Vorteil gegenüber dem Fliegen: Die ICE s fahren stündlich. Ich muß mich also nicht stressen. Und kann’s mir noch mal überlegen. Denn ich habe Angst. Ich will nicht los. Irgend etwas wird auf dieser Reise geschehen, irgend etwas, dem ich nicht gewachsen bin. Das sagt mir mein Gefühl. Eine Vorahnung? Ich schließe die Augen, um mich in das Gefühl fallen zu lassen. Ich hoffe auf Bilder. Und es kommt tatsächlich eins.
Ich sehe ein Gefängnis in Ägypten. Ein ziemlich mieses Loch mit Ratten und Ketten. Das Bild verflüchtigt sich wieder. Ein zweites steigt auf. Ein Bus in den Bergen von Laos. Schlechte Reifen auf schlechten Straßen, überladen und zu schnell in den Kurven. Ich öffne die Augen und weiß nicht, was das soll. Tief in mir spricht etwas, und ich verstehe es nicht. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, denke ich. Entweder du bleibst sitzen. Oder du stehst auf. Entscheide dich. Ich kann es nicht. Denn die Warnung ist genauso stark wie die Chance, die vor mir liegt. Eine Weltreise, immerhin. Ich flippe seit Jahrzehnten kreuz und quer über diesen Planeten, aber noch nie habe ich ihn mit einer Reise umrundet. Keine Zeit, kein Geld, keine Gelegenheit. Jetzt sind alle Türen offen, und jetzt sagt irgend so ein Arsch in mir: NEIN! BLEIB SITZEN! Ich suche nach einem Kompromiß, nach einer dritten Möglichkeit. Ein bißchen aufstehen, ein bißchen sitzenbleiben – gibt es das? Ja, man nennt es «probeweise». Geh einfach los, bis zum Taxistand kannst du es dir ja noch mal überlegen, und wenn du im Taxi sitzt, überlegst du es dir bis zum Bahnhof, und auf dem Bahnsteig bleibt wahrscheinlich auch noch Zeit, um eine anständige Entscheidung zu treffen.
Ich stehe auf, schnappe meinen Rucksack und gehe zur Tür. In der Tür drehe ich mich um. Was ich sehe, läßt mich nicht zur Salzsäule erstarren, so ist es nicht. Aber ähnlich. An der Wand hinter meinem Schreibtisch hängen Fotos und ein Filmplakat. Also Freunde und Idole. Zu den Freunden zählt ein Yogi aus Südindien, ein Yogi aus Nepal, eine Schriftstellerin aus Zürich, eine Sängerin, eine Malerin und Omar, vor dem Hotel «CTM» in Marrakesch. Die Idole sind Hermann Hesse und Klaus Kinski. Hesse klein, Kinski groß. Mit Cowboyhut und stahlblauen Augen. Normalerweise stahlblau. Jetzt scheinen sie an Farbe zu verlieren, zu verblassen, nicht nur die Augen von Klausi-Mausi, wie ich Kinski gerne nenne, wenn ich mit ihm alleine bin, alle Gesichter an der Wand wirken, als läge Nebel über ihnen. Und es ist mir, als würde ich ihre Botschaft verstehen:
«Du wirst uns nie wiedersehen, wenn du jetzt gehst.»
Erneut stehe ich vor zwei Möglichkeiten: Entweder du hörst auf ’ne Wand. Oder du hörst nicht auf ’ne Wand. Ich kenne diese Angst und sollte wissen, daß sie immer übertreibt. Tripper statt Tod, Sonnenbrand statt Pest, so war es doch bisher. Das unbestimmte, aber große Gefühl, auf der Reise seinem Schicksal zu begegnen, kam am Ende immer mit einer Lappalie daher, mit einer Berufskrankheit, mit irgendeinem Scheiß, für den es sich nicht gelohnt hat, Angst durchlebt zu haben. Also einfach weitergehen. Was heißt weiter? Wie wär’s mal mit losgehen, mit raus aus der Wohnung ins Treppenhaus? Ich sehe nach, ob ich wirklich die Heizung ausgestellt habe und alle Wasserhähne zugedreht sind. Dann bin ich endlich auf der Straße. Aber kein Hochgefühl überkommt mich, kein Zauber, der allem Anfang innewohnt, weht mich an. Kein Triumph, es wieder geschafft zu haben. Im Gegenteil: On the road again fühlt sich wie eine Niederlage an. Das ist doch schon mal ein guter Anfang.
Am Zug geht es wie inzwischen schon gewohnt weiter. Ich steige nicht ein. Mein Bauch sagt nein. Ich lausche diesem Nein seit fünf Minuten und kann das laut Fahrplan auch noch weitere fünf Minuten tun. Was lähmt mich, womit habe ich es hier zu tun? Wirklich mit den Warnungen der Intuition? Oder ist es nur Bequemlichkeit, und ich bin einfach zu alt für so etwas? Dieser Gedanke treibt mich rein. Kaum bin ich im Zug, verschwinden die paranoiden Vorahnungen wie ein Hausgeist, der einen noch unbedingt zum Bahnhof bringen wollte. Kein Grund zur Entspannung. Die Dämonen sind heute im Staffellauf unterwegs. Die Angst hat soeben an die Liebe übergeben. Mein Herz wird schwer. Mein Herz stellt Fragen. Bist du noch immer zu schön zum Heiraten? Warum hast du sie nicht mitgenommen?
Anders als das Alter schickt die Liebe ihre Dämonen nicht schon vor der Abreise, sie wartet, bis die Räder rollen. Aber dann: Film ab, Action, kleine Rebellion der Gefühle, die durchaus größer werden kann, wenn ich nicht sofort für ein Frauenmagazin darüber schreibe. Der Vorteil des kreativen Unglücklichen gegenüber dem unkreativen Unglücklichen ist, daß er mit seinem Unglück Geld verdienen kann. Bin ich unglücklich? Ich müßte eigentlich überglücklich sein. Weil frei. Endlich frei. Für achtzig Tage, achtzig Nächte, achtzig Betten. Und achtzig ist mehr als achtzig: Die 8, dreht man sie in die Waagerechte, ist das Zeichen für Unendlichkeit, die Null dahinter verzehnfacht die Rechnung, nein, ich müßte durch den ICE tanzen vor Überglücklichkeit. Statt dessen fällt mir ein, wie schön es wäre, wenn sie jetzt ein Brot und ein gekochtes Ei aus ihrer Tasche holen würde. Sie ist so eine. Sie gehört zu diesen altmodischen Frauen mit Reiseproviant. Und dann würde sie sich über die Kreuzworträtsel hermachen, die sie sich am Bahnhof gekauft hat. Sie kauft nie Frauenmagazine. Immer bloß Kreuzworträtsel. Weil sie schlau ist. Gott, warum habe ich sie nicht mitgenommen? Weil ich auch schlau bin. Traue keinen Gefühlen – aber ist nicht die Sehnsucht nach Freiheit ebenfalls nur ein Gefühl?
Ich sitze im ICE nach München, wo ich übernachten werde, die erste von achtzig freien Nächten, und überlege, ob ich in Hannover aussteigen soll, um den Zug zurück zu nehmen. Nach Hannover denke ich dasselbe über Göttingen, aber hinter den Kasseler Bergen wird der Wunsch schwächer. Erstaunlich, welche Wirkung natürliche Grenzen auf die Seele haben, selbst wenn es nur Mittelgebirge sind. Ja, was wäre denn, wenn ich es wirklich täte und mich nach einer Stunde, vielleicht auch schon nach zehn Minuten in ihren Armen die Erkenntnis überkäme, daß ich doch lieber frei sein will? Das ist mein Problem: das ewige Hin und Her, und da ich seit geraumer Zeit damit lebe, habe ich gelernt, damit umzugehen. Aussitzen ist die Devise, und in der Fränkischen Schweiz werde ich dafür mit einem spektakulären Sonnenuntergang belohnt. Ich komme auf andere Gedanken. Wie schön Deutschland ist. Leider habe ich nur noch zwei Zigaretten. Und es sind noch zwei Stunden bis München. Mit 230km/h bewege ich mich auf den nächsten Kiosk zu.
Es regnet, als ich aus dem Münchener Hauptbahnhof trete, und ich will nicht lange fackeln. Ich nehme das nächstbeste Hotel gegenüber. Es hat drei Sterne. Das Foyer ist leer, aus modernen Materialien und geschmacksneutral. Hinter der Rezeption steht ein müder Bayer. Fünf Minuten später bin ich in einem Zimmer, bei dessen Einrichtung wahrscheinlich der KGB ein Wörtchen mitzureden gehabt hat. Das Bett so schmal wie eine Pritsche, ein Stuhl, ein Tisch und grüne Wände, lackiert, damit man das Blut abwaschen kann. Ich werfe meinen Rucksack aufs Bett, gehe zum Fenster und sehe auf eine Straße, die gerade eine kalte Dusche nimmt. Es wird immer soviel darüber spekuliert, warum Menschen Drogen nehmen. Das Hotelgewerbe hat Antworten. Aber hat es auch Antworten darauf, wo ich Drogen bekommen kann? Ich meine, wer bin ich eigentlich? Hans im Glück? Habe ich ein sau-, ich betone, saugemütliches Schlafzimmer mit fleischgewordener Wärmflasche für so einen Scheiß verlassen? Und wofür verlasse ich dieses Zimmer? Was kommt als nächstes? Ein schmaler Etagenflur mit zweifelhaftem Bodenbelag, ein kalter, nackter, kleiner Fahrstuhl, das geschmacksneutrale Foyer von eben und dann raus auf die Straße und rein in den Regen. Quo vadis, stranger in the night? Nicht zu weit. Es regnet nicht nur, es ist auch kalt. Im Februar, in München, in der Bahnhofsgegend. Trotzdem verharre ich einen Moment, denn mir ist nicht ganz klar, ob ich mein Glück nach rechts oder nach links versuchen soll. Ich gehe schließlich mit dem Wind, der mich ziemlich geschwind nach rechts die Straße herunterpeitscht, vierzig Meter später setzen mich die Naturgewalten im Eingang einer Kneipe ab.
Die Frau hinter der Theke gefällt mir, aber das ist nichts Neues, das ist immer so und auch normal, daß Männer in Frauen ihre Mütter suchen. Ich bin der Sohn einer wunderschönen Kellnerin, und diese hier ist fast so schön wie sie. Sie ist übrigens die einzige Frau im Lokal. Alle Gäste sind Männer. Keine Homosexuellen, wie ich annehme, dafür sind sie zu uncool gekleidet und hören zu uncoole Musik. Oldies brettern aus der großen Musikbox, als ob es seit zwanzig Jahren, nee, seit dreißig, nichts anderes mehr gegeben hätte. Dazu trinken sie Bier und spielen Darts oder trinken Bier und singen mit oder trinken Bier und schweigen. Ich mache gleich mit. Hier sind Männer ohne Frauen, die nicht wollen, was sie kriegen, und nicht kriegen, was sie wollen. Der Gott der Bayern gab ihnen das Paulaner Weizen zum Trost. Ein trockenes Plätzchen, ein einheimisches Bier, «Hotel California» für alle. Und das rhythmische Klack-klackklack der sich in die Zielscheibe bohrenden Pfeile wirkt wie ein Metronom für die Trance, in die ich gleite. Draußen streunen Scheinwerfer durch den Regen, drinnen quillt Hefe durchs Gehirn, und nachdem der Alkohol zu wirken beginnt, fühle ich mich plötzlich wieder so allein, aber so angenehm allein, angenehm im Sinne von «so muß das sein». So ist das Leben. Wir tauschen Gold gegen ein Pferd und ein Pferd gegen einen Esel. Der Esel neben mir greift zu seinem Handy, weil es bellt. Irgendein Mensch, so bescheuert wie ein Murmeltier, quatscht ihn voll, und der Typ tut so, als sei er begehrt. Ich bin im Wohnzimmer der einsamen Männer. Und fahre morgen nach Venedig. Was ist so schlecht an diesem Leben? Schlecht ist, wenn man trinkt ohne Regeln. Die wichtigste Regel ist, daß du gehen mußt, bevor dich die Putzfrau rausfegt. Ich halte mich daran. Und laufe wieder durch den Regen, jetzt aber beschwingter. Vor mir sind die großen Berge, hinter mir heulen Sirenen.
2.Kapitel
Venedig
Double Check im Karneval
Hannibal hat die Alpen bezwungen, die Kimbern und Teutonen haben die Alpen bezwungen, und auch ich habe die Alpen bezwungen, aber im Gegensatz zu den Erstgenannten bezwang ich sie viele Male. Um einer weiteren Abnutzung der Eindrücke vorzubeugen, kaufe ich am Bahnhof drei Romane. Der erste handelt von der Liebe zwischen einem Arzt und einer Kellnerin, die nicht besonders erfreulich verläuft; erst als sie einen Hund anschaffen, geht’s etwas besser. Mit diesen guten Nachrichten fahre ich in Bozen ein. Nach Bozen erkrankt der Hund an Krebs, nach Verona stirbt er, und einen Halt vor Venedig sind in dem Buch alle tot. Wie an jeder Station vorher nutze ich auch hier die Pause, um auf dem Bahnsteig eine Zigarette zu rauchen. Etwa die Hälfte der Mitreisenden macht es wie ich. Dabei haben wir alle fest den Schaffner im Blick, der ebenfalls auf dem Bahnsteig steht und raucht. Er braucht seine Trillerpfeife nicht mehr. Sobald er seine Zigarette wegwirft, steigen wieder alle ein. Erste Reiseerkenntnis: Die italienischen Züge halten immer für genau eine Zigarettenlänge.
Zurück zu Milan Kundera. Die unerträgliche Leichtigkeit seiner Sprache gehört zur Kategorie der Opiate. Sie schafft Frieden mit allem. Mit den Russen (Prager Frühling), mit der Schwäche (Liebe aus Mitleid), mit perversen Sexualpraktiken (Facesitting), und zu Venedig ist eigentlich nur folgendes zu sagen: Es wird immer soviel darüber geschrieben, daß die alles zuscheißenden Tauben auf dem Markusplatz zu einer Plage geworden sind und nicht gefüttert gehören. Warum schreibt man nicht dasselbe über die Touristen? Die Bahnhofshalle von Venezia Santa Lucia ist so voll mit Menschen, daß es schwerfällt, die Ausgänge zu finden, und draußen fällt’s schwer, irgendwas vom Canal Grande zu sehen, außer den abertausend Touristen, die am Canal Grande stehen; auch fällt es schwer, hier zu gehen, so dicht gedrängt stehen sie. Und alle tragen Masken, Augenmasken, Gesichtsmasken, Masken am Stiel, und weil die meisten Masken spitze Nasen haben und die meisten dazu lange, schwarze Umhänge tragen, muten die Touristenscharen auf der linker Hand liegenden Brücke wie eine Prozession vogelgesichtiger Dämonen an. Ich bin also zufällig in den Karneval geplatzt. Wie blöd ist das eigentlich?
Richtiges Timing ist die halbe Miete. Und wenn man nicht vor der Frage zurückschreckt, was richtiges Timing ist, verliert der Satz sofort das billige Parfüm der Platitüde. Die einen sagen, richtiges Timing macht nur der Zufall, weil nur der Zufall eine Botschaft hat. Die anderen sagen, richtiges Timing ist ausführliche Recherche, sorgfältige Planung, frühes Buchen und ein unbeugsamer Wille. Ich gehöre zu der ersten Fraktion. Und ich hatte den Rummel vergessen. Während des Karnevals verändert sich das ohnehin schon bizarre Mischungsverhältnis zwischen Gästen und Gastgebern (3:1) in Venedig noch mal total. So total, daß man nicht mehr von einer Mischung reden kann. Die Gastgeber fehlen. Sie flüchten seit Jahren vor dem Karneval zu Verwandten aufs Festland oder zu den Stränden der Karibik, sie flüchten auch nach Marokko und Tunesien, und im Grunde ist es ihnen egal, wohin sie flüchten. Hauptsache, raus aus Venedig. Zweihunderttausend Touristen pro Tag, und alle Männer wollen Casanova sein und alle Frauen geile Hofdame, das halten die Leute hier einfach nicht aus. Karneval in Venedig ohne Venezianer. Hinter jeder zweiten Maske ist ein Japaner. Hinter jeder ersten ein Amerikaner.
Die wenigen Venezianer, die bleiben, weil sie Maskenverkäufer, Kellner und Hotelangestellte sind, lassen sich das teuer bezahlen. 6,80Euro für zwanzig Minuten Internet, 12Euro für den Cappuccino am Markusplatz, 18,90Euro für zwei Spiegeleier mit Pommes frites am Stadtrand, und was das letzte freie Zimmer im Hotel «Marco Polo» kostet, mag ich den Mann an der Rezeption gar nicht fragen. Muß es aber. Der Mann trägt eine Uniform mit goldenen Kordeln, eine Goldrandbrille und ein Lächeln, das eigentlich schon freches Lachen ist, und während ich noch mit mir ringe, ob ich ihn nun nach dem Zimmerpreis fragen soll oder nicht, sehe ich in diesem Lächeln seine Gedanken niedergeschrieben. Etwa folgender Text: Hör zu, du bescheuerter Teutone, wir haben euch und die Kimbern schon 101 vor Christus in der Poebene geschlagen, wir haben auch die Goten, Vandalen, Langobarden und Cherusker geschlagen, bis zu Theoderich dem Großen haben wir letztlich alles geschlagen, was über die Alpen gekommen ist, und ab Karl dem Großen nehmen wir euch aus. «Das Zimmer kostet 330Euro, ohne Frühstück», sagt er laut.
Hotelzimmer werden mit Liebe oder mit Haß eingerichtet. Die mit Liebe eingerichteten sind auch nicht immer ungefährlich, denn nicht alle Liebenden haben Geschmack. Und nicht alle Hassenden sind geschmacklos. Das KGB-Zimmer zum Beispiel, das ich gestern nacht in München hatte, das war Haß MIT Geschmack. Weil das Bild in sich stimmte. Haß ohne Geschmack sieht dann so aus wie das Zimmer 107 des «Marco Polo». Hier stimmt nichts mehr. Der Raum ist lang, hoch und sehr, sehr schmal; er mutet eigentlich wie die Hälfte oder, let’s face it, wie das Drittel eines ehemals großen und normal geschnittenen Zimmers an, durch das man wahllos Mauern gezogen hat, um es dreifach zu vermieten. So ein Schlauch ist, ich weiß, immer schwer einzurichten, selbst mit gutem Willen. Man müßte es minimalistisch probieren, wenig Möbel, schönes Holz, mönchsklausenhaft. Statt dessen haben sie ihn über Jahre mit allem vollgemüllt, was woanders im Wege stand. Sperrmüll, aber King-size. Mehr gestaut als abgestellt. Feng-Shui ist kein Quatsch: Das bringt böse Stauenergien. Und man kann sich dem nicht einmal durch einen Blick aus dem Fenster entziehen, denn einen halben Meter hinter dem Fenster ist nur die nächste Hauswand zu sehen. Mauern, Müll und keine gerade Linie, die Ewigkeit suggeriert, kein sanfter Bogen, der harmonisiert, kein Kreis, der Tiefe schafft. Sobald man dieses Zimmer betritt, ist Krieg.
Ich stelle meinen Rucksack ab und setze mich aufs Bett. Es gibt Zimmer, die man mit Meditation umdrehen kann. Dieses nicht. Es gibt Zimmer, die man mit Lesen vergessen kann. Dieses nicht. Hier geht wieder nur eins: saufen, saufen, saufen. Irgendwo da draußen. Egal was und so viel, daß ich sofort einschlafe, wenn ich nachher wieder aufs Bett falle, aber nicht so viel, daß ich vorher noch kotzen muß. Das ist ein guter Plan.
Ich brauche auch nicht weit zu gehen. Gleich neben dem Hotel findet sich eine nette, kleine Bar mit ein paar Tischen auf der Gasse für die rauchenden Gäste. Drinnen ist «No Smoking Area». Ich beginne mit ein paar Weißweinschorlen, um nicht zu früh den Löffel abzugeben, denn dann werde ich auch zu früh wieder aufwachen, und die Vorstellung, in dieser wie die Hölle proportionierten Venedig-Kitsch-Gruselkammer, sagen wir, so gegen drei oder vier Uhr plötzlich die Augen aufzumachen und sie bis zum Morgengrauen nicht mehr zuzukriegen, läßt mich das alles hier nicht zu locker sehen. Das disziplinierte, konzentrierte, mathematische Besaufen ist es, um das es mir geht. Also dreimal Wein mit Wasser, um das Blut aufzuwärmen, dann zwei, drei Stunden Wein ohne Wasser und schließlich einen oder, wenn nötig, zwei Caipirinhas als Vollstrecker. Genauso wird es gemacht. Die Masken der Nacht flanieren dazu, wie gehabt, im Dutzendpack Schulter an Schulter durch das Gäßchen, in dem ich sitze. Immer die gleichen Masken. Immer Casanova. Warum wollen hier eigentlich alle der größte Liebhaber der Welt sein? Warum reicht nicht Pirat, Scheich oder der Glöckner von Notre-Dame? Warum müssen sie unbedingt in die Rolle eines Mannes schlüpfen, der weit über tausend Frauen mehrfach befriedigt hat? Was ist so toll daran?
Aber irgendwann, als ich schon ziemlich betrunken bin, kommen doch noch zwei vorbei, die wie ich denken und den Casanovismus nicht mitmachen. Ein rotes Teufelchen mit Teufelshörnern und teuflischer Figur führt einen Mönch in Büßergewand am Kanal entlang. Als sie auf meiner Höhe sind, bleiben sie stehen und blicken mich an. Ich kann mir vorstellen, was sie sehen.
«Was ist denn bei dir schiefgelaufen?» fragt der Mann.
«Falsches Timing», antworte ich.
«Wie konnte das passieren?»
«Ich habe dem Zufall vertraut.»
«Zufall ist gut, Vertrauen ist schlecht», sagt der Mönch und setzt sich zu mir an den Tisch, während seine Begleitung ihre rote Korsage und rote Latexhose auf roten Stiefeletten in die Bar bewegt, um drei Wodka Red zu bestellen. «Vertrauen ist ein viel zu positiv besetztes Wort», fährt er fort, «Vertrauen ist das Schönreden von Unwissenheit. Und zwar Unwissenheit aus Nachlässigkeit. Vertrauen ist gefährlich. In meinem Beruf ist Vertrauen sogar ein Dienstvergehen.»
«Bist du Polizist?»
«Nein, Pilot.»
«Und sie ist Stewardeß?»
«Genau, und sie würde nicht mit mir fliegen, wenn ich nicht jede Funktion des Fliegers vorher kontrolliert hätte. Jede. Und das nicht einmal, sondern zweimal. Und du weißt, was das heißt, oder nicht?!» Bei «einmal» hatte der Mönch den Zeigefinger seiner rechten Hand gen Himmel gestreckt, bei «zweimal» auch den Mittelfinger.
«Peace», lalle ich.
«Nein», sagt der Mönch. «Bei uns heißt das nicht Peace und auch nicht Victory. Bei uns heißt das Double Check.»
Er hat recht. Sieg und Frieden sind keine Zufallsprodukte. Bei einem Double Check hätte ich mir nicht nur VOR dem Bezahlen das Hotelzimmer angesehen, sondern wäre auch bereits vor der Ankunft in Venedig über den Karneval informiert gewesen und gar nicht erst aus dem Zug gestiegen. Es gibt ja noch andere nette Städte in der Gegend, wie zum Beispiel Rimini.
«Und was machen wir jetzt?» fragt die Stewardeß im Freizeitdreß. Sie hat sich mittlerweile zwischen uns gesetzt. Ihr höllisches Dekolleté hypnotisiert mich. Träume ich? Phantasiere ich? Werde ich gleich auch weiße Mäuse sehen? Oder ist das wirklich kein Silikon? Der Mönch grinst.
«Wie wär’s mit einem Double Check?»
Nachdem das erledigt ist, wird die Nacht langsam schön. Der Fluß der Karnevalisten beginnt auszudünnen, es entstehen Lücken, und die Lücken mehren sich. In den Lücken ist Venedig. Kleine Gasse, kleiner Kanal. Zu meiner Rechten mündet die Gasse in ein Plätzchen und wird dann zum Treppchen, zu meiner Linken schlängelt sie sich ins Ungewisse. Ein Boot schaukelt vor dem gegenüberliegenden Haus, angeleint neben einer grünen Tür. Ich weiß, das ist nicht viel. Und ich weiß, das ist alles. Eine überschaubare Komposition aus Efeu, Glas und alten Steinen, verträumten Fenstern, versteckten Balkonen. Ein Venedig-Atom, ein Bühnenbild. Und was für ein Stück wird hier aufgeführt? Genau das wird zum Problem. Es gibt Schönheit, die man durchaus allein genießen kann, wie die Schönheit der Musik oder die Schönheit eines Sonnenuntergangs, aber die Schönheit von Venedig gehört nicht dazu. Die ist nur als Paar begehbar. Aus Gründen, die mein historisches, kulturelles und architektonisches Wissen übersteigen, haben bei dem Bau dieser Stadt Reichtum, Geschmack und Sehnsucht etwas vollbracht, das Liebende selig und Alleinreisende kreuzunglücklich macht. Singles werden hier zu Schatten, die geisterhaft verloren an den Lagunen stehen und ihre Sünden bereuen. Eine Liebe zu verlassen ist eine Sünde.
3.Kapitel
Triest
Rilke à Go-go
Jede Stadt hat einen Tick. Irgendeine Eigenart, die es in keiner anderen Stadt gibt. Oder es gibt in ihr etwas nicht, was es sonst überall gibt. In Triest gibt es keine Internetcafés. Ich frage jetzt zum x-ten Mal einen Triester danach und weiß schon vorher, was er sagt. Und wie er es sagt. Entweder wie ein Nichtraucher die Frage nach Feuer verneint oder wie einer, der die Frage nicht versteht. Internetcafé? In Triest?! Weil ich es nicht glauben kann, gebe ich es nicht auf zu fragen und naß zu werden. Es regnet. Es ist Februar. Es ist an der Zeit, ein Bett zu finden. Darum will ich ins Internet. Nach meinen Erfahrungen der letzten Nächte möchte ich ganz gern mal auf Nummer Sicher gehen; auf Google und «Hotels in Triest». Außerdem will ich Busverbindungen nach Slowenien finden. Ich habe die Route geändert. Das ziemlich konsequente Rauchverbot in Italien hat mir das Sehnsuchtsland der Deutschen schwer erträglich gemacht. In Ex-Jugoslawien, so mein Kalkül, wird das besser. Und ich bin sicher, der gute alte Jules Verne hätte das ähnlich gesehen.
Die Fahrt von Venedig nach Triest war übrigens sehr schön, drei Stunden mit dem Zug am Meer entlang, Pinienbestand. Ich habe ein Lustschlößchen entdeckt, und, um ehrlich zu sein, der Anblick dieser barocken Immobilie hat mich fast aus dem Sitz gerissen, die Nase klebte an der Scheibe, und da war ein Geräusch, tief in meiner Seele, und das Geräusch hörte sich in etwa so an: Klick. Alles schön und gut. Aber warum gibt es in Triest kein Internet?
Abgesehen davon erinnert mich die Stadt an Wien. Allerdings an ein Wien nach der Klimakatastrophe, und man kann sagen, dieses Wien hat Glück gehabt, denn es liegt jetzt am Meer. Man kann aber auch sagen, dieses Wien hat Pech gehabt, denn es gibt keine Internetcafés mehr. Die Wahrheit ist natürlich weniger spektakulär. Triest wurde zu großen Teilen von den Österreichern gebaut, als Österreich noch eine europäische Großmacht war und kein zwergenhafter Operettenstaat. So kam ein Kaiser zu einem Seehafen und eine Uferpromenade zu k.u.k. Architektur. Prachtbauten, aber cool. Man kriegt keinen Liebeskummer von ihrem Anblick. Und man muß sie auch nicht unbedingt off-season sehen. Der internationale Massentourismus ist schlauer als ich. Im Gegensatz zu Venedig bin ich in Triest der einzige Gast zur Zeit; wahrscheinlich der einzige, meine Hand dafür ins Feuer legen will ich nicht. Aber bisher habe ich noch keinen anderen gesehen, und die Fassaden der Grandhotels sind mit Planen abgedeckt. Manche Hotels haben ihre Fenster, wie es scheint, sogar zugenagelt, nein, die Post ab geht hier im Februar nicht. Es ist ziemlich windig, und der Regen wird immer stärker, und ich habe, ich erwähnte es möglicherweise noch nicht, durchaus auch Gepäck. Sturmgepäck könnte man langsam sagen. Das Wetter entwickelt sich indiskutabel.
Ich gehe deshalb zum Ausgangspunkt meiner Internetcafé-Odyssee zurück und nehme das Bahnhofshotel, also das erste Hotel, das ich gesehen habe, als ich aus dem Zug gestiegen bin. Das hätte ich trockener haben können. Die junge Frau an der Rezeption reagiert überrascht. Wahrscheinlich hat sie seit dem letzten Herbst, der ein besonders goldener war, keinen Gast mehr gesehen. Die bange Frage, ob sie ein freies Zimmer haben, beantwortet sie mit: «Wir haben ein freies Hotel.» Ich kann mir aussuchen, was ich will. Nun, ich will ein Einzelzimmer, das wie ein Doppelzimmer wirkt, weil ich a) große Zimmer mag und b) mit kleinem Budget reise. Sie versteht das total, auch wenn es gelogen ist. Das Budget ist okay. Ich weiß nur noch nicht so genau, was in den durchgeknallten Megametropolen Südostasiens an Spesen auf mich zukommt. In Hongkong, Shanghai, Tokio. Oder, besser, ich weiß es zu genau. Und habe einen Durchschnitt errechnet. Gestern lag ich für ein mieses Zimmer weit darüber, heute zahle ich für ein gutes weit darunter. Ein gutes? Ich wollte ursprünglich nicht unbedingt und durchgehend Hotelzimmer thematisieren, aber langsam ergibt es Sinn. Ich kann diese Leute einfach nicht verstehen, die ein Hotelzimmer ausschließlich als Übernachtungsmöglichkeit sehen, reduziert auf ein sauberes Bett, auf Licht aus und schlafen gehen. Was soll das? Setzt in fremden Städten und fernen Ländern das Bedürfnis nach einem Rückzugsort aus? Nach einem Ruhepol? Nach einem Zuhause? In dem man auch tagsüber mal sitzen kann? Das richtige Hotel gehört zu den Grundpfeilern eines erfolgreichen Urlaubs, und wer einen Welturlaub macht und Tag für Tag ein neues braucht, schult sich entweder in dieser hohen Kunst des Reisens, oder er geht vor die Hunde. Seelisch, emotional, finanziell. Und ich hab’s kommen sehen. Das Zimmer im Bahnhofshotel von Triest ist leider auch nicht der Hit. Groß genug, ja, es gibt sogar einen Balkon mit Blick auf die Straße und auf einen begrünten Platz. Zum Problem wird hier das Holz. Ich bin keine Mimose, ich habe nur Allergien. Etwa gegen Fichte. Und was den Ausblick vom Balkon angeht: Ich sagte es bereits, es regnet Bindfäden.
Und ich habe Hunger. Natürlich hat das Hotelrestaurant geschlossen und das Restaurant neben dem Hotel auch, und auch das Restaurant daneben. Wieder irre ich durch die Straßen und werde naß, ja, noch unangenehmer, werde schwach. Es ist erst der dritte Abend meiner Reise, und schon stehe ich draußen vor allen Türen. Wo soll das enden?
Es endet vor einem kleinen Weinlokal, an den Stehtischen für Raucher. Dort trinken, von einer Jalousie gegen das Wetter geschützt, ein paar gutgekleidete Italiener und ein kleiner Spanier. Die Italiener sind sympathisch, aber zurückhaltend; der Spanier ist unsympathisch, aber aufdringlich. Er hat hier bereits alle vollgequatscht, jetzt bin ich dran. Er kommt aus Katalonien, er ist Schiffsingenieur, morgen früh läuft sein Frachter wieder aus. Als er hört, daß ich Deutscher bin, löst das einen Freudentaumel bei ihm aus. «Alemania, España, Italia!» ruft er und nimmt rechts und links in den Arm, was er kriegen kann. «Good friends, good Europe!», und dann will er alle aus seinem Weinglas trinken lassen, aber keiner nimmt die Einladung an. Er kriegt’s nicht mal mit. Er ist besoffen und blöde und, wie sich bald herausstellt, trotz seiner EU-Euphorie ein Faschist. Und doch stehe ich mit ihm an einem Tisch. Und rede mit ihm. Ergebnis: Ich fühle mich besser. Gott, wie demütigend, denke ich, als ich wieder allein über das nasse Kopfsteinpflaster zurück zum Hotel gehe. Wie beschissen einsam muß einer sein, daß ihm selbst so ein Gespräch Kraft gibt?
Am Morgen werde ich wach und bin plötzlich fünfundfünfzig. Aber klar, man ist ja immer nur so alt, wie man sich fühlt. Ich fühle mich wie fünfundsechzig. Trotzdem, ich habe Geburtstag, und es gibt Geschenke. Ich brauche sie nicht auszupacken, ich brauche nur rauszugehen. Das erste Geschenk ist Sonne. Triest mit blauem Himmel und blauem Mittelmeer. Das zweite Geschenk ist Internet. Im Hotel! Die Frau an der Rezeption verrät mir, wo sie es versteckt haben, aber nicht, ohne mich zu ermahnen, es nur kurz zu nutzen, zehn Minuten, länger nicht. Langsam bekomme ich ein schlechtes Gewissen und, was noch fataler ist, gewöhne mich daran, weil sich der Mensch an alles gewöhnen kann. Nach einem Jahr in Triest würde ich wahrscheinlich auch jeden Tag schwitzend vor Scham im Beichtstuhl sitzen: «Pater, ich habe schwer gesurft!»
Aber die zehn Minuten reichen für das dritte Geschenk. Auf der offiziellen Homepage der Stadt finde ich unter Sehenswürdigkeiten den «Sentiero Rilke» oder auch den Rainer-Maria-Rilke-Wanderweg. Und: Klick. Zu Rilke habe ich eine besondere Beziehung, weil ich mal bei der «Bunten» gearbeitet habe und weil bei der «Bunten» in jenen Tagen eine ältere adelige Dame von irgendeinem See in Oberbayern jederzeit Zugang zur Chefredaktion hatte; sie saß da einfach nur rum und gab Kommentare ab. Zu meinen Geschichten sagte sie, so etwas habe sie zum letzten Mal bei Rainer Maria Rilke gelesen. «Komisch», sagte ich, «hat der Mann auch Drogen genommen?» Was soll man sonst sagen, wenn man Rilke nie gelesen hat? Ich bin kein großer Leser. Bis heute weiß ich nicht, was und wie er geschrieben hat. Aber ich weiß jetzt endlich, wie er gewandert ist. Also, was ihn inspiriert hat. Ich bin mit dem Taxi hingefahren, denn der Weg ist ein bißchen außerhalb von Triest. Und das vierte Geschenk an meinem fünfundfünfzigsten Geburtstag ist dann ’ne Tabledancebar. Ich würde am liebsten an dieser Stelle mal Demokratie walten lassen und die Leser befragen: Worüber soll ich en détail berichten? Über Rainer Maria Rilkes Spaziergänge an der Nordadria? Oder über schweißnasse Körper an Go-go-Stangen?
Na? Ich wußte es: Rilke!
Typisch Dichter, bevorzugte er den eher kurzen Wanderweg. Ich bin, obwohl ich langsam ging, in zehn Minuten an seinem Ende angelangt. Aber hübsch ist er. Meter für Meter bietet er einen spektakulären Ausblick auf die Bucht von Triest, also auf die nördliche Spitze der Adria, fast möchte ich sagen: Zunge der Adria, die mit jeder Welle hofft, an den Ausläufern der Alpen zu lecken, aber bis jetzt kommt sie noch nicht dran. Zu kleine Wellen, auf denen große Yachten schaukeln. Duften wird es im Frühling nach Kräutern jeder Art, auch die Bäume werden dann Parfüm auflegen, mitunter aufdringliches, doch im Februar hält man es aus. Was wird Rainer gedacht haben, als er hier im bewaldeten Steilhang lustwandelte? Scheißbuch? Warum habe ich damit angefangen? Oder hat der Poet Strategien ersponnen, wie er das Hausmädchen der Thurn und Taxis, deren Gast er war, ins Bett kriegt? Ihnen gehört das Lustschlößchen, das ich auf der Zugfahrt nach Triest gesehen habe. Und das hier das Ende des Rainer-Maria-Rilke-Wanderwegs markiert. Der Schlingel, vielleicht hatte er ja auch die Fürstin höchstpersönlich im Visier. Ich weiß, Visier ist ein Begriff aus der Waffentechnik und erscheint auf den ersten Blick als Vergleich unangebracht, wenn es um die Liebe geht. Aber was soll ich machen, ich bin kein Dichterfürst, auch nach diesem Spaziergang nicht. Der Rainer-Maria-Rilke-Wanderweg unterscheidet sich vom Jakobsweg nicht nur durch seine Kürze, sondern vor allem durch seine Reinkarnations-Resistenz. Schade eigentlich. Man stelle sich vor, ich hätte herausgefunden, daß ich die Wiedergeburt von Rilke bin, gerade jetzt und gerade hier, vor dem Eingang dieses unglaublich geilen Lustschlößchens, dessen aktuelle Hausherrin die Fürstin Gloria ist. Dann würde ich mich doch von privateproperty - und no-entry -Schildern nicht kirre machen lassen, sondern sofort meinen lieben Kollegen Alexander von Schönburg anrufen, weil er der Bruder von Fürstin Gloria ist. «Hör mal, Graf, wie siehst du das? Einmal Gast, immer Gast, oder?!»
Und nun zur Tabledancebar.
Weil der Weg ein so kurzer war, bin ich früher als geplant zurück in Triest, so gegen Mittag, und erkundige mich zunächst am Busbahnhof nach meinen Möglichkeiten für die Weiterreise. Die sind entspannt. Der Bus nach Slowenien fährt alle zwei Stunden ab. Trotzdem verpasse ich jeden. Um nur wenige Minuten, aber verpaßt ist verpaßt. Und jedesmal bin ich ganz froh darüber, daß ich den Bus verpaßt habe. Zwischendurch gehe ich spazieren und sitze vor Cafés in der Wintersonne. Das ist angenehmer, als im Bus zu sitzen, und ich habe ja auch jede Menge Zeit. Heute die Welt in achtzig Tagen zu umreisen verlangt nicht, wie zu Jules Vernes Zeiten, permanentes, pausenloses und zielstrebiges Voraneilen, heute braucht es das glatte Gegenteil, also ein gewisses Klebenbleiben. Eine gewisse Unentschlossenheit. Soll ich denn wirklich mit dem Bus durch Ex-Jugoslawien, obwohl ich in Wahrheit keine Busfahrten mag? Oder doch lieber mit dem Nachtzug nach Süditalien, im Schlafwagen würde ich das Rauchverbot kaum mitkriegen.