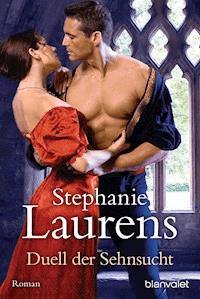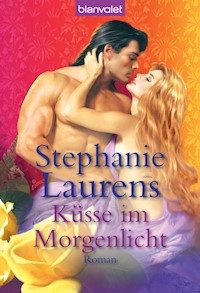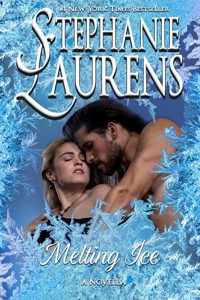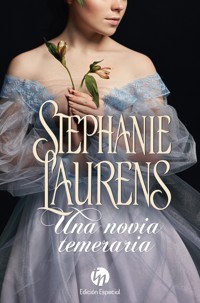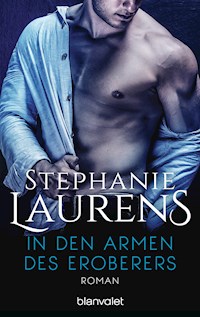
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cynster
- Sprache: Deutsch
Romantisch, sexy, gefühlvoll - für alle Fans von Bridgerton!
Somersham, 1818: Blitze zucken, Donner grollt, die Hufe eines mächtigen schwarzen Hengstes verfehlen sie nur um Haaresbreite – was allein der meisterhaften Beherrschung des pechschwarz gekleideten Reiters zuzuschreiben ist. Die vierundzwanzigjährige Honoria Wetherby ist überzeugt, vom Teufel höchstpersönlich gerettet worden zu sein. Dabei wollte sie gerade selbst einem verletzten Mann helfen, den sie am Wegesrand entdeckt hatte. Ohne jegliche Debatten übernimmt der unheimliche Mann mit den merkwürdig grün schimmernden Augen das Kommando – und bringt Honorias ehrenvolles Leben gewaltig durcheinander.
Ein historischer Liebesroman voll knisternder Sinnlichkeit, herrlichem Witz und atemberaubender Spannung von der Erfolgsautorin Stephanie Laurens!
»Dieser Roman ist Erotik pur!« Romantic Times
Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick
Band 1: In den Armen des Eroberers
Band 2: Der Liebesschwur
Band 3: Gezähmt von sanfter Hand
Band 4: In den Fesseln der Liebe
Band 5: Ein unmoralischer Handel
Band 6: Nur in deinen Armen
Band 7: Nur mit deinen Küssen
Band 8: Küsse im Mondschein
Band 9: Küsse im Morgenlicht
Band 10: Verführt zur Liebe
Band 11: Was dein Herz dir sagt
Band 12: Hauch der Verführung
Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide
Band 14: Sturm der Verführung
Band 15: Stolz und Verführung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
STEPHANIE LAURENS
In den Armen des Eroberers
Roman
Aus dem Englischen von Elisabeth Hartmann
Buch
Blitze zucken, Donner grollt, die Hufe eines mächtigen schwarzen Hengstes verfehlen sie nur um Haaresbreite – was allein der meisterhaften Beherrschung des pechschwarz gekleideten Reiters zuzuschreiben ist. Die achtzehnjährige Honoria Wetherby ist überzeugt, vom Satan persönlich gerettet worden zu sein. Dabei wollte sie doch gerade selbst einem jungen, verletzten Mann helfen, den sie am Wegesrand entdeckt hatte. Ohne jegliche Debatten übernimmt der unheimliche Mann mit den merkwürdig grün schimmernden Augen das Kommando – und bringt Honorias ehrenvolles Leben gewaltig durcheinander. Ihren derzeitigen Beruf der Gouvernante betrachtet sie zwar selbst nur als Zwischenlösung, bis sie als Abenteuerin die Welt erobern wird, doch nun kommt das Abenteuer früher, als ihr lieb ist. Dummerweise kompromittiert dieser umwerfende Fremde sie nämlich, indem er sie in die trockene Wärme eines einsamen Häuschens mitnimmt – schlimm genug. Doch was nun folgt, läßt Honoria aus allen Wolken fallen: Nicht nur, daß dieser sinnliche Kerl niemand anderer ist als der berüchtigte Frauenheld Devil Cynster – er will sie zudem auch noch zu seiner Frau machen! Honoria kann sich nicht entscheiden zwischen ihrem Freiheitsdrang und dem verlockenden Angebot …
Autorin
Stephanie Laurens begann zu schreiben, um etwas Farbe in ihren trockenen wissenschaftlichen Alltag zu bringen. Ihre Romane wurden bald so beliebt, daß sie aus ihrem Hobby den Beruf machte. Heute gehört sie weltweit zu den meistgelesenen und populärsten Autorinnen historischer Liebesromane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in einem Vorort von Melbourne/Australien.
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Devils’s Bride« bei Avon Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 1998 by Savdek Management Proprietory Ltd. Published by Arrangement with Savdek Management Ltd. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2003 by Wilhelm Goldmann Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Copyright © der Übersetzung 2000 by Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit der Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden. Satz: DTP Service Apel, Hannover E-Book-Umsetzung: GGP Media GmbH, Pößneck Verlagsnummer: 35838 LW ⋅ Herstellung: Heidrun Nawrot ISBN 9783641039912V002 www.blanvalet-verlag.de
1
Somersham, Cambridgeshire August1818
Die Herzogin ist so sehr … sehr … nun ja, sie ist einfach bezaubernd. So …« Mr. Postlethwaite, der Pfarrer von Somersham, vollführte mit engelsgleichem Lächeln eine vage Handbewegung. »So kontinental, wenn Ihr versteht, was ich meine.«
Honoria Wetherby stand am Zaun des Pfarrhauses, wartete darauf, daß ihr Wagen gebracht wurde, und wünschte sich nichts sehnlicher als eben das: zu wissen, was er meinte. Wenn sie eine neue Stelle antrat, bestand eine ihrer ersten Amtshandlungen gewöhnlich darin, dem Pfarrer des Ortes Informationen zu entlocken. Während sie in diesem Fall viel dringender Informationen benötigte als sonst, erwiesen sich Mr. Postlethwaites Bemerkungen leider als äußerst vage und nicht sehr hilfreich. Sie nickte ihm ermutigend zu – und griff den einen Punkt auf, der möglicherweise eine tiefere Bedeutung haben könnte. »Ist die Herzogin im Ausland geboren?«
»Die Herzogin-Witwe.« Mr. Postlethwaite strahlte. »So läßt sie sich inzwischen gern nennen. Aber im Ausland geboren?« Er neigte den Kopf ein wenig zur Seite und dachte scharf nach. »So könnte man es wahrscheinlich nennen – sie ist in Frankreich geboren und aufgewachsen. Aber mittlerweile ist sie schon so lange bei uns, daß sie ein Teil der Landschaft geworden ist. Im Grunde« – seine Augen leuchteten auf – »ist sie so etwas wie ein Lichtblick an unserem begrenzten Horizont.«
Soviel hatte Honoria nun schon in Erfahrung gebracht. Das war einer der Gründe, warum sie mehr wissen mußte. »Gehört die Witwe Eurer Gemeinde an? Ich habe nirgends ein herzogliches Wappen gesehen.« Sie warf einen Blick auf die hübsche steinerne Kirche hinter dem Pfarrhaus und entsann sich mehrerer Gedenksteine zu Ehren Verstorbener aus verschiedenen Herrschaftshäusern, einschließlich einiger Nachkommen der Claypoles, der Familie, in deren Haushalt sie am Sonnabend zuvor aufgenommen worden war.
»Gelegentlich nimmt sie am Gottesdienst teil«, erwiderte Mr. Postlethwaite. »Doch auf ihrem Besitz verfügen sie über eine eigene Kirche, eine besonders schöne sogar. Mr. Merryweather ist dort Kaplan. Die Herzogin ist sehr beständig in ihrem Glauben.« Traurig schüttelte er den Kopf. »Ich fürchte, das trifft jedoch nicht auf den Rest der Familie zu.«
Honoria wehrte sich gegen den Drang, mit den Zähnen zu knirschen. Von welcher Familie redete er? Seit drei Tagen schon wollte sie das herausfinden. Angesichts der Tatsache, daß ihre neue Arbeitgeberin, Lady Claypole, anscheinend überzeugt davon war, ihre Tochter Melissa, die sich zur Zeit unter Honorias Fittichen befand, wäre zur nächsten Herzogin ausersehen, erschien es ihr immens wichtig, über den Herzog und seine Familie soviel wie eben möglich in Erfahrung zu bringen. Schon der Familienname wäre eine große Hilfe.
Sie hatte sich aus freien Stücken nur selten unter den haut ton gemischt, doch dank der ausführlichen Briefe ihres Bruders Michael war sie bestens informiert über den jeweiligen Stand der Dinge in den Familien, die zu diesem illustren Kreis gehörten – der Kreis, in den sie hineingeboren war. Wenn sie nur den Namen herausbekam oder wenigstens den Titel, wußte sie schon bedeutend mehr.
Doch obwohl Lady Claypole am Sonntag eine geschlagene Stunde darauf verwendet hatte, in allen Einzelheiten zu erklären, warum Melissa zur nächsten Herzogin bestimmt war, hatte sie nicht ein einziges Mal den Titel des glücklichen Herzogs genannt. In der Annahme, es dürfte nicht schwer sein, ihn in Erfahrung zu bringen, hatte Honoria ihre Ladyschaft dann auch nicht ausdrücklich danach gefragt. Sie hatte die Frau ja gerade erst kennengelernt, deshalb erschien es ihr nicht sehr angebracht, ihre Unwissenheit zur Schau zu stellen. Nach der ersten Einschätzung Melissas und ihrer jüngeren Schwester Annabel schloß sie es aus, sie zu befragen; wenn sie ihnen gegenüber ihre Unwissenheit kundtat, würde sie sich nichts als Unannehmlichkeiten einhandeln. Aus demselben Grund hatte sie sich auch nicht an die Dienerschaft der Claypoles gewandt. In der Überzeugung, alles, was sie wissen wollte, während ihres Antrittsbesuchs beim Damenkränzchen des Ortes zu erfahren, hatte sie ihren freien Nachmittag genutzt, um eben diesen abzustatten.
Dabei hatte sie jedoch vergessen, daß der Herzog und die Herzogin-Witwe in der unmittelbaren Umgebung wohl immer nur mit diesen Titeln genannt wurden. Die Nachbarn wußten schließlich alle, wer gemeint wäre – nur sie immer noch nicht. Leider wäre eine schlichte Anfrage angesichts des unverhohlenen Spotts, mit dem die anderen Damen Lady Claypoles Aspirationen auf den herzoglichen Schwiegersohn abtaten, einfach zu peinlich gewesen. Heldenhaft hatte Honoria eine langwierige Konferenz zum Thema Spendensammlung für die Reparatur des uralten Kirchendachs über sich ergehen lassen und sich dann auch noch in der Kirche umgeschaut, um jedes Namensschild, das sie entdeckte, zu lesen. Alles vergebens.
Sie holte tief Luft und schickte sich an, ihre Unwissenheit einzugestehen. »Welchen …«
»Da bist du ja, Ralph!« Mrs. Postlethwaite watschelte geschäftig den Weg entlang. »Entschuldigt, daß ich Euch unterbreche, meine Liebe.« Sie lächelte Honoria an, bevor sie sich ihrem Gatten zuwandte. »Da ist ein Junge, er kommt von der alten Mrs. Mickleham – sie verlangt dringend nach dir.«
»Bitte schön, Miss.«
Honoria fuhr herum – und sah den Gärtner des Pfarrers, den übellaunigen Grauen am Zügel führend, den der Stallknecht von Claypole Hall vor ihren Wagen gespannt hatte. Honoria machte den Mund wieder zu, nickte Mrs. Postlethwaite freundlich zu und trat durch das Tor, das der Pfarrer ihr weit geöffnet hatte. Mit einem verkrampften Lächeln ergriff sie die Zügel und ließ sich vom Gärtner auf den Sitz helfen.
Mr. Postlethwaite strahlte. »Ich rechne am Sonntag mit Euch, Miss Wetherby.«
Honoria nickte majestätisch. »Es gibt nichts, was mich am Kommen hindern könnte, Mr. Postlethwaite.« Und, dachte sie und gab dem Grauen die Zügel, wenn ich bis dahin noch immer nicht weiß, wer dieser verdammte Herzog ist, lass' ich dich erst wieder gehen, wenn du es mir verraten hast!
Mit finsteren Gedanken fuhr sie durch das Dorf; erst als sie die letzten Häuser hinter sich gelassen hatte, merkte sie, daß etwas in der Luft lag. Sie hob den Blick und sah von Westen her Gewitterwolken herantreiben.
Beklemmung überkam sie und machte ihr das Atmen schwer. Rasch blickte sie wieder nach vorn und konzentrierte sich auf die vor ihr liegende Kreuzung. Die Straße nach Chatteris führte geradeaus, bog sich dann in nördliche Richtung, mitten in das Unwetter hinein, und der lange Weg nach Claypole Hall zweigte in drei Meilen Entfernung ab.
Ein Windstoß zerrte an ihr und pfiff höhnisch. Honoria zuckte zusammen, der Graue wurde nervös. Sie zügelte das Pferd und schalt sich wegen ihres langen Ausbleibens. Der Name eines Herzogs war kaum von so welterschütternder Bedeutung, wohl aber das nahende Unwetter.
Ihr Blick fiel auf den schmalen Weg, der bei dem Wegweiser von der Straße abzweigte. Er schlängelte sich zwischen Stoppelfeldern hindurch und führte dann in einen dichten Wald auf einer kleinen Erhebung. Man hatte ihr gesagt, dieser Weg wäre eine Abkürzung und würde nur wenige Meter vor den Toren des Claypoleschen Besitzes wieder zur Claypole-Straße stoßen. Diese Abkürzung war wahrscheinlich ihre einzige Chance, vor dem Unwetter im Herrenhaus anzukommen.
Mit einem Blick auf die brodelnden Wolkenmassen, die sich zu ihrer Rechten wie zu einer himmlischen Flutwelle auftürmten, traf sie ihre Entscheidung. Honoria straffte die Schultern, ließ die Zügel schnalzen und dirigierte den Grauen nach links. Das Tier griff munter aus und trug sie an goldenen Feldern vorbei, die immer dunkler wurden, je dichter sich die Wolken zusammenballten.
Ein dumpfer Knall zerriß die lastende Stille. Honoria blickte nach vorn zwischen die Bäume, denen sie sich rasch näherte. Wilderer? Würden die sich bei solch einem Wetter herumtreiben, wenn das Wild sich verkroch und Schutz vor dem Gewitter suchte? Sie rätselte immer noch an der Ursache des merkwürdigen Knalls, als der Wald sich vor ihr auftat. Der Graue trottete weiter, und sie verschwanden zwischen den Bäumen. Entschlossen, nicht an das Unwetter und die Angst, die es in ihr hervorrief, zu denken, wandte sich Honoria Gedanken über ihre derzeitigen Arbeitgeber zu und ihren nagenden Zweifeln daran, daß sie würdige Empfänger ihrer Künste wären. Du kannst sie dir nicht aussuchen, würde jede andere Gouvernante in diesem Fall sagen. Sie aber war zum Glück nicht wie jede andere. Sie war vermögend genug, um nicht arbeiten zu müssen; auf eigenen Wunsch führte sie ein angenehm geschäftiges Leben, das es ihr gestattete, ihre Talente zu nutzen. Was bedeutete, daß sie ihre Arbeitgeber sehr wohl aussuchen konnte und es gewöhnlich auch mit erstaunlicher Treffsicherheit tat. Diesmal allerdings hatte das Schicksal entschieden und sie zu den Claypoles geschickt. Die Claypoles hatten keinen guten Eindruck auf sie gemacht.
Der Wind begann zu kreischen wie ein Gespenst und dann zu schluchzen und zu seufzen. Zweige peitschten, Äste rieben sich aneinander und ächzten.
Honoria zog die Schultern zusammen. Und konzentrierte sich wieder auf die Claypoles – auf Melissa, deren älteste Tochter, die zukünftige Herzogin. Honoria verzog das Gesicht. Melissa war zierlich und irgendwie zurückgeblieben, blaß, um nicht zu sagen farblos. Was ihr Temperament betraf, hatte sie sich die Maxime ›Kinder hört man nicht, man sieht sie nur‹ zu Herzen genommen – sie brachte kaum ein vernünftiges Wort über die Lippen. Ihr einziger Vorzug bestand, soweit Honoria es bisher beurteilen konnte, in ihrer von Natur aus eleganten Haltung – alles andere würde Honoria noch harte Arbeit abverlangen, wenn Melissa den Ansprüchen eines Herzogs genügen sollte.
Ihr Ärger lenkte sie zum Glück ab von dem, was sie nun durch das dichte Blätterdach nicht sehen konnte. Honoria schob die nagende Frage nach der Identität des Herzogs beiseite und beschäftigte sich statt dessen lieber mit den Eigenschaften, die Lady Claypole ihm zuschrieb.
Er war sehr besonnen, ein ausgezeichneter Verwalter seines Landbesitzes, reif, aber nicht alt und den Worten ihrer Ladyschaft zufolge bereit, seßhaft zu werden und seine Kinderzimmer zu bevölkern. Dieser Ausbund an Tugend wies keinerlei Makel auf. Ihre Ladyschaft hatte das Bild eines nüchternen, ernsthaften, zurückhaltenden Individuums gezeichnet, das Neigungen zum Einsiedlertum zeigte. Letztere Beschreibung hatte Honoria selbst hinzugefügt; sie konnte sich lediglich einen einsiedlerischen Herzog vorstellen, der, wie Lady Claypole behauptete, bereit sein würde, um Melissas Hand anzuhalten.
Der Graue zerrte am Halfter. Honoria hielt die Zügel straff. Sie waren an den Einmündungen zweier Reitwege vorbeigekommen, die sich beide in so dichten Wald hineinschlängelten, daß sie schon nach wenigen Metern nicht mehr zu erkennen waren. Die Straße vor ihr beschrieb einen scharfen Bogen nach links. Der Graue warf den Kopf auf und trottete weiter.
Honoria bemerkte, daß die steile Wegstrecke zu Ende war. Da er nicht mehr so schwer zu ziehen hatte, beschleunigte der Graue unverhofft seinen Schritt, und die Zügel glitten Honoria aus der Hand. Fluchend hielt sie sie fester, lehnte sich zurück und versuchte, das Tier zu bremsen.
Der Graue scheute. Honoria schrie auf und riß heftig am Zaumzeug, ausnahmsweise ohne an das empfindliche Maul des Tieres zu denken. Mit wild klopfendem Herzen zwang sie den Grauen zum Anhalten. Und mit zitternden Flanken stand das Pferd plötzlich stocksteif. Honoria legte die Stirn in Falten. Bisher hatte sie noch kein Donnergrollen gehört. Sie ließ den Blick über die Straße schweifen und sah plötzlich eine Gestalt an der Böschung liegen.
Die Zeit stand still – selbst der Wind hielt inne.
Honoria riß die Augen auf. »Lieber Gott!«
Auf ihr Flüstern hin seufzte das Laubwerk; der metallische Geruch von Blut trieb die Straße entlang. Der Graue tänzelte seitwärts; Honoria beruhigte ihn und schluckte den Kloß in ihrem Hals hinunter. Sie mußte sich nicht sonderlich anstrengen, um die dunkle, glitzernde Lache zu identifizieren, die sich neben der Gestalt ausbreitete. Der Mann war erst vor ganz kurzer Zeit niedergeschossen worden – vielleicht lebte er noch.
Honoria ließ sich vom Kutschbock gleiten. Der Graue stand ganz still mit hängendem Kopf. Honoria schlang die Zügel in einen Strauch an der Böschung und zog den Knoten straff. Sie streifte ihre Handschuhe ab und schob sie in die Tasche. Dann wandte sie sich um, holte tief Luft und ging die Straße entlang.
Der Mann lebte noch, soviel wußte sie gleich, als sie sich neben ihn ins Gras kniete. Sein Atem ging schwer und rasselnd. Er lag zusammengekrümmt auf der Seite, sie packte ihn bei der rechten Schulter und drehte ihn auf den Rücken. Daraufhin atmete er etwas leichter, doch Honoria bemerkte es kaum, denn sie starrte entsetzt auf das zackige Loch auf der linken Vorderseite seiner Jacke. Mit jedem Atemzug des Mannes quoll mehr Blut aus der Wunde.
Sie mußte die Blutung stillen. Honoria blickte an sich herab; sie hielt bereits ihr Taschentuch in der Hand, das allerdings für diese Verletzung nicht ausreichen würde. Hastig löste sie den Seidenschal, den sie zu ihrem brauen Kleid trug, und faltete ihn zu einer Kompresse. Sie öffnete die blutgetränkte Jacke, rührte das ruinierte Hemd des Mannes nicht an und preßte den behelfsmäßigen Verband auf das klaffende Einschußloch. Erst jetzt blickte sie dem Mann ins Gesicht.
Er war jung – entschieden zu jung zum Sterben. Sein Gesicht war bleich, die Züge waren regelmäßig, schön und zeigten noch Spuren von kindlicher Weichheit. Dichtes braunes Haar hing zerzaust in die breite Stirn, braune Augenbrauen bogen sich über den geschlossenen Augen.
Klebrige Feuchte berührte Honorias Finger; ihr Taschentuch und der Schal konnten den Fluß des Bluts nicht aufhalten. Ihr Blick fiel auf das Halstuch des jungen Mannes. Sie löste die Nadel, die die leinenen Falten zusammenhielt, faltete das Tuch, legte es auf die Wunde und drückte es behutsam fest.
Sie beugte sich noch immer über den Patienten, als der erste Donnerschlag dröhnte.
Ein tiefes, hallendes Grollen zerriß die Luft. Der Graue wieherte wild und schoß mit klappernden Hufen die Straße entlang. Mit wild klopfendem Herzen sah Honoria hilflos zu, wie ihr Gig an ihr vorbeiholperte und den Strauch, an den sie die Zügel gebunden hatte, hinter sich her schleifte.
Dann zuckte knisternd ein Blitz. Das Blätterdach verbarg ihn, und doch tauchte er die Straße in grelles Weiß. Honoria preßte die Augen fest zu und verdrängte mit geballter Willenskraft die dräuenden Erinnerungen.
Ein leises Stöhnen drang an ihr Ohr. Sie schlug die Augen auf und blickte auf ihren Patienten herab, doch dieser war noch immer bewußtlos.
»Wunderbar.« Sie schaute um sich; es war unmöglich, der Wahrheit nicht ins Auge zu blicken. Sie befanden sich allein im Wald, unter Bäumen, meilenweit entfernt von jeglichem Unterschlupf, ohne Beförderungsmittel, in einer Gegend, die sie erst seit vier Tagen kannte, inmitten eines Unwetters, das die Blätter von den Bäumen riß – und vor ihr lag ein schwerverwundeter Mann. Wie um alles in der Welt sollte sie ihm helfen?
In ihrem Kopf herrschte trostlose Leere. Mitten hinein drang plötzlich Hufgetrappel. Zuerst glaubte Honoria zu träumen, doch das Geräusch wurde immer lauter, kam näher. Ganz benommen vor Erleichterung stand sie auf. Sie stand gebeugt auf der Straße, drückte die Fingerspitzen auf die Kompresse und lauschte dem näher kommenden Hufschlag. Im letzten Augenblick richtete sie sich auf, drehte sich um und sprang tollkühn mitten in den Weg.
Die Erde bebte, Donner hüllte Honoria ein. Sie hob den Blick und sah dem Tod ins Auge.
Ein mächtiger schwarzer Hengst wieherte und stieg direkt vor ihr; seine eisenbeschlagenen Hufe verfehlten nur um Haaresbreite ihren Kopf. Auf dem Rücken des Tiers saß der dazu passende Mann, dessen schwarzbetuchte Schultern das Dämmerlicht blockierten. Seine dunkle Mähne flatterte, seine Züge waren streng – satanisch.
Die Hufe des Hengstes donnerten knapp neben Honoria auf den Boden. Wutschnaubend, mit rollenden Augen zerrte das Tier an den Zügeln. Es versuchte, seinen großen Kopf in ihre Richtung aufzuwerfen, und als ihm das verweigert wurde, wollte es erneut steigen.
Muskeln wölbten sich an den Armen des Reiters und den langen Schenkeln, die die Flanken des Hengstes preßten. Eine ewig dauernde Minute währte der Kampf zwischen Reiter und Pferd. Dann wurde es still; der Hengst ergab sich mit einem langen, schaudernden Pferdeseufzer.
Das Herz klopfte ihr im Halse, als Honoria den Blick zu dem Reiter hob – und in seine Augen sah. Trotz des spärlichen Lichts war sie sich der Farbe ganz sicher. In ihrem hellen, leuchtenden Grün wirkten diese Augen alt, alles sehend. Groß und tiefliegend unter kräftig geschwungenen dunklen Brauen, bildeten sie das hervorstechendste Merkmal in einem ausgeprägt männlichen Gesicht. Der Blick war durchdringend, hypnotisch – nicht von dieser Welt. In diesem Moment war Honoria überzeugt davon, daß der Teufel selbst gekommen war, um sich einer armen Seele zu bemächtigen. Und ihrer ebenfalls.
Dann färbte sich die Luft um sie herum blau.
2
»Was in drei Teufels Namen treibt Ihr hier, Weib?«
Die Frage, als Abschluß einer entschieden einfallsreichen Kette von Flüchen mit so viel Wut hervorgestoßen, daß selbst der Sturm innehielt, brachte Honoria wieder zu Verstand. Sie blickte die gebieterische Gestalt auf dem unruhigen Hengst an, trat mit herablassender Würde einen Schritt zurück und deutete auf die Gestalt an der Böschung. »Ich habe ihn vor wenigen Minuten gefunden – er ist niedergeschossen worden, und ich kann die Blutung nicht stillen.«
Der Reiter wandte sich der reglosen Gestalt zu. Zufrieden drehte Honoria sich um und ging zurück zu dem Verwundeten, bemerkte dann aber, daß der Reiter sich nicht von der Stelle rührte. Sie sah ihn über die Schulter hinweg an und bemerkte, wie die Brust unter der dunklen Jacke sich dehnte und dehnte, als der Mann einen unfaßbar tiefen Atemzug tat.
Sein Blick fuhr zu ihr herum. »Drückt die Kompresse an, ganz fest.«
Ohne zu warten, ob sie gehorchte, sprang er in einer so kraftvoll geschmeidigen Bewegung vom Pferd, daß Honoria erneut schwindlig wurde. Eilig wandte sie sich ihrem Patienten zu. »Genau das mache ich doch die ganze Zeit«, sagte sie leise, ließ sich auf die Knie sinken und drückte mit beiden Händen auf die Kompresse.
Der Reiter band sein Pferd an einen Baum und blickte in Honorias Richtung. »Lehnt Euch mit Eurem ganzen Gewicht auf ihn.«
Honoria furchte die Stirn, rückte aber doch näher an den Verletzten heran und befolgte den Rat des Mannes. Der Ton seiner tiefen Stimme verriet, daß er an Gehorsam gewöhnt war. Angesichts der Tatsache, daß sie seine Hilfe bei der Versorgung des Verwundeten benötigte, entschied sie, daß jetzt nicht der rechte Zeitpunkt für Widerspruch wäre. Sie hörte ihn näher kommen, feste Schritte auf hartem Boden. Die Schritte verlangsamten sich, wurden zögernd, hörten dann ganz auf. Schon wollte Honoria sich umschauen, als der Mann weiterging.
»Laßt mich die Wunde sehen.«
Hörte sie tatsächlich ein leichtes Beben in seiner Stimme, einer Stimme, so tief, daß sie sie nahezu körperlich spürte? Honoria warf ihrem Retter einen raschen Blick zu. Seine Miene war ausdruckslos, verriet kein Gefühl – nein, das Beben hatte sie sich nur eingebildet.
Sie hob die durchfeuchtete Kompresse an, beugte sich dichter über den Verletzten und rückte ein wenig zur Seite, damit etwas mehr Licht auf die Wunde fallen konnte. Der Mann knurrte etwas, nickte dann und verlagerte sein Gewicht auf die Fersen, während sie die Kompresse wieder auflegte.
Honoria blickte auf und sah sein Stirnrunzeln. Dann hob er die schweren Lider, und ihre Blicke begegneten sich. Wieder stutzte sie angesichts seiner merkwürdigen Augen, die den Eindruck von Allwissenheit vermittelten.
Donner grollte und hallte noch nach, als ein Blitz aufzuckte.
Honoria fuhr zusammen und hatte Mühe, regelmäßig zu atmen. Sie wandte sich wieder ihrem Retter zu, er hatte den Blick nicht von ihr gewandt. Regentropfen prasselten auf das Laub und platzten im Straßenstaub. Der Mann hob den Blick. »Wir müssen ihn – und uns selbst – ins Trockene schaffen. Das Gewitter ist schon fast über uns.«
Er stand auf und streckte geschmeidig seine langen Beine. Honoria, immer noch knieend, war gezwungen, an ihm hinaufzublicken, über hohe Stulpenstiefel und lange, muskulöse Schenkel, vorbei an schlanken Hüften und einer schmalen Taille, über die breite Ausdehnung seines Brustkorbs bis in sein Gesicht. Er war groß, breit, schlank, langgliedrig und muskelbepackt – eine ausgesprochen kraftvolle Erscheinung.
Plötzlich wurde ihr Gaumen trocken, Zorn kochte hoch. »Und wohin, wenn ich fragen darf? Im Umkreis von Meilen gibt es keine Behausung.« Ihr Retter senkte den Blick aufreizend auf ihr Gesicht. Honorias Zuversicht schwand. »Oder?«
Er richtete den Blick auf den Wald. »Hier in der Nähe liegt das Häuschen eines Waldarbeiters. Ein Stück die Straße hinunter zweigt ein Weg dorthin ab.«
Also stammte er aus dieser Gegend, und Honoria atmete erleichtert auf. »Wie sollen wir ihn transportieren?«
»Ich trage ihn.« Zwar fügte er kein »natürlich« hinzu, aber sie hörte es dennoch. Dann verzog er das Gesicht. »Aber wir sollten die Wunde besser verbinden, bevor wir ihn bewegen.«
Er streifte seine Jacke ab, warf sie über einen Ast am Straßenrand und begann, sich das Hemd über den Kopf zu ziehen. Ruckartig senkte Honoria den Blick auf den Verwundeten. Sekunden später baumelte ein feines Leinenhemd vor ihrer Nase, gehalten von langen, gebräunten Fingern.
»Legt das Hemd zusammen und bindet es mit den Ärmeln um ihn herum.«
Honoria betrachtete das Hemd voller Skepsis. Sie nahm es entgegen und sah dem Mann ins Gesicht, sorgsam darauf bedacht, seine breite gebräunte Brust mit dem krausen schwarzen Haar darauf nicht zu beachten. »Wenn Ihr mich hier ablösen und die Wunde versorgen wollt, kann ich meinen Unterrock beisteuern. Wir brauchen mehr Verbandsmaterial für dieses Loch.«
Seine schwarzen Augenbrauen fuhren in die Höhe, doch er nickte, hockte sich hin und legte die Hand auf die Kompresse. Honoria zog ihre Hand unter seiner hervor und stand auf.
Hastig und bemüht, nicht nachzudenken über das, was sie tat, ging sie hinüber auf die andere Straßenseite. Den Bäumen zugewandt, hob sie ihren Rock und löste das Band, das ihren Unterrock hielt.
»Vermutlich tragt Ihr keine Unterhosen?«
Honoria verbiß sich einen empörten Aufschrei und warf einen Blick über die Schulter, aber ihr teuflischer Retter kehrte ihr immer noch den Rücken zu. Als sie nicht sogleich antwortete, fuhr er fort: »Sonst hätten wir noch ein bißchen mehr Fülle für die Kompresse.«
Honorias Unterrock glitt an ihren bloßen Beinen hinab. »Damit kann ich leider nicht dienen«, erwiderte sie gepreßt. Sie nahm das Kleidungsstück, hob es auf und stapfte zurück über die Straße.
Er hob die Schultern. »Ja, nun … ich kann auch nicht gerade behaupten, sie besonders zu mögen.«
Die Vorstellung, die seine Worte heraufbeschworen, war lächerlich. Verspätet begriff Honoria. Der Blick, mit dem sie ihn bedachte, als sie sich neben ihm auf die Knie niederließ, hätte ihn einschrumpfen lassen müssen, doch er war vergeudet – der Mann hatte den Blick auf das Gesicht des Verwundeten geheftet. Voll innerer Entrüstung verbuchte Honoria die zotige Bemerkung als schlechtes Benehmen.
Sie legte ihren Unterrock zusammen, verstärkte diese Bandage mit seinem Hemd, und als er seine Hand von der Wunde hob, deckte sie die dicke Kompresse über die unzulängliche frühere.
»Laßt die Ärmel hängen. Ich hebe ihn hoch, dann könnt Ihr sie festbinden.«
Honoria fragte sich, wie er diesen großen, schweren, bewußtlosen Mann wohl tragen wollte. Erstaunlich gut, war die Antwort; er hob den Körper an und richtete sich gleichzeitig auf. Sie sprang auf die Füße. Er hielt den jungen Mann an seiner Brust; einen Ärmel in der Hand, duckte sie sich und tastete nach dem anderen. Ihre Fingerspitzen erspürten warme Haut; wie zur Antwort zuckten Muskeln. Sie gab vor, nichts zu bemerken. Schließlich fand sie den zweiten Ärmel, zog ihn fest und schlang die Enden zu einem flachen Knoten.
Ihr Retter stieß den Atem durch die Zähne aus. Einen Augenblick lang glitzerten seine merkwürdigen Augen. »Gehen wir. Ihr werdet Sulieman führen müssen.« Mit einer Kopfbewegung deutete er auf das schwarze Ungeheuer, das am Straßenrand Gras rupfte.
Honoria musterte den Hengst. »Sulieman war ein verräterischer Türke.«
»So.«
Ihr Blick fuhr wieder zu dem Mann herum. »Es ist Euer Ernst, wie?«
»Wir können ihn nicht hier zurücklassen. Falls er wegen des Gewitters in Panik gerät und sich losreißt, könnte er Schaden anrichten. Oder jemanden verletzen.«
Voller Skepsis nahm Honoria seine Jacke von dem Ast. Sie maß den Hengst mit Blicken. »Seid Ihr sicher, daß er mich nicht beißt?« Als sie keine Antwort erhielt, drehte sie sich zu dem Mann um und sah ihn entsetzt an. »Ihr erwartet von mir, daß ich …?«
»Nehmt einfach die Zügel – er wird sich schon benehmen.«
Sein Tonfall verriet so viel männliche Ungeduld und Gereiztheit, daß sie tatsächlich, wenn auch durchaus nicht freudig, die Straße überquerte. Sie bedachte den Hengst mit einem bösen Blick, er sah ihr fest in die Augen. Entschlossen, sich nicht von einem Pferd einschüchtern zu lassen, stopfte Honoria die Jacke unter den Sattel, band die Zügel los und schickte sich an, die Straße entlangzugehen. Ruckartig blieb sie stehen, denn der Hengst rührte sich nicht von der Stelle.
»Sulieman – komm schon.«
Auf den Befehl hin setzte sich das mächtige Roß in Bewegung. Honoria eilte voraus und versuchte, außerhalb der Reichweite der monströsen Zähne zu bleiben. Ihr Retter drehte sich, nachdem er mit einem Blick die Situation erfaßt hatte, um und stapfte los.
Sie befanden sich tief im dichtesten Wald; über ihnen wölbte sich ein in sich verschlungenes Blätterdach. Der böige Wind fuhr durch das Laub und schüttete Regen über ihnen aus.
Honoria beobachtete, wie ihr Retter seine unhandliche Last um eine enge Wegbiegung manövrierte. Als er sich straffte, verschoben sich seine kräftigen Rückenmuskeln unter der glatten Haut. Ein Regentropfen landete zitternd auf einer braunen Schulter und rann dann langsam seinen Rücken hinunter. Honoria verfolgte seinen Weg; als der Tropfen im Hosenbund verschwand, mußte sie schlucken.
Warum der Anblick sie so beeindruckte, hätte sie nicht sagen können – der nackte Oberkörper eines Mannes, ein Anblick, den sie schon seit Kindertagen auf den Feldern und in der Schmiede gewohnt war, hatte ihr bisher nie den Atem geraubt. Allerdings konnte sie sich nicht erinnern, jemals ein so prachtvolles Exemplar wie ihren Retter gesehen zu haben.
Er warf einen Blick zurück. »Wie kommt's, daß Ihr allein auf der Straße wart?« Er hielt inne, verlagerte das Gewicht des jungen Mannes in seinen Armen und ging weiter.
»Ich war eigentlich nicht ganz allein«, erklärte Honoria seinem Rücken. »Ich war auf dem Rückweg aus dem Dorf, in meinem Wagen. Als ich sah, daß ein Gewitter aufzog, wollte ich eine Abkürzung nehmen.«
»Und Euer Wagen?«
»Als ich die Gestalt am Wegesrand bemerkte, wollte ich nachsehen. Beim ersten Donnerschlag ist dann das Pferd durchgegangen.«
»Ah.«
Honoria kniff die Augen zusammen. Seinen himmelwärts gerichteten Blick hatte sie nicht gesehen, wohl aber geahnt. »Es lag nicht daran, daß mein Knoten sich gelöst hätte. Nein, der Zweig riß ab, an den ich die Zügel gebunden hatte.«
Er sah zu ihr hinüber; sein Gesicht blieb dabei ausdruckslos, doch seine Lippen bildeten nicht mehr eine so strenge Linie. »Ich verstehe.«
Die nichtssagendsten Worte, die sie je vernommen hatte. Honoria blickte böse auf seinen Rücken, der sie wütend machte, während er weiterstapfte. In ihren Stiefeletten aus weichem Leder, die nicht für Fußmärsche geschaffen waren, rutschte sie und glitt immer wieder aus, als sie versuchte, mit ihm Schritt zu halten. Leider konnte sie ihm angesichts des immer schlimmer werdenden Unwetters keinen Vorwurf aus seiner Eile machen. Seit dem Auftauchen ihres Retters war sie sich einer gewissen Gereiztheit bewußt, einer Verletztheit ihrer Empfindungen. Er war barsch, entschieden zu arrogant – auf schwer beschreibliche Weise einfach unmöglich. Und doch tat er, was getan werden mußte, rasch und sicher. Sie hätte dankbar sein müssen.
Während sie vorsichtig ein Gewirr von freiliegenden Baumwurzeln überwand, kam sie zu dem Schluß, daß die Selbstverständlichkeit, mit der er das Kommando übernahm, sie am meisten ärgerte – nie zuvor war sie einem derart autoritären Menschen begegnet, der sich aufführte, als wäre es sein naturgegebenes Recht zu führen, zu befehlen und Gehorsam zu erfahren. Natürlich konnte ein solches Benehmen ihr angesichts ihrer Stellung, der man Gehorsam zollte, nicht behagen.
Als sie sich erneut dabei ertappte, daß sie fasziniert das Spiel seiner Rückenmuskeln beobachtete, rief Honoria sich streng zur Ordnung. Zorn wallte auf – sie hieß ihn als Rettungsanker willkommen. Er war unmöglich – in jeder Beziehung.
Er schaute zurück und bemerkte ihren finsteren Blick, bevor sie ihre Miene glätten konnte. Seine Brauen schossen in die Höhe, sein Blick begegnete ihrem, dann drehte er sich um. »Wir sind gleich da.«
Honoria stieß den Atem aus, der ihr im Halse steckengeblieben war. Und gönnte sich ein wütendes Stirnrunzeln. Wer zum Teufel mochte er sein?
Ganz gewiß ein Gentleman – Pferd, Kleidung und Benehmen sprachen für sich. Darüber hinaus – wer wußte das schon? Sie überprüfte ihre Eindrücke, fand aber keinen Hinweis auf unterschwelliges Unbehagen; sie war vollkommen sicher, daß ihr von diesem Mann keine Gefahr drohte. Sechs Jahre Arbeit als Gouvernante hatten ihren Instinkt gut geschult – sie hatte keinen Grund, daran zu zweifeln. Sobald sie Unterschlupf gefunden hatten, würden sie sich einander vorstellen. Als wohlerzogene Dame konnte sie unmöglich nach seinem Namen fragen. Es war seine Pflicht, sich mit ihr bekannt zu machen.
Weiter vorn lichteten sich die Bäume, nach weiteren zehn Schritten hatten sie eine große Lichtung erreicht. Vor ihnen, direkt am Waldrand, stand ein Holzhäuschen mit einem gut erhaltenen Strohdach. Honoria bemerkte die Einmündungen zweier Reitwege, eine rechts, eine links. Mit großen Schritten strebte ihr Retter der Tür des Häuschens zu.
»An der Seite befindet sich eine Art Stall. Bindet Sulieman dort an.« Flüchtig sah er in ihre Richtung. »An etwas, das nicht so leicht abbrechen kann.«
Ihr böser Blick prallte an seinem Rücken ab. Getrieben von dem immer lauter werdenden Heulen des Windes, machte sie sich schnell auf den Weg. Blätter tanzten wie Derwische und griffen nach ihren Röcken; das schwarze Ungeheuer trottete dicht hinter ihr. Der Stall war kaum mehr als ein an die Hauswand gelehnter, grober Unterstand.
Honoria hielt nach einem zum Festbinden geeigneten Pfosten Ausschau. »Du bist wahrscheinlich Besseres gewöhnt«, sagte sie zu ihrem Schutzbefohlenen, »aber du wirst dich hiermit begnügen müssen.« Sie entdeckte einen Eisenring in der Hauswand. »Aha.«
Sie führte die Zügel durch den Ring und zog den Knoten fest. Dann ergriff sie die Jacke und wollte sich schon zum Gehen wenden, als der riesige schwarze Kopf zu ihr herumfuhr und große Augen sie mit beinahe verletzlichem Ausdruck anschauten. Rasch tätschelte sie die schwarzen Nüstern. »Bleib schön ruhig.«
Mit diesem weisen Rat raffte sie ihre Röcke und eilte zur Haustür. Ausgerechnet in diesem Augenblick riß der Himmel auf – Donner brüllte, Blitze zuckten, der Wind kreischte –, und Honoria kreischte ebenfalls.
Sie flog durch die offene Tür, wirbelte herum und schlug sie zu, um sich dann mit geschlossenen Augen, die Jacke an die Brust gepreßt, rücklings gegen das Holz zu lehnen. Regen trommelte aufs Dach und gegen die Hauswand in ihrem Rücken. Der Wind rüttelte an den Fensterläden und ließ die Dachbalken ächzen. Honorias Herz pochte wild; mit geschlossenen Augen sah sie das weiße Licht, das, wie sie wußte, den Tod brachte.
Sie atmete keuchend und schlug die Augen auf. Und sah ihren Retter, der, den Jungen in den Armen, neben einer einfachen Pritsche mit Strohsack stand. Es war dunkel in dem Häuschen, nur durch die Ritzen der Fensterläden drang noch ein wenig trübes Licht.
»Zündet die Kerzen an, und kommt dann her, um das Bett zu richten.«
Der nüchterne Befehl riß Honoria aus ihrer Erstarrung. Sie ging zu dem Tisch, der den einzigen Raum dieser Behausung beherrschte. Darauf stand in einem schlichten Leuchter eine Kerze, daneben lagen Zunder und Feuerstein. Honoria legte die Jacke beiseite, schlug einen Funken aus dem Stein und brachte den Docht zum Brennen. Weiches Licht breitete sich im Zimmer aus. Zufrieden wandte sie sich dem Lager zu. Eine seltsame Ansammlung von Möbeln drängte sich in dem engen Raum. Neben dem steinernen Herd stand ein alter Ohrensessel, ihm gegenüber ein mächtiger geschnitzter Stuhl mit verblichener Polsterung. Stühle, Bett und Tisch nahmen einen Großteil des ohnehin beengten Raums ein; an den Wänden standen zudem eine Kommode und zwei klobige Frisiertische. Das Bett ragte in den Raum hinein, das Kopfende an der Wand. Honoria griff nach den säuberlich gefalteten Decken am Fußende. »Wer wohnt hier?«
»Ein Waldarbeiter. Aber jetzt im August ist er bei Earith in den Wäldern. Das hier ist sein Winterquartier.« Er beugte sich vor, um sich seiner Last zu entledigen, während Honoria die Decken über das Lager warf.
»Wartet! Er hat es bequemer, wenn wir ihm die Jacke ausziehen.«
Diese unirdischen Augen hielten ihren Blick fest und richteten sich dann auf den Körper in seinen Armen. »Versucht, ihm den Ärmel abzustreifen.«
Sie hatte darauf geachtet, den Verband so anzulegen, daß die Jacke nicht eingeschnürt wurde. Sie zog behutsam an dem Ärmel und schaffte es, ihn Stückchen für Stückchen herabzuziehen.
Ihr Retter schnaubte. »Alberner Geck! Er hat bestimmt eine Stunde gebraucht, um hineinzukommen.«
Honoria hob den Blick. Diesmal war sie sicher. Bei dem Wort »Geck« hatte seine Stimme gezittert. Sie starrte ihn an, überwältigt von einer schrecklichen Vorahnung. »Zieht heftiger, er spürt im Moment überhaupt nichts.«
Sie tat, wie ihr geheißen, und gemeinsam gelang es ihnen, einen Arm aus der Jacke zu befreien. Mit einem erleichterten Seufzer ließ der Mann den Verletzten auf das Lager nieder und zog ihm die Jacke endgültig aus. Gemeinsam betrachteten sie dann das leichenblasse Gesicht auf der verwaschenen Decke.
Ein Blitz knisterte in der Luft; Honoria zuckte zusammen und sah ihren Retter an. »Sollten wir nicht lieber einen Arzt holen?«
Donner grollte und hallte rollend nach. Ihr Retter wandte den Kopf, hob die schweren Lider und blickte ihr mit seinen merkwürdigen Augen ins Gesicht. In dem klaren Grün – zeitlos, alterslos, erfüllt von Niedergeschlagenheit und Leere – las Honoria die Antwort. »Er wird nicht überleben, stimmt's?«
Der zwingende Blick ließ sie los, die schwarze Mähne wehte, als er den Kopf schüttelte.
»Seid Ihr sicher?« Sie fragte, obwohl sie ohnehin ahnte, daß er recht hatte.
Seine Lippen zuckten. »Der Tod ist ein guter Bekannter von mir.« Die Bemerkung hing in der plötzlich kalten Luft. Honoria war dankbar, als er erklärend hinzufügte: »Ich war bei Waterloo dabei. Ein großer Sieg, wie wir später hörten. Die Hölle auf Erden für diejenigen, die es überlebten. An einem Tag habe ich mehr Männer sterben sehen, als ein normaler Mensch während eines ganzen langen Lebens sieht. Ich bin ganz sicher …« Donner dröhnte und erstickte seine Worte fast völlig. »Er wird die Nacht nicht überleben.«
Seine Worte fielen in die plötzliche Stille. Honoria glaubte ihm; die Traurigkeit, die ihn umgab, ließ keinen Raum für Zweifel.
»Ihr habt die Wunde gesehen – wie das Blut pulsierte? Die Kugel hat sein Herz gestreift – entweder das oder eines der großen Gefäße in seiner Umgebung. Deshalb können wir die Blutung nicht stillen.« Er zeigte auf den dicken, bereits durchgebluteten Verband. »Mit jedem Herzschlag stirbt er ein bißchen mehr.«
Honoria sah dem Jungen in das unschuldige Gesicht und schöpfte tief Atem. Dann blickte sie ihren Retter an. Seine unbewegte Miene konnte sie nicht täuschen. Seine Kaltschnäuzigkeit weckte ihren Argwohn; Mitleid überkam sie.
Dann zog er die Stirn in Falten und die Brauen zusammen, als er die Jacke des Jungen hochhob und den Knopf an dem blutigen Einschußloch untersuchte. »Was ist?«
»Der Knopf hat die Kugel abgelenkt. Seht Ihr?« Er hielt den Knopf ans Licht, so daß die Kerbe an seinem Rand und daneben die Brandstelle sichtbar wurden. »Wenn der Knopf nicht gewesen wäre, hätte die Kugel mitten durchs Herz getroffen.«
Honoria verzog das Gesicht. »Ein Unglück, vielleicht.« Als er sie mit seltsam leeren, grünen Augen ansah, hob sie hilflos die Schultern. »Unter diesen Umständen, meinte ich. Nun muß er langsam sterben.«
Der Mann sagte nichts, sondern betrachtete weiterhin den Knopf. Honoria preßte die Lippen zusammen, wehrte sich gegen den Drang zu fragen und tat es dann trotzdem. »Aber?«
»Aber …« Er zögerte und fuhr dann fort: »Ein sauberer Schuß durchs Herz mit einer langläufigen Pistole – kleines Kaliber, also war es kein Gewehr und auch keine Jagdpistole – dazu aus einiger Entfernung – ein Schuß aus der Nähe hätte einen größeren Brandfleck hinterlassen –, das ist schon ungewöhnlich. So ein Schuß erfordert bemerkenswertes Geschick.«
»Und bemerkenswerte Kaltblütigkeit, möchte ich meinen.«
»Auch das.«
Regen peitschte gegen die Wände und Fensterläden. Honoria straffte sich. »Wenn Ihr Feuer macht, kann ich Wasser kochen und das Blut abwaschen, soweit es möglich ist.« Der Vorschlag brachte ihr einen erstaunten Blick ein; sie begegnete ihm mit unerschütterlicher Ruhe. »Wenn er denn sterben muß, so soll er wenigstens sauber sterben.«
Im ersten Moment glaubte sie, ihn schockiert zu haben – er wirkte eindeutig verblüfft. Dann nickte er, und sein Einverständnis vermittelte ihr zweifelsfrei, daß er sich verantwortlich für den Jungen fühlte.
Sie ging zum Herd, er folgte ihr, erstaunlich leise für einen so kräftigen Mann. Vor dem Feuerloch blieb sie stehen und blickte über die Schulter zurück – und hätte beinahe ihre Zunge verschluckt, als sie ihn direkt neben sich sah.
Er war groß – noch größer, als sie ihn eingeschätzt hatte. Sie selbst wurde oft genug als hochgewachsen bezeichnet, doch dieser Mann überragte sie noch um eine volle Haupteslänge. Er verdeckte die Kerze, sein markantes Gesicht lag in tiefem Schatten, und sein schwarzes Haar zog sich wie ein dunkler Schein um seinen Kopf. Er war der personifizierte Prinz der Finsternis. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte Honoria sich klein, zerbrechlich, ungeheuer verletzlich.
»Beim Stall befindet sich eine Pumpe.« Er griff an ihr vorbei; das Kerzenlicht schimmerte auf dem Umriß seines Arms, als er den Kessel vom Haken nahm. »Ich muß auch noch nach Sulieman sehen, doch zuerst kümmere ich mich um das Feuer.«
Honoria rückte rasch zur Seite. Erst als er vor dem Herd hockte und Scheite aus der Holzkiste auf den Rost legte, konnte sie wieder frei atmen. Wenn er ihr so nahe war, erzeugte seine Stimme einen zitternden Widerhall in ihr, ein äußerst beunruhigendes Gefühl.
Als das Feuer schließlich brannte, kramte sie geschäftig in der Kommode und förderte saubere Kleidung und eine Teebüchse zutage. Sie hörte den Mann vorbeigehen, er griff nach oben und nahm einen Eimer von einem Haken. Der Riegel klickte; Honoria sah sich um – da stand er unter der Tür, nackt bis zu den Hüften, gestochen scharf vor dem grellen Licht eines Blitzes – eine urwüchsige Gestalt in einer urwüchsigen Umgebung. Der Wind stob in den Raum und verschwand abrupt wieder. Die Tür schlug zu, und er war fort.
Sie zählte sieben Donnerschläge, bis er zurückkam. Als die Tür sich hinter ihm schloß, ließ ihre Anspannung ein wenig nach. Dann bemerkte sie, daß er tropfnaß war. »Hier.« Sie reichte ihm das größte Tuch, das sie gefunden hatte, und griff nach dem Kessel. Sie machte sich am Herd zu schaffen, brachte den Kessel zum Kochen, bemüht, nicht dabei zuzusehen, wie er seinen bemerkenswerten Oberkörper trockenrieb. Der Kessel fauchte; sie griff nach der bereitgestellten Schüssel.
Er erwartete sie am Bett; sie überlegte, ob sie ihm befehlen sollte, sich am Feuer zu trocknen, entschied sich jedoch dagegen. Sein Blick war auf das Gesicht des Jungen geheftet.
Sie stellte die Schüssel auf den Bettkasten, wrang ein Tuch aus und wusch behutsam das Gesicht des Jungen, entfernte den Schmutz und den Staub der Straße. Die Sauberkeit betonte noch sein unschuldiges Aussehen und die Grausamkeit seines Todes. Honoria preßte die Lippen zusammen und konzentrierte sich auf ihre Arbeit. Bis sie bei dem blutgetränkten Hemd anlangte.
»Laßt mich.« Sie wich zurück. Zwei exakte Bewegungen, und die linke Seite des Hemdes war abgerissen.
»Gebt mir einen Lappen.«
Sie wrang einen aus und reichte ihn hinüber. Seite an Seite arbeiteten sie im flackernden Licht; sie staunte über die Sanftheit der großen Hände, war gerührt über die Ehrfurcht, die ein so kraftvoll Lebendiger einem Sterbenden erwies.
Dann waren sie fertig. Sie legten eine weitere Decke über ihren Patienten, dann sammelte sie die schmutzigen Lappen ein und legte sie in die Schüssel. Er ging ihr voran zum Herd; sie stellte die Schüssel auf den Tisch und straffte den Rücken.
»Devil?«
Der Ruf war so schwach, daß sie ihn kaum vernahm. Honoria wirbelte herum und flog zurück ans Bett. Die Augenlider des Jungen flatterten. »Devil. Brauche … Devil.«
»Schon gut, schon gut«, flüsterte sie und legte ihm die Hand auf die Stirn. »Hier ist kein Teufel – wir lassen ihn nicht an dich heran.«
Der Junge furchte die Stirn und schüttelte den Kopf unter ihrer Hand. »Nein! Muß ihn sehen …«
Harte Hände umfaßten Honorias Schultern; sie schnappte nach Luft, als sie hochgehoben und beiseite gestellt wurde. Frei von ihrer Berührung, öffnete der Junge seine glasigen Augen und versuchte, sich aufzurichten.
»Bleib liegen, Tolly. Ich bin bei dir.«
Honoria sah mit geweiteten Augen, wie ihr Retter ihren Platz einnahm und den Jungen sanft zurück aufs Bett drängte. Seine Stimme, seine Berührung beruhigten den Sterbenden – er legte sich zurück, sichtbar entspannter, und sah den Älteren an. »Gut«, hauchte er mit kaum hörbarer Stimme. »Hab' dich gefunden.« Ein mattes Lächeln huschte über sein Gesicht. Dann wirkte er plötzlich ernüchtert. »Muß dir unbedingt sagen …«
Seine drängenden Worte wurden von einem Husten abgeschnitten, der sich zu einem schmerzhaften Krampf entwickelte. Honorias Retter stützte den Jungen mit beiden Händen, als wollte er dem rasch verfallenden Körper von seiner Kraft abgeben. Als der Hustenanfall nachließ, griff Honoria nach einem sauberen Lappen und bot ihn an. Ihr Retter bettete den Jungen zurück aufs Lager und wischte ihm das Blut von den Lippen.
»Tolly?«
Er erhielt keine Antwort; der Verletzte hatte erneut das Bewußtsein verloren.
»Ihr seid mit ihm verwandt.« Diese Erkenntnis war Honoria in dem Augenblick gekommen, als der Junge die Augen aufschlug. Die Ähnlichkeit war nicht nur an der hohen Stirn zu erkennen, sondern vor allem am Schwung der Brauen und dem Schnitt der Augen.
»Vettern.« Alles Leben wich aus den strengen Zügen ihres Retters. »Vettern ersten Grades. Er gehört zu der jüngeren Garde – kaum zwanzig Jahre alt.«
Honoria überlegte, wie alt er selbst wohl sein mochte – vermutlich war er in den Dreißigern, doch am Gesicht war sein Alter unmöglich einzuschätzen. Sein Benehmen erweckte den Eindruck von großer Lebenserfahrung.
Während sie zusah, streckte er langsam eine Hand aus und schob unendlich sanft eine Haarlocke aus der bleichen Stirn seines Vetters.
Das leise Seufzen des Windes schwoll zu lautem Getöse an.
3
Sie saß mit einem Sterbenden und einem Mann, den seine Freunde Devil nannten, in einem Waldhaus fest. Im Ohrensessel beim Feuer trank Honoria Tee aus einem Becher und dachte über ihre Situation nach. Inzwischen war es Nacht geworden; der Sturm machte keinerlei Anstalten nachzulassen. Sie konnte das Häuschen nicht verlassen, selbst dann nicht, wenn es ihr sehnlichster Wunsch gewesen wäre.
Mit einem Blick auf ihren Retter, der immer noch auf der Bettkante saß, verzog sie das Gesicht; sie wollte gar nicht fort. Seinen Namen kannte sie noch immer nicht, aber er verlangte ihr Respekt und Mitgefühl ab.
Eine halbe Stunde war vergangen, seit der Junge gesprochen hatte; Devil – einen anderen Namen hatte sie nicht für ihn – war nicht ein einziges Mal von der Seite seines sterbenden Vetters gewichen. Seine Miene blieb unbewegt, verriet keinerlei Gefühle, und doch waren da Emotionen, hinter der Fassade, und verdüsterten das klare Grün seiner Augen. Honoria wußte um den Schock und den Schmerz, den ein plötzlicher Tod mit sich brachte, wußte vom stummen Warten und von der Totenwache. Sie richtete den Blick wieder in die Flammen und trank ihren Tee.
Einige Zeit später hörte sie das Bett knarren; langsam näherten sich leise Schritte. Sie spürte mehr, als daß sie sah, wie er sich auf dem riesigen geschnitzten Stuhl niederließ, und roch den Staub, der aus den verblichenen Polstern aufstieg. Der Kessel summte leise. Sie neigte sich vor und goß, als der Dampf sich legte, Wasser in den bereitgestellten Becher, den sie dem Mann dann reichte.
Er nahm ihn entgegen, wobei seine Finger die ihren und seine Blicke flüchtig ihr Gesicht streiften. »Danke.«
Er trank schweigend und schaute dabei, genauso wie Honoria, ins Feuer.
Minuten verstrichen, dann streckte er die langen Beine aus und kreuzte sie an den Knöcheln. Honoria spürte seinen Blick auf ihrem Gesicht.
»Was führt Euch nach Somersham, Miss …?«
Das war es, worauf sie gewartet hatte. »Wetherby«, klärte sie ihn auf.
Statt ihr daraufhin seinen Namen zu nennen – Mr. Soundso oder Lord Sowieso –, kniff er die Augen zusammen. »Euer vollständiger Name?«
Honoria versagte sich ein Stirnrunzeln. »Honoria Prudence Wetherby«, antwortete sie reichlich spitz.
Eine schwarze Braue fuhr in die Höhe; der beunruhigende Blick aus den grünen Augen flackerte jedoch kein bißchen. »Doch nicht etwa Honoria Prudence Anstruther – Wetherby?«
Honoria starrte ihn an. »Woher wißt Ihr?«
Seine Lippen zuckten. »Ich kenne Euren Großvater.«
Ein ungläubiger Blick war ihre Antwort. »Und jetzt wollt Ihr mir wahrscheinlich weismachen, ich sähe ihm ähnlich?«
Ein kurzes Lachen, weich und tief, fächelte über ihre Sinne. »Jetzt, da Ihr es zur Sprache bringt, glaube ich tatsächlich, eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen – das Kinn vielleicht?«
Honoria funkelte ihn böse an.
»Also, jetzt«, bemerkte ihr Folterknecht, »erinnert Ihr doch stark an den alten Magnus.«
Sie runzelte die Stirn. »Ach ja?«
Langsam nahm er einen Schluck Tee, ohne den Blick von ihrem zu lösen. »Magnus Anstruther-Wetherby ist ein jähzorniger alter Herr, unerträglich hochnäsig und mindestens so stur wie ein Esel.«
»Ihr kennt ihn gut?«
»Wir grüßen einander – mein Vater kannte ihn bedeutend besser.«
Verunsichert beobachtete Honoria ihn, wie er trank. Ihr vollständiger Name war kein Staatsgeheimnis, aber sie hatte einfach keine Lust, sich seiner zu bedienen und auf ihre Verwandtschaft mit diesem jähzornigen, sturen alten Herrn in London aufmerksam zu machen.
»Da gab es doch noch einen zweiten Sohn, nicht wahr?« Ihr Retter musterte sie versonnen. »Er hat sich gegen Magnus aufgelehnt wegen … jetzt weiß ich's wieder – er hat gegen Magnus' Willen geheiratet. Eines von den Montgomery-Mädchen. Seid Ihr die Tochter?«
Honoria nickte steif.
»Das führt mich zurück zu meiner Frage, Miss Anstruther-Wetherby. Was zum Teufel führt Euch hierher, in unsere stille, hinterwäldlerische Gegend?«
Honoria zögerte; von seiner Gestalt ging eine Unruhe, eine Rastlosigkeit aus – nicht auf sie bezogen, sondern auf den Jungen hinter ihnen auf dem Lager –, die verriet, daß er eine Unterhaltung für sein Seelenheil dringend benötigte. Sie hob das Kinn. »Ich bin Gouvernante für höhere Töchter.«
»Für höhere Töchter?«
Sie nickte. »Ich bereite Mädchen auf ihr Debüt vor – ich bleibe nur ein Jahr, bis zur Einführung in die Gesellschaft, bei der jeweiligen Familie.«
Er beäugte sie fasziniert und ungläubig. »Was um alles in der Welt sagt der alte Magnus dazu?«
»Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nie nach seiner Meinung gefragt.«
Er lachte kurz auf – wieder dieser kehlige, sinnliche Ton. Honoria wehrte sich gegen den Drang, die Schultern hochzuziehen. Dann wurde er wieder sachlich. »Was ist aus Eurer Familie geworden?«
Innerlich zuckte Honoria die Achseln. Es schadete niemandem, wenn sie ihm ihre Geschichte erzählte, und wenn sie ihn ablenkte, schön und gut. »Meine Eltern sind bei einem Unfall ums Leben gekommen, als ich sechzehn war. Mein Bruder war damals neunzehn. Wir lebten in Hampshire, doch nach dem Unfall bin ich zu der Schwester meiner Mutter nach Leicestershire gezogen.«
Er zog die Brauen zusammen. »Erstaunlich, daß Magnus nicht dagegen eingeschritten ist.«
»Michael hat ihn über den Tod unserer Eltern in Kenntnis gesetzt, aber er ist nicht zum Begräbnis gekommen.« Honoria hob die Schultern. »Wir hatten auch nicht mit ihm gerechnet. Nach dem Zerwürfnis zwischen ihm und Papa bestand kein Kontakt mehr.« Flüchtig verzog sie die Lippen. »Papa hatte sich geschworen, ihn niemals um Obdach zu bitten.«
»Sturheit liegt wohl in der Familie.«
Honoria überging diese Bemerkung. »Nach einem Jahr in Leicestershire beschloß ich, mich als Gouvernante zu versuchen.« Sie hob den Kopf und schaute in seine viel zu hellsichtigen grünen Augen.
»Eure Tante hieß Euch nicht eben herzlich willkommen?«
Honoria seufzte. »Im Gegenteil – sie nahm mich von Herzen gern bei sich auf. Sie hatte unter ihrem Stand geheiratet – nichts im Vergleich zu der kleinen Mesalliance, die die Gemüter der Anstruther-Wetherbys so sehr erhitzte, sondern tatsächlich weit unter ihrer Klasse.« Sie hielt inne und sah im Geiste das weitläufige, von Hunden und Kindern erfüllte Haus vor sich. »Aber sie war glücklich, und in ihrem Haushalt herrschte eine herzliche Atmosphäre, aber …« Sie warf einen Blick in das dunkle Gesicht ihr gegenüber. »Nichts für mich.«
»Fehl am Platze?«
»Genau. Als die Trauerzeit vorüber war, machte ich eine Bestandsaufnahme von meinen Möglichkeiten. Geld war natürlich nie ein Problem. Michael wünschte, daß ich ein kleines Haus in irgendeinem ruhigen Dörfchen auf dem Lande kaufte und dort ein stilles Leben führte, aber …«
»Auch nichts für Euch?«
Honoria reckte das Kinn vor. »Ein so geruhsames Leben konnte ich mir nicht vorstellen. Ich finde es ungerecht, daß Frauen zu einer so langweiligen Existenz gezwungen werden und nur Männer ein abenteuerliches Leben führen dürfen.«
Diesmal zog er beide Brauen hoch. »Ich persönlich habe festgestellt, daß es sich stets auszahlt, das abenteuerliche Leben zu teilen.«
Honoria öffnete schon den Mund, um ihm zuzustimmen – dann sah sie seinen Blick. Sie blinzelte und schaute noch einmal hin, doch da war das anzügliche Blitzen verschwunden. »Ich für meine Person habe beschlossen, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und auf ein aufregenderes Leben hinzuarbeiten.«
»Als Gouvernante?« Er schien tatsächlich sehr interessiert.
»Nein. Das ist nur eine Übergangslösung. Ich war zu dem Schluß gekommen, daß ich mit achtzehn noch zu jung war, um in Afrika Abenteuer zu suchen. Ich bin fest entschlossen, in Lady Stanhopes Fußstapfen zu treten.«
»Gütiger Gott!«
Honoria achtete nicht auf seinen Zwischenruf. »Ich habe alles genau geplant – mein sehnlichster Wunsch ist der, auf einem Kamel im Schatten der Großen Sphinx zu reiten. Es wäre nicht ratsam, eine solche Expedition in allzu jungen Jahren zu unternehmen, und da erschien der Beruf einer Gouvernante, die immer nur ein Jahr bei der jeweiligen Familie verbringt, als idealer Zeitvertreib zur Überbrückung. Da ich außer meiner Kleidung nichts anschaffen muß, wächst mein Kapital, während ich verschiedene Landstriche kennenlerne und in ausgewählten Häusern lebe. Letzteres beruhigt natürlich Michael ganz ungemein.«
»Ah ja, Euer Bruder. Was macht er, während Ihr Euch die Zeit vertreibt?«
Honoria maß ihren Inquisitor mit abschätzendem Blick. »Michael arbeitet als Lord Carlisles Sekretär. Kennt Ihr ihn?«
»Carlisle, ja. Seinen Sekretär jedoch nicht. Dann strebt Euer Bruder wohl eine politische Laufbahn an?«
»Lord Carlisle war mit Papa befreundet und hat sich bereit erklärt, Michael zu fördern.«
Seine Brauen hoben sich flüchtig; er trank seinen Becher leer. »Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, Euch für eine Weile als Gouvernante zu betätigen?«
Honoria hob die Schultern. »Welche andere Möglichkeit gibt es denn noch? Ich habe eine gute Erziehung genossen, wurde ausgebildet, um zu repräsentieren. Papa bestand darauf, daß ich dem ton vorgestellt und, aufgetakelt wie eine Fregatte, meinem Großvater unter die Nase gerieben werden sollte. Er hoffte auf eine großartige Heirat für mich, nur um Großvater zu beweisen, daß er mit seinen antiquierten Vorstellungen allein auf der Welt stünde.«
»Doch Eure Eltern starben noch vor Eurem Debüt?«
Honoria nickte. »Lady Harwell, eine alte Freundin Mamas, hat eine Tochter, die zwei Jahre jünger ist als ich. Nachdem die Trauerzeit vorüber war, habe ich ihr meine Idee unterbreitet – ich war der Meinung, dank meiner Herkunft und meiner Ausbildung wohl andere Mädchen unterweisen zu können. Lady Harwell war bereit, es zu versuchen. Nachdem ich Miranda auf ihr Debüt vorbereitet hatte, angelte sie sich einen Earl. Danach hat es mir natürlich nie an Anstellungen gemangelt.«
»Zum Entzücken der kuppelnden Mamas.« Ein zynischer Unterton hatte sich in seine tiefe Stimme eingeschlichen. »Und wen unterweist Ihr hier in Somersham?«
Die Frage holte Honoria brutal in die Gegenwart zurück. »Melissa Claypole.«
Ihr Retter furchte die Stirn. »Ist das die Dunkle oder die Blonde?«
»Die Blonde.« Honoria stützte das Kinn in die Hand und blickte in die Flammen. »Ein zimperliches Fräulein ohne jegliches Konversationsgeschick – Gott allein weiß, wie ich sie attraktiver machen soll. Eigentlich hatte Lady Oxley mich angefordert, aber ihr Sechsjähriger bekam die Windpocken, und dann starb die alte Lady Oxley. Da hatte ich schon alle anderen Angebote abgelehnt, aber der Brief der Claypoles traf spät ein, und ich hatte ihn noch nicht beantwortet. Also sagte ich zu, ohne, wie sonst üblich, meine Erkundigungen einzuziehen.«
ENDE DER LESEPROBE