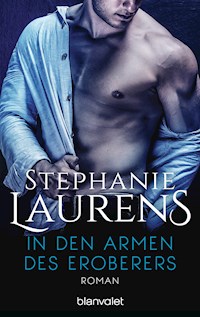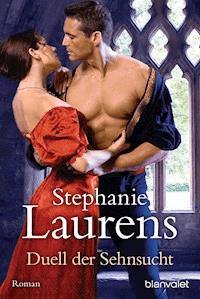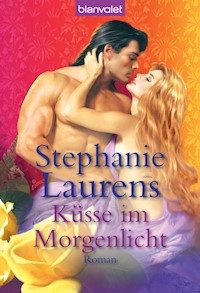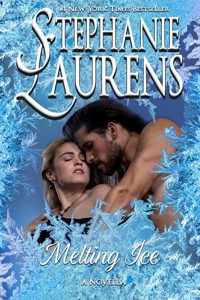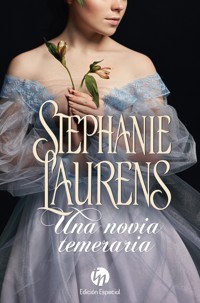5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cynster
- Sprache: Deutsch
Romantisch, sexy, gefühlvoll - für alle Fans von Bridgerton!
Ist es möglich, dass die ehrbare und freiheitsliebende schottische Lady Catriona Hennessy den Lebemann Richard Cynster heiratet? Catrionas Vormund hat dies testamentarisch verfügt – und ihr Erbe davon abhängig gemacht. Cynster, der bis dato zu den überzeugendsten Junggesellen Englands gehörte, ist beim Anblick der schönen Catriona dem Handel nicht mehr abgeneigt. Doch obwohl sie sich leidenschaftlich zu Richard hingezogen fühlt, will die stolze Lady ihre Unabhängigkeit bewahren ...
Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick
Band 1: In den Armen des Eroberers
Band 2: Der Liebesschwur
Band 3: Gezähmt von sanfter Hand
Band 4: In den Fesseln der Liebe
Band 5: Ein unmoralischer Handel
Band 6: Nur in deinen Armen
Band 7: Nur mit deinen Küssen
Band 8: Küsse im Mondschein
Band 9: Küsse im Morgenlicht
Band 10: Verführt zur Liebe
Band 11: Was dein Herz dir sagt
Band 12: Hauch der Verführung
Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide
Band 14: Sturm der Verführung
Band 15: Stolz und Verführung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 785
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Stephanie Laurens
Gezähmt von sanfter Hand
Roman
Aus dem Englischen von Elke Bartels
Buch
Der letzte Wille ihres Vormunds schreibt vor, dass Catriona Hennessy den skandalumwitterten Richard Cynster heiraten soll. Als die stolze und ehrbare schottische Lady diese Zeilen des Testaments liest, ist sie entsetzt. Wie kann man von ihr verlangen, einen Schuft wie diesen Cynster zu ehelichen, einen Mann, an dem alles skandalös ist, von seiner illegitimen Geburt angefangen? Und auch Richard ist alles andere als begeistert von der arrangierten Hochzeit – hatte er sich doch geschworen, niemals ins Netz der Ehe zu gehen, und alles dazu getan, sich einen entsprechend anrüchigen Ruf zu verschaffen. Dennoch reist er nach Schottland, um Catriona zu treffen und sich den letzten Willen ihres Vormunds anzuhören. Und er ist höchst erstaunt, in Catriona eine schöne, intelligente und temperamentvolsle junge Frau kennen zu lernen, deren Ehemann zu werden ihm gar nicht so schlecht gefallen würde. Und auch Catriona kann sich dem Charme des attraktiven Engländers nicht entziehen. Doch trotz der Leidenschaft, die zwischen ihnen lodert, will die junge Lady um ihre Unabhängigkeit kämpfen. Also schmiedet sie einen Plan, wie sie an das Erbe kommt, ohne den Brautschleier zu tragen…
Autor
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Scandal’s Bride« bei Avon Books, New York.
1. Auflage Deutsche Erstausgabe August 2004 Copyright © der Originalausgabe 1999 by Savdek Management Proprietory Ltd. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2004 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen. Satz: deutsch-türkischer fotosatz, Berlin E-Book-Umsetzung: GGP Media GmbH, Pößneck Verlagsnummer: 36085 Redaktion: Anne Bartels und Marion Gieseke LW · Herstellung: Heidrun Nawrot ISBN 978-3-442-36085-4 www.blanvalet-verlag.de
Der Stammbaum desCynster-Clans
Prolog
1.Dezember 1819Casphairn Manor, Tal von Casphairn Galloway Hills, Schottland
Noch niemals zuvor hatte sie eine Vision wie diese gehabt.
Augen – blau, blau – so leuchtend blau wie der Himmel über dem hohen Gipfel des Merrick, so leuchtend blau wie die Kornblumen, die die Felder des Tales sprenkelten. Es waren die Augen eines Denkers, weit blickend und zielgerichtet zugleich.
Oder auch die Augen eines Kriegers.
Catriona erwachte mit einem Ruck, fast überrascht darüber, sich allein im Raum zu befinden. Aus den Tiefen ihres großen Bettes betrachtete sie ihre vertraute Umgebung – die dicken Samtvorhänge, die das Bett zur Hälfte umhüllten, die fest zugezogenen Vorhänge an den Fenstern, hinter denen unablässig der Wind murmelte und denen, die noch wach waren, Geschichten vom nahenden Winter erzählte. Im Kamin leuchtete die Glut des heruntergebrannten Feuers und warf einen schwachen rötlichen Lichtschein auf poliertes Holz, den matt glänzenden Fußboden, die helleren Farbschattierungen von Sessel und Frisierkommode. Es war tiefste Nacht, die Stunde zwischen dem alten und dem neuen Tag. Alles war beruhigend normal; nichts hatte sich verändert.
Und dennoch war etwas anders als zuvor.
Nachdem sich ihr hämmernder Herzschlag allmählich wieder beruhigt hatte, zog Catriona sich die Bettdecke bis zur Brust hinauf und dachte über die Vision nach, die sie heimgesucht hatte – das Gesicht eines Mannes. Die Einzelheiten ihres Traums hatten sich tief in ihr Gedächtnis geprägt. Zusammen mit der Überzeugung, dass diesem Mann noch eine ganz bestimmte Bedeutung zukommen, dass er noch auf irgendeine entscheidende Weise ihr Leben beeinflussen würde.
Wer weiß, womöglich war er sogar derjenige, den Die Herrin für sie auserkoren hatte.
Dieser Gedanke war Catriona durchaus nicht unangenehm. Schließlich war sie mittlerweile zweiundzwanzig Jahre alt, also schon lange über das Alter hinaus, in dem Mädchen Liebhaber in ihr Bett lockten und in dem sie hätte erwarten können, ihre Rolle in diesem endlosen Ritus zu spielen. Nicht, dass sie es bedauerte, dass ihr Leben anders verlaufen war. Vom Augenblick ihrer Geburt an war ihr Weg vorgezeichnet gewesen. Sie war »die Herrin des Tales«.
Dieser Titel, der auf einem alten landesüblichen Brauch basierte, gehörte ihr und nur ihr allein; niemand anderer konnte Anspruch darauf erheben. Als einziges Kind ihrer Eltern hatte sie bei deren Tod Casphairn Manor geerbt, zusammen mit dem Tal und den damit verbundenen Pflichten und Aufgaben. Vor ihr hatte ihre Mutter diesen Titel innegehabt, und sie wiederum hatte das Rittergut, die Ländereien und das Amt von ihrer Mutter geerbt. Jede ihrer direkten weiblichen Vorfahren war »die Herrin des Tales« gewesen.
Eingehüllt in mollig warme Daunen, lächelte Catriona leise vor sich hin. Was ihr Titel genau bedeutete, verstanden nur wenige Außenstehende. Manche hielten sie für eine Hexe – sie hatte sich diese Fiktion sogar schon des Öfteren zu Nutze gemacht, um Möchtegern-Freier in die Flucht zu schlagen. Kirche und Staat hatten für Hexen nicht sonderlich viel übrig, doch dank der abgeschiedenen Lage des Tales war sie in Sicherheit; es gab nur wenige, die überhaupt von ihrer Existenz wussten, und niemanden, der ihre Autorität oder die Doktrin, der sie entsprang, in Zweifel gezogen hätte.
Sämtliche Bewohner des Tales wussten, wer sie war und was ihre Position mit sich brachte. Seit unzähligen Generationen in der fruchtbaren Erde verwurzelt, betrachteten ihre Pächter – all jene, die im Tal lebten und arbeiteten – »ihre Herrin« als die Stellvertreterin Der Herrin selbst, die älter war als die Zeit, Geist der Erde, der ihnen beistand, Hüterin ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft. Sie alle huldigten, jeder auf seine ihm eigene Weise, Der Herrin, und verließen sich mit absolutem und unumstößlichem Vertrauen darauf, dass ihre irdische Stellvertreterin über sie und das Tal wachte.
Schutz und Trost spenden, ernähren, hegen und pflegen sowie heilen – das waren die Lehren Der Herrin, die einzigen Richtlinien, denen Catriona folgte und denen sie uneingeschränkt ihr Leben gewidmet hatte. So wie es auch schon ihre Mutter, ihre Großmutter und ihre Urgroßmutter vor ihr getan hatten. Sie führte ein einfaches Leben in Übereinstimmung mit den Geboten Der Herrin, und das war für gewöhnlich eine leichte Aufgabe.
Außer in einem Bereich.
Catrionas Blick schweifte zu dem Schriftstück aus Pergament hinüber, das auseinander gefaltet auf ihrem Frisiertisch lag. Ein Rechtsanwalt aus Perth hatte ihr geschrieben, um sie vom Tode ihres Vormunds, Seamus McEnery, in Kenntnis zu setzen und sie gleichzeitig zu bitten, zur Testamentsverlesung zum McEnery House zu kommen. Das McEnery House stand auf einem kahlen, öden Hügel in den Trossachs, nordwestlich von Perth; vor ihrem geistigen Auge konnte Catriona das Haus deutlich sehen – es war der einzige Ort außerhalb des Tales, an dem sie schon mehrere Tage verbracht hatte.
Vor sechs Jahren, als ihre Eltern gestorben waren, war Seamus, der Cousin ihres Vaters, traditionsgemäß ihr gesetzlicher Vormund geworden. Er war ein kalter, harter Mann und hatte darauf bestanden, dass sie ihren Wohnsitz ins McEnery House verlegte, damit er leichter einen Gatten für sie finden konnte – einen Mann, der ihre Ländereien übernehmen würde. Da Seamus mit strenger Hand ihre Finanzen verwaltet und sie ziemlich kurz gehalten hatte, war Catriona gezwungen gewesen, ihm zu gehorchen; und so hatte sie das Tal verlassen und war in den Norden gereist, um ihn zu treffen.
Sie wollte mit ihrem Vormund um ihr Erbe kämpfen, um ihre Unabhängigkeit und ihr unveräußerliches Recht, die Herrin des Tales zu bleiben, auf Casphairn Manor zu wohnen und für ihre Leute zu sorgen. Drei dramatische und nervenaufreibende Wochen später war sie in ihr Tal zurückgekehrt; Seamus hatte kein Wort mehr über Freier oder über Catrionas Bestimmung verloren. Und er hatte, dessen war Catriona sich ziemlich sicher, auch nie wieder den Namen Der Herrin missbraucht.
Nun war Seamus tot. Sein ältester Sohn, Jamie, würde jetzt seine Nachfolge antreten. Catriona kannte Jamie; wie alle Kinder von Seamus, so war auch er sanftmütig und willensschwach und nicht wie Seamus. Catriona hatte überlegt, wie sie am besten auf die Aufforderung des Anwalts reagieren sollte, und wollte gleich zu Anfang unmissverständlich klarstellen, dass sie sich nicht herumkommandieren ließ. Jamie sollte sie nach der Testamentsverlesung und seiner formellen Ernennung zu ihrem Vormund hier, im Gutshaus, besuchen. Obwohl sie im Umgang mit Jamie eigentlich keine Schwierigkeiten sah, zog sie es doch vor, aus einer Position der Stärke heraus zu verhandeln. Das Tal war ihr Zuhause; innerhalb seiner Grenzen war sie die unangefochtene Herrscherin. Und dennoch …
Catrionas Blick schweifte erneut zu dem pergamentenen Schriftstück auf dem Frisiertisch; nach einem kurzen Augenblick begannen seine Umrisse zu verschwimmen – und wieder stieg die Vision vor ihrem geistigen Auge auf. Eine volle Minute lang betrachtete sie das Bild, das sie im Geiste vor sich sah. Sie konnte das Gesicht des geheimnisvollen Unbekannten nun ganz deutlich erkennen – die gerade, patriarchalische Nase, das eckige, energische Kinn, die Züge, die in ihrer Kantigkeit und Härte wie aus Stein gemeißelt wirkten. Seine Stirn war unter einem Schwall lockigen schwarzen Haares verborgen, seine stechenden blauen Augen lagen tief unter kühn geschwungenen schwarzen Brauen und waren von dichten schwarzen Wimpern umrahmt. Seine Lippen, zu einer geraden, unnachgiebigen Linie zusammengepresst, sagten ihr nur wenig; tatsächlich schien er ein Mann zu sein, der seine Gedanken und Gefühle vor neugierigen Beobachtern sorgsam verbarg.
Sie war jedoch keine neugierige Beobachterin. Catriona beschlich eine Vorahnung – nein, es war die unumstößliche Gewissheit –, dass sie ihn irgendwann treffen würde. Sie bündelte die Kraft ihrer Gedanken, um hinter seine undurchsichtige Fassade zu schlüpfen, und öffnete zögernd ihre Sinne.
Hunger, heiß und gierig – ein heftiges, animalisches Verlangen –, stürmte aus den Tiefen seines Inneren auf sie ein. Er liebkoste sie mit glutheißen Fingern, eine Anziehungskraft, die fast greifbar schien und auf die sie instinktiv reagierte. Hinter diesem sinnlichen Verlangen, verborgen in den tieferen Schatten seines Wesens, lauerte … Ruhelosigkeit. Ein aus tiefster Seele empfundenes Gefühl, führerlos auf dem Meer des Lebens dahinzutreiben.
Catriona blinzelte und zog sich wieder in ihre vertraute Schlafkammer zurück. Sie sah den Brief, der noch immer auf ihrer Frisierkommode lag, und schnitt eine Grimasse. Sie verstand sich recht gut darauf, die Botschaften Der Herrin zu interpretieren – und diese hier war sonnenklar. Sie sollte zum McEnery House reisen, und zu irgendeinem Zeitpunkt würde sie dem ruhelosen, hungrigen, reservierten Fremden mit dem steinernen Gesicht und den Kriegeraugen begegnen.
Ein verirrter Krieger – ein Krieger ohne eine Sache, für die er kämpfen konnte.
Catriona runzelte die Stirn und rutschte noch tiefer unter die Bettdecken. Als sie sein Gesicht zum ersten Mal in ihren Träumen gesehen hatte, hatte sie tief in ihrem Inneren gefühlt, dass Die Herrin ihr schließlich und endlich einen Gefährten sandte – den einen, der ihr treu zur Seite stehen würde, der gemeinsam mit ihr die schwere Bürde der Verantwortung für den Schutz des Tales und seiner Bewohner tragen würde – den Mann, den sie in ihr Bett lassen würde. Endlich. Jetzt jedoch …
»Sein Gesicht ist zu markant. Bei weitem zu markant«, murmelte Catriona vor sich hin.
Für sie als die Herrin des Tales war es zwingend notwendig, dass sie der dominante Partner in ihrer Ehe war, so wie ihre Mutter es in ihrer Ehe gewesen war. Es stand in Stein geschrieben, dass kein Mann sie beherrschen konnte. Ein arroganter, dominanter Ehemann kam für sie einfach nicht in Frage - das würde niemals gut gehen. Was in diesem Fall wirklich ein Jammer war.
Sie hatte augenblicklich die Quelle seiner Ruhelosigkeit erkannt, die Ruhelosigkeit derer, die kein Lebensziel hatten; aber sie hatte noch nie zuvor etwas Derartiges erlebt wie jenes Verlangen, das in seinem Inneren wütete. Wie eine lebendige, fast greifbare Macht, hatte er seine unsichtbaren Finger nach ihr, Catriona, ausgestreckt und sie berührt, und sie hatte einen unwiderstehlichen Drang verspürt, diesen Hunger zu stillen. Ein instinktives Bedürfnis, diesen rastlosen Fremden zu beruhigen und zu trösten, ihm Halt zu geben und Erleichterung zu verschaffen. Ihn zu …
Ihre Stirn legte sich in Falten; aus irgendeinem Grund konnte Catriona nicht die passenden Worte finden, aber sie hatte so etwas wie Erregung empfunden, ein seltsames Gefühl des Wagemuts, der Herausforderung. Nicht unbedingt Emotionen, die sie normalerweise in ihrem täglichen Trott von Pflichten und Aufgaben wahrnahm. Andererseits … vielleicht waren es ja auch bloß ihre Heiler-Instinkte, die sie anspornten? Catriona schnaubte verächtlich. »Was auch immer mich so an ihm reizt, er kann einfach nicht der Lebensgefährte sein, den Die Herrin für mich ausersehen hat – nicht mit einem solchen Gesicht.«
Sandte Die Herrin ihr vielleicht ein verwundetes männliches Wesen, eine schwache, flügellahme Ente, die sie gesund pflegen sollte? In seinen Augen und den harten, kantigen Zügen waren jedoch keinerlei Anzeichen von Schwäche zu erkennen gewesen.
Nicht, dass das irgendeine Rolle spielte; sie hatte ihre Anweisungen, und die würde sie befolgen. Sie würde ins Hochland reisen, zum McEnery House, und dann abwarten, was – oder vielmehr, wer – sie dort erwartete.
Mit einem Seufzer kroch Catriona tiefer unter die Bettdecke. Sie drehte sich auf die Seite, schloss die Augen – und zwang sich, ihre Gedanken in andere Bahnen zu lenken.
1
5.Dezember 1819 Keltyburn, The Trossachs Schottisches Hochland
»Wünscht Ihr sonst noch etwas, Sir?«
Richard fiel auf diese Frage nur eine Antwort ein: ein reizvolles Arrangement geschmeidiger, wohlgeformter, verführerischer nackter weiblicher Glieder. Der Gastwirt hatte gerade die Überreste seines Abendessens abgeräumt – die weiblichen Glieder würden seinen ungestillten Appetit befriedigen. Aber …
Richard schüttelte stumm den Kopf. Es war nicht etwa so, dass er befürchtete, seinen überaus korrekten Kammerdiener, Worboys, zu schockieren, der steif und kerzengerade aufgerichtet neben ihm stand. Worboys, seit nunmehr acht Jahren in Richards Diensten, konnte schon lange nichts mehr schockieren. Er war allerdings kein Zauberer, und Richard war der festen Überzeugung, dass magische Kräfte erforderlich wären, um hier in Keltyburn ein zufrieden stellendes Angebot an Weiblichkeit aufzutreiben.
Erst als das letzte Tageslicht aus dem bleigrauen Himmel schwand, waren sie in dem einsamen kleinen Weiler eingetroffen. Die Dunkelheit war ziemlich rasch hereingebrochen und hatte sich wie ein schwarzes Leichentuch über die Landschaft gelegt. Der dichte Nebel, der sich auf die Berge herabgesenkt und in schweren, nasskalten Schwaden über ihrem Weg gehangen hatte, sodass sie schließlich kaum noch die schmale, kurvenreiche Straße hatten erkennen können, die den Keltyhead hinauf zu ihrem Ziel führte, hatte die Vorstellung, die Reise zu unterbrechen und die ungemütliche Nacht in der fragwürdigen Behaglichkeit des Keltyburn Arms zu verbringen, plötzlich zu einer geradezu verlockenden Aussicht gemacht.
Außerdem wollte Richard das letzte Zuhause seiner Mutter bei Tageslicht in Augenschein nehmen, und es gab da noch eine gewisse Sache, die er hinter sich bringen wollte, bevor er Keltyburn wieder verließ.
Er räusperte sich. »Ich werde mich in Kürze zurückziehen. Geht ruhig schon zu Bett – ich brauche Euch heute Abend nicht mehr.« Worboys zögerte, und Richard wusste, sein Kammerdiener zerbrach sich den Kopf darüber, wer sich um seinen Überrock und seine Stiefel kümmern würde. Richard seufzte. »Geht zu Bett, Worboys.«
Worboys versteifte sich noch ein wenig mehr. »Sehr wohl, Sir – aber ich wünschte doch sehr, wir wären ohne Umwege zum McEnery House weitergereist. Dort hätte ich mich wenigstens auf die Stiefelknechte verlassen können.«
»Seid einfach froh und dankbar, dass wir hier sind«, erwiderte Richard, »und nicht von der Straße abgekommen oder auf halbem Weg diesen verfluchten Berg hinauf in einer Schneeverwehung stecken geblieben sind.«
Worboys rümpfte die Nase. Er war der offenkundigen Ansicht, dass in einer Schneewehe festzustecken, und noch dazu bei einem Sauwetter, das kalt genug war, um sich den Allerwertesten abzufrieren, immer noch besser war als schlecht gewichste Stiefel. Gehorsam bewegte er seinen rundlichen Körper aus dem Raum und walzte in die dunklen Tiefen des Gasthofs davon.
Um Richards Lippen spielte ein leises Lächeln, während er seine langen Beine dem Feuer entgegenstreckte, das im Kamin prasselte. Egal, wie es um die Qualität der Schuhwichse im Keltyburn Arms bestellt sein mochte, der Wirt hatte jedenfalls keine Mühe gescheut, es ihnen behaglich zu machen. Andere Gäste hatte Richard nicht gesehen, doch in einem solch stillen, abgelegenen Provinznest war das schließlich nicht weiter verwunderlich.
Die Flammen im Kamin loderten hoch auf; Richard starrte gebannt in das Feuer – und fragte sich nicht zum ersten Mal, ob seine Expedition ins Hochland, die das Resultat seiner Langeweile und einer bestimmten Furcht war, nicht vielleicht doch ein wenig überstürzt gewesen war. Aber die Vergnügungen Londons hatten allmählich einen schalen Beigeschmack bekommen; die parfümierten Körper, die sich ihm so bereitwillig – zu bereitwillig – anboten, hatten für ihn mittlerweile an Reiz verloren. Obwohl er nach wie vor eine starke sinnliche Begierde verspürte, war er noch wählerischer und anspruchsvoller geworden, als er es ohnehin schon gewesen war. Richard wollte mehr von einer Frau als nur ihren Körper und einige wenige Augenblicke irdischer Glückseligkeit.
Er runzelte die Stirn und verlagerte sein Gewicht auf dem Stuhl – und lenkte seine Gedanken in andere Bahnen. Es war ein Brief, der ihn hierher geführt hatte, genauer gesagt, ein Brief des Testamentsvollstreckers von Seamus McEnery, dem Ehemann seiner schon vor langer Zeit verstorbenen Mutter, der kürzlich das Zeitliche gesegnet hatte. In dem knapp gefassten juristischen Schreiben war er, Richard, aufgefordert worden, sich zur Testamentsverlesung einzufinden, die übermorgen im McEnery House stattfinden sollte. Wenn er Anspruch auf ein Vermächtnis geltend machen wollte, das seine Mutter ihm überschrieben und das Seamus ihm anscheinend fast dreißig Jahre lang vorenthalten hatte, dann musste er persönlich erscheinen.
Dem wenigen nach zu urteilen, was er über den Ehemann seiner verstorbenen Mutter erfahren hatte, schien das geradezu typisch für Seamus McEnery zu sein. Der Mann war ein Hitzkopf gewesen, unverfroren, rücksichtslos und energisch, ein harter, entschlossener, verschlagener Despot. Was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Grund dafür gewesen war, weshalb er, Richard, auf der Welt war. Seine Mutter hatte sehr darunter gelitten, mit einem solchen Mann verheiratet zu sein; sein Vater dagegen, Sebastian Cynster, Fünfter Herzog von St. Ives, der zum McEnery House geschickt worden war, um Seamus' politisches Feuer zu löschen, hatte Mitleid mit ihr empfunden und sich nach besten Kräften bemüht, sie zu trösten und ihr die Freuden zu bescheren, die ihr in ihrem Eheleben versagt blieben.
Und das Resultat war Richard. Die Geschichte war mittlerweile so alt – dreißig Jahre, um ganz genau zu sein –, dass sie keinerlei Empfindungen mehr in ihm auslöste, abgesehen von einer vagen Trauer um die Mutter, die er nie gekannt hatte. Sie war nur wenige Monate nach seiner Geburt an einer Fieberkrankheit gestorben; Seamus hatte ihn daraufhin auf dem schnellsten Wege zu den Cynsters geschickt, das Beste, was er hatte tun können. Sie hatten Richard mit offenen Armen aufgenommen und als einen der ihren aufgezogen. Die Cynsters waren eine Sorte für sich, besonders die männlichen Mitglieder des weit verzweigten Clans. Er, Richard, war ein Cynster mit Leib und Seele.
Und das war der zweite Grund dafür gewesen, weshalb er London verlassen hatte. Das einzig wichtige gesellschaftliche Ereignis, das er auf diese Weise verpasste, war das verspätet stattfindende Hochzeitsessen seines Cousins Vane, ein Ereignis, dem er mit ziemlichem Unbehagen und unguten Ahnungen entgegengesehen hatte. Er war schließlich nicht blind – er hatte das verräterische Funkeln gesehen, das in den Augen der älteren Damen Cynster blitzte. Zum Beispiel Helena, der Herzoginwitwe, seiner innig geliebten Stiefmutter – von seinem Geschwader von Tanten ganz zu schweigen. Wenn er zu Vanes und Patiences Feier erschienen wäre, hätten sie ihn doch sofort als Kandidaten ins Auge gefasst. Er war aber noch nicht gelangweilt und ruhelos genug, um sich zu opfern und als Futter für ihre ehestifterischen Machenschaften zu dienen. Noch nicht.
Richard kannte sich selbst gut, vielleicht zu gut. Er war kein impulsiver Mensch. Er legte großen Wert auf ein wohl geordnetes Leben, kalkulierbar und überschaubar – er legte Wert darauf, Herr der Lage zu sein und die Dinge unter Kontrolle zu haben. Schon in jungen Jahren hatte er Krieg erlebt, aber er war ein friedliebender und leidenschaftlicher Mann. Ein Mann, dem Heim und Herd über alles gingen.
Diese Redensart beschwor in seiner Vorstellung unwillkürlich Bilder herauf – Bilder von Vane und seiner neuen Braut, Bilder von seinem Halbbruder, Devil, und dessen Herzogin und ihrem gemeinsamen Sohn. Richard rutschte nervös auf seinem Stuhl herum und lehnte sich dann wieder zurück. Es war ihm deutlich bewusst, was sein Bruder und sein Cousin jetzt hatten. Sie hatten das, was er selbst gerne haben wollte und wonach er sich fast schmerzlich sehnte. Er war schließlich ein Cynster. Ihm kam allmählich der Verdacht, dass solch verflixte Gedanken tief in ihm verwurzelt waren. Sie setzten einem Mann unaufhörlich zu und machten ihn … gereizt. Unzufrieden.
Ruhelos.
Verletzlich.
Ganz plötzlich knarrte ein Dielenbrett, und Richard hob den Kopf und blickte durch den Türbogen in die Halle hinüber. Eine Frau tauchte aus der Dunkelheit auf. In einen Umhang aus grober Wolle gehüllt, erwiderte sie seinen Blick direkt und unverwandt. Sie war nicht mehr jung und ihr Gesicht war von tiefen Falten durchzogen. Sie maß Richard prüfend von oben bis unten, dann wurde ihr Blick eisig. Richard unterdrückte ein Grinsen. Mit steifem Rücken und festem Schritt machte die Frau kehrt und stieg die Treppe hinauf.
Richard lehnte sich wieder in seinem Stuhl zurück und verzog die Lippen zu einem amüsierten Lächeln. Im Keltyburn Arms war er vor Versuchungen sicher, so viel stand fest.
Er blickte wieder in die Flammen im Kamin, und nach und nach verblasste sein Lächeln. Er verlagerte abermals sein Gewicht und entspannte die Schultern; eine Minute später erhob er sich mit einer geschmeidigen Bewegung und ging zu dem beschlagenen Fenster hinüber.
Er rieb eine kleine Stelle auf der Scheibe frei und spähte hinaus. Er blickte auf eine winterliche Landschaft mit einem sternenklaren, von Mondlicht erhellten Himmel und einer dünnen, verharschten Schneedecke. Als er schräg zur Seite blickte, konnte er die Dorfkirche und den kleinen Friedhof sehen. Richard zögerte einen Moment, dann straffte er entschlossen die Schultern. Er nahm seinen Umhang vom Garderobenständer und eilte in die Nacht hinaus.
In einem Raum im oberen Stockwerk des Gasthofs saß Catriona an einem kleinen Holztisch. Auf der Tischplatte stand nichts außer einer silbernen Schale, gefüllt mit reinem, klarem Quellwasser, in das Catriona ruhig und unverwandt starrte. Wie aus weiter Ferne hörte sie ihre Begleiterin, Algaria, den Korridor entlanggehen und das Zimmer nebenan betreten – sie selbst war jedoch tief in die Betrachtung des Wassers versunken, während ihre Sinne mit seiner Oberfläche verschmolzen, ihre Gedanken voll und ganz auf das konzentriert, was sie dort zu finden hoffte.
Und wieder entstand vor ihr das Bild – dieselben markanten, energischen Züge, dieselben arroganten Augen. Dieselbe Aura der Ruhelosigkeit. Diesmal wagte Catriona jedoch nicht, tiefer einzudringen. Das Bild war jetzt äußerst scharf – er war nahe.
Catriona sog scharf den Atem ein, blinzelte und zog sich wieder zurück. An der Tür ertönte ein kurzes Klopfen, gleich darauf schwang sie auf, und herein kam Algaria. Sie sah augenblicklich, womit Catriona sich beschäftigt hatte. Rasch schloss sie die Tür hinter sich. »Was hast du gesehen?«
Catriona schüttelte den Kopf. »Es ist alles ziemlich verwirrend.« Das Gesicht des geheimnisvollen Fremden war sogar noch härter, als sie ursprünglich gedacht hatte; seine Züge waren von Willenskraft und Stärke geprägt, Eigenschaften, die sich so deutlich in seinem Antlitz abzeichneten, dass jeder sie erkennen konnte. Er war ein Mann, der keinen Grund hatte, seinen Charakter zu verbergen – er trug die Zeichen ganz offen und anmaßend zur Schau, wie der Häuptling eines Stammes.
Wie ein Krieger.
Catriona runzelte die Stirn. Immer wieder stolperte sie über dieses Wort, aber sie brauchte keinen Krieger – sie brauchte einen zahmen, friedfertigen, entgegenkommenden und möglichst auf Anhieb in sie vernarrten Gentleman, den sie heiraten konnte, um eine Erbin zu zeugen. Der geheimnisvolle Fremde aus ihrer Vision passte jedoch nur in einer einzigen Beziehung in ihr Konzept – er war unbestreitbar männlich. Die Herrin, Sie Die Alles Wusste, konnte ihn doch unmöglich als Ehemann für sie auserkoren haben!
»Aber wenn nicht das, was dann?« Ratlos schob Catriona die silberne Schale beiseite, lehnte sich auf den Tisch und stützte ihr Kinn in die Hand. »Ich muss die Botschaften wohl irgendwie falsch verstehen.« Das war ihr seit ihrem vierzehnten Lebensjahr nicht mehr passiert. »Vielleicht gibt es ja zwei von ihnen?«
»Zwei wovon?« Algaria strich neugierig um Catriona herum. »Was war das für eine Vision?«
Catriona schüttelte den Kopf. Die Angelegenheit war bei weitem zu persönlich, zu heikel, um sie jemand anderem zu enthüllen, nicht einmal Algaria, die seit dem Tode ihrer Mutter ihre treue und weise Ratgeberin war. Sie würde erst mit ihr darüber sprechen können, wenn sie selbst der Sache auf den Grund gegangen war und sie voll und ganz verstand.
Was immer sie verstehen sollte.
»Es hat keinen Zweck.« Entschlossen stand Catriona auf. »Ich muss Die Herrin direkt konsultieren.«
»Was? Jetzt?« Algaria starrte sie verdutzt an. »Draußen ist es bitterkalt.«
»Ich gehe nur zu dem Kreis am Ende des Friedhofs. Ich werde nicht lange draußen bleiben.« Catriona hasste Unsicherheit, das Gefühl, sich ihres Weges nicht sicher zu sein. Und diesmal hatte die Unsicherheit eine ungewöhnliche Nervosität und Angespanntheit mit sich gebracht, gepaart mit einem Gefühl der Erwartung, einem seltsamen, beunruhigenden Vorgefühl der Erregung. Nicht die Art von Erregung, die sie gewohnt war, sondern etwas Prickelnderes, Verlockenderes. Mit einer raschen Bewegung legte sie sich ihren Umhang um die Schultern und band die Bänder am Hals zu einer Schleife.
»Unten im Erdgeschoss ist ein Gentleman.« Algarias schwarze Augen blitzten. »Einer, dem du besser aus dem Weg gehen solltest.«
»So?« Catriona zögerte. Konnte es sein, dass ihr Zukünftiger hier war, unter demselben Dach? Die nervöse Anspannung, die sie bei diesem Gedanken befiel, bestärkte sie nur noch in ihrem Entschluss, und sie knüpfte die Bänder ihres Umhangs zu einem festen Knoten. »Ich werde schon dafür sorgen, dass er mich nicht zu Gesicht bekommt. Und jeder im Dorf kennt mich vom Sehen her – zumindest in diesem Aufzug.« Sie löste ihr zu einem Knoten aufgestecktes Haar und ließ es offen um ihre Schultern wallen. »Hier droht mir keine Gefahr.«
Algaria seufzte. »Na schön – aber trödle nicht herum. Ich nehme an, du wirst mir bald sagen, worum es eigentlich geht.«
Catriona, bereits an der Tür, schenkte ihr ein rasches Lächeln. »Das verspreche ich dir. Sobald ich mir ganz sicher bin.«
Auf halbem Weg die Treppe hinunter erblickte sie den Gentleman, von dem Algaria gesprochen hatte – er war klein, dicklich, makellos gekleidet und gerade damit beschäftigt, die ausrangierten Zeitungen im Gesellschaftszimmer des Gasthofs zu inspizieren. Sein Gesicht war ebenso kreisrund wie seine Gestalt; er war definitiv nicht ihr Krieger. Auf leisen Sohlen eilte Catriona durch die Halle. Sie benötigte einen kurzen Augenblick, um die schwere Tür zu öffnen, die noch nicht für die Nacht verriegelt war.
Und dann war Catriona draußen.
Sie blieb einen Moment auf der steinernen Treppe des Gasthofs stehen, atmete die frische, frostklare Nachtluft ein und fühlte, wie die Kälte ihr einen klaren Kopf verschaffte. Belebt und erfrischt zog sie ihren Umhang fester um sich und ging hinaus, den Blick auf ihre Füße geheftet, sorgsam darauf bedacht, nicht auf dem vereisten Schnee auszurutschen.
Auf dem Friedhof, im Schutze der hohen Mauer, blickte Richard auf das Grab seiner Mutter hinab. Die Inschrift auf dem Grabstein war nur kurz: Lady Eleanor McEnery, Gattin von Seamus McEnery, Gutsherr von Keltyhead. Mehr stand nicht darauf geschrieben. Keine liebevolle Widmung, keine Erwähnung des unehelichen Sohnes, den sie zurückgelassen hatte.
Richards Gesichtsausdruck veränderte sich nicht; er hatte sich schon lange mit seinem Status abgefunden. Als er damals auf der Türschwelle seines Vaters ausgesetzt worden war, hatte Helena, Devils Mutter, alle verblüfft, indem sie Richard ohne zu zögern als ihr eigen Fleisch und Blut ausgegeben hatte. Auf diese Weise hatte sie ihm zu seinem Platz unter den oberen Zehntausend verholfen. Selbst heute noch würde niemand es wagen, ihr Missfallen zu riskieren, indem er auch nur eine leise Andeutung darüber fallen ließe, dass Richard nicht der war, der er Helenas Behauptung nach war. Nämlich der eheliche Sohn seines Vaters. Ausgestattet mit einer instinktiven Klugheit, Gewitztheit und unendlichen Großzügigkeit, hatte Helena ihm seinen Rang in der Gesellschaft gesichert; und Richard hatte niemals aufgehört, ihr dafür dankbar zu sein.
Die Frau jedoch, deren Gebeine unter diesem kalten Grabstein ruhten, hatte ihm das Leben geschenkt – und er konnte nichts tun, um ihr dafür zu danken.
Außer vielleicht das Leben in vollen Zügen zu genießen.
Das Einzige, was er über seine Mutter wusste, hatte er von seinem Vater erfahren; als Richard ihn einmal in aller Unschuld gefragt hatte, ob er seine Mutter geliebt habe, hatte Sebastian ihm zärtlich das Haar zerzaust und erklärt: »Sie war sehr hübsch und sehr einsam – sie verdiente mehr als das, was die Ehe ihr gab.« Dann hatte er kurz innegehalten und schließlich hinzugefügt: »Sie tat mir Leid.« Er hatte Richard angeblickt, und sein Mund hatte sich zu einem breiten Lächeln verzogen. »Aber dich liebe ich von ganzem Herzen. Ich bedaure ihren Tod, aber ich kann nicht bedauern, dass du geboren wurdest.«
Richard konnte jetzt verstehen, wie seinem Vater zu Mute gewesen war, er war schließlich mit Leib und Seele ein Cynster. Familie, Kinder, Heim und Herd – das waren die Dinge, die für die Cynsters von höchster Bedeutung waren, die wichtigsten Ziele, für die sie kämpften, und die größten Siege des Lebens.
Minutenlang stand Richard still vor dem Grab seiner Mutter, bis die Kälte schließlich durch seine Stiefel drang. Mit einem Seufzer richtete er sich auf und machte nach einem allerletzten Blick auf den Grabstein kehrt, um den Weg zurückzugehen, den er gekommen war.
Was mochte seine Mutter ihm hinterlassen haben? Und warum hatte Seamus, nachdem er ihr Vermächtnis all die Jahre über geheim gehalten hatte, ihn jetzt, nach seinem eigenen Tod, wieder zum McEnery House zitiert? Langsam und tief in Gedanken versunken ging Richard um die Kirche herum. Das Knirschen seiner Schritte auf dem hart gefrorenen Schnee wurde vom Wind übertönt, der leise durch die schneebeladenen Äste der Bäume pfiff. Er erreichte den Hauptweg – und hörte ganz plötzlich forsche, entschlossene Schritte, die sich von einer Stelle hinter der Kirche näherten. Richard blieb stehen, drehte sich um und erblickte …
… ein geradezu märchenhaftes Geschöpf, umgeben vom Schimmer des Mondlichts.
Es war eine Frau, eingehüllt in einen dunklen, wogenden Umhang, ihr Kopf war unbedeckt. Über ihre Schultern und weit ihren Rücken hinunter wallte eine prachtvolle Mähne dichten, lockigen, seidig schimmernden Haares, das kupferrot im Mondlicht glänzte und sich wie ein wahres Leuchtfeuer gegen die dunklen, winterlich kahlen Bäume hinter ihr abhob. Ihr Gang war energisch, jeder einzelne Schritt entschlossen und zielstrebig, ihr Blick auf den Boden gerichtet. Richard hätte schwören können, dass sie nicht darauf achtete, wo sie hintrat.
Sie ging unaufhaltsam weiter den Hauptweg entlang und strebte geradewegs auf Richard zu. Er konnte weder ihr Gesicht noch ihre Figur unter dem weiten, wallenden Umhang sehen, doch sein Instinkt täuschte ihn nur selten. Seine Sinne erwachten und konzentrierten sich dann voll und ganz auf die näher kommende Gestalt – es war Begierde auf den ersten Blick. Voller Vorfreude verzog er seine Lippen zu einem wölfischen Lächeln und drehte sich schweigend um, um die Bekanntschaft der Dame zu machen.
Catriona eilte raschen Schrittes den Weg entlang, ihre Lippen zu einer schmalen Linie zusammengepresst, ihre Stirn nachdenklich gerunzelt. Sie war schon zu lange eine Jüngerin Der Herrin, um nicht zu wissen, wie sie ihre Bitte um Aufklärung formulieren musste; die Frage, die sie gestellt hatte, war knapp und unmissverständlich gewesen. Sie hatte nach der wahren Bedeutung jenes Mannes gefragt, dessen Gesicht sie in ihren Träumen verfolgte. Und die Antwort Der Herrin, die Worte, die sich in Catrionas Kopf geformt hatten, war schonungslos kurz und bündig gewesen: Er wird der Vater deiner Kinder sein.
Eine Antwort, die – ganz gleich, wie sie die Worte auch drehte und wendete – nicht sonderlich viele Auslegungsmöglichkeiten zuließ.
Was Catriona vor ein sehr großes Problem stellte. Denn so beispiellos und unerhört es auch sein mochte, Die Herrin musste sich einfach geirrt haben. Dieser Mann, wer immer er auch sein mochte, war arrogant, rücksichtslos und dominant. Sie aber brauchte ein sanftes, schlichtes Gemüt, einen Mann, der damit zufrieden war, eine eher untergeordnete Rolle zu spielen und sie bei ihren Aufgaben zu unterstützen, während sie selbst das Regiment führte. Sie brauchte keine Stärke, sondern Schwäche. Es war absolut sinnlos, ihr einen Krieger ohne Anliegen zu schicken.
Catriona stieß einen ratlosen Seufzer aus, wobei ihr Atem kleine weiße Dampfwölkchen vor ihrem Gesicht bildete. Durch den sich auflösenden Dunst erspähte sie – das Letzte, was sie in diesem Moment zu sehen erwartete – plötzlich ein Paar große, schwarze, glänzend polierte Schaftstiefel, die ihr direkt im Weg standen. Sie versuchte anzuhalten, doch ihre Füße fanden keinen Halt auf dem vereisten Pfad, und der Schwung ihrer Schritte ließ sie hilflos weiter vorwärts schlittern. Sie versuchte, mit den Armen zu rudern, doch sie waren unter ihrem schweren Umhang gefangen. Mit einem erschrockenen Aufkeuchen blickte sie auf, genau in dem Moment, als sie mit dem Besitzer der Stiefel kollidierte.
Die Wucht des Zusammenstoßes war so stark, dass es ihr den Atem aus den Lungen presste, und für einen flüchtigen Moment hatte Catriona das Gefühl, gegen einen Baum geprallt zu sein. Aber dann grub sich ihre Nase in ein weiches Halstuch oberhalb des V-Ausschnitts einer seidenen Weste; das Kinn des Fremden schob sich über ihren Kopf, und ihre Kopfhaut prickelte, als es sanft ihr Haar streifte. Arme wie aus Stahl schlossen sich langsam um sie.
Mit einem Schlag erwachten Catrionas Instinkte. Sie riss nervös die Hände hoch und stemmte sich gegen seine Brust.
Ihre Füße kamen prompt ins Rutschen, dann glitten sie unter ihr weg.
Sie keuchte abermals erschrocken auf – und klammerte sich wie wild an den Fremden, statt ihn wegzustoßen. Der Griff der stahlharten Arme um ihren Körper verstärkte sich, und plötzlich berührten nur noch ihre Zehenspitzen den Schnee. Catriona holte Luft, doch es war ein zu flacher Atemzug, um das wirbelnde Schwindelgefühl in ihrem Kopf zu vertreiben. Ihre Lungen fühlten sich an, als ob sie zugeschnürt wären; ihre Sinne waren in hellem Aufruhr und ließen sie in atemloser Ausführlichkeit wissen, dass sie, von der Brust bis zu den Schenkeln, an einen Mann gepresst wurde.
Es war jedoch nicht irgendein Mann – sondern einer mit einem Körper wie warmer, biegsamer Stahl. Sie musste sich zurücklehnen, um ihm ins Gesicht sehen zu können.
Blaue, tiefblaue Augen erwiderten ihren Blick.
Catriona hielt reglos inne und starrte den Fremden entgeistert an. Dann blinzelte sie. Sie brauchte einen Moment, um seine Züge zu mustern – die arrogante Miene, das energische Kinn – und sich darüber klar zu werden, dass er der Mann aus ihrer Vision war.
Sie verengte die Augen zu Schlitzen und blickte ihn fest an; wenn Der Herrin nun doch kein Irrtum unterlaufen war, dann sollte sie besser gleich zu Anfang so energisch auftreten, wie sie auch weiterhin aufzutreten gedachte. »Lasst mich runter!«
Sie hatte schon früh von ihrer Mutter gelernt, wie man Gehorsam einforderte; in ihren simplen Worten schwang Autorität mit und ein drohender, gebietender Unterton.
Er hörte die Worte und reagierte darauf, indem er den Kopf schief legte, eine schwarze Braue hochzog und seine Lippen zu einem amüsierten Lächeln verzog. »Gleich.«
Jetzt war Catriona an der Reihe, zuzuhören und die unverkennbare Absicht aus seinem tiefen, kehligen Säuseln herauszuhören. Verdutzt riss sie die Augen auf.
»Aber zuerst …«
Wenn sie in der Lage gewesen wäre, einen klaren Gedanken zu fassen, hätte sie empört geschrien, aber der Schock seiner Berührung, die intime Wärme seiner Handfläche, als er ihre Wange umfasste, verwirrten sie zutiefst. Seine Lippen vollendeten die Eroberung – sie fielen, geradezu anmaßend selbstsicher und siegesgewiss, über ihren Mund her und verschlossen ihn.
Die erste Berührung überwältigte Catriona so sehr, dass sie aufhörte zu atmen. Sie dachte nicht mehr daran, Luft zu holen, als sich seine Lippen träge auf den ihren hin und her bewegten. Sie waren weder warm noch kalt, und dennoch waren sie von leidenschaftlicher Glut erfüllt. Sie drückten sich fest auf ihren Mund, dann lösten sie sich wieder, um zart an ihren Mundwinkeln zu nippen. Fest und fordernd berührten seine Küsse Catriona tief in ihrem Inneren und erregten sie auf eine ungeahnte Art und Weise.
Sie bewegte sich in seiner Umarmung, und er schloss seinen Arm noch fester um sie. Sinnliche Hitze umhüllte sie – sie konnte sie selbst durch ihren dicken Umhang spüren, konnte fühlen, wie sie mit unsichtbaren Fingern nach ihr griff, wie sie sie umschloss und dann in ihren Körper eindrang. Und dort anschwoll und sich zu einem wahren Crescendo von Hitze und Erregtheit steigerte, die nach Erlösung und Erfüllung strebte. Sein heißer sinnlicher Hunger hatte sie angesteckt und eine Begierde in ihr geweckt, wie sie sie nie zuvor gekannt hatte. Zutiefst verwirrt und beunruhigt, versuchte Catriona mit aller Macht, ihr Verlangen zu unterdrücken, seine Existenz zu leugnen, dagegen anzukämpfen.
Aber es gelang ihr nicht. Sie musste sich wohl oder übel mit einer schmachvollen Niederlage abfinden – ohne auch nur die leiseste Ahnung zu haben, was darauf folgte –, als die harte Hand, die ihren Kopf umschlossen hielt, plötzlich an ihrer Wange herabglitt. Der Fremde veränderte seinen Griff und drückte jetzt mit einem Daumen hartnäckig auf die Mitte ihres Kinns.
Ihr Unterkiefer erschlaffte, ihre Lippen öffneten sich.
Er drang ein.
Der Schock der ersten Berührung von Zunge an Zunge ließ Catriona buchstäblich bis in die Zehenspitzen erbeben. Sie wollte nach Luft schnappen, aber das war unmöglich. Das Einzige, wozu sie in der Lage war, war zu fühlen. Zu fühlen und die Realität jenes heißen sinnlichen Hungers wahrzunehmen, dieses überraschend heimtückischen, unglaublich starke Empfindungen wachrufenden, verführerisch natürlich erscheinenden körperlichen Bedürfnisses. Und sich verzweifelt gegen die Verlockung zu behaupten, die sie durchzuckte.
Und das alles, während der Fremde seine Unverschämtheit auf die Spitze trieb.
Catriona hätte nicht gedacht, dass es möglich wäre, aber er umschlang sie noch fester, presste seinen stahlharten Körper an ihr weiches Fleisch, als wollte er ihr seinen Stempel aufdrücken. Dreist neigte er den Kopf zur Seite und kostete genussvoll ihren Mund – als hätte er alle Zeit der Welt.
Dann verlegte er sich darauf, mit ihr zu spielen.
Er drang tiefer zwischen ihre Lippen und zog sich sofort wieder zurück, um sie auf raffinierte Weise dazu zu verleiten, bei dem sinnlichen Spiel mitzumachen. Die bloße Vorstellung, sich darauf einzulassen, schockierte Catriona bis ins Innerste – heiße Funken der Erregung durchzuckten ihren Körper. Währenddessen setzten seine Lippen und seine Zunge ihr verführerisches Spiel fort.
Schließlich reagierte Catriona zögernd. Doch statt der aggressiven Reaktion, die sie von ihm erwartet hatte, wurden seine Lippen etwas sanfter. Sie wurde mutiger und erwiderte den Druck seiner Lippen, die sinnliche Liebkosung seiner Zunge.
Ohne es auch nur zu merken, gab sie sich dem Kuss hin.
Ein Gefühl des Triumphes wallte in Richard auf, und er jubelte innerlich. Er hatte ihren beharrlichen Widerstand gebrochen; sie war jetzt sanft und hingebungsvoll, die reinste Magie in seinen Armen. Und sie schmeckte wie der süßeste Sommerwein. Das berauschende Gefühl stieg ihm direkt in den Kopf.
Und in die Lenden.
Während er in dem Kuss schwelgte, kämpfte Richard gegen den aufkeimenden Schmerz an, sorgsam darauf bedacht, sie nicht zu erschrecken und sie nicht wieder so weit zur Besinnung kommen zu lassen, dass sie erkannte, welche Freiheiten er sich herausnahm. Er war nicht so töricht zu glauben, dass sie sich nicht losreißen und davonlaufen würde, wenn er ihr einen hinreichenden Anlass dazu gab. Sie war kein unbedarftes Mädchen vom Lande, keine naive Unschuld – ihre drei Worte, ihr Verhalten hatten eindeutig von Autorität gezeugt. Und sie war auch kein unreifes junges Ding; kein junges Mädchen hätte das unerschrockene Selbstbewusstsein besessen, ausgerechnet ihm zu befehlen: »Lasst mich runter!« Sie war kein Mädchen, sondern eine Frau – und sie passte so gut in seine Arme, ihr Körper war so weich und schmiegsam und kurvenreich.
Wie perfekt sie tatsächlich in seine Arme passte und wie verführerisch die Rundungen waren, die sich so hart an ihn pressten, kam ihm erst jetzt voll und ganz zu Bewusstsein, und diese Erkenntnis heizte seine Wollust noch stärker an. Der weiche, seidige Schwung ihres schweren Haares, ein warmer, lebendiger Schleier, der über seinen Handrücken floss, und der betörende Duft – eine Mischung aus Wildblumen, einem Hauch von Frühling und schwerer, dunkler, fruchtbarer Erde –, der von ihren seidigen Locken ausströmte, verwandelte seine Wollust in Schmerz.
Es war Richard, der schließlich zurückwich und den Kuss beendete – entweder das, oder er würde noch schlimmere Qualen leiden. Denn er würde sie wohl oder übel gehen lassen müssen, unberührt, unangetastet, sein verzehrender Hunger blieb ungestillt; ein tief verschneiter Friedhof mitten in einer kalten Winternacht war eine Herausforderung, vor der selbst er zurückschreckte.
Außerdem wusste er, dass sie trotz der intimen Liebkosungen, die sie getauscht hatten, nicht jene Sorte Frau war. Er hatte ihre inneren Mauern durch schamlose Unverfrorenheit niedergerissen, ausgelöst durch ihren hochmütigen Befehl, sie wieder auf den Boden zu stellen. Im Moment hätte er sie am liebsten auf ebendiesem Boden flachgelegt, aber das sollte nicht sein.
Er löste seine Lippen von ihrem Mund und hob den Kopf.
Sie riss überrascht die Augen auf und starrte ihn an wie einen Geist.
»Herrin, bewahre mich!«
Catrionas Worte kamen als inbrünstiges Flüstern über ihre Lippen, ihr Atem, durch die Kälte kondensiert, bildete kleine weiße Dampfwölkchen. Sie durchforschte sein Gesicht – wonach, konnte Richard nicht erraten, und er zog mit gewohnter Arroganz eine Braue hoch.
Lippen, samtweich und rosig – tatsächlich waren sie jetzt sehr viel rosiger als zuvor –, verzogen sich empört. »Beim Schleier der Herrin! Das ist doch der helle Wahnsinn!«
Sie schüttelte den Kopf und stemmte sich mit beiden Händen gegen seine Brust. Vorsichtig stellte Richard Catriona wieder auf die Füße, dann ließ er sie los. Mit einem gedankenverlorenen Stirnrunzeln trat sie an ihm vorbei, dann wirbelte sie abrupt zu ihm herum. »Wer seid Ihr?«
»Richard Cynster.« Er verbeugte sich mit schwungvoller Eleganz. Als er sich wieder aufrichtete, hielt er ihren Blick fest. »Stets zu Euren Diensten.«
Ihre Augen blitzten wütend. »Ist das eine spezielle Angewohnheit von Euch, arglose Frauen auf Friedhöfen zu belästigen?«
»Nur, wenn sie mir direkt in die Arme laufen.«
»Ich hatte Euch gebeten, mich loszulassen.«
»Ihr habt mir befohlen, Euch loszulassen – und das habe ich auch getan. Letztendlich.«
»Ja. Aber …« Ihre Schimpfkanonade – er war davon überzeugt, dass es zu einer Schimpfkanonade ausgeartet wäre – erstarb auf ihren Lippen. Sie blickte ihn verdutzt blinzelnd an. »Ihr seid Engländer!«
Es klang eher wie ein Vorwurf als wie eine Feststellung. Richard zog abermals eine Braue hoch. »Wir Cynsters sind Engländer, richtig.«
Mit zu Schlitzen verengten Augen betrachtete sie prüfend Richards Gesicht. »Von normannischer Abstammung?«
Er lächelte voller Stolz. »Wir sind einstmals mit Wilhelm dem Eroberer herübergekommen.« Sein Lächeln verwandelte sich in ein breites Grinsen, als er sie langsam von Kopf bis Fuß musterte. »Wir versuchen uns natürlich auch heute noch gerne auf diesem Gebiet.« Dann sah er wieder auf und hielt ihren Blick fest. »Hin und wieder eine kleine Eroberung, das hilft uns, in Übung zu bleiben.«
Selbst in dem schwachen Licht des Mondes sah er ihren zornigen Blick, sah die Funken, die in ihren Augen blitzten.
»Nun, dann lasst Euch gesagt sein, dass dies alles ein riesengroßer Fehler ist!«
Damit machte Catriona auf dem Absatz kehrt und eilte zornschnaubend davon. Der Schnee knirschte laut unter ihren Füßen, als sie in einem Wirbel von Röcken und Umhang davonmarschierte. Mit hochgezogenen Brauen beobachtete Richard, wie sie durch das überdachte Friedhofstor stürmte, und sah den raschen, finsteren Blick, den sie ihm von dort noch einmal zuwarf. Dann warf sie den Kopf zurück, reckte energisch das Kinn in die Luft und marschierte die Straße hinauf.
In Richtung Gasthof.
Um Richards Mundwinkel zuckte es belustigt. Seine Brauen zogen sich noch ein wenig höher, und in seinen Augen erschien ein leicht nachdenklicher Ausdruck. Fehler?
Er beobachtete sie, bis sie endgültig aus seinem Blickfeld verschwand, erst dann rührte er sich, straffte die Schultern und schlenderte, ein wölfisches Lächeln auf den Lippen, gemächlich hinter ihr her.
2
Am nächsten Morgen stand Richard früh auf. Er rasierte sich und kleidete sich an und war erfüllt von einer vertrauten Erregung – dem Jagdfieber. Als er gerade die letzte Falte seines Halstuchs zurechtzog und nach seiner diamantgeschmückten Krawattennadel griff, drang plötzlich ein lauter, barscher Ruf an sein Ohr. Er hielt mitten in der Bewegung inne und hörte, gedämpft durch die zum Schutz vor der winterlichen Kälte fest geschlossenen Fenster, das unverkennbare Klappern von Pferdehufen auf Kopfsteinpflaster.
Mit drei raschen Schritten war er am Fenster und spähte durch die mit Eisblumen überzogene Scheibe in den Hof hinunter. Vor dem Haupteingang des Gasthofs stand eine schwere Reisekutsche, die von einem kräftigen Zweiergespann gezogen wurde. Stallknechte hielten die Pferde fest, die ungeduldig schnaubten und mit den Hufen scharrten, während Bedienstete aus dem Gasthof unter den Anweisungen des Wirts einen schweren Schrankkoffer auf das Dach der Kutsche hievten.
Dann trat eine junge Dame unter dem Vordach des Gasthofs hervor, direkt unterhalb von Richard. Der Wirt beeilte sich, ihr den Kutschenverschlag zu öffnen. Seine Verbeugung war respektvoll, was Richard nicht weiter überraschte – die Dame war seine Bekanntschaft vom Friedhof.
»Verdammt!«, fluchte er leise vor sich hin, sein Blick auf ihr langes, gelocktes Haar geheftet, das jetzt, im hellen Licht des Morgens, flammend rot leuchtete und im Nacken von einer Spange zusammengehalten wurde, sodass es wie ein Strom in zahllosen kleinen Wellen über ihren Rücken floss.
Mit einem hoheitsvollen Nicken und ohne sich noch ein letztes Mal umzuschauen, stieg die Dame in die Kutsche. Dicht auf ihren Fersen folgte die ältere Frau, die Richard am Abend zuvor im Gasthof gesehen hatte. Kurz bevor sie das Trittbrett der Kutsche erklomm, blickte die Frau plötzlich zum Fenster über dem Eingang hinauf – und starrte Richard direkt in die Augen. Er widerstand jedoch dem Drang, vom Fenster zurückzuweichen; einen Augenblick später wandte sie sich wieder ab und folgte ihrer Gefährtin in die Kutsche.
Der Wirt klappte die Tür zu, der Kutscher schlug mit den Zügeln, und die Kutsche rumpelte schwerfällig aus dem Hof hinaus. Richard fluchte abermals lästerlich – seine Beute war im Begriff, ihm zu entwischen. Wenig später erreichte die Reisekutsche das Ende der Dorfstraße und bog dann nach rechts auf die Landstraße nach Keltyhead ab.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!