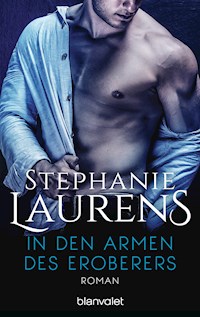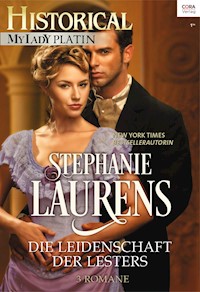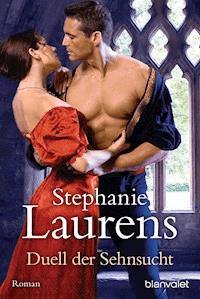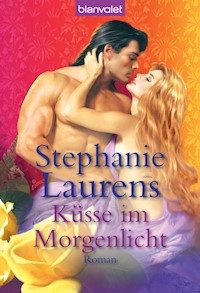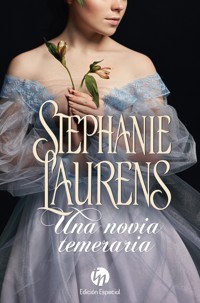Inhaltsverzeichnis
Buch
Autorin
Von Stephanie Laurens außerdem lieferbar:
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Copyright
Buch
An einem verschneiten Weihnachtsabend stößt die junge Helena, im Garten ihrer Klosterschule, auf einen geheimnisvollen Fremden, der ihr einen Kuss raubt. Einen leidenschaftlichen, einen verbotenen Kuss, den Helena jahrelang nicht vergessen wird. Und auch Sebastian Cynster, der Herzog von St. Ives, hat die Begegnung in Erinnerung behalten. Als sieben Jahre später eine atemberaubende Schönheit, die Comtesse d’Lisle, Lady Morphleths Ballsaal betritt, erkennt Sebastian in ihr sofort Helena wieder - und will sie besitzen. Doch Helena sträubt sich und legt ihm alle erdenklichen Steine in den Weg. Obwohl auch sie sich im Geheimen nach dem attraktiven Herzog verzehrt …
Autorin
Stephanie Laurens begann zu schreiben, um etwas Farbe in ihren trockenen wissenschaftlichen Alltag zu bringen. Ihre Romane wurden bald so beliebt, dass sie aus ihrem Hobby den Beruf machte. Heute gehört sie weltweit zu den meistgelesenen und populärsten Autorinnen historischer Liebesromane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in einem Vorort von Melbourne/Australien.
Von Stephanie Laurens außerdem lieferbar:
In den Armen des Eroberers (35838) - Der Liebesschwur (35839) - Gezähmt von sanfter Hand (36085) - In den Fesseln der Liebe (36098) - Nur in deinen Armen (36472) - Nur mit deinen Küssen (36490) - Küsse im Mondschein (36528) - Küsse im Morgenlicht (36529) - Verführt zur Liebe (36759) - Was dein Herz dir sagt (36806)
Für Keith, Stefanie und Lauren Nancy, Lucia und Carrie »The Lunch Mob« - für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft -
Prolog
19. Dezember, 1776
Kloster des Jardinières de Marie, Paris
Mitternacht war vorbei. Helena hörte die kleine Glocke der Kirche läuten, als sie in der Tür der Krankenstation innehielt. Drei Uhr. Ihre jüngere Schwester Ariele schlief endlich tief und fest. Das Fieber war gebrochen - in Schwester Artemis’ Obhut würde sie geborgen sein. Beschwichtigt, erleichtert konnte Helena in ihr eigenes Bett im Schlaftrakt hinter dem Kreuzgang schlüpfen.
Sie zog ihren Wollschal fester um die Schultern und trat aus den Schatten des Gemäuers. Ihre Holzpantoffeln klapperten leise über Steinplatten, als sie die Gärten des Klosters durchquerte. Die Nacht war eisig, klar. Helena trug nur ihr Nachthemd und einen Umhang - sie hatte schon geschlafen - doch die Nachtschwester holte sie zu Hilfe für Ariele. Die Vernunft drängte zur Eile - dennoch ging sie ganz langsam. Sie fühlte sich wohl in den mondlichtgetränkten Anlagen, war vertraut mit diesem Ort, wo sie den Großteil der letzten neun Jahre verbracht hatte.
Bald, sobald Ariele wieder reisen könnte, würde sie das Kloster für immer verlassen. Vor drei Monaten hatte sie ihren sechzehnten Geburtstag gefeiert, ihre Zukunft lag vor ihr - Einführung in die Gesellschaft, gefolgt von Heirat, eine arrangierte Verbindung mit irgendeinem vermögenden Aristokraten. So war es Brauch bei Leuten ihres Standes. Als Comtesse d’Lisle, mit weitläufigen Besitzungen in der Camargue, unter anderem entfernt verwandt mit den mächtigen de Mordaunts, war ihre Hand eine begehrte Trophäe.
Die Äste einer riesigen Linde warfen tiefe Schatten über den Weg. Sie durchquerte sie, trat wieder in das silbrige Licht und hob ihr Gesicht zum unendlichen Himmel. Sog den Frieden in sich ein. So kurz vor dem Festtag des Herrn war das Kloster leer. Die herrschaftlichen Töchter waren bereits für die Feiertage nach Hause gereist. Die beiden Schwestern mussten wegen Arieles schwacher Brust noch bleiben. Helena hatte sich geweigert, ohne ihre Schwester abzureisen. Ariele und die meisten anderen würden im Februar zurückkehren und den Unterricht fortsetzen. Bis dahin …
Stille lag auf den silberbespitzten Büschen, die im Mondlicht, das sich vom wolkenlosen Himmel ergoss, schimmerten. Über ihr blinkten Sterne, verstreute Diamanten im samtenen Meer der Nacht. Vor ihr tauchte jetzt der steinerne Kreuzgang auf, ein vertrauter, tröstlicher Anblick.
Was sie außerhalb der Klostermauern erwartete, war ihr nicht deutlich bewusst. Helena atmete tief ein, ignorierte die Kälte, genoss die Süße der letzten Tage ihres Jungmädchendaseins. Die letzten Tage der Freiheit.
Trockene Blätter raschelten in der Nacht. Sie sah zu der Stelle, wo sich, wie sie wusste, ein knorriger uralter Stamm an die hohe Wand des Schlaftrakts klammerte - direkt links vor ihr. Die Wand lag in undurchdringlicher Finsternis. Sie kniff die Augen zusammen, versuchte etwas in der Dunkelheit zu erkennen, selbst zu dieser Stunde furchtlos. Das Kloster hatte einen eifrig gehüteten Ruf der Sicherheit, dessentwegen so viele adlige Familien ihre Töchter hierher schickten.
Plötzlich hörte sie einen gedämpften Aufprall, dann noch einen und zuletzt kippte polternd ein Körper von der Höhe der Mauer, verfehlte die Kante des Daches des Kreuzgangs und landete direkt vor ihren Füßen.
Helena sah sich das erstaunt an. Es kam ihr nicht in den Sinn zu kreischen. Warum kreischen? Der Mann - ein sehr großes, breitschultriges Exemplar - war fraglos ein Gentleman. Selbst im vagen Mondlicht konnte sie den Schimmer seiner Seidenjacke, das Funkeln eines Juwels in der Spitze um seinen Hals erkennen. Ein weiteres, noch helleres Funkeln schmückte den Finger einer Hand, die er langsam hob, um sich die Locken, die sich aus seinem Zopf gelöst hatten, aus dem markanten Gesicht zu streifen.
Er blieb so liegen, wie er gelandet war, halb auf die Ellbogen gestützt. Die Stellung brachte seinen Brustkorb gut zur Geltung. Seine Hüften waren schmal, die Beine lang, mit muskulösen Schenkeln, die sich klar unter seiner Satinkniebundhose abzeichneten. Er war schlank und groß - seine Füße in den schwarzen Schuhen mit den Goldschnallen auch. Die flachen Absätze bestätigten ihre Vermutung, dass er es nicht nötig hatte, sich größer zu machen.
Zwar war er auf dem gepflasterten Weg gelandet, hatte es aber geschafft, seinen Fall zu bremsen. Abgesehen von ein paar blauen Flecken hatte er wohl keinen Schaden davongetragen, das stand für sie fest. Verletzt sah er nicht aus - eher verärgert, entrüstet. Aber auch misstrauisch.
Er musterte sie eindringlich. Wartete zweifellos darauf, dass sie zu schreien anfing.
Sollte er ruhig warten. Sie war mit ihrer Betrachtung noch nicht fertig.
Doch nun kam Sebastian sich vor, als wäre er in ein Märchen geplumpst. Einer verzauberten Prinzessin zu Füßen gefallen. Sie war schuld an seinem Sturz - er hatte hinuntergeschaut, nach seinem nächsten Halt gesucht und gesehen, wie sie aus den Schatten trat. Sie hatte ihr Gesicht ins Mondlicht gehoben, und da vergaß er komplett, wo er sich befand, rutschte ab.
Sein Jackett hatte sich geöffnet, seine Hand tastete sich unter das klaffende Revers, suchte. Er fand den Ohrring, dessentwegen er gekommen war, er lag noch sicher in der Brusttasche.
Fabien de Mordaunts Familiendolch hatte er damit gewonnen!
Eine weitere irre Wette, noch ein verrücktes Abenteuer, das er für sich verbuchen konnte - noch ein Sieg!
Und eine unerwartete Begegnung.
Irgendein tief in seinem Inneren begrabener Instinkt, lange ruhend, regte sich, zollte ihr den nötigen Respekt. Das Mädchen - sicherlich war sie noch eines, musterte ihn mit einem Selbstbewusstsein, das ihren Stand deutlicher verriet als die feine Spitze am Ausschnitt ihres züchtigen Nachthemdes. Sie musste einer der blaublütigen Zöglinge des Klosters sein, der aus irgendeinem Grund hier festgehalten wurde.
Langsam richtete er sich auf, so elegant, wie es ihm möglich war. »Mille pardons, mademoiselle!«
Eine dunkle, fein geschwungene Braue zuckte, ihre Lippen, voll, aber unmodisch breit, entspannten sich etwas. Ihr offenes Haar umspielte ihre Schultern wie ein Wasserfall, die sanften Locken schimmerten pechschwarz im Mondlicht.
»Ich wollte Euch nicht erschrecken.«
Keineswegs sah sie erschrocken aus, sondern wie die Prinzessin, für die er sie hielt: absolut selbstsicher, etwas amüsiert. Sie war klein gewachsen, er überragte sie - ihr Kopf reichte nicht einmal bis zu seinem Kinn.
Sie hob ihr Gesicht zu ihm, der Mond beleuchtete es. Keine Spur von Besorgnis fand er in ihren kristallblauen Augen, groß unter gesenkten Lidern. Ihre langen Wimpern legten einen Hauch von Schatten über ihre Wangen. Die gerade, aristokratische Nase, ihr ganzes Gesicht bestätigte ihre Herkunft, den wahrscheinlichen Stand.
Die Kleine wirkte gelassen, erwartungsvoll. Er sollte sich wohl vorstellen.
»Diable! Le fou …«
Er wirbelte herum. Laute Stimmen ergossen sich in die Nacht, zerschmetterten die Stille. Am Ende des Kreuzgangs erwachten Fackeln zum Leben.
Er trat vom Weg, glitt hastig hinter einen großen Busch. Die Prinzessin konnte ihn noch sehen; aber er war vor der lärmenden Menge, die den Weg entlangeilte, versteckt. Natürlich könnte sie ihn verraten, ihm die Wachen auf den Hals hetzen.
Helena beobachtete, wie ein Schwarm Nonnen mit wild flatternden Gewändern auf sie zueilte. Zwei Gärtner begleiteten sie, beide fuchtelten mit Mistgabeln.
Sie entdeckten sie.
»Mamselle - habt Ihr ihn gesehen?« Schwester Agatha kam schlitternd am Ende des Kreuzgangs zum Stehen.
»Einen Mann gesehen!« Die Mutter Oberin, bereits außer Atem, bemühte sich, ihre Würde zu wahren. »Der Comte de Vichesse hat eine Warnung geschickt. Ein Irrer will sich mit Mlle Marchand treffen … und dieses alberne, dumme Ding …« Die Augen der Mutter Oberin funkelten im Dunkeln. »Der Mann war hier - da bin ich mir sicher! Er muss über die Mauer geklettert sein. Ist er bei Euch vorbeigerannt? Habt Ihr ihn gesehen?«
Mit Unschuldsblick drehte Helena den Kopf nach rechts, weg von der Gestalt, die der Busch verdeckte. Sie spähte zum Haupttor, hob eine Hand …
»Das Tor! Rasch - wenn wir uns beeilen, kriegen wir ihn!«
Die Gruppe stürmte den Kreuzgang entlang, stürzte sich in den Garten dahinter, verteilte sich rufend, schlug auf die Rabatten entlang der Einfahrt ein - wesentlich verrückter als der geisterhafte Irre, den sie suchten … als der Mann, der ihr vor die Füße gefallen war.
Die Stille kehrte zurück, das Geschrei und Gebrüll verhallten in der Nacht. Sie wickelte sich wieder in ihren Umhang, verschränkte erneut die Arme und wandte sich dann dem Gentleman zu, der gerade aus den Schatten trat.
»Meinen Dank, Mademoiselle! Es erübrigt sich wohl zu beteuern, dass ich kein Irrer bin.«
Seine tiefe Stimme und seine kultivierte Sprache beschwichtigten sie mehr als seine Worte. Helena betrachtete die Absturzmauer. Colette Marchand hatte das Kloster im Jahr zuvor verlassen, war aber vor zwei Tagen von ihren aufgebrachten Verwandten in seinen Schutz zurückgebracht worden. Hier sollte sie auf ihren Bruder warten, der sie aufs Land bringen würde. Den Gerüchten zufolge hatte Colettes Verhalten in den Pariser Salons ziemliches Aufsehen erregt. Helena fasste den Fremden ins Auge, der jetzt näher kam. »Was für eine Art von Mann seid Ihr denn dann?«
Sein großer Mund, etwas schmal und faszinierend beweglich, zuckte, als er vor ihr stehen blieb. »Ein Engländer.«
An seiner Aussprache hätte sie das nie erkannt - ihm fehlte jeglicher Akzent. Trotzdem erklärte diese Enthüllung einiges. Sie hatte gehört, dass Engländer oft groß und ziemlich verrückt waren - selbst nach den laxen Pariser Maßstäben.
Noch niemals war sie einem begegnet. Diese Tatsache verriet der Ausdruck ihrer berückend kristallblauen Augen. Im silbrigen Licht konnte Sebastian nicht erkennen, ob sie blau, grün oder grau waren. Und er bedauerte, nicht verweilen zu können, um das zu klären. Er hob die Hand und strich mit einem Finger über ihre Wange. »Noch einmal, Mademoiselle, meinen Dank!«
Widerstrebend schickte er sich an zu gehen, sagte sich, er müsste es tun. Und zögerte trotzdem.
Etwas schimmerte in der Finsternis - er hob den Kopf. Direkt hinter ihr hing eine Mistel von einem der Äste der Linde.
Es war kurz vor Weihnachten.
Sie hob den Kopf, folgte seinem Blick. Betrachtete die hängende Mistel. Dann musterte sie eindringlich seine Augen, seine Lippen.
Ihr Gesicht glich dem einer französischen Madonna - nicht pariserisch, sondern dramatischer, lebendiger. Sebastian verspürte einen Urtrieb, stärker als je zuvor. Er beugte sich zu ihr hinab.
Langsam … ließ ihr reichlich Zeit, zurückzutreten.
Sie tat es nicht. Hob ihr Gesicht seinem entgegen.
Seine Lippen berührten ihre zum keuschesten Kuss seines Lebens. Er spürte, wie ihre Lippen unter seinen zitterten, ihre Unschuld drang ihm bis in die Knochen.
Danke. Mehr sagte der Kuss nicht, mehr gestattete er nicht.
Sebastian hob den Kopf, konnte aber noch nicht zurücktreten. Brachte es nicht fertig. Ihre Blicke begegneten sich, ihr Atem vereinte sich …
Erneut näherte er sich ihr. Diesmal stellten sich ihre Lippen den seinen noch weicher, großzügiger, tastend. Der Drang zu verschlingen war stark, aber er zügelte ihn, nahm nur, was sie unschuldig bot und gab nicht mehr als das zurück. Ein Austausch - ein Versprechen - obgleich er die Hoffnungslosigkeit erkannte, genau wie sicherlich sie auch.
Es kostete Mühe den Kuss zu beenden, ihn schwindelte ein wenig. Er konnte ihre Wärme entlang seines Körpers spüren, obwohl er sie nicht berührt hatte. Jetzt zwang er sich, Haltung anzunehmen, nach oben zu schauen, Atem zu schöpfen.
Sein Blick fiel auf den Mistelzweig. Impulsiv griff er über sich und riss den baumelnden Zweig ab - das Gefühl des Pflanzlichen zwischen seinen Fingern gab ihm etwas Reales, etwas von dieser Welt, woran er sich festhalten konnte.
Er machte noch einen Schritt rückwärts, bevor er sich gestattete, ihrem Blick zu begegnen. Dann salutierte er mit dem Zweig, neigte den Kopf. »Joyeux Noel!«
Indessen bewegte er sich weiter rückwärts, lenkte seine Augen an ihr vorbei zum Haupttor, durch das er eingedrungen war.
»Geht dort entlang.«
Helena, der das Blut in den Ohren pochte vor lauter Benommenheit, winkte ihn in die entgegengesetzte Richtung. »Wenn Ihr an der Mauer angelangt seid, folgt ihr, weg vom Kloster. Bald findet Ihr eine hölzerne Tür. Ich weiß nicht, ob sie zugesperrt ist oder …« Sie zuckte die Achseln. »Die Mädchen benützen sie, wenn sie sich rausschleichen. Sie führt auf eine Allee.«
Der Engländer sah sie an, musterte sie, dann neigte er abermals den Kopf. Seine Hand war in seine Tasche geglitten, hatte den Zweig in ihren Tiefen verstaut. Sein Blick blieb auf sie gerichtet, als er sagte: »Au revoir, Mademoiselle!«
Dann drehte er sich um und verschmolz mit der Dunkelheit.
In weniger als einer Minute sah sie ihn weder noch hörte sie ihn mehr. Helena raffte ihren Umhang enger um sich, holte Luft, hielt sie an - versuchte, den Zauber, der sie umfangen hatte, festzuhalten - dann tappte sie widerwillig weiter.
Es war, als träte sie aus einem Traum. Die Kälte, die sie bis jetzt nicht bemerkt hatte, durchschnitt ihr Gewand; sie erschauderte und ging schneller. Nun hob sie die Hand und berührte ihre Lippen, behutsam, verwundert. Sie spürte noch die Wärme, den wissenden Druck.
Wer war er wirklich? Sie wünschte, sie wäre kühn genug gewesen, ihn zu fragen. Aber vielleicht sollte sie es auch gar nicht wissen. Aus so einer Begegnung konnte nichts entstehen - aus dem ungreifbaren Versprechen eines Kusses …
Warum war er hier gewesen? Zweifellos würde sie das morgen früh von Colette erfahren. Aber ein Irrer?
Sie lächelte zynisch. Nie würde sie dem Glauben schenken, was der Comte de Vichesse behauptete. Und wenn der Engländer irgendwie beabsichtigt hatte, ihrem Vormund ein Schnippchen zu schlagen, war es ihr eine Genugtuung ihm dabei geholfen zu haben.
1
November 1783London
Colette hatte sich geweigert, seinen Namen zu verraten - den ihres irren Engländers; aber da stand er, groß, schlank und so attraktiv wie eh und je, wenn auch sieben Jahre älter. Umgeben von gepflegter Konversation, auf dem Weg von einer Gruppe zur nächsten, blieb Helena wie angewurzelt stehen.
Auf Lady Morphleths Soirée herrschte Hochstimmung. Es war Mitte November und die hochrangige Gesellschaft hatte sich unisono auf die festliche Jahreszeit eingestellt. Stechpalmen in Hülle und Fülle, der Duft von Tannengrün erfüllte die Luft. In Frankreich war die Zeit vor la nuit de Noel schon lange ein Vorwand für Extravaganzen. Obwohl die Verbundenheit zwischen London und Paris allmählich lockerer wurde, zog London in dieser Hinsicht noch mit. Der Glitzer, der Glamour, die Üppigkeit und die Pracht, die Zerstreuungen der noblen Kreise kamen dem des französischen Hofes gleich. Was ehrliche Lebensfreude anging, übertrafen sie ihn sogar; denn hier gab es keine Bedrohung durch Unruhen, keine canaillen, die sich in den Schatten hinter den Mauern zusammenrotteten. Hier konnten diejenigen, die ihrer Herkunft und Güter gemäß der Elite angehörten, unbekümmert lachen und frei den Wirbel von Aktivitäten, die in den Wochen vor den Festlichkeiten zu Christi Geburt stattfanden, genießen.
Der kleinere Raum, in den sich Helena gewagt hatte, war überfüllt. Während sie dastand und in den Hauptsalon starrte, schwand das unablässige Geplapper aus ihrer Wahrnehmung.
Eingerahmt von einem Flurgewölbe, hielt er - der wilde Engländer, der sie als Erster geküsst hatte - inne, um mit irgendeiner Lady zu plaudern. Ein Hauch von Lächeln umspielte seine Lippen, immer noch schmal, immer noch von träger Sinnlichkeit. Helena erinnerte sich, wie sie sich auf ihren angefühlt hatten.
Sieben Jahre.
Ihr Blick huschte über ihn. Im Klostergarten hatte sie ihn nicht so genau gesehen, um irgendwelche Veränderungen feststellen zu können; doch er bewegte sich mit derselben katzenhaften Anmut, die sie seinerzeit bei einer Person von solcher Größe völlig überraschte. Sein blasses Gesicht, frei von Puder und Schönheitspflästerchen schien jetzt härter, strenger. Seine Haare wellten sich in honigfarbenen Locken, die ein schwarzes Band zusammenhielt.
Sein Anzug wies zurückhaltende Eleganz auf. Jedes Kleidungsstück trug den Stempel eines Meisters: von dem Wasserfall teurer Mechlinspitze am Hals bis zu der üppigen Länge derselben Spitze über seinen großen Händen, dem exquisiten Schnitt seines silbergrauen Jacketts und den dunkler grauen Breeches. Andere hätten das Jackett mit Samt oder Posamenten besetzen lassen. Er zog es schmucklos vor, bis auf große Silberknöpfe. Seine Weste, dunkles Grau, reich mit Silber bestickt, blitzte, wenn er sich bewegte, und vermittelte zusammen mit dem Jackett den Eindruck einer luxuriösen Verpackung, die einen Preis ahnen ließ, der üppig und sündig war.
In einem Salon von überbordender Pracht dominierte er dennoch, und das nicht nur wegen seiner Größe.
Falls die letzten Jahre überhaupt Spuren hinterlassen hatten, dann war es diese Präsenz, die undefinierbare Aura, die mächtigen Männern anhaftete. Sebastian war noch mächtiger, arroganter und rücksichtsloser geworden. Dieselben sieben Jahre hatten sie zur Expertin gemacht. Macht war für sie genauso offen erkennbar wie die Farbe einer Haut.
Fabien de Mordaunt, Comte de Vichesse, der Aristokrat, der entfernte familiäre Verbindungen schamlos ausgenutzt hatte, um sich zu ihrem Vormund berufen zu lassen, strahlte dieselbe Aura aus. In den letzten sieben Jahren war sie mächtigen Männern gegenüber immer misstrauischer und zuletzt ihrer überdrüssig geworden.
»Eh bien! Wie geht es, ma cousine?«
Helena drehte sich um, nickte kühl. »Bon soir, Louis.« Er war nicht ihr Cousin, nicht einmal entfernt mit ihr verwandt; aber sie verkniff es sich, ihn hochmütig auf diese Tatsache hinzuweisen. Louis, dieses Nichts, spielte sich als ihr Hüter, der verlängerte Arm seines Onkels und Herrn, Fabien de Mordaunt, auf.
Louis konnte sie ignorieren. Aber sie hatte gelernt, nie Fabien zu vergessen.
Die dunklen Augen des lästigen Ankömmlings durchstreiften den Raum. »Hier wären ein paar aussichtsreiche Kandidaten!« Er beugte seinen gepuderten Kopf näher und murmelte: »Ich habe gehört, ein englischer Herzog ist anwesend. Unverheiratet. St. Ives. Du tätest gut daran dafür zu sorgen, dass du ihm vorgestellt wirst.«
Helena lüftete die Brauen und sah sich im Salon um. Ein Herzog. Louis war doch irgendwie nützlich. Er hatte sich den Plänen seines Onkels verschrieben und in diesem Fall verfolgten sie und Fabien dasselbe Ziel, wenn auch aus verschiedenen Beweggründen.
In der vergangenen sieben Jahren, ungefähr ab dem Tag, an dem sie der Engländer geküsst hatte - benutzte Fabien sie als Bauer auf seinem Schachbrett. Ihre Hand war eine Trophäe, die die mächtigen und reichen Familien Frankreichs allesamt begehrten. Sie konnte sich gar nicht mehr erinnern, wie viele Verlobungen schon eingefädelt wurden. Aber auf Grund des explosiven Zustands des französischen Staates und der Schicksalsschwankungen der aristokratischen Familien, die vollkommen abhingen von den Launen des Königs, hatte Fabien eine endgültige Verbindung nie wirklich für attraktiv gehalten. Wesentlich reizvoller war das Spiel, ihr Vermögen und ihre Person als Köder einzusetzen, um die Einflussreichen in sein Netz zu ziehen. Sobald er das, was er wollte, durch sie erreicht hatte, entließ er sie wieder in die Pariser Salons, um die Aufmerksamkeit einer nächsten Exzellenz zu erregen.
Sie wagte gar nicht daran zu denken, wie lange dieses Spiel noch weitergehen würde - bis sie mit grauen Haaren als Köder ausgedient hätte? Glücklicherweise, zumindest für sie, gebot die wachsende Unzufriedenheit in Frankreich Fabien Einhalt. Er war ein geborenes Raubtier mit gesundem Instinkt - und die Witterung im Wind gefiel ihm gar nicht. Sie war sich sicher gewesen, dass er bereits vor dem Entführungsversuch eine Änderung seiner Taktik erwogen hatte.
Das war beängstigend gewesen. Selbst jetzt, wo sie sich neben Louis mitten in einem modischen Salon außerhalb ihrer Heimat befand, musste sie gegen ein Schaudern ankämpfen. In den Obstgärten von Le Roc, Fabiens Festung an der Loire, war sie spazieren gegangen, als drei Männer angeprescht kamen und versuchten, sie zu entführen.
Sie hatten sie sicher beobachtet, den richtigen Zeitpunkt abgewartet. Helena hatte gekämpft, gestrampelt - vergeblich. Sie hätten sie geraubt, wenn da nicht Fabien gewesen wäre. Auf seinem Abendritt hatte er ihre Schreie gehört und war ihr zu Hilfe galoppiert.
Fabiens Macht über sie mochte ihr zuwider sein; aber er beschützte das, was er als Eigentum betrachtete. Mit seinen neununddreißig Jahren stand er noch voll im Saft. Einen der Männer hatte er erledigt, die anderen beiden waren geflohen. Fabien hatte sie gejagt, aber sie entwischten ihm.
An diesem Abend hatten sie und Fabien über ihre Zukunft diskutiert. Jede Minute des Gesprächs unter vier Augen war in ihrem Gedächtnis eingebrannt. Fabien hatte sie informiert, dass diese Männer von den Rochefoulds angeheuert gewesen wären. Wie Fabien, wussten die mächtigsten Intriganten, dass ein Sturm im Anzug war. Jede Familie, jeder Mann von Rang war darauf bedacht, so viele Güter, Titel und Pfründen wie möglich an sich zu raffen. Je weiter sie ihre Macht ausbauten, für desto größer hielten sie die Chance, den Sturm zu überstehen.
Sie war ein begehrtes Raubstück geworden. Nicht nur für die Rochefoulds.
»Ich habe von allen vier großen Familien sehr eindringlich formulierte Anträge um deine Hand erhalten. Von allen vieren!« Fabien hatte seine dunklen Augen auf sie gerichtet. »Wie du siehst, bin ich nicht vor Freude aus dem Häuschen. Diese Situation stellt ein unwillkommenes Problem dar.«
Ein Problem in der Tat, voller Risiken. Fabien stand nicht der Sinn danach, ihr Vermögen und seinen Einfluss irgendeiner der vier in die Hände zu spielen. Wenn er eine bevorzugte, würden ihm die anderen drei bei der ersten Gelegenheit die Kehle durchschneiden. Vielleicht nur indirekt, doch am Ende gar buchstäblich. All das hatte sie begriffen; die Beobachtung, dass Fabiens Machenschaften anfingen, nach hinten loszugehen, behielt sie für sich.
»Die Möglichkeit, einer Verbindung für dich innerhalb Frankreichs zuzustimmen, besteht nicht mehr - dennoch wird der Druck, deine Hand zu vergeben, dauernd stärker.« Fabien hatte sie nachdenklich gemustert und fuhr dann mit seiner aalglatten, schnurrenden Stimme fort: »Deshalb ziehe ich in Betracht, diese jetzt unbefriedigende Arena zu verlassen und auf gewissermaßen produktivere Gefilde vorzurücken.«
Sie hatte erstaunt geblinzelt. Er hatte gelächelt, mehr für sich als für sie.
»In diesen unruhigen Zeiten wäre es meiner Meinung nach im Interesse der Familie, stärkere Bande mit unseren entfernten Verwandten auf der anderen Seite des Kanals zu knüpfen.«
»Du möchtest, dass ich einen émigré heirate?« Sie war schockiert gewesen. Émigrés hatten für gewöhnlich einen niederen gesellschaftlichen Status - Leute ohne Besitz.
Fabien hatte verärgert die Augen zusammengekniffen. »Nein. Ich meinte, für den Fall, dass du die Aufmerksamkeit eines englischen Aristokraten erregen solltest, der von Stand ist und so vermögend wie du - dann wäre das nicht nur eine Lösung unseres augenblicklichen Dilemmas, sondern auch eine wertvolle Verbindung zum Schutz vor einer unsicheren Zukunft.«
Vor lauter Trotz, Schock und Überraschung arbeitete ihr Verstand fieberhaft.
Fabien hatte ihr Schweigen falsch interpretiert und gesagt: »Habe die Güte dich zu erinnern, dass sich die englische Aristokratie zum großen Teil, wenn auch nicht ausschließlich aus Familien zusammensetzt, die von William abstammen. Du wirst vielleicht gezwungen werden, ihre grässliche Sprache zu erlernen; aber die Oberklasse spricht Französisch und äfft uns ohnehin nach. Es wäre nicht hoffnungslos grauenvoll unzivilisiert …«
»Die Sprache beherrsche ich bereits.« Mehr war ihr nicht eingefallen - denn mit einem Mal eröffneten sich ihr Möglichkeiten, die sie sich nie erträumt hatte. Flucht. Freiheit.
Sieben Jahre Umgang mit Fabien waren eine gute Schule gewesen. Sie hatte ihre Erregung gezügelt, nichts davon in ihrer Miene oder ihren Augen verraten. Gefasst hatte sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf ihn gerichtet. »Du willst damit sagen, ich soll nach London gehen und eine Verbindung mit einem Engländer suchen?«
»Nicht mit irgendeinem Engländer - mit einem von Stand und einem Besitz, der deinem eigenen zumindest gleichkommt. Nach deren Gesellschaftsordnung einen Earl, einen Marques oder Duke, und zwar vermögend! Ich brauche dich wohl kaum daran zu erinnern, was du wert bist.«
Ihr ganzes Leben lang hatte man sie das nie vergessen lassen. Sie hatte Fabien mit gerunzelter Stirn angesehen, so getan, als hätte sie nicht den Wunsch, nach England zu gehen und Umgang mit Engländern zu haben, während sie sich einen Plan zurechtlegte. Auf ihrem Weg hatte es ein sehr großes Hindernis gegeben. Sie hatte ihre Enttäuschung und ihren Ärger offen gezeigt. »Ich gehe also nach London, spaziere durch ihre Salons, bin ach-so-nett zu den englischen Mylords und was dann? Du hast ja doch etwas dagegen, dass ich diesen heirate. Und später vielleicht auch etwas gegen einen anderen.«
Ihre Ablehnung bekräftigte sie schließlich noch mit einem »hmmpf«, verschränkte die Arme und wandte den Blick. »Es hat keinen Sinn. Ich möchte lieber nach Hause, nach Cameralle!«
Sie hatte nicht gewagt, aus dem Augenwinkel zu spitzen, wie Fabien auf ihren Vorschlag reagierte und doch hatte sie seinen dunklen Blick gespürt, durchdringend wie immer.
Nach einer langen Weile hatte er, zu ihrem großen Erstaunen, gelacht. »Schön! Ich werde dir einen Brief mitgeben. Eine allgemeine Zustimmung.« Er hatte sich an seinen Schreibtisch gesetzt, ein Stück Pergament herausgezogen und dann seine Feder genommen. Er sagte laut, was er schrieb: »Hiermit bestätige ich als dein gesetzlicher Vormund, dass ich einer Heirat mit einem Mitglied der englischen Aristokratie zustimme, sofern sein Stand dem deinen gleicht, seine Besitzungen größer als die deinen sind und sein Einkommen deines übertrifft.«
Das Schriftstück unterzeichnete er tatsächlich und sie hatte ihr Glück nicht fassen können. Er hatte Sand auf das Dokument geschüttet, es dann zusammengerollt und ihr gereicht - nach dem sie nicht gierig grapschte. Stattdessen hatte sie das Dokument mit resignierter Miene zu sich genommen und sich einverstanden erklärt, nach London zu reisen auf der Suche nach einem englischen Ehemann.
Das Dokument war in ihrem Koffer versteckt, ins Futter eingenäht: ein Pass in die Freiheit und endlich ein eigenes Leben.
»Der Earl von Withersay ist ein liebenswürdiger Mann.« Louis’ Blick war auf den stämmigen Klotz gerichtet, der in der Gruppe stand, von der sie sich gerade entfernt hatte. »Hast du mit ihm geredet?«
»Er ist alt genug, mein Vater zu sein.« Und nicht nach meinem Geschmack …« Helenas Augen schweiften über die Menge. »Ich werde mich bei Marjorie über einen gewissen Herzog erkundigen. Sonst gibt es hier sowieso keinen passenden.«
Louis schnaubte verächtlich. »Seit einer Woche bist du umgeben von der Blüte englischer Aristokratie - ich glaube, du schraubst deine Ansprüche zu hoch. Eingedenk der Wünsche deines Onkels, könnte ich jede Menge Kandidaten für deine Hand finden.«
Helena fixierte Louis unnachgiebig. »Fabien und ich haben seine Wünsche besprochen. Ich gestatte es dir nicht, - wie sagt man doch - meine Pläne über den Haufen zu werfen.« Ihre Stimme war jetzt eisig. Sie strafte Louis’ Sturheit mit Verachtung und neigte hochmütig den Kopf. »Ich werde mit Marjorie in die Green Street zurückkehren. Du brauchst dich keinesfalls verpflichtet zu fühlen, uns zu begleiten.«
Damit rauschte sie davon. Sie erlaubte ihrem Mund, sich zu einem Lächeln zu entspannen, und glitt durch die Menge. Marjorie, Mme Thierry, Gemahlin des Chevalier Thierry, einem entfernten Verwandten, war nominell ihre Anstandsdame; Helena hatte sie auf der anderen Seite des Raumes erspäht. Sie begab sich in diese Richtung, war sich der männlichen Blicke, die ihr folgten, bewusst. Und erleichtert, dass in dieser Saison, in der sich die Gesellschaft in hektischen Aktivitäten erging, ihr Einstieg in diese wesentlich weniger auffiel als es sonst der Fall gewesen wäre. Häufchen von kichernden Ladys und geschwätzigen Gentlemen drängten sich aneinander, die Stimmung war ausgelassen dank Myladys Glühwein und dem viel versprechenden Auftakt der Festzeit. Man konnte mit einem Nicken und einem Lächeln an allen vorbeihuschen.
Durch Fabiens Vermittlung logierten Helena und Louis bei den Thierrys, im Nobelviertel der Stadt. Für Fabien und auch für Helena spielte Geld keine Rolle. Die Thierrys dagegen waren nicht vermögend und außerordentlich dankbar, dass Monsieur le Comte de Vichesse Unterkunft und Unterhalt bezahlte - ebenso wie Diener und eine Apanage, um die zahlreichen Freunde und Bekannten, die sie in ihrem einen, bedauerlich teuren Jahr in London kennen gelernt hatten, einzuladen.
Die Thierrys wussten selbstverständlich, welch starken Einfluss Fabien de Mordaunt hatte, sogar in England. Helenas Vormund besaß einen berüchtigt langen Arm. Sie waren nur allzu bereit, alles zu befolgen, was Monsieur Le Comte forderte; voller Eifer führten sie sein Mündel in die feine Gesellschaft ein und halfen ihr dabei, sich akzeptable Anträge zu sichern.
Mit großer Sorgfalt hatte Helena die Dankbarkeit der Thierrys gefördert. Trotz der Tatsache, dass Marjorie dazu neigte, sich Louis zu fügen, war sie ein Quell von Informationen über die guten Partien hier zu Lande.
Es musste doch wenigstens einen geben, der ihren Kriterien entsprach.
Marjorie, eine magere, aber elegante Blondine um die dreißig, plauderte angeregt mit einer Lady und einem Gentleman. Sie gesellte sich zu ihnen. Etwas später trennten sie sich und sie zog Marjorie beiseite.
»Withersay?«
Helena schüttelte den Kopf. »Zu alt.« Zu festgefahren, zu anspruchsvoll. »Louis sagt, es wäre ein Herzog hier - St. Ives. Was ist mit dem?«
»St. Ives? Oh, nein, nein, nein.« Marjorie riss entsetzt die Augen auf und wedelte obendrein abweisend mit den Händen. Sie sah sich um, dann beugte sie sich zu ihr und flüsterte: »Nicht St. Ives, ma petite! Er ist nichts für dich - in der Tat - er eignet sich für keine gut erzogene Mademoiselle.«
Mit gelüfteten Brauen wartete Helena auf weitere Einzelheiten. »Sein Ruf schockiert alle! Schon seit vielen Jahren ist das so. Nun, dieser Herzog gehört zum Hochadel und hat riesige Besitzungen; aber es sieht nicht so aus, dass der jemals heiraten würde.« Marjories viel sagende Gestik zeigte, wie unbegreiflich sie das fand. »Das akzeptiert die Gesellschaft - angeblich hat er drei Brüder, der ältere von ihnen ist jetzt verheiratet und hat einen Sohn …« Noch ein verständnisloses Achselzucken. »Also ist der Herzog gar keine respektable Partie und überdies …« Sie hielt inne, suchte nach dem richtigen Wort, dann hauchte sie: »dangereux«.
Bevor Helena etwas sagen konnte, hob Marjorie den Kopf, packte Mademoiselles Handgelenk und zischte: »Schau!«
Helenas Blick folgte Marjories zu dem Herrn, der soeben durch den Bogen aus dem Hauptsalon getreten war.
»Monsieur Le Duc de St. Ives!«
Ihr wilder Engländer, der mit den kühlen, machtvollen Lippen, sanft im Mondlicht …
Ein Bild von Eleganz, Arroganz, von Macht, stand er auf der Schwelle und musterte die Anwesenden. Bevor sein Blick sie erreichte, zerrte Marjorie Helena in die entgegengesetzte Richtung.
»Jetzt siehst du es. Dangereux!«
Helena sah es in der Tat und dennoch … sie erinnerte sich immer noch an den Kuss und das darin verborgene Versprechen - dass wenn sie sich hingeben würde, sie für immer auf Händen getragen würde. Elementar verführerisch - und es stellte die Schwüre jedes potenziellen Liebhabers in den Schatten. Ja, er war ein Verführer, hatte seine Kunst perfektioniert, daran bestand keinerlei Zweifel. Gefährlich - das musste sie zugeben; es wäre weise, Distanz zu bewahren.
Niemals würde sie so närrisch sein und einem mächtigen Mann entfliehen, nur um sich in die Hände des nächsten zu begeben. Freiheit war ihr viel zu kostbar geworden.
Glücklicherweise hatte Monsieur le Duc öffentlich kundgetan, dass er nicht zur kämpfenden Truppe gehörte.
»Gibt es hier noch irgendwelche andere, die ich in Betracht ziehen sollte?«
»Du hast Monsieur le Marquess kennen gelernt?«
»Tanqueray? Ja. Ich glaube nicht, dass er Monsieur le Comtes Bedingungen erfüllen würde. Nachdem was er angedeutet hat, ist er verschuldet.«
»Sehr gut möglich. Aber er gibt sich immer besonders stolz, also hab ich nichts davon gehört. Schauen wir mal …« Marjorie betrat einen anderen Salon, blieb stehen und sah sich um. »Hier kommt auch niemand in Frage, aber es ist für uns noch zu früh zu gehen. Das wäre eine Beleidigung. Wir müssen mindestens eine weiter halbe Stunde bleiben.«
»Also gut, noch eine halbe Stunde. Mehr nicht.« Helena ließ sich von Marjorie zu einer lebhaften Gruppe führen. Die Konversation war voll im Gange; aber als Neuankömmling beobachtete sie nur, hörte schweigend zu. Niemand kannte sie so gut, um zu wissen, dass Zurückhaltung sonst nicht zu ihren Tugenden gehörte; aber heute Abend gab sie sich damit zufrieden, den Mund zu halten und ihren Gedanken freien Lauf zu lassen.
Helena hatte es wirklich satt, Fabiens Bauer zu sein; doch das Gesetz und die Gesellschaft zwangen sie, sich seinem Diktat zu beugen, wodurch ihr die Hände gebunden waren. Dieser Londonaufenthalt bot ihr die vielleicht einzige Chance, dem zu entfliehen - eine Wende des Schicksals, die sie mit List und Tücke aufgegriffen hatte, und die sie entschlossen war zu nutzen. Mit Fabiens schriftlicher Erklärung, unterzeichnet und besiegelt, konnte sie jeden englischen Aristokraten ihrer Wahl heiraten - vorausgesetzt, er erfüllte Fabiens Forderungen hinsichtlich Stand, Besitz und Einkommen. Sie fand die Bedingungen vernünftig; es gab bestimmt englische passende Kandidaten.
Sie mussten einen Titel haben, etabliert und reich sein - sowie beherrschbar. Das vierte Kriterium hatte sie zu Fabiens dreien hinzugefügt, um den perfekten Ehemann für sich zu definieren. Unter keinen Umständen war sie bereit, die Marionette zu spielen, deren Fäden ein Mann zog. Wenn in Zukunft irgendwelche Fäden gezogen würden, dann von ihr.
Sie würde nicht heiraten, nur um das bewegliche Besitztum eines neuen Tyrannen zu werden - ein Ding ohne nennenswerte Gefühle. Fabien interessierten die Emotionen anderer Menschen nur, insoweit sie seine Pläne betrafen. Er war ein Despot, zerquetschte jeden, der sich gegen ihn wehrte, gnadenlos. Von Anfang an hatte sie ihn durchschaut und seine Obhut unbeschadet überstanden, weil sie ihn und seine Motive einzuordnen vermochte; gleichzeitig hatte sie gelernt, ihren Drang nach Unabhängigkeit zu bändigen.
Sie war nie so dumm gewesen, einen Kreuzzug anzutreten, den sie nicht gewinnen konnte. Aber diesmal war das Glück auf ihrer Seite. Sich von Fabien, von allen mächtigen Männern zu befreien, zeigte sich nun als erreichbares Ziel.
»Welch glücklicher Zufall, meine liebe Comtesse!«
Gaston Thierry tauchte neben ihr auf. In Anerkennung ihres Rangs verbeugte er sich tief und strahlte, als er sich wieder aufrichtete. »Falls du frei bist - ich habe eine Reihe von Bitten dich vorzustellen erhalten.«
Das Zwinkern in seinen Augen brachte Helena zum Lächeln. Der Chevalier war ein Charmeur, aber ein liebenswerter. Bereitwillig reichte sie ihm ihre Hand. »Wenn Madame, Eure Gattin, mich entschuldigt …«
Mit einem huldvollen Nicken Richtung Marjorie und den Rest der Gruppe ließ sie sich von Gaston wegführen.
Wie angekündigt, hatte eine Reihe von Gentlemen diese Bitte geäußert, und wenn sie schon Stunden in Lady Morphets Salon verbringen musste, konnte sie sich genauso gut amüsieren. Sie gaben sich alle die größte Mühe mit ihr, versuchten ihr Interesse zu wecken, erzählten ihr die neuesten Ondits, schilderten ihr die jüngsten Weihnachtsextravaganzen, die irgendeine einfallsreiche Gastgeberin sich ausgedacht hatte.
Fragten sie nach ihren Plänen.
Zu diesem Thema äußerte sie sich vage, was sie noch neugieriger machte, wie sie sehr wohl wusste.
»Ah, Thierry - bitte stell mich vor.«
Die träge Stimme kam von hinten. Helena erkannte seine Stimme nicht, wusste aber, wer er war. Es kostete sie große Mühe, nicht herumzuwirbeln und ihn anzustarren. Sie drehte sich langsam, anmutig und fixierte ihn mit höflich abweisender Miene.
Sebastian sah hinunter in das madonnengleiche Antlitz, das er trotz sieben langer, verstrichener Jahre nicht vergessen hatte. Ihre Miene war genauso hochmütig und selbstbewusst, wie er sie in Erinnerung hatte - eine unverhohlene Handbewegung für seinesgleichen, obwohl er bezweifelte, dass sie sich darüber im Klaren war. Ihre Augen … er wartete, bis sich ihre Lider hoben und ihr Blick sich auf ihn richtete.
Grün. Durchsichtiges Grün. Peridot-Augen, die in ihrer kristallenen Klarheit überraschten. Augen, die verlockten, die einem Mann gestatteten, in ihre Seele zu schauen.
Wenn sie es zuließ.
Er hatte sieben Jahre darauf gewartet, diese Augen wieder zu finden. Da lag keine Spur von Erkennen in ihnen, auch nicht in ihrer Miene. Er erlaubte seinen Lippen, sich anerkennend zu schürzen. Natürlich wusste er, dass sie ihn erkannt hatte. Genauso unbestreitbar, wie er sie erkannt hatte.
Es war ihr Haar, das ihn auf sie aufmerksam gemacht hatte. Schwarz wie die Nacht, eine Wolke dichter Locken, die ihr Gesicht umrahmte, über ihre Schultern fiel. Er hatte seinen Blick schweifen lassen, ihre Figur gemustert, die aufreizend in einem seegrünen Seidengewand mit Petticoat und Überrock aus Brokat zur Schau gestellt war. Er hatte abgeschätzt, überlegt … und dann erst ihr Gesicht entdeckt.
Inzwischen war das Schweigen etwas angespannt. Er warf Thierry einen Blick zu, hob eine Braue einen Millimeter; es stand fest, warum der Mann zögerte. Der Chevalier trat von einem Fuß auf den anderen wie eine Katze auf heißen Kohlen.
Dann schaute er die Lady Thierry auffordernd an und hob selbst eine herrische, kaum zu übersehende Braue.
»Ahem!« Thierry wedelte mit der Hand. »Monsieur le Duc de St. Ives. Mademoiselle la Comtessa d’Lisle.«
Er reichte ihr die Hand, sie legte ihre Finger auf die seinen und machte einen tiefen Knicks.
»Monsieur le Duc!«
»Comtesse!« Er verbeugte sich, dann zog er sie hoch. Widerstand dem Drang, ihre schlanken Finger zu packen. »Sie sind erst vor kurzem aus Paris gekommen?«
»Vor einer Woche.« Sie sah sich so siegesgewiss um, wie er sie in Erinnerung hatte. »Es ist mein erster Besuch an diesen Gestaden.« Ihr Blick traf sich mit seinem. »In London …«
Helena nahm an, dass er sie erkannt hatte, aber seine Miene blieb verschlossen. Sein kantiges, hart modelliertes Gesicht ähnelte einer steinernen Maske, verriet nichts; seine Augen waren blau wie der Sommerhimmel, irgendwie unschuldig und doch von Wimpern umrahmt, die so lang und üppig waren, dass sich jeder Gedanke an Unschuld verflüchtigte. Seine Lippen zeigten ähnlichen Widerspruch, verkörperten mehr als nur eine Andeutung rücksichtslosen Willens, und momentan zwar entspannt, deuteten sie doch einen wachen Sinn für Humor an, einen trockenen fordernden Geist.
Er gehörte nicht zu den Jüngsten. Von denen, die sie augenblicklich umgaben, war er zweifellos der Älteste, definitiv der Reifste. Trotzdem strahlte er eine lebendige, maskuline Vitalität aus, die die Übrigen in den Schatten stellte, sie in den Hintergrund treten ließ.
Dominant. Helena war die Gegenwart eines solchen Mannes gewohnt, war es gewohnt, sich gegen einen mächtigen Willen zu behaupten. Sie hob ihr Kinn und sah ihm gelassen in die Augen. »Haben Sie in letzter Zeit Paris besucht, Mylord?«
Augen und Lippen verrieten ihn, aber nur, weil sie ihn so genau beobachtete. Ein Blitzen, ein kurzes Zucken, das war alles.
»In den letzten Jahren nicht. Früher einmal verbrachte ich einen Teil des Jahres dort, aber das ist eine Weile her.«
Die letzten sechs Worte betonte er kaum merklich; er hatte sie definitiv erkannt. Ein Hauch von Erinnerung huschte über Helenas Haut. Und, als hätte er es gespürt, begann sein Blick zu wandern, senkte sich und streifte über ihre Schultern.
»Ich gestehe, ich bin überrascht, dass wir uns nicht schon längst begegnet sind.«
Sie wartete, bis er ihr wieder in die Augen sah. »Ich besuchte Paris nicht häufig. Meine Güter liegen im Süden Frankreichs.«
Seine Mundwinkel zuckten nach oben, sein Blick hob sich zu ihrem Haar, dann kehrte er zu ihren Augen zurück. »Das hatte ich mir gedacht.«
Die Bemerkung klang unverfänglich - ihr Teint war in der Tat typischer für den Süden Frankreichs als für den Norden. Aber sein Tonfall … fuhr ihr in die Glieder und glitt durch sie, schlug eine Saite in ihr an, ließ sie vibrieren.
Sie warf Gaston, der immer noch sichtlich nervös neben ihnen stand, einen Blick zu. »Verzeiht, Euer Gnaden, aber ich glaube, es ist an der Zeit, aufzubrechen. Nicht wahr, Monsieur?«
»In der Tat, in der Tat.« Gaston nickte wie eine mechanische Puppe. »Wenn Monsieur le Duc uns entschuldigen würde?«
»Natürlich.« Die blauen Augen funkelten amüsiert, als sie zu Helenas Gesicht zurückkehrten. Sie ignorierte das und knickste abermals. Er verbeugte sich, zog sie hoch, bevor sie ihm ihre Hand entwinden konnte, und murmelte: »Ich nehme an, Ihr werdet in London bleiben, Comtesse - zumindest für den Augenblick.«
Sie zögerte, neigte dann den Kopf. »Vorübergehend …«
»Dann werden wir zweifellos Gelegenheit haben, unsere Bekanntschaft zu vertiefen.« Er hob ihre Hand, ohne sie aus den Augen zu lassen und strich mit den Lippen über ihre Knöchel. Ließ sie gewandt los und senkte den Kopf. »Noch einmal, Mademoiselle, au revoir!«
Zu Helenas Erleichterung hörte Gaston dieses »noch einmal« nicht. Er und Marjorie waren so erregt über ihr Zusammentreffen mit St. Ives - und dass er darum gebeten hatte, vorgestellt zu werden -, dass sie Helenas Gedankenverlorenheit gar nicht bemerkten. Noch bekamen sie mit, wie ihre Finger über die Knöchel strichen, wo seine Lippen sie berührt hatten. Bis zu ihrer Ankunft in Green Street, als sie die geflieste Halle betraten, hatte sie ihre Reaktionen unter Kontrolle.
»Wieder ein Abend vorbei«, seufzte sie, als die Zofe herbeieilte, um ihr den Umhang abzunehmen. »Vielleicht haben wir ja morgen mehr Erfolg.«
Marjorie warf ihr einen Blick zu. »Morgen ist Lady Montgomerys Empfang - da werden sie sich bis zur Decke stapeln, die bedeutenden Persönlichkeiten.«
»Bon!« Helena wandte sich zur Treppe. »Ein interessantes Revier zum Jagen, denke ich!«
Sie wünschte Gaston eine gute Nacht. Marjorie stieg mit ihr die Treppe hoch.
»Meine Liebe … Monsieur le Duc - er ist keine angemessene parti. Es schickt sich nicht, dass du ihn ermutigst, an deiner Seite zu verweilen. Ich bin mir sicher, du verstehst das.«
»Monsieur le Duc de St. Ives?« Als Marjorie nickte, winkte Helena abfällig. »Er hat sich nur amüsiert - und bestimmt hat es ihm Spaß gemacht, Thierry aus der Fassung zu bringen.«
»Eh bien - das wäre möglich, gebe ich zu. Solche wie er … na ja, gewarnt ist gewappnet!«
»In der Tat.« Helena blieb vor ihrer Tür stehen. »Seid unbesorgt, Madame. Ich bin nicht so dumm, dass ich meine Zeit an einen Mann wie Seine Gnaden St. Ives verschwende!«
»Endlich! Sie haben sich kennen gelernt!« Louis zerrte sich seine Krawatte vom Hals, warf sie dem wartenden Kammerdiener zu und lockerte seinen Kragen. »Ich hatte schon Sorge, ich selbst müsste sie miteinander bekannt machen, aber endlich haben sich ihre Wege von alleine gekreuzt. Es lief genau, wie Onkel Fabien prophezeit hatte - er kam zu ihr.«
»In der Tat, Monsieur. Ihr Onkel hat eine geradezu unheimliche Nase für solche Dinge.« Villard half Louis aus dem Mantel.
»Ich werde ihm morgen schreiben - er möchte sicher die gute Nachricht hören.«
»Mein Wort, Monsieur, ich werde dafür sorgen, dass Eure Botschaft mit aller gebotenen Eile losgeschickt wird.«
»Erinnere mich morgen daran«, murmelte Louis, während er seine Weste aufknöpfte. »Jetzt zum nächsten Schritt!«
Helena traf Monsieur le Duc St. Ives auf Lady Montgomerys Empfang, auf Lady Furness Kostüm-Party und auf dem Ball der Rawleighs. Wenn sie im Park spazieren ging, war er durch schieren Zufall da, flanierte dort mit zwei Freunden.
Wohin sie die nächsten vier Tage ihre Schritte auch lenkte, irgendwie gab es ihn immer ganz plötzlich.
Folglich überraschte sie es gar nicht, als er sich zu einer Gruppe gesellte, mit der sie im Ballsaal der Duchess of Richmond plauderte. Er tauchte dräuend zu ihrer Rechten auf und die anderen Gentlemen wichen feige zur Seite, als hätte er einen Anspruch auf diesen Platz. Helena verkniff sich ihren Ärger - auf ihn und auch auf die anderen - lächelte heiter und reichte ihm die Hand. Und wappnete sich gegen das Kribbeln, das sie von den Fingern bis zu den Zehen durchfuhr, als er ihr tief in die Augen sah und seinen Mund auf ihre Rechte drückte.
»Bon soir, meine Liebe!«
Es war ihr ein Rätsel, wie zweideutig so unschuldige Worte klingen konnten. War es das Strahlen in seinen blauen Augen, der verführerische Tenor seiner Stimme, oder die gezügelte Kraft seiner Berührung? Helena wusste es nicht; aber es gefiel ihr nicht, dass jemand ihre sinnlichen Saiten so geschickt zum Klingen brachte.
Dennoch lächelte sie weiter und ließ es zu, dass er sich neben sie stellte und sich ihrer Unterhaltung anschloss. Als die Gruppe sich auflöste, um die Runde zu machen, blieb sie zurück. Sie wusste, dass er sie beobachtete, immer wachsam. Nachdem er ihr nach kurzem Zögern seine Hand reichte, legte sie freundlich ihre Finger auf seine.
Sie setzten sich in Bewegung, aber schon nach ein paar Metern murmelte sie: »Ich möchte mit Euch sprechen.«
Helena sah ihm nicht ins Gesicht, ahnte aber, dass seine Lippen zuckten.
»Das hatte ich angenommen.«
»Gibt es hier irgendeinen Platz - in diesem Raum - für alle sichtbar, aber wo einen niemand belauscht?«
»Drüben, an der Seite befinden sich offene Alkoven.«
Er führte sie zu einem davon mit einer S-förmigen Liebesbank, die momentan frei war. Er setzte sie auf den Platz mit Blick zum Raum, dann ließ er sich lässig auf dem anderen nieder.
»Ich bin ganz Ohr, mignonne.«
Helena musterte ihn aus zusammengekniffenen Augen. »Was habt Ihr vor?«
Seine fein geschwungenen Brauen hoben sich. »Vor?«
»Was genau hofft Ihr damit zu erreichen, dass Ihr mich auf diese Art und Weise verfolgt?«
Er sah ihr ernst in die Augen, aber sein Mund zuckte erneut. Jetzt hob er die Hand, legte sie theatralisch ans Herz. »Mignonne, Ihr verletzt mich tief.«
»Wenn ich das nur könnte!« Helena zwang sich, ruhig zu bleiben - mit knapper Not. »Und ich bin nicht Eure mignonne!«
Nicht sein Schoßhündchen, nicht sein Liebling.
Der Herzog lächelte nur - nachsichtig - als wisse er so viel mehr als sie.
Helenas Finger krallten sich um ihren Fächer, und sie musste sich bezähmen, ihn nicht damit zu schlagen. Sie hatte mit so einer Reaktion gerechnet - keiner Reaktion - und war darauf vorbereitet. Jedoch überraschte es sie, wie heftig sie sich ärgerte, wie leicht er sie aus der Fassung bringen konnte. Normalerweise war sie nicht so dünnhäutig, verlor nicht so schnell die Beherrschung.
»Wie Ihr ohne Zweifel erraten habt, so allwissend wie Ihr seid, bin ich auf der Suche nach einem Ehemann. Aber ich bin nicht auf der Suche nach einem Eroberer. Ich möchte das ein für alle Mal klarstellen, Euer Gnaden! Egal welche Absichten Ihr hegt, egal wie routiniert Ihr seid, es besteht keine Chance, dass ich Eurem legendären Charme erliege.«
Darüber hatte sie von einer besorgten Marjorie gehört und noch mehr aus Geflüster und verwunderten Blicken geschlossen. Selbst wenn sie sich, so wie jetzt, in aller Öffentlichkeit unterhielten - und sie nicht dreiundzwanzig und von edler Geburt wäre, liefe sie Gefahr, lockerer Moral bezichtigt zu werden.
Ihr Blick tauchte in seinen; sie wartete auf eine spöttische Bemerkung, irgendeine Herausforderung, ein Kreuzen der Klingen. Stattdessen betrachtete er sie nachdenklich und bedächtig, dehnte den Moment aus, bis er die Brauen eine Winzigkeit hob. »Glaubt Ihr nicht?«
»Ich weiß, dass ich es nicht werde.« Es war eine Erleichterung, die Zügel der Unterhaltung wieder aufzunehmen. »Für Euch gibt es hier nichts - keinerlei Hoffnung - also besteht kein Grund, dass Ihr ständig an meiner Seite klebt.«
Seine Lippen entspannten sich zu einem definitiven Lächeln. »Ich … äh, klebe an Eurer Seite, mignonne, weil Ihr mich amüsiert.« Er sah hinunter, zupfte die Spitze, die sich über eine weiße Hand ergoss, zurecht. »Es gibt nur wenige, denen das gelingt.«
Helena unterdrückte ein verächtliches Schnauben. »Es gibt sehr viele, die nur allzu bereit sind, es zu versuchen.«
»Leider mangelt es ihnen an Fähigkeiten.«
»Vielleicht sind Eure Maßstäbe zu hoch?«
Er hob den Kopf und sah sie an. »Meine Maßstäbe mögen vielleicht streng sein. Aber wie sich zeigt, nicht unerreichbar.«
Ihre Augen wurden zu schmalen Schlitzen. »Ihr seid eine Pest!«
Das Ganze machte ihm Spaß. »Nicht meine Absicht, mignonne!«
Sie biss die Zähne zusammen, um nicht laut loszuschreien. Niemals würde sie seine mignonne sein! Aber auch das hatte sie einkalkuliert - seine Unerschütterlichkeit. Einen gewohnheitsmäßigen Tyrannen dazu zu bringen, sich mit einer Niederlage abzufinden und zu gehen - das würde ihr nicht beim ersten Waffengang gelingen. Helena holte tief Luft, zügelte ihren Zorn. »Schön.« Sie nickte mit hoch erhobenem Haupt. »Wenn Ihr darauf besteht, an meinem Rockzipfel zu hängen, könnt Ihr Euch auch nützlich machen. Ihr kennt alle Gentlemen der Gesellschaft - wisst mehr, wage ich zu sagen, als die meisten, was ihre Güter und Lebensumstände betrifft. Ihr dürft mir helfen, einen passenden Gemahl zu finden.«
Vorübergehend verschlug es Sebastian die Sprache. Und diese Tatsache bewies seine These, dass sie und nur sie allein die Fähigkeit besaß, ihn in Erstaunen zu versetzen - ja, ihn zum Lachen zu bringen. Der Impuls, selbst wenn er ihm nicht nachgab, verschaffte ihm ein unerwartet gutes Gefühl. Erfrischend.
Aber seinen Ruf hatte er nicht gewonnen, indem er beim Erkennen und Ergreifen einer Gelegenheit zögerte. »Die Freude wird ganz auf meiner Seite sein, mignonne.«
Der Blick, den sie ihm zuwarf, war misstrauisch; er ließ seine Augen nicht seine Absichten verraten. Stattdessen legte er die Hand aufs Herz und verbeugte sich. »Es wird mir eine Ehre sein, mit Euch gemeinsam die Angebote zu überprüfen.«
»Vraiment?«
»Vraiment.« Er lächelte, war absolut bereit, ihr diesen Gefallen zu tun. Auf keine andere Weise konnte er besser verhindern, dass sie jemanden von zweifelhafter Bedeutung kennen lernte. Und jetzt würde sie ihm gestatten, in ihrer Nähe zu bleiben, während er überlegte …
Sebastian streckte die Hand aus und griff nach ihrer. »Kommt, tanzt mit mir!«
Er erhob sich, umrundete die Liebesbank, und zog sie hoch. Helena fügte sich, obwohl es eindeutig ein Befehl war und keine Bitte. Bis jetzt hatte sie es vermieden zu tanzen, um sich nicht mit dem Gefühl auseinander setzen zu müssen, das sie erfasste, wenn seine langen Finger die ihren umschlossen.
In ihrer Nähe stellten sich weitere Paare auf; sie gesellten sich dazu. Der erste Takt erklang und sie machte einen Knicks. Er verbeugte sich. Dann nahmen sie sich an der Hand und der Tanz begann.
Es war schlimmer, als sie es sich vorgestellt hatte. Sie schaffte es nicht, sich von seinen Blicken zu lösen, obwohl sie
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Promise of a Kiss« bei William Morris, an inprint of HarperCollins Publishers Inc., New York.
4. Auflage Deutsche Erstausgabe April 2003 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2001 by
Savdek Management Proprietory Limited Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2003 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Uhl+Massopust, Aalen
Redaktion: Barbara Gernet LW · Herstellung: Heidrun Nawrot
eISBN 978-3-641-03995-0
www.blanvalet-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de