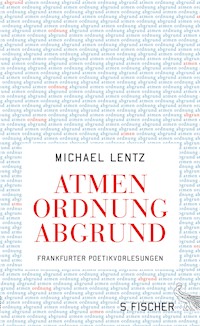22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Eugen Gomringer, der Begründer der Konkreten Poesie, schreibt in einem Brief an Michael Lentz: »Seit Jahren, Jahrzehnten sind für mich Romane überflüssig. Bis eben dein Roman eintraf. Wir müssen keine Bücher mehr schreiben.« Burkhard Müller hingegen findet in der »Süddeutschen Zeitung«, »Schattenfroh« raube einem nur die Zeit. Anders Andreas Platthaus in der F.A.Z., für den sich »der weiteste Leseweg und die größte Lesemühe« lohnen, man solle nach der ersten gleich die zweite Lektüre beginnen. Wieder anders Andrea Köhler in der »Zeit«. Sie kapituliert und kann sich nicht entscheiden, ob das nun genialisch, wahnsinnig oder albern ist. Diese Frage hat Richard Kämmerlings entschieden und bewundert in der »Welt« das »große literarische Werk«. Wir merken, es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit, selbst bei geübten Lesern. Dem hilft Michael Lentz jetzt ab, indem er in seiner Wiener Ernst-Jandl-Poetikvorlesung seinen Roman erklärt. Ja, das ist schon ein bisschen größenwahnsinnig. Aber wen wundert's? Das ist »Schattenfroh« schließlich auch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Michael Lentz
Innehaben
Schattenfroh und die Bilder
Biografie
Michael Lentz, 1964 in Düren geboren, lebt in Berlin. Autor, Musiker, Herausgeber. Zuletzt erschienen: »Pazifik Exil« (Roman), »Warum wir also hier sind« (Theaterstück), »Offene Unruh« (Gedichte), die Essay- und Aufsatzsammlung »Textleben«, die Frankfurter Poetikvorlesungen »Atmen Ordnung Abgrund« und »Schattenfroh. Ein Requiem« (Roman), alle bei S. FISCHER und bei FISCHER Taschenbuch.
Inhalt
I. Einleitung
II. Grenzüberschreitungen zwischen Kunst und Literatur
1. Der Paragone
2. Ekphrasis
2.1 Zur (Definitions)geschichte der Ekphrasis
2.2 Rhetorische Ekphrasis
2.3 Enérgeia und enárgeia
2.4 Narrative Ekphrasis
2.5 Ekphrasis als Geste
2.6 Ekphrasis als Schauplatz der Otherness
2.7 Ekphrasis als Repräsentationstheorie
III. Ekphrastische Psychogeographie. Über die Bilder im Roman Schattenfroh
1. Einleitung
2. Zur Ekphrasis in Schattenfroh
3. Bilder der Angst: Schattenfroh
3.1 Einleitung
3.2 Re-Präsentation der Repräsentation
3.3 Zu einzelnen Bildern in Schattenfroh
IV. Anamorphosen. Ausblicke
Literatur
I.Einleitung
»Man kann ein Leben daran wenden, das Eingebildete und das Wirkliche gegeneinanderzuhalten, und wird dennoch niemals damit zu Rande kommen.« (Jean Améry)
Die Grunddifferenz zwischen »res« und »verba« ist ein Konstitutionsakt der Sprache, der die bloße Selbstreferenzialität von sprachlicher Materialität verhindert, indem er diese immer zugleich in ihrem Bezug voraussetzt.
Der Grunddifferenz zwischen »res« und »verba«, die der Kommunikation vorgängig ist und als komplementär vermittelt wird, damit Sprache als Kommunikationsakt operationabel ist, korrespondiert von der antiken Rhetorik bis heute die Vereinbarung, dass Sprache nicht als sie selbst »in ihrer grafischen oder klanglichen Gestalt, sondern etwas anderes, eine Figur, eine Landschaft, ein Gegenstand oder eine Handlung«[1] zum Erscheinen kommt.
Auch Bilder können in der Literatur und durch sie zum Erscheinen kommen. Denn Literatur ist ein »Imaginationsmedium«[2]. Bei diesen Bildern kann es sich um physische Bilder handeln, zum Beispiel um Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, die beschrieben oder erzählt werden, oder um fiktionale Bilder, denen kein physisches Korrelat entspricht.
Literatur öffnet dem Leser Schau- und Imaginationsräume und stimuliert seine Wahrnehmungstätigkeit. Der Autor bzw. Erzähler fungiert als Perieget, als Herumführer, der den Leser wahrnehmen und erkennen lässt. Insofern ist jede Literatur Periegese, Reiseliteratur, die ihre Legitimation aus dem imaginativen Besuch, wenn vielleicht auch nicht (mehr) real existierender, so doch zumindest imaginärer Sehenswürdigkeiten erfährt. Denn als Itinerar, als beschreibende Darstellung von Verkehrswegen und Straßen mit Ortsangaben zu Unterkünften etc. wie bei den altgriechischen Periegeten, mit der Periegesis des Hekataios von Milet vom Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. als Gründungsakte, fungiert eine solche Reiseliteratur nicht mehr.
Beiden Arten von Reiseliteratur, der faktualen wie der fiktionalen, gemeinsam ist ihre Kinetik. »Wie die reale Umwelt so ist auch die Vorstellung kinetisch.«[3] Einer der Gründe für die nachhaltige Attraktivität des Lesens liegt darin, dass der Leser phänomenologisch die imaginative Visualisierung als nicht weniger real als die Wirklichkeit und die in ihr vorfindlichen Dinge auffasst bzw. das Lesen eine solche Analogie suggeriert. Der Zusammenhang von »realer Wahrnehmung und imaginativer Visualisierung« wird neuro- und kognitionswissenschaftlich abgestützt. Bei »der visuellen Wahrnehmung und der visuellen Imagination« seien »dieselben Zentren im Gehirn aktiv« und außerdem interferiere »die visuelle Imagination mit der visuellen Wahrnehmung«. Dies bedeute nicht nur, dass eine Affinität von visueller Wahrnehmung und Imagination besteht, sondern sogar, dass die visuelle Vorstellung nach denselben Gesetzen und Regeln verläuft wie die tatsächliche Wahrnehmung. Eine wesentliche Differenz zwischen Visualisierung und visueller Wahrnehmung bestünde jedoch darin, dass Visualisierungen intentional und von Willen und Aufmerksamkeit abhängig seien, fasst Renate Brosch diesbezügliche Experimente und ihre Konsequenzen zusammen.[4]
Lesen heißt Vorstellungen bilden. Vorstellungen bzw. innere Bilder begleiten den Vorgang des Lesens permanent, gehen ineinander über, lösen einander ab, überlagern sich. An manche Sätze eines Buches mögen wir uns erinnern, nachhaltiger aber verbinden wir mit Büchern und ihren Lektüren bestimmte Vorstellungen, manchmal auch ›nur‹ ein diffuses Gefühl, einen Geschmack im Mund, einen Geruch, eine Temperatur. Selbst aber diese sensorischen Reize können mit Vorstellungen verbunden sein.
Renate Brosch weist darauf hin, dass im Vergleich zur prozessualen Visualisierung »die im Nachhinein erinnerbaren Bilder wirkungsmächtiger durch ihre spezifische Kombination von kultureller Konstruiertheit und affektivem Appell« seien. »Die erinnerbaren Bilder und Bildfolgen« entstünden aus einer vom Text mit Nachdruck evozierten Visualität durch einen deutlichen Bezug zum ikonischen Teil des kulturellen Gedächtnisses«. Bedeutsam ist nun, dass »dieser Bezug auf das Bildgedächtnis einer Kultur nicht unbedingt affirmativ sein« muss. Die Revidierung von Bildinhalten des kulturellen Gedächtnisses steigert gegenüber ihrer Bestätigung die »Wirkungsmächtigkeit«. Die Quintessenz für Brosch lautet, »dass visuelle Aspekte des Textes selbst in unsere schematisierten Wissensbestände eingehen und diese verändern können«[5] – und genau das ist der ästhetische Ehrgeiz von Literatur, den Roman Schattenfroh nicht ausgeschlossen, um den es hier im Zusammenhang mit der Ekphrasis, der Bildbeschreibung, gehen soll, denn Schattenfroh ist ein Roman der Bilder.
Konzentrierte, willentliche Fokussierung als Grundbedingung gerichteter Aufmerksamkeit ist im »Gegensatz zum passiven Sehen« Grundbedingung der visuellen Vorstellung. Das führe, so Brosch, dazu, dass die imaginative Visualisierung enorm angeregt werde, wenn im literarischen Text ein dekodierendes Betrachten dargestellt sei, das den leserseitigen Imaginationsprozess spiegele.[6]
Gleichwohl ist es die von der Literatur nicht restlos zu kontrollierende Freiheit des Lesers, in den gezeigten Dingen und Figuren anderes und andere zu sehen, als vom Autor bzw. Erzähler intendiert bzw. dargestellt. Das Sehen und Anders-Sehen ist abhängig von den mentalen Dispositionen des Lesers, seinem biographischen Hintergrund, seinem das Bildgedächtnis einschließenden kulturellen (Vor)Wissen und den Bedingungen seiner mentalen Partizipation.
Das Buch entsteht also erst im Leser. Erst die Lektüre aktualisiert den Text. Sind diese Feststellungen mehr als erkenntnistheoretische (oder phänomenologische) Petitessen? Lesen heißt Übertragen. Im und mit einem literarischen Text kommt also etwas in Bewegung. Der gewebte Text steht nicht still, er wird lesend belebt und dynamisiert, als unbewegtes Medium ist er fixiert und bewegt zugleich, Bewegung im Stillstand, ohne hier gleich schon von »Eigenbewegtheit« sprechen zu wollen. Gleichwohl ist gerade die Eigenbewegtheit für die Konstitution und das Selbstverständnis der Literatur von besonderem Interesse.[7] Was aber macht die Textbewegung aus? Zunächst einmal handelt es sich nicht um eine einseitige Bewegungsrichtung. Das sukzessive, Zeile für Zeile vorantastende Lesen bedingt eine allmähliche, auf Referentialisierung angelegte Prozessierung von Sinn – eine Bewegung vom Text in Richtung Leser und eine Bewegung vom Leser in Richtung Text. Dies wäre allerdings nur der rezeptiv-texturale Prozess, eine Augenbewegung, die der mechanisch-texturalen Bewegung folgt, ein Surfen auf der materialen Oberfläche. Dieses Surfen selbst ist zu denken als ein beständiger Wechsel von Fixieren (Stillstand) und Bewegen (Sukzession, Iteration, Rekursion). Ihm korrespondiert, scheinbar paradox, die als solche bereits benannte Eigenbewegung des Textes, die selbst eine iterative oder zum Beispiel rekursive sein kann, und es ist das Oszillieren des Rezipienten zwischen diesen beiden entgegengesetzten, jedoch komplementären, im Text bereits programmierten Bewegungsarten, das einen Text allererst konstituiert. Bewegung des Textes konfiguriert sich demnach als eine intrinsisch entfachte Eigenbewegung des Textes und als eine Bewegung des Textes als Rezeptionseffekt. In der Anwesenheit seiner selbst überschreitet sich der Text in Richtung auf sein von ihm evoziertes und angezieltes Abwesendes, das ist der Virus, den er in der Wahrnehmung durch den Rezipienten in Umlauf setzt. Lesen heißt immer Supplementieren. Der Roman Schattenfroh bzw. seine Erzählinstanz weiß, dass das durch die Imagination des Lesers in seine texturale Anwesenheit eingespeiste Abwesende sukzessive Teil des Anwesenden wird und so fort – zumindest, solange der Text gelesen und somit akualisiert wird: eine Echternacher Schleifenprozession des die Linearität gewissermaßen nach links und rechts, oben und unten, vorne und hinten durchbrechenden allmählichen Entstehens von Text, das Erzählen von Fiktion, das kein Nacherzählen kennt, das verschlungen ist und auch seine eigene Löschung erzählt.
Die Rede von einer Aktualisierung des Abwesenden in und mit der Lektüre spielt demgegenüber auf die »unvollständigen ontologischen Strukturen« literarischer Texte an, aufgrund deren literarische Texte »eine imaginäre Komplettierung« herausfordern.[8] Das gilt sowohl für Prosatexte als auch für Poesie, die je eigene Bewegungsmodelle implizieren.[9] Was aber wird komplettiert? Komplettiert kann nur werden, was der Adresse der Vervollständigung fehlt. Dieses Fehlen ist kein defizitäres, keine Mangelerscheinung, sondern der unhintergehbaren Disposition fiktionaler Texte und überhaupt ästhetischer Manifestationen geschuldet.
Renate Brosch bzw. Monika Fludernik und Rolf A. Zwaan sprechen in diesem Zusammenhang von »Eigenbestände(n) aus dem persönlichen Erleben – innere Bilder, Gefühle und Körperempfindungen aus der eigenen Welt, andererseits Wissensbestände aus unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel historisches oder literaturbezogenes Wissen«[10], die Lesende imaginär transferieren. Zum Abwesenden bzw. imaginär zu Transferierenden gehört auch das physische und das innere Bild. Eine Technik der Evokation des Abwesenden ist die Ekphrasis, die Bildbeschreibung. Hierbei spielt es keine Rolle, ob ein wiederum nur imaginäres Bild beschrieben wird, dem kein physisches Bild entspricht.
Bildende Kunst kann ein Erreger[11] sein. Staunend steht der Text vor dem Bild und sagt: »Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist unsichtbar.« Das Bild bleibt ganz gelassen und sagt: »Was du siehst, kann nicht gesagt werden.« Es wäre zu klären, ob sich Bild und Text auf dasselbe Phänomen beziehen.
Es gibt Literatur, die den Erreger Bild nicht loswerden will. Das Bild (ein Gemälde, eine Fotografie, eine Vorstellung etc.) soll den Text immer wieder befeuern in der naiven Annahme, das Bild selbst könne Text erzeugen oder das bloße Betrachten eines Bildes erzeuge den Text. Das Betrachten eines Bildes erzeugt immerhin innere Vorstellungen oder ruft diese – auch als Erinnerungen im Sinne modifizierter Reproduktionen – hervor.
Den Roman Schattenfroh haben nicht die Bilder und Skulpturen von Lotta Blokker, Hieronymus Bosch, Giorgio de Chirico, Matthias Grünewald, Wenzel Hollar, Michael Triegel, Werner Tübke, Jan Vermeer oder zum Beispiel Ror Wolf geschrieben – und doch hat er seine Sprache und seine Form weitenteils nur gefunden durch diese ihm zugrundeliegenden Bilder. Was wie selbstverständlich begann, der naiv zu nennende erzählerische Zugriff auf die Bilder, die Konzeption des Romans als erzählte Bilder, in Korrelation zum erzählenden Bild[12], erfuhr durch selbst wieder zur Narration werdende selbstreflexive Metafiktion eine immer komplexere Struktur.
Es gibt Bilder. Und es gibt Schrift. Mit diesen beiden Feststellungen fangen die Fragen an. Was verstehe ich unter einem »Bild«? Und was genau ist mit »Schrift« gemeint? Der Bild-Begriff ist ein notorisch vielgestaltiger und nicht zuletzt deshalb dunkler, zumindest kann darüber, was ein Bild ist, Konsens nicht vorausgesetzt werden.[13] An ihm arbeiten sich unterschiedliche Disziplinen ab wie zum Beispiel Phänomenologie, Ikonographie, Bildsemiotik, Kognitions- und Neurowissenschaften, Medien- und Kulturtheorie.
Es ist nicht immer ausgemacht, ob diese Disziplinen über einen gemeinsamen Bild-Begriff verhandeln, für den die Bildwissenschaft »seit einiger Zeit einen disziplinenübergreifenden Theorierahmen«[14] sucht.
Auch im Rahmen dieser Selbststudie zum Roman Schattenfroh und seinen bildlichen Implikationen wird im Folgenden »weder der recht unscharfe Bereich literarischer Bildlichkeit behandelt noch das schillernde Phänomen ›Bild‹« theoriegeschichtlich »ausgeleuchtet«. Im Zentrum stehen neben einer Einführung in den für Schattenfroh wichtigen Schlüsselbegriff der Ekphrasis »die imaginativen Prozesse der Leseerfahrung und die Darstellungsverfahren, die sie auslösen«.[15]
Der Bild-Begriff im Deutschen ist, und das unterscheidet ihn vom Bild-Begriff anderer Sprachen, ambig: Er umfasst das innere Bild der Vorstellung wie das äußere Bild der Wahrnehmung. Das Englische zum Beispiel hat für diese Differenz zwei Begriffe, es unterscheidet zwischen »images« und »pictures«.
Pictures (Wahrnehmungsbilder) evozieren images (Vorstellungsbilder), die in Sprache transformiert werden. Diese sprachtransformierten Vorstellungsbilder, Reduktionsstufen von Wahrnehmungsbildern, könnten nun wieder in Wahrnehmungsbilder, zum Beispiel in Gemälde, transformiert werden. Eine unendliche Reihe käme so in Gang.
Selbstverständlich kann Wahrnehmen von Vorstellen begleitet oder auch überlagert sein. Günter Abel spricht in diesem Zusammenhang von einer interpretatorischen Genealogie während des Wahrnehmungsprozesses, in der die Wahrnehmung ein und desselben Objekts in »verschiedenen Situationen, Kontexten und Zeiten« und verschiedener anderer Objekte »derselben Art« in »verschiedenen Situationen, Kontexten und Zeiten« miteinander verknüpft werden, die aktuelle Wahrnehmung also eine Verbindung aktueller und reaktualisierter vergangener Wahrnehmungsmodalitäten und -modifikationen ist.[16]
Was die Verbindung von Sprache und Bild betrifft, konstatiert Ralf Simon ein »Paradox«: »Die Sprache stellt einerseits eine zunächst nichtikonische Materialisierungsinstanz für Bilder dar, ist andererseits aber ihrer logischen Form nach zugleich dort, von woher das Bild überhaupt erst entspringen kann.«[17]
Sind innere Bilder »in der black box der Subjektivität eingeschlossen«[18], so gewährt die Literatur Einblicke in diese Black Box. Sie, die Literatur, ist eine Mobilisierungsinstanz des Imaginären, das »kein sich selbst aktivierendes Potential« ist.[19]
Und doch ist diese von Ralf Simon apostrophierte Black Box der Subjektivität als Eingeschlossensein nicht absolut zu denken, denn so wie auch die inneren Bilder an einem Bildspeicher kulturellen Wissens partizipieren und nicht das bloße Produkt subjektiver fensterloser Monaden ohne intersubjektivierbare Rekurrenz sind, sind auch Subjektivität und die Produktion und Rezeption von Literatur keine solipsistischen Seinsmodi bzw. Tätigkeiten bloßer Selbstwahrnehmung ohne Transferleistungen. Mehr noch, Verständnis selbst ist das Ergebnis von kulturellem Wissenstransfer in den Prozess der Lektüre. »Ohne eine Übertragung kulturellen Wissens auf die Lektüre«, so Brosch, würde »kein Verständnis zustande kommen«.[20]
Literatur bzw. Fiktion lädt das Imaginäre intentional auf, ohne aber von diesem überschwemmt zu werden, denn hier lauert im Akt des Schreibens immer wieder die Gefahr der ordnungsfeindlichen digressio, die, im Sinne der Rhetorik als unkontrollierte Abweichung verstanden, stets die imaginäre Entfesselung zu lizenzieren droht.
Aber geht es bei inneren Bildern tatsächlich um Anschauung oder zumindest vorrangig um Anschauung? Stephanie Jordans zufolge geht es bei inneren Bildern »nicht um Anschaulichkeit, sondern um Erkenntnis und das geeignete Reflexionsmedium hierfür.«[21]
Subjektivität, das Imaginäre und das Vorstellungsvermögen sind nie ›rein‹ zu haben, auch die Autonomie der inventio als Erfindung, in der Renaissance-Poetik als Auffindung noch an die Topik, die rhetorische Lehre von den Topoi und die meisterlichen Musterbücher (exempla) gebunden, ist kulturell restringiert; mediale Prozessualität ist eine unhintergehbare, kaum zu steuernde Dynamik, der das Imaginäre im Rahmen seiner materialisierenden Fiktionalität ausgeliefert wird. Renate Brosch weist darauf hin, dass literarische Visualität aus einer »komplexen Interaktion« entsteht, »an der die Imagination der Autorinnen und Autoren, die spezifischen literarischen Darstellungsverfahren, die mentale Partizipation der Lesenden sowie die sowohl für Autor/innen wie Leser/innen als Rahmenreferenz zur Verfügung stehende visuelle Kultur beteiligt sind«.[22]
Das Verhältnis von Imaginärem, Bild, Gedächtnis, inventio und Textproduktion bzw. literarischem Text basiert auf einem rekursiven osmotischen Austausch mit dem kulturellen Imaginären und den kulturellen Wissensbeständen. Letzteres fungiert als unhintergehbare Matrix und Bildspeicher, der das Bildgedächtnis als Partizipation am kulturellen Gedächtnis auffüllt und reaktualisiert, ihrerseits werden Bildfindung und Bildgedächtnis vom literarischen Text und seiner Rezeption angereichert. Text ist deshalb immer Intertext, das imaginäre Vorstellungsvermögen immer intermedial präfiguriert.[23]
Der Schrift-Begriff scheint es hier leichter zu haben. Die beiden in ihrer Erscheinungsweise divergenten Medien Schrift und Bild stehen in mannigfacher Beziehung zueinander bis hin zu einem synonymisierenden Verständnis des Ineinanderübergehens. Im Schriftbild erschöpfen sich ihre Konvergenzen und Analogien jedenfalls nicht.
Literatur und Kunst wissen aus den Fragestellungen und den Aporien der Bild- und Schrifttheorien Kapital zu schlagen. Die Spannungen zwischen Schrift und Bild können in der Tat ein generativer Motor der Produktion sein. Kunst und Literatur können die anthropologischen, zeichentheoretischen, phänomenologischen und wahrnehmungstheoretischen Verstrickungen und Paradoxa auf der formalen wie der Darstellungsebene in ihre semiotischen Prozesse wieder einspeisen und auf die Spitze treiben. Das kann spielerische Momente haben, aber auch von existenziellem Ernst zeugen. Umgekehrt können die Produkte dieser ästhetischen Einspeisungen selbst wieder Gegenstand theoretischer Auseinandersetzungen werden.
Ist Sprache »selbst schon der Ort einer ›ikonischen Poiesis‹«[24] und sind somit Sprache und Bild(lichkeit) medial aneinandergekoppelt, so operiert jede Literatur mit Bildern, beschreibt Bilder und evoziert Bilder.
Ohne den Bild-Begriff ist Literatur jedenfalls nicht zu denken – wie umgekehrt Literatur dem Bild als vorgängig gedacht werden konnte und kann: Das klassisch-idealistische Kunstkonzept, zuerst formuliert »in der italienischen Kunsttheorie des 16. Jahrhunderts«, um dann »an der französischen Akademie des 17. Jahrhunderts seine kanonische Form zu finden«, ist, Werner Busch zufolge, »verkürzt gesagt das Ergebnis einer Mischung aus platonischem bzw. neuplatonischem Idee-Begriff und aristotelischem Nachahmungsbegriff. Begrifflich ausgestaltet nach rhetorischem Vorbild, »verpflichtete es sich dem Horazischen Diktum des ut pictura poesis. Das Bild verstanden als Einlösung eines vorgängigen Textes, eines concetto, mit ihm eigenen Mitteln, die (…) einen textförmigen Nachvollzug (…) befördern sollen. ›Liser la peinture‹, forderte Poussin und entwickelte Strategien, uns schrittweise zur Sinnerschließung durchs Bild zu führen.«[25]
Die Interdependenzen zwischen bildender Kunst und Literatur sind vielfältiger und tiefgreifender, als dies auf den ersten Blick (er)scheinen mag. So kann, zumindest bei Beschreibungen gegenständlicher Bilder, mit Haiko Wandhoff von einer »implizite(n) Repräsentationstheorie des Textes« gesprochen werden, insofern die Bildbeschreibung als »verbale Repräsentation einer visuellen Darstellung (…) immer schon eine ›Abbildung des Abgebildeten‹«, eine »Mimesis in zweiter Potenz« ist. »Liser la peinture«, die Aufforderung, das Bild zu lesen, ist dann eben gar nicht so sehr metaphorisch oder im Sinne eines medialen Transfers der Rezeptionsmodi zu verstehen, wenn »noch eine dritte Vermittlungsebene« hinzukommt, »da die im Text dargestellten Bildkunstwerke (…) ihrerseits zumeist ikonographische Übersetzungen anderer poetischer Texte sind«[26], wie sie Wandhoff für antike und mittelalterliche Bildbeschreibungen wie zum Beispiel die Eikones des älteren Philostratos ausmacht, auf die noch einzugehen sein wird.
In der zeitgenössischen Kunst ist wiederum eine modifizierte Bewegung zu beobachten. In den bildlichen Arbeiten von Werner Tübke und Michael Triegel, die meinem Roman Schattenfroh als Bildspender zugrunde liegen, finden sich zahlreiche Bild-Zitate, ikonographische Metamorphosen und Transformationen von biblischen und sonstigen literarischen Texten, denen ihrerseits vielfach bildliche Vorstellungen zugrunde liegen.
Will ich etwas beschreiben, arbeite ich mich an Vorstellungen, an inneren Bildern ab. Diese inneren Bilder können und werden sich während ihres Verschriftlichungsprozesses modifizieren. Was aber ist dieses »Etwas«, und was genau sind »innere Bilder«? Und werden diese inneren Bilder verschriftlicht oder nicht vielmehr die Vorstellung hinter ihnen, für die sie nur das Durchgangsmedium sind. Der prekäre ontische Zustand innerer Bilder wird so lange ein korrigierendes Nachfassen des Beschreibens bzw. Erzählens auslösen, bis dieses innere Bild entweder ›erloschen‹ ist oder die Beschreibungspassage als hinreichend gesättigt aufgefasst wird. Die Frage nach inneren und äußeren Korrelaten von Bewusstseinsinhalten und der terminologischen Unterscheidung des Bildbewusstseins als Wahrnehmungs- oder Phantasievorstellung, nach vorstellungshaften Vergegenwärtigungsphasen, aber auch nach dem Status des Bildlichkeitsbewusstseins treibt die Frage nach der Differenz von »Wahrnehmungs- und Phantasievorstellung« an.[27] Die verschiedenen Wissenschaften differenzieren hier zwischen äußerer Wahrnehmung und innerer Vorstellung, zwischen Wahrnehmung und Phantasie als »Vergegenwärtigungsbewusstsein«[28], »Erinnerungsbild« und »Gedächtnisbild«[29], zwischen Wahrnehmungsbewusstsein und »Erinnerungsbewusstsein«[30], zwischen Wahrnehmung, Bild, Erscheinung, Vorstellungsbild, Erinnerung, Phantom, Phantasma[31], Phantasiebild als reproduzierende Modifikation (»Phantasiemodifikation«)[32] im Sinne eines »Als ob«-Gegenwärtigseins und -Erscheinens und einer modifizierenden Vergegenwärtigung etc.
Für die Literatur mögen diese Differenzierungen aufgrund ihres fiktionalen Status und ihres metafiktionalen Spiels zweitrangig sein, das »Bewusstsein von Differenz«, das nach Edmund Husserl »zwischen repräsentierendem Bild und Bildsujet« vorhanden sein muss,[33] kann in der Literatur unterlaufen werden, gerade die fiktionale Aufhebung dieser Differenz kann zum literarischen Sujet gemacht werden.
Dass mir als Leser das geschriebene Bild nicht vorgeschrieben wird, dass ich es mir – ganz anders – vorstellen kann, ohne es zu sehen, dass das Vorstellen, das Imaginieren gleichwohl eine Art Sehen ist,[34] dass mit diesem Sehen Interpretieren bereits anfängt, dass das geschriebene Bild keine Beschreibung eines als Vorlage dienenden physischen Bildes, also eines Bildes der äußeren Wahrnehmung, sein muss, dass es in der Lektüre nicht einmal als ein geschriebenes Bild erkannt werden muss – das alles scheint mir, wenn auch kein Vorzug der Literatur gegenüber der bildenden Kunst, so doch eine mediale Eigenart von Literatur zu sein. Und mit diesem Versuch einer Differenzierung verstricke ich mich bereits in alte, spätestens seit der italienischen Renaissance des 15. Jahrhunderts geführte Debatten, die, wenn auch unter anderen Vorzeichen, in den Mediendiskursen der Gegenwart noch andauern. Denn kann nicht auch ein physisch äußeres Bild – ein Kunstwerk, ein Gemälde, eine Zeichnung, eine Fotografie – die Imagination entzünden? Braucht es aber stets eines »Erregers«? Hinsichtlich der »geistigen Bilder« führt Edmund Husserl in Bezug auf diesen Begriff aus: »Die Sachlage ist nun zwar komplizierter im Fall der physischen Imagination als in dem der gewöhnlichen Phantasievorstellung, aber im Wesen finden ›wir‹ Gemeinsamkeit: Dort ist ein physischer Gegenstand vorausgesetzt, der die Funktion übt, ein ›geistiges Bild‹ zu wecken, in der Phantasievorstellung im gewöhnlichen Sinn ist das geistige Bild da, ohne an einen solchen physischen Erreger geknüpft zu sein. Beiderseits aber ist das geistige Bild eben Bild, es repräsentiert ein Sujet.«[35]
Im Folgenden sei zunächst auf zwei Begriffe aus der Kunst- und Kulturgeschichte näher eingegangen, deren Gegenstand Grenzüberschreitungen zwischen Kunst und Literatur sind: Paragone und Ekphrasis.
Fußnoten
[1]
Christina Lechtermann: Berührt werden. Narrative Strategien der Präsenz in der höfischen Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts. Berlin: Erich Schmidt 2005 (Diss. Humboldt-Universität zu Berlin, 2003), S. 46.
[2]
Haiko Wandhoff: Ekphrasis: Kunstbeschreibungen und virtuelle Räume in der Literatur des Mittelalters. Berlin, New York: De Gruyter 2003, S. 327.
[3]
Renate Brosch: »Literarische Lektüre und imaginative Visualisierung: Kognitionsnarratologische Aspekte«, in: Claudia Benthien, Brigitte Weingart (Hg.): Handbuch Literatur & Visuelle Kultur. Berlin, New York: De Gruyter 2014, S. 112.
[4]
Renate Brosch: »Literarische Lektüre«, a.a.O., S. 107.
[5]
Renate Brosch: »Literarische Lektüre«, a.a.O., S. 110. Es gibt aber auch gewichtige Positionen, die eine solche kognitivistische Analogie ablehnen und »die visuelle Vorstellung eher mit dem Denken als mit dem Sehen« vergleichen. Siehe S. 107.
[6]
Vgl. Renate Brosch: »Literarische Lektüre«, a.a.O., S. 107.
[7]
Zur dynamischen Denkfigur der Textbewegung siehe Matthias Buschmeier, Till Dembeck (Hg.): Textbewegungen 1800/1900. Würzburg: Königshausen & Neumann 2007.
[8]
Renate Brosch: »Literarische Lektüre«, a.a.O., S. 107.
[9]
So gilt Erika Greber zufolge Prosa als »Progression: lat oratio prosa > prōrsus, provōrsus: vorwärts, geradeaus gerichtet, fortlaufend. Die Poesie ist vom Rekurrenzkonzept des Verses beherrscht: lat. versus > vertere, versum: gewendet, gedreht; ähnlich gr. strophe: Wendung«. Erika Greber: »Textbewegung/Textwebung. Texturierungsmodelle im Fadenkreuz von Prosa und Poesie, Buchstabe und Zahl«, in: Matthias Buschmeier, Till Dembeck (Hg.): Textbewegungen 1800/1900, a.a.O., S. 24–48, hier: S. 27.
[10]
Renate Brosch: »Literarische Lektüre«, a.a.O., S. 107. Dieses Wissen, so Brosch, ist im Gedächtnis »nicht als ungeordnete Einzelinformationen gespeichert, wie die Schematheorie festgestellt hat, sondern bildet zusammengefasste Informationscluster, die ein semantisches Feld abstecken und typische kulturspezifische Gegenstände und Situationen zusammenfassen«.
[11]
Edmund Husserl spricht im Zusammenhang des Unterschieds zwischen physischer Imagination und Phantasievorstellung von einem »physischen Erreger«, an den als physischem Gegenstand die physische Imagination, nicht aber die »gewöhnliche« Phantasievorstellung geknüpft sei. Vgl. Husserl: Phantasie und Bildbewußtsein. Hamburg: Felix Meiner 2006, S. 23 (21): »§ 10. Wesensgemeinschaft der physischen Imagination und der gewöhnlichen Phantasievorstellung bezüglich der ›geistigen Bilder‹«.
[12]
Alexander Honold, Alexander Simon (Hg.): Das erzählende und das erzählte Bild. München: Wilhelm Fink 2010.
[13]
Siehe hierzu Lambert Wiesing: »Bildwissenschaft und Bildbegriff« und »Die Hauptströmungen der gegenwärtigen Philosophie des Bildes«, in: ders.: Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005, S. 7–14; 16–34. Gottfried Boehm (Hg.): Was ist ein Bild? München: Wilhelm Fink 2006; Ralf Simon: Der poetische Text als Bildkritik. Paderborn: Wilhelm Fink 2009. Die beiden letztgenannten Titel befassen sich auch mit der sprachlichen Verfasstheit innerer Bilder. Klaus Sachs-Hombach: Bildtheorien. Anthropologische und kulturelle Grundlagen des Visualistic Turn. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009.
[14]
Renate Brosch: »Literarische Lektüre«, a.a.O., S. 105.
[15]
Ebd.
[16]
Vgl. Günter Abel: Sprache, Zeichen, Interpretation. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999, S. 151.
[17]
Ralf Simon: Der poetische Text, a.a.O., S. 243.
[18]
Ralf Simon: Der poetische Text, a.a.O., S. 242–243.
[19]
Wolfgang Iser: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009 (1993), S. 377.
[20]
Renate Brosch: »Literarische Lektüre«, a.a.O., S. 104.
[21]
Stephanie Jordans: Innere Bilder. Theorien, Perspektiven, Analysen. Würzburg: Königshausen & Neumann 2018, S. 23.
[22]
Renate Brosch: »Literarische Lektüre«, a.a.O., S. 104.
[23]
Vgl. ebd.
[24]
Ulrich Gaier, Ralf Simon (Hg.): Zwischen Bild und Begriff. Kant und Herder zum Schema. Paderborn: Wilhelm Fink 2010, S. 9.
[25]
Werner Busch: »Erscheinung statt Erzählung«, in: Alexander Honold, Alexander Simon (Hg.): Das erzählende und das erzählte Bild, a.a.O., S. 55–83, hier S. 55.
[26]
Haiko Wandhoff: Ekphrasis, a.a.O., S. 10.
[27]
Siehe hierzu Edmund Husserl: Phantasie, a.a.O.
[28]
Edmund Husserl: Phantasie, a.a.O., S. 79 (77)–80 (78), 108 (106), 131 (190).
[29]
Siehe Emmanuel Alloa: Das durchscheinende Bild. Konturen einer medialen Phänomenologie. Zürich: Diaphanes 2018.
[30]
Stephan Otto: Die Wiederholung und die Bilder. Zur Philosophie des Erinnerungsbewußtseins. Hamburg: Felix Meiner 2007, S. 10.
[31]
Siehe Edmund Husserl: Phantasie, a.a.O.
[32]
Edmund Husserl: Phantasie, a.a.O., S. 129 (188).
[33]
Edmund Husserl: Phantasie, a.a.O., S. 22 (20).
[34]
Siehe hierzu auch: Stephan Otto: Die Wiederholung und die Bilder, a.a.O.; Stephanie Jordans: Innere Bilder, a.a.O.
[35]
Edmund Husserl: Phantasie, a.a.O., S. 23 (21).
II.Grenzüberschreitungen zwischen Kunst und Literatur
1.Der Paragone
Der Paragone, in der Antike als sportliche oder künstlerische Wettkämpfe im Rahmen eines öffentlichen Festes unter der Bezeichnung »ágon« bekannt, »in Italien (…) seit dem 15. Jh. für den Bereich der bildenden Kunst bezeugt«, kunsthistorisch aber erst im 19. Jahrhundert zu einem »festen Terminus« avanciert[1], ist ein Wettstreit zwischen Künstlern derselben und verschiedener Disziplinen, zwischen den Künsten, aber auch zwischen Kunst und Wissenschaft. So zum Beispiel zwischen bildender Kunst (Malerei, Skulptur) und Dichtung, zwischen Bild und Wort.
In diesem Wettstreit geht es um den medialen Vorrang und die Überbietung einzelner Künste hinsichtlich ihrer produktions- und rezeptionsästhetischen Differenzqualitäten sowie um die auch durch diese mitbedingte zeitgeschichtliche Angemessenheit der Darstellungsmittel und der sie motivierenden Ideale bzw. ästhetischen Kriterien.
Im Begriff »Paragone« kommen, so Michael Wetzel, »zwei etymologische Stränge« zusammen, »nämlich das Denken nach Modellen (frz. parangon) als Antrieb (von griech. parakonan: ›schärfen‹, ›wetzen‹) und der Wettstreit (griech. agon)«.[2]
Hinsichtlich der begrifflichen Etablierung von Kunst und der (selbstreflexiven) Ausdifferenzierung der Künste, die auch aus einer starken Abwehrbewegung gegen andere Künste resultieren kann, ist der Paragone ein zentrales Agens, für Hannah Baader »eine der zentralen Denk- und Argumentationsfiguren.«[3] Unter diesem Gesichtspunkt sind die Autonomiebestrebungen der Moderne mit ihren Maximen der medialen Reinheit der Fokussierung auf einen der Sinne zu betrachten, wie zum Beispiel in der Malerei auf das Sehen, oder die Emanzipierung des Theaters von der Literatur, wie sie Wassily Kandinsky (Der gelbe Klang) forderte und praktizierte.
In der Konsequenz können die historischen und Nachkriegsavantgarden mit ihren materialästhetischen und mentalen Überbietungsstrategien und Manifestkulturen unter dem Begriff des Paragone gefasst werden.
Als produktives Prinzip spielt der Paragone auch bei der Ausdifferenzierung des zeitgenössischen Literaturbegriffs eine nicht zu unterschätzende Rolle, befindet sich die Literatur doch in einer ihrerseits hoch ausdifferenzierten medialen Konkurrenzsituation, und das nicht zuletzt hinsichtlich faktualer Literatur und Berichterstattung. Paragonales Denken und Vergleichen kann das Schreiben begleiten und entsprechend neu konfigurieren. Es wirkt als regulierende Hintergrundmatrix.
Im denkfigürlichen und analogischen Horizont des Paragone bildeten sich auch Formen intermedialer Kombinatorik und medialer Intertextualität aus. Bei bestimmten Formen intermedialer Hybride finden sich textuell-visuelle Doppelkodierungen, so zum Beispiel bei barocken Figurengedichten und anderen Spielarten der visuellen bzw. Optischen Poesie.[4] Barocke Figurengedichte sind als Text-Bild-Hybride homolog kodifiziert: Sie zeigen, was sie bezeichnen, indem ihre graphematischen Mittel das Bezeichnete zu einem Bild konfigurieren. Gesagtes wird dargestellt. In diesem Sinne sind Figurengedichte kookurrent, indem »ihr Ausdruckskörper« Beziehungen nachbildet, »die unserem Wahrnehmungsmodell des Gegenstandes in irgendeiner Weise entsprechen«.[5] Ordnet man das Figurengedicht der Gattung des Bildgedichts zu, wäre es abzugrenzen vom ekphrastischen Gemälde- und Schildgedicht, wie es aus der nordischen Literatur bekannt ist und sich präfiguriert findet im 18. Gesang von Homers Ilias.[6]
Der auch implizit geführte Wettstreit zwischen Dichtung und Bildender Kunst[7] und auch die Analogisierungen von Bild und Text wie zum Beispiel die »Annahme einer Konformität von Satzstruktur und Bildstruktur«[8] erfahren mit Leonardo da Vincis Traktat über die Malerei (Trattato della pittura) dahingehend eine Umwertung, dass Leonardo die Malerei als Wissenschaft valorisierte und damit »die erstmalige Erhebung des Mediums Bild in die Höhe eines Wissens, einer Bildwissenschaft« vollzog. Unter diesem Signum beginnt sich »das visuelle Weltverhältnis als Weltbild zu konfigurieren«.[9]
Ausgelöst durch Charles Perraults These von der Überlegenheit der Epoche Ludwigs XIV. gegenüber der Antike, spezifizierte sich dieser Wettstreit ab 1687 historisch als ein diachroner Vergleich von Antike und Moderne beziehungsweise als eine Kontroverse um die Relevanz und Gültigkeit antikischer Kunstmaßstäbe und -ideale für die Gegenwart. In Deutschland sehr genau verfolgt und debattiert, erfuhr dieser Streit in Friedrich Schillers Schrift Über naive und sentimentalische Dichtung einen nachgetragenen Höhepunkt.[10]
Die Geschichte der Beziehung von Text und Bild, Literatur und bildender Kunst ist also von Anfang an gekennzeichnet von Debatten über ihre Komplementarität, Defizienz oder Vorrangigkeit und nicht zuletzt über Ähnlichkeitsbeziehungen.
Je nach präfigurierendem Turn kehrt sich das Verhältnis von Defizienz und Vorrangigkeit um; was als besondere maßstabsbildende Qualität des ›stummen‹ Bildes apostrophiert wurde – auf den Dichter Simonides soll das Aperçu zurückgehen, ein Bild sei schweigende Dichtung, die Dichtung sprechende Bildkunst[11] –, kann nach einem Paradigmenwechsel als Mangel ausgewiesen werden, den zu kompensieren nur das Wort vermag und vice versa.
Die Beziehung zwischen Text und Bild, Literatur und bildender Kunst ist jedenfalls keine ungestörte. An der Divergenz von Metapher und Bild[12] und einem differenzierten Bild-Begriff – der Frage zum Beispiel, was überhaupt ein Bild ist und wie sich das Bild als physisch äußeres Bild (Fotografie, Gemälde etc.) von einem inneren Bild (der Vorstellung) unterscheidet – arbeiten sich die verschiedenen Bildtheorien ab.[13]
Die Verschiebung der »Funktion der Sprache von der Objektdarstellung hin zu einem interpretationsbedürftigen Code« trägt ab dem 15., spätestens 16. Jahrhundert dazu bei, »daß alle Kunst zum interpretierbaren Text wird, selbst wenn – für eine Welt, die noch auf sicheren metaphysischen Grundfesten ruhte – die Interpretation vorgegeben war«.[14]
Die Literatur bzw. Sprachkunst und mit ihr die Ekphrasis bzw. das ekphrastische Prinzip erleben während der Renaissance einen emanzipatorischen Höhepunkt, der sie im Selbstverständnis als ästhetisch-epistemologischer Hybrid aus Geistigem und Sinnlichem gleichsam an die Spitze der Künste setzt. Ihr emanzipatorischer Affront gegen die in der Tradition Platons stehende höhere Valorisierung der »visuellen Epistemologie«[15] – in seiner Schrift Kratylos unterschied Platon erstmals zwischen natürlichen und arbiträren Zeichen – wird dann allerdings durch die im späten 17. Jahrhundert wieder propagierte und praktizierte Mimesis-Doktrin[16], die auch große Bedeutung für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte, zurückgedrängt zugunsten einer umgekehrten Hierarchisierung der Künste mit der Folge, dass nach Maßgabe der vorherrschenden (Theorie der) Ästhetik die bildenden Künste, allen voran die Bildhauerei, die Sprachkünste unter die Defensive der »ut pictura poesis« subordinierte. Als Medium hat die Literatur rezeptionsästhetisch zu verschwinden und das Gesagte als Gezeigtes transparent zu machen. Allerdings war auch diese Positionierung des nachantiken Paragone nicht unangefochten, gab es doch zum Beispiel in Edmund Burke einen großen Fürsprecher der Literatur, der mit starken Argumenten der semiotischen Unbestimmtheit des arbiträren sprachlichen Zeichens für eine Vorrangstellung des Literarischen optierte, das eben nicht »durch die physischen Grenzen ihres Nachahmungsobjekts eingeschränkt wird« und in der Prävalenz des Erhabenen vor dem nur Schönen seinen Ausdruck finden sollte.[17]
Besteht Ralf Simon zufolge ein Nachteil poetischer Texte darin, dass sie »Bilder prinzipiell nicht sichtbar machen« können und »sich deshalb in einer Defensive dem mächtigen Dispositiv gegenüber« befinden, »welches den Bildbegriff an die Sichtbarkeit bindet«,[18] so kann die relative Unbestimmtheit der durch Literatur evozierten Bildvorstellungen als ein Vorteil, zumindest als eine Kompensation gewertet werden, insofern durch sie zum einen ein bewusstes Spiel mit narrativ-visuellen Ambiguitäten getrieben und zum anderen die Imagination innerer Bilder stimuliert werden kann. Kann die Malerei das nicht auch? Sie schreibt die Bilder vor, sie macht sie eben sichtbar. In der ungegenständlichen Kunst hinwiederum kann es nicht darum gehen, den Betrachter zu fragen »Was siehst du«, in der Absicht, er möge im Ungegenständlichen Gegenständliches (wieder)erkennen.
Spätestens mit Nietzsche, präfiguriert schon bei Addinson und Burke,[19] wird das visuelle Medium der bildenden Künste als dominante bzw. dominierende Bezugsgröße der Literatur ersetzt durch die Inthronisation der Musik; Visualität bzw. Visualisierung und Räumlichkeit als ästhetisch-funktionale Essenz der Kunst werden abgelöst durch die akustisch-zeitliche Dimension. Nicht nur werde, so Murray Krieger, »den Künsten des Wortes und der Zeit anstelle der Künste des Bildes und des Raumes eine Vorrangstellung eingeräumt«, je weiter wir uns der Gegenwart näherten, »das sich ausbreitende semiotische Interesse an Texten« würde alle Künste, die visuellen wie der verbalen« erfassen, und sie »alle der Zeitlichkeit« unterwerfen, »so daß sie alle in ähnlicher Weise für das entschlüsselnde Lesen« bereitstünden. Michael Thimann spricht in diesem Zusammenhang von einem »Logozentrismus gewisser Formen der älteren Kunst«.[20]
Dass die Frage einer Vorrangstellung von Bildern oder Wörtern, von Anschauung oder Begriffen auch den philosophischen Diskurs nachhaltig prägt, zeigen prominent die divergenten Positionen, die Giambatista Vico und Georg Wilhelm Friedrich Hegel einnehmen.[21] Argumentiert Vico mit seiner Auffassung eines über Anschauung konfigurierten Gedächtnisses für den Vorrang der Bilder – wir können »uns nichts anderes vorstellen (…) als das, woran wir uns erinnern, und wir erinnern uns immer nur an das, was wir durch Sinneswahrnehmungen aufnehmen können«[22] –, so steht für Hegel mit seinem Magazinmodell der Vorrang der Wörter außer Zweifel. Der Name ist für Hegel die intelligible Objektivation der Sache. »Der Name ist so die Sache, wie sie im Reiche der Vorstellung vorhanden ist und Gültigkeit hat«, schreibt Hegel und kommt zu folgendem Fazit: »Das reproduzierende Gedächtnis hat und erkennt im Namen die Sache und mit der Sache den Namen, ohne Anschauung und Bild. (…) Es ist in Namen, daß wir denken.«[23] Stephan Otto zufolge will die memoria Vicos »an eine ungeschriebene Geschichte erinnern, an eine ›Geschichte vor der Geschichte‹, an eine Geschichte vor dem vertexteten Wort – an eine ›phantastische‹ Geschichte mythischer Bilder.« Deshalb dürfe Vico »die phantasia mit der memoria verknüpfen und die Darstellung der ›phantastischen Geschichte‹ des mythischen Zeitalters einem inventiven Zugriff der ›Poesie‹ zuordnen.«[24]
Diese Divergenz findet, unter anderen Voraussetzungen, in Franz Brentano und Edmund Husserl ihre Fortsetzung.[25] Während Brentano Phantasievorstellungen als »Begriffe mit anschaulichem Kern« beschreibt, spricht Husserl u.a. von der intentionalen Struktur der »Phantasie als Vergegenwärtigungsbewußtsein« mittels des Begriffs der »reproduktiven Modifikation« der Erlebnisse.[26]
Die Evokation und Revokation innerer Bilder, deren Genesis, fiktionsinduziert, unterschiedliche Disziplinen beschäftigt, von der Phänomenologie bis zur Kognitions- und Neurowissenschaft, und die, mit unsicherem ontischem Status, als Ausgliederungen des Imaginären, fiktionsgebunden und auf die Fiktion als gestaltgebende Objektivation angewiesen sind, kann als Vorgang selbst erzählt und zum Nukleus der Narration werden.
Hierbei, im Erzählen der Genesis innerer Bilder, stellt sich permanent die Frage, ob es tatsächlich diesen »Traum einer Rückkehr zur Idylle des natürlichen Zeichens« gibt, »das anhaltende semiotische Verlangen nach dem natürlichen Zeichen«, das den Dichter dränge, »im Reich des geistig Faßbaren zur sprachlichen Analogie für dieses natürliche Zeichen zu greifen«, wie Murray Krieger schreibt.[27]
Das überwiegende Interesse an gegenständlicher Malerei, das sich in verschiedener Hinsicht in meinem Roman Schattenfroh manifestiert, scheint dies zu bestätigen. Ganz so einfach ist es jedoch nicht, gilt es doch, die Semiotik der Malerei mit ihren Funktionen der Repräsentation, symbolischen Ordnung, Allegorisierung, Verrätselung zu beachten, so dass hier das Drängen nicht mit einem Griff nach dem sprachlichen Analogon für das Zeichenelement des Gemäldes befriedet wird, das aus seinem symbolisierenden oder allegorischen Kontext herausgelöst und als autonomes Zeichen renaturalisiert wird, indem es als bildliches Repräsentamen (Ikon), als piktural Bezeichnetes wörtlich ›gelesen‹ wird. Die Funktion der sprachlichen Analoga erschöpft sich auch nicht in einer bloßen Beschreibung der natürlichen Zeichen, vielmehr werden sie, teils mit biographischer, auch autobiographischer Grundierung, in Auswahl narrativ rekombiniert und zu neuen Zeichen-Ensembles zusammengeschlossen, die ihrerseits wieder in Bildern revisualisiert werden könnten. Diese Praxis der Neubesetzung ist derjenigen von Hieronymus Bosch nicht unähnlich. Bosch arbeitet rhetorisch-ikonographisch mit wiedererkennbaren Teilelementen, die er zu neukontextuierenden Ensembles kombiniert.
Mit der Rede von der (simulierten) »internen Ekphrasis« der Sprache bzw. Literatur, die den Anschein erwecke, »ihr eigenes Emblem« zu sein,[28] ruft Krieger einen Begriff auf, der für den Roman Schattenfroh von zentraler Bedeutung ist. Die Beschäftigung mit der Begriffsgeschichte, der Theorie und Tradition der Ekphrasis und Beispielen der ekphrastischen Literatur von der Antike bis in die Gegenwart lief zur Entstehung des Romans parallel.
Was ist »Ekphrasis«?
Fußnoten
[1]
Vgl. Hannah Baader: »Paragone«, in: Ulrich Pfisterer: Metzler Lexikon der Kunstwissenschaft: Ideen, Methoden, Begriffe. Stuttgart: J.B. Metzler 2019, S. 321–324, hier S. 321; Michael Wetzel: »Der blinde Fleck der Disziplinen: Zwischen Bild- und Textwissenschaften«, in: Claudia Benthien, Brigitte Weingart (Hg.): Handbuch Literatur & Visuelle Kultur, a.a.O., S. 175–192, insbes. S. 178–180.
[2]
Michael Wetzel: »Der blinde Fleck«, a.a.O., S. 178.
[3]
Hannah Baader: »Paragone«, a.a.O., S. 321–324, hier S. 321.
[4]
Siehe diesbezüglich Klaus Peter Dencker: Optische Poesie. Von den prähistorischen Schriftzeichen bis zu den digitalen Experimenten der Gegenwart. Berlin, Boston: De Gruyter 2010. Ulrich Ernst (Hg.): Visuelle Poesie. Band 1: Von der Antike bis zum Barock. Berlin, Boston: De Gruyter 2012.
[5]
Rolf Kloepfer: Poetik und Linguistik. München: Wilhelm Fink 1975, S. 103.
[6]
Homer: Ilias. Übersetzt von Kurt Steinmann. München: Manesse 2017.
[7]
Man denke an Horaz’ notorisch berühmte und in der Rezeptionsgeschichte fast chronisch missverstandene »ut pictura poesis«-Formel, deren mittelalterliche Rezeption der Dichtung im rhetorikzentrierten wissenssystematisierenden Konzept der (septem) artes liberales eine Vorrangstellung einräumte.
[8]
Cornelia Logemann, Michael Thimann (Hg.): Cesare Ripa und die Begriffsbilder der Frühen Neuzeit. Zürich: Diaphanes 2011, S. 9–21, hier: S. 10.
[9]
Michael Wetzel: »Der blinde Fleck«, a.a.O., S. 175–192, hier S. 178.
[10]
Friedrich Schiller stellte mit der Einführung der Begriffe des Naiven und Sentimentalischen die komplementäre Inkomparabilität beider ›Systeme‹ heraus, das jedes seine Vorzüge habe. Das Naive bringt eine auf Intuition basierende Literatur hervor, die sich eins weiß mit der Natur; das Sentimentalische bringt eine auf Reflexion basierende Literatur hervor, die sich entzweit von der Natur weiß. Schiller zufolge charakterisieren das Naive und das Sentimentalische nicht mehr bzw. nicht ausschließlich Epochen und sind also nur eingeschränkt Epochenbegriffe, sondern zwei Haltungen, zwei Verfahrensweisen von Dichtung, die zu ein und derselben Zeit koexistieren können, wobei die Antike und mit ihr das Naive eine Erfindung des Modernen bzw. der modernen, durch Schiller begründeten Literaturtheorie sind, um sich in Abgrenzung von jener selbst denken und beschreiben zu können.
[11]
Vgl. Fritz Graf: »Ekphrasis: Die Entstehung der Gattung in der Antike«, in: Gottfried Boehm, Helmut Pfotenhauer (Hg.): Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung. Ekphrasis von der Antike bis zur Gegenwart. München: Wilhelm Fink 1995, S. 143–155, hier S. 147.
[12]
An dieser Stelle festzuhalten ist, dass Metaphorizität über den ontischen Bildbegriff hinausgeht, sich also nicht substantialistisch reduzieren lässt, vielmehr Prozesse gleitender Sprache (auch auf begrifflicher Ebene) einbegreift.
[13]
Einen konzisen Überblick geben Klaus Sachs-Hombach (Hg.): Bildtheorien, a.a.O., Lambert Wiesing: Artifizielle Präsenz, a.a.O., sowie ders.: Sehen lassen: Praxis des Zeigens. Berlin: Suhrkamp 2013.
[14]
Murray Krieger: »Das Problem der Ekphrasis. Wort und Bild, Raum und Zeit und das literarische Werk«, in: Gottfried Boehm, Helmut Pfotenhauer (Hg.): Beschreibungskunst, a.a.O., S. 51.
[15]
Murray Krieger: »Das Problem der Ekphrasis«, a.a.O., S. 54. Zu einer differenzierten Sicht auf Platon als Gegner des Sinnlichen bzw. sinnlicher Erkenntnis und als vehementer Bildkritiker siehe: Benjamin Jörissen: »Die Ambivalenz des Bildes: Medienkritik bei Platon«, in: ders.: Beobachtungen der Realität. Die Frage nach der Wirklichkeit im Zeitalter der Neuen Medien. Bielefeld: Transcript 2015, S. 31–66. Hinsichtlich des Bildes im »Kontext des Verhältnisses von Vor- oder Urbild (paradeigma) und Abbild (eikôn)« differenziert Jorissen: »Paradeigma und eikôn bilden in der Philosophie Platons ein komplementäres Begriffspaar (Böhme 1996 a: 29f.), was in der deutschen Übersetzung als Vorbild/Abbild nicht mehr erkennbar ist: denn ein ›Vor-Bild‹ ist bereits selbst bildhaft und bedürfte insofern, im Gegensatz zum platonischen paradeigma, nicht des Abbildes, um zur Darstellung zu kommen. Doch die platonische Idee (eidos, paradeigma) ist gerade nicht Bild (eikôn). Schon mathematische Gegenstände, etwa ein ideelles Dreieck, sind Abbilder von Ideen. Die Abstraktheit der Ideen als ideale Formbestimmungen, als reine ›Vorschriften‹, die dann bildhaft umgesetzt werden können, entbehrt vollkommen der Bildhaftigkeit.«
[16]
Hier sind grundsätzlich die Positionen von Platon und Aristoteles zu unterscheiden. Platons an den Wahrheitsbegriff gekoppeltes semiotisches Modell von Kunst und Dichtung, das in seiner Schrift Der Staat grundgelegt ist, basiert auf einem dreistufigen Mimesis-Modell. In hierarchischer Abstufung bilden die Begriffe Idee, Bild und Abbild Regulative einer Repräsentationsordnung. In dieser Abstufung der auf dem Vorrang des natürlichen Zeichens gründenden Mimesis rangierte die Malerei hinter dem Handwerk zum Beispiel des Schreiners, insofern den Malern allein ein mimetischer Vollzug zweiter Stufe möglich war, zumal der Maler (aber auch der Dichter) nichts von den nachgeahmten Dingen verstehe, sondern nur von der Nachahmung des Abbildes der Idee. Der Maler ist ein Nachahmer, er ahmt nicht die Idee nach, sondern die Werke der Handwerker, wie der Schreiner einer ist. Der Schreiner gibt das Bild einer Idee, die von und bei Gott ist. Gott allein ist »Hersteller des wirklich seienden Stuhles, nicht aber der eines beliebigen Stuhles«. (Platon: Der Staat/Politeia. Übers. v. Rudolf Rufener. Hg. v. Thomas Szlezák. Düsseldorf, Zürich: Artemis & Winkler 2000, Zehntes Buch, 597e, S. 813.)
[17]
Vgl. Murray Krieger: »Das Problem der Ekphrasis«, a.a.O., S. 52–53.
[18]
Ralf Simon: Der poetische Text, a.a.O., S. 199.
[19]
Vgl. Krieger: »Das Problem der Ekphrasis«, a.a.O., S. 52–53.
[20]
Cornelia Logemann, Michael Thimann (Hg.): Cesare Ripa, a.a.O., S. 9–21, hier: S. 9.
[21]
Siehe hierzu Stephan Otto: »Der Konflikt zwischen ›Bildern‹ und ›Wörtern‹. I. Die Option Vicos: memoria und ingenium oder vom Vorrang der Bilder. II. Die Option Hegels: memoria und Intelligenz oder vom Vorrang der Wörter«, in: ders.: Die Wiederholung und die Bilder, a.a.O., S. 23–51, sowie: Michael Lentz: »Die memoria bei Hegel«, in: ders.: Atmen Ordnung Abgrund. Frankfurter Poetikvorlesungen. Frankfurt am Main: S. Fischer 2013, S. 221–224.
[22]
Giambattista Vico: Liber metaphysicus. Aus dem Lateinischen und Italienischen von Stephan Otto und Helmut Viechtbauer. München: Wilhelm Fink 1979, S. 124–125.
[23]
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Dritter Teil: Die Philosophie des Geistes. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1981, § 462, S. 278–281, hier S. 278.
[24]
Stephan Otto: Die Wiederholung und die Bilder, a.a.O., S. 29.
[25]
Siehe Edmund Husserl: Phantasie, a.a.O.
[26]
Siehe Edmund Husserl: Phantasie, a.a.O., S. 79–80 (77–78), 108–109 (105–106), 130–131 (189–190).
[27]
Murray Krieger: »Das Problem der Ekphrasis«, a.a.O., S. 52.
[28]
Vgl. Murray Krieger: »Das Problem der Ekphrasis«, a.a.O., S. 52.
2.Ekphrasis
2.1Zur (Definitions)geschichte der Ekphrasis
Die Begriffsgeschichte der Ekphrasis und ihre Pragmatik ist von ihrem antiken Anfang an so diffus wie umstritten. Dies ist nicht zuletzt in ihren heterogenen Erscheinungsformen begründet. Innerhalb der (frühen) Geschichtsschreibung, der Gerichtsrede und der Literatur[1] mit Homers Beschreibung des »Schild des Achilleus«[2] als wohl berühmtestem Beispiel der entwickelten Formen der Ekphrasis kommen ihr unterschiedliche pragmatische und ästhetische Funktionen zu. Mit dem lateinischen Begriff der descriptio[3] wurde von der Forschung eine Binnendifferenzierung für erdichtete Ekphrasen vorgeschlagen: Beschreibungen, »welche nicht vorhandene Kunstwerke beschreiben, sondern von dem Dichter frei konzipiert sind«.[4]
Zweifellos hat Ekphrasis in der griechischen Lyrik und Prosa die Muster möglicher ästhetischer Konstellationen der Bildaneignung (auch von Friesen, Skulpturen oder zum Beispiel Alltagsgegenständen) vorgebildet und auch zur Inkorporierung plastischer und räumlicher Formen in die Literatur bzw. in Erzählung und Roman beigetragen.[5] In manchen Rhetoriken gilt Ekphrasis bloß als schmückendes, semantisch nicht notwendiges Beiwerk (»epitheton ornans«), andere ordnen sie innerhalb der Gerichtsrede der Narratio zu, der die Funktion einer parteiischen Tatverlaufsschilderung, eines Beispiel gebenden Exkurses oder zum Beispiel eines epideiktischen Beweismittels zukommt.[6]
2.2Rhetorische Ekphrasis
Innerhalb der ekphrastischen Definitions- und Gattungsgeschichte[7] muss demnach grundsätzlich unterschieden werden zwischen einer rhetorischen und einer literarischen bzw. narrativen Ekphrasis. Die Rhetorik versteht unter Ekphrasis Beschreibung im allgemeinen Sinn, die Bildbeschreibung gehört »nicht als fester Teil der Ekphrasis in die rhetorische Theorie der Antike – und schon gar nicht als eigene Gattung«[8]; die literarische Ekphrasis ist Bildbeschreibung, vorrangig von Artefakten der bildenden Kunst. Was als rhetorische Ekphrasis in der Antike eher randständig war, erfährt in der literarischen Ekphrasis eine Aufwertung.
Ekphrasis als rhetorische (Anfänger-)Übung im Rahmen der »Progymnasmata« und als Redebestandteil »ist ein Unterort der Textgattung ›Übungstexte‹«[9] und fungiert hier als Teil »eines größeren «Textzusammenhangs«[10], nicht als Text für sich; eine spezielle Gattung »Beschreibung« oder »Bildbeschreibung« wird in der Rhetorik und den rhetorischen Übungen der »Progymnasmata«, in denen die Evokation von Affekten im Vordergrund steht, sogar ausgeschlossen. Ekphrasis als »isolierte Übung der Rhetorenschule« allerdings kann als »virtuose Etude« auch einmal »Beschreibungen als alleinigen Redeinhalt« haben.[11]
Die wohl zentrale antike Definition der Ekphrasis stammt von Aelius Theon, einem alexandrinischen Sophisten und Autor einer Progymnasmata genannten Sammlung rhetorischer Übungen. Sie lautet: »Ekphrasis ist ein beschreibender Text, der das Mitgeteilte anschaulich (ενέργεια) vor Augen führt.« »Ekphrasis geschieht«, so Theon, »(1) von Lebewesen, (2) von Geschehnissen, (3) von Orten, (4) von Zeiten«.[12] Ihre produktiven Kriterien lauten »Klarheit« und »Anschaulichkeit« (repraesentatio), »so daß das Dargestellte so ziemlich gesehen werden kann«.[13]
Bei Quintilian kündigt sich bereits ein intermediales Denken vergegenwärtigender Anschaulichkeit der Beschreibung (evidentia) an. Die Wirkung der evidentia besteht für ihn in einem medialen Sinnestransfer. Anschaulichkeit ist »eine in Worten so ausgeprägte Gestaltung von Vorgängen, daß man eher glaubt, sie zu sehen als zu hören.«[14]
Für manche Theoretiker bleibt der sprachbasierte Visualisierungseffekt der »evidentia« (Augenscheinlichkeit)[15] als wirkungsästhetische Transferleistung nicht auf Bildlichkeit beschränkt, sondern transformiert sich vom Visuellen »ins Akustische, Olfaktorische, Haptische«: »ein Blumenbild, das so intensiv wirkt, dass wir den Duft zu riechen vermeinen«.[16] Solche immersiven Synästhetisierungseffekte verleihen dem Direkt-vor-Augen-Stehenden quasi-ontologischen Status. Der Leser wird nicht nur zum Augen-, sondern auch zum akustischen, haptischen und olfaktorischen Zeugen erzählerischer Evidenz. Der Rezipient ist demnach körperlich an der ekphrastischen Einholung des Abwesenden in den präsentischen Horizont beteiligt.
Der Ekphrast fungiert als Perieget (periegematikos), als Reiseführer durch innere Vorstellungen und Bilder, die er mit seiner Darstellung evoziert und in dieser Präsenzsuggestion das Medium seiner Darstellung, die Worte, scheinbar vergessen macht: »Die Erzählung der Sachverhalte und Ereignisse, in denen man ›aufgeht‹ oder in die man ›eintaucht‹, transgrediert dann in der Aisthesis die Materialität des Mediums.«[17] Der Wahrnehmende seinerseits muss die inneren Vorstellungen hinnehmen, sie sind gewissermaßen per se ›wahr‹, weil sie innerlich wahrgenommen werden.
2.3Enérgeia und enárgeia
Die für die evidentia und die Ekphrasis zentralen Begriffe »Enérgeia« und »Enárgeia« werden nicht immer trennscharf voneinander unterschieden. Heinrich Lausberg zufolge ist die evidentia (Quint. 8,3,61; 9,2,40) »die lebhaft-« (Enérgeia) »detaillierte« (Enárgeia) »Schilderung eines rahmenmäßigen Gesamtgegenstandes (Quint. 8,3,70 totum; 9,2,40 res … universa) durch Aufzählung (wirklicher oder in der Phantasie erfundener) sinnfälliger Einzelheiten (Quint. 8,3,70 omnia; 9,2,40 per partes). Der Gesamtgegenstand hat in der evidentia kernhaft statischen Charakter, auch wenn er ein Vorgang (Quint. 9,2,40 res … ut sit gesta ostenditur) ist: es handelt sich um die Beschreibung eines wenn auch in den Einzelheiten bewegten, so doch durch den Rahmen einer (mehr oder minder lockerbaren) Gleichzeitigkeit zusammengehaltenen Bildes. Die den statischen Charakter des Gesamtgegenstandes bedingende Gleichzeitigkeit der Einzelheiten ist das Gleichzeitigkeitserlebnis des Augenzeugen; der Redner versetzt sich und sein Publikum in die Lage des Augenzeugen«[18], und dies mittels der Intensivierung von Klarheit und Wahrscheinlichkeit.
Für Heinrich Plett ist mit »Enérgeia« »eher die Dynamisierung des Stils durch pathetisch-anschauliche Verlebendigung der Darstellung« und mit »Enárgeia hingegen eher die sinnliche Evidenz einer detaillierten Beschreibung« bezeichnet. Erstere umfasse besonders die affektischen, Letztere besonders die ekphrastischen Figuren, darüber hinaus auch alle anderen Mittel der amplificatio.[19] Allerdings kann die lebendige Veranschaulichung der Enérgeia dem Erkenntnisgewinn förderlich sein und gerade auch der Detailreichtum (Enárgeia) der Schilderung (evidentia, descriptio) kann affektsteigernd wirken und zu diesem Zwecke fungieren: »Die Detaillierung des Gesamtgegenstandes ist ein Produkt des Phantasieerlebnisses im Autor und hat dementsprechend auf das Publikum eine ›realistische‹ (Quint. 4,2,123 credibilis rerum imago) und affekterregende (Quit. 8,3,67 in affectus … penetrat; 6,2,32 affectus) Wirkung.«[20]
Die »Suggestion von Präsenz und Unmittelbarkeit«[21], das »Aufscheinen der Präsenz im Augenblick«[22] zeitigt Realitätseffekte mittels differenzierter Strategien der unter den Begriff der »enérgeia«[23] gefassten (visuellen) Verlebendigung und Vergegenwärtigung von Abwesendem und des enárgeia[24] genannten, Anschaulichkeit vermittelnden detaillierten Beschreibens. Evidentia als rhetorische Technik der Darstellung, die zum Beispiel in der Gerichtsrede zur Dynamisierung und Affektsteigerung bis hin zur Pathetisierung der Darstellung bzw. des Dargestellten und somit zu einer rationaler Argumentation gleichwertigen oder diese sogar subordinierenden Emotionalisierung der Zuhörer führen soll, ist nicht allein eine rezeptionstheoretische Kategorie[25], vielmehr soll der Redner zunächst vor ein Forum internum treten und sich in die Doppelrolle des Redners und Zuhörers spalten, indem er an sich selbst die Wirkung der demonstratio ad oculos erfährt. Nur was er an sich selbst als zuhörender Augenzeuge erfahren hat, kann er »so deutlich, lebendig oder detailliert (…) schildern, daß alle sich als Augenzeugen fühlen«[26], was Quintilian als Phantasieerlebnisse im Autor bezeichnet.
Präsenz- und Unmittelbarkeitseffekte realisieren sich als innere Bilder. Innere Bilder haben einen »prekären ontologischen Status«[27], sie sind als solche nicht intersubjektivierbar, sondern, so Ralf Simon, »in der black box der Subjektivität eingeschlossen«,[28] aber auch derjenige, dem allein sie gegeben sind, hat aufgrund ihres phantomhaften, ephemeren Status keinen gesicherten Zugriff auf sie. Um kommuniziert oder erzählt zu werden, bedürfen sie einer Übersetzung in ein anderes Medium, in Worte bzw. Texte, Musik oder äußere Bilder: Wenn von inneren Bildern gesprochen wird, so Stephanie Jordans, »wurden sie bereits vom Medium ›Bild‹ ins Medium ›Sprache‹ übersetzt«.[29]
2.4Narrative Ekphrasis
Antike und mittelalterliche Kunst bezieht sich vielfach auf mythologische, christliche und literarische Stoffe, insofern hier überhaupt unterschieden werden kann: »Bild, Sprache und Schrift« haben »in den alteuropäischen Kulturen eine gemeinsame Stoffgrundlage, die es zu tradieren gilt und aus der die verschiedenen Kunstformen ihre Gegenstände beziehen.«[30]
Zeitgenössische Maler wie Werner Tübke und Michael Triegel knüpfen an diese Tradition wieder an.
Intermediale Konzeptualisierungen der Ekphrasis, die partiell an antike Theoreme eines Medientransfers anknüpfen, in deren Horizont bereits Vorstellungen wechselseitiger Durchlässigkeit visueller und akustischer (verbaler) Medien artikuliert worden sind – prominent Horaz: »ut pictura poesis« und Simonides von Keos’ Theorem von der Literatur als redende Malerei und der Malerei als stumme Dichtung –, stellen »das Moment der Visualisierung und Verräumlichung von und durch Sprache«, aber auch den »paragonale(n) Charakter von visueller und verbaler Repräsentation«[31] ins Zentrum.
Demgegenüber sieht die narratologische Konzeptualisierung in der Ekphrasis weniger das »konkurrierende Andere der Wortkunst«. Vor dem Hintergrund einer selbst schon narrativen Organisation der »sprachlich generierten Bildkunstwerke« werden Ekphrasen, analog zum Bild im Bild, als eingebettete Erzählungen oder »Hypoerzählungen«[32] verstanden: »Erzählung in der Erzählung« bzw »micro-narratives« oder »paranarratives«, »die von der Rahmenerzählung sowohl getrennt sind, wie sie sich ihr auch einfügen, um sie mit zusätzlichen Registern und Bedeutungsdimensionen anzureichern«. Die Ekphrasis ist demnach ein Fragment, »das paradoxerweise das Ganze des Werkes enthalten kann, von dem es doch zugleich eingeschlossen und begrenzt wird«[33].
Als »micro-narratives« fungieren die Ekphrasen nicht nur als Visualisierungsstrategie, sondern nach dem Prinzip der mise en abyme[34] auch als – nicht selten allegorischer – »inter- wie intratextueller Spiegel« der Haupthandlungen oder werden als Synekdochen beschrieben.[35] Die Erzählungen der Bilder zum Beispiel von Hieronymus Bosch, Jan Vermeer, Michael Triegel und Ror Wolf im Roman Schattenfroh nehmen diese mittelalterliche Tradition ekphrastischen Erzählens, wie sie einen prägnanten Ausdruck im sogenannten Prosalancelot[36] findet, wieder auf und finden für die Appropriation je eigene Lösungen. In Schattenfroh findet vielfach eine Verlebendigung metadiegetischer Figuren »aus in der Diegese vorhandenen Gemälden und Fotografien« statt.[37]
Die Aneignung der Bilder von Hieronymus Bosch löst sich von ihrer allegorischen Textur, ihrer Moraldidaxe und ihrer anagogischen Sinnebene.[38] An ihrer Stelle erfolgt eine Aufpfropfung auch