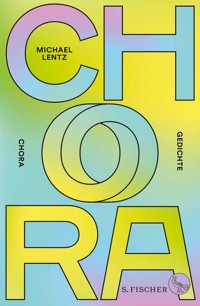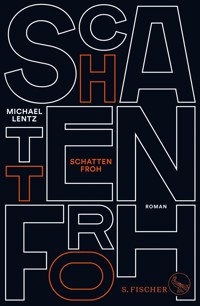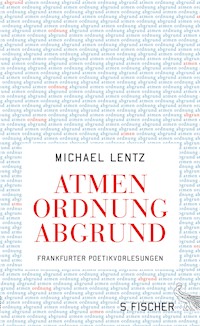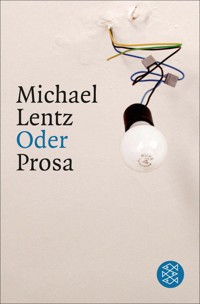9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine literarische Geschichte des Exils. Michael Lentz erzählt mit Humor, historischer Genauigkeit und der ihm eigenen Energie von dem Leben derer, die vor den Nationalsozialisten an die amerikanische Pazifikküste fliehen konnten: Bert Brecht, Franz Werfel, Lion Feuchtwanger, Thomas und Heinrich Mann, Arnold Schönberg. Dieser große Roman sammelt die Bilder der Realität und der Phantasie, die das Vergangene erfahrbar machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 656
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Michael Lentz
Pazifik Exil
Roman
Roman
Über dieses Buch
Eine literarische Geschichte des Exils. Michael Lentz erzählt mit Humor, historischer Genauigkeit und der ihm eigenen Energie von dem Leben derer, die vor den Nationalsozialisten an die amerikanische Pazifikküste fliehen konnten: Bert Brecht, Franz Werfel, Lion Feuchtwanger, Thomas und Heinrich Mann, Arnold Schönberg. Dieser große Roman sammelt die Bilder der Realität und der Phantasie, die das Vergangene erfahrbar machen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg – Abbildung: Stefanie Schneider
© S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2007
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401026-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
»im moment der explosion [...]
Auszug
I.
Die Nachricht
Eine kleine Tür
Berlin, Nizza. Ein Bericht
Die Welt wird enger
Die Überfahrt
Brandganter Erwin
Die Blume
Eine Beerdigung
Nach dem Tod meiner Mitarbeiterin M. S.
II.
Ich, der Überlebende
Die Welt will von Ihnen wissen
Ein Relikt
Es müsste doch jeden Moment um alles gehen
Feindlicher Ausländer
Eine Alibischicht Muttererde
Mein rasendes Herz
Es war aber ein Zeichen
Du machst dir zu viele Gedanken
III.
Der Mensch ist weg
Wir leben nur geradeaus
In zwei Sprachen schweigen
Das andere Zimmer
Pelikane
Die Bienen
Für Sophia
»im moment der explosion ist die sense auf den stein gestoßen«
Hartmut Geerken
Auszug
Die Bienen sind weg. Die Stöcke stehen leer. Im ganzen Land. Spurlos. Ein ganzes Volk kollabiert. Ausgeflogen zum Sterben. Ohne Gottes Genehmigung aber dürfen sie gar nicht ausfliegen, die Bienen, und dennoch fliegen sie aus. Hat Gott ihnen das erlaubt? Keine Toten im Stock. Nur Honig und Junge, die verhungern. Noch steht der Stock, noch sieht er unverändert aus. Das Herz aber fehlt.
Ausgesungen ist von den Bienen, den Honigvögelein und ihrer Blumenfahrt. Welche Seelen haben die Bienen mitgenommen, die jetzt nicht mehr im Gras umher sind? Sie werden nicht mehr auf der Weide schmausen, und gibt der Schnee den Boden frei, wird es ganz still sein im Land.
Wo kamen die Bienen her? Sie kamen aus dem Stier, der geopfert wurde. Zu Tode geprügelt wurde der Stier, der, von der Masse entzündet, so gewütet hat. Kein Blut durfte fließen. Dem Kadaver verschloss man alle nur denkbaren Öffnungen. Drei Wochen lang hielt man ihn völlig dicht in einem unzugänglichen Haus. Dann setzte man den bereits verwesenden Stier der Frischluft aus. Gottes Vöglein, die Bienen, entstanden und bildeten sogleich einen großen Schwarm. Der ans Schwarze Meer Verbannte schrieb: »Die Seele des Stiers geht, weil er so viele Pflanzen gefressen hat, zur Strafe in unzählige Bienenseelen über, deren Körper die Pflanzen liebkosen, ohne sie zu verletzen.« Aber ist das eine große Strafe? Eine viel größere Strafe erwartet die Bienen. Die finden nicht mehr heim. Und die Königin geht aus dem Gehirn des Stiers hervor, die anderen aus seinem Fleisch. Apis heißt ein schwarzer Stier, der Sonne lebendiges Seelenbild, schwarz wie Erde und Unterwelt. Und Apis heißt die Biene.
Nun sind die Bienen weg. Das Bienenhaus verwaist, der Bienenflug vorbei. Die Sonne geht unter und geht nicht mehr auf. Denn sie scheint in der Unterwelt.
Die Bienen und die Wiese – die kommen aus dem Paradiese, die Wiese ist verlassen. Der eine Biene tötet, begeht Teufelswerk. Die Immen aber kamen dem Mord zuvor und flogen aus. Nichts deutet auf den Zusammenbruch ihrer Häuser, der im Gange ist, nur das Fernbleiben der Älteren, die bleiben ununterbrochen fern.
Aus heiterem Himmel geschieht das nicht. Wenn die Biene von der Erde verschwindet, dann hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben, heißt es.
Kein Immenschwarm mehr, kein Bienentanz, keine Verkündung der Trachtquelle, die alles im Gleichen hält. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, kein Apfel, keine Birne, keine Pflaume, keine Himbeere, kein Kürbis, kein Mandelbaum, die Melone verschwindet, die Paprika.
Die Bienenstöcke stehen verwaist, die Plünderer lassen auf sich warten.
I.
Die Nachricht
Minus dreiunddreißig Grad. Rekordtief. Zahlreiche Tote bei Auffahrunfällen. Die Straße mit einer Abfahrtspiste verwechselt. Schnee schippen oder Tee trinken. Für beides ist keine Zeit. Also noch früher raus als gestern. Den Hals brechen. Der Schnee liegt mittlerweile so hoch, der hat sich jetzt so aufgetürmt, in eine Höhe begeben, der ist so hoch geweht worden, dahin folgt kein Fahrzeug mehr, kein Kettengerät. Hier herrscht Naturgewalt. Man möchte diesen Satz hinausbrüllen. Den Berg hoch mit Sorgfalt und Geduld und hoch oben dann gegen die Natur anbrüllen: »Hier herrscht Naturgewalt«. Das muss ganz vehement kommen, man darf sich da nichts schenken und der Natur schon gar nicht, das muss ganz raus aus der Lunge, die Lunge muss knarren, rausfliegen wollen, die Stimme versagt fast, es reißt die Stimmbänder weg, man ist sprachlos. Warum hast du den Mund offen, fragt man sich. Warum stehst du mit offenem Mund denn da, ohne ein Wort zu sagen, ein Sterbenswörtchen. Da geht ein Zug um deinen Mund, ein schlagender Wind, der führt das Eis mit, die Eiseskälte. Die Ohren schmerzen. Gegen den Wind gedreht gibt es nichts zu horchen. Keine Stimmen filtern die Trichter aus dem Hörband. Geübt in Stille, sind das strudelnde Rauschen, der reißende Fluss Allgemeingut, trockenes Geröll. Was hatte man noch im Ohr, als man hierhin kam. Welche Vorsätze, gute Meinung. Man wird nichts berichten können, nichts wird in Erfahrung zu bringen gewesen sein. Frühmorgens hinauf mit flinken Schritten, die Sonne zögert, was Zeit lässt, ein Stirnband will man ja nicht um den Kopf tragen, das den Schweiß fängt, der in den Augen brennt, die blinzeln müssen, bis das Stolpern beginnt, der Fehltritt, nicht richtig hingeschaut, nicht aufgepasst, weil der Schweiß in die Augen lief, die Stirn hinunter, aber ein Stirnband will man nicht haben, das den Schweiß erst strömen lässt, eine Sonne um neun schlägt dich an, lässt dich winseln, ob man nicht lieber abbrechen sollte, umkehren, jetzt schon umkehren?, aber nein, wir kehren in den Schatten, nehmen den Berg von hinten, wo der Schatten wohnt, wo niemand hinschaut. Diesen Gipfel stürmt man nur noch mit einer Schaufel. Der Schnee ist nicht von Menschenhand. Aber die Menschenhand muss seiner Herr werden. Ein langsam gefrierender Mund. Der Wind passiert das Ohr und geht in den Mund. Er schießt in den Mund. Ist das nicht schon Eis, was da ankommt? Ich gehe jetzt hinauf. Ich mach’s jetzt. Ich pack’s. Das sind so Sprüche. Der Schnee ist leise, er schleicht sich ein. Schnee gilt ja als niedlich fast, so gemütlich und wohlgesonnen. Allein was über ihn gesagt wird. Er ist weiß. Flocken. Er rieselt hinab. Er kommt von oben. Es schneit von unten, sagt man ja schließlich nicht. Schnee dämpft. Schnee macht besinnlich. Und dann der Schneemann. Steht ein Schneemann im Garten, kann nichts mehr anbrennen. Und dann hat der Schneemann ja auch eine rote Rübennase. Warum ist Papa gestorben? Das wird ja gerne mit dem Schneemann erklärt. Es taut. Schneemann knickt weg. Kippt seitlich. Papa. Der Schneemann war dein bester Freund. Versprichst du mir, dass er nächstes Jahr wiederkommt? Wohin ist er denn verreist? Und warum kann es nicht so bleiben wie es ist? Warum hat er denn nicht seine Nase mitgenommen? Und die Kastanien da, was machen die denn da? Ich sehe nichts. Da liegt also die Mütze. Wie heißt das Lied? Der Lotse verlässt das Schiff. Der Schnee. Er kommt so still, wie es keinem Feind zu wünschen ist. Noch nie ist ein Schnee verhindert worden. Er kommt und geht, wann er will. Sehnt man ihn herbei, kommt er nicht. Ist er da, will er nicht bleiben. Bleibt er, droht er augenblicklich wieder zu verschwinden. Verschwindet er dann nicht ganz, hat er bald schon Ausschlag. Überall tritt Schmutz ein, wenn die Leute mit ihren Straßenschuhen auf und ab gehen. Wir marschieren mit unseren Sohlen über blütenweißen Schnee, und schon ist dieser Schnee ganz schwarz. Schnee ist unberührbar. Er ist so gleich, dass wir nirgendwohin mehr gehen sollten. Zu Hause bleiben, sagt der Schnee. Es ist eine Schande, wie dieser Schnee belaufen wurde. Der so belaufene Schnee ist nicht mehr zu reparieren. Man könnte ja mit einer Schaufel die Fehltritte zudecken, eine Schaufel Schnee von hier nach dort transplantieren, die Wunde schließen, die aber nicht geschlossen werden kann, nur vertuscht. Wir müssten unentwegt vorwärtsgehen, uns nach jedem Schritt umwenden und die hinterlassene Spur wieder zudecken. Auf diese Weise könnten wir uns gar nicht mehr entfernen. Entweder müssten wir das Vorwärtsgehen ohne Unterlass fortsetzen und uns mit jedem Schritt einen Schritt mehr vom Haus entfernen oder augenblicklich umkehren und umkehrend die Spuren beseitigen. Die einzige Konsequenz muss sein, gar nicht erst das Haus zu verlassen. Ein verrannter Schnee ist untröstlich. Spätestens mit diesen Eindrücken sehnt man das Frühjahr herbei, den Blumenduft und fliegenden Sommer.
Dann fällt Neuschnee. Die Gnade des späten Neuschnees. Das fahle Licht der Küche klärt sich auf, ein klarer Gedanke wird gefasst, unwillkürlich drehst du dich herum, der neue Schnee hüllt dich ganz ein. Deine Handschrift im Schnee. Das Stempelkissen. Da lief ein Hase, die Schnur hier ist eindeutig ein Fuchs, diese Entfernungen hinterließ eine Katze. Und die Augen schmerzen. Der Schnee brennt sein Licht in die Augen. Ohne Brille macht er unweigerlich blind. Wer eine Brille trägt, die den Schnee erträglich macht, setzt diese immer wieder ab. Schließlich will jeder sehen, wie es wirklich ist. Die Brille hat den Augen einen braunen Filter eingebrannt, den sie vorerst nicht loswerden können. Man setzt die Brille also wieder auf und sieht durch sie hindurch, wie es nun wirklich zu sein scheint. Dann nimmt man die Brille wieder ab. Hält man dann für einige Minuten die Augen geschlossen, hat sich der Braunton verflüchtigt. Er löst sich von den Augen ab. Er schwebt. Jetzt werden die Dinge sichtbar. Die Dinge sind jetzt in einen kleinen Raum gefasst. Sie tauchen auf, sie tauchen ab. Das ist das Kindheitsmobile. Unsichtbare Fäden. Eins sitzt oben, eins geht nach unten. Und dann die Wut. Die zitternden Äste in Fetzen. Windschiefes Trauerspiel. Und überall siehst du das Mobile. Das immer vor den Augen tanzt. Wenn du die Augen öffnest, schiebt sich die Welt dazwischen. Du bräuchtest diese Welt doch gar nicht. Genügt denn dieses zerschlagene Mobile nicht? Könnte einer, der nur dieses Mobile vor Augen hat, nicht alles voraussehen, und er bringt sein Leben damit zu, nur immer dieses Mobile zu studieren, jede Regung, jeden Stillstand, könnte ihm das nicht völlig genug sein, lernte er nicht bald schon, vom Mobile auf die Welt zu schließen? Er sitzt in einem immer gleichen Raum, die Fenster werden geöffnet, die Fenster werden geschlossen, Licht durchflutet den Raum, es ist genug zu atmen da, die Gegenstände des Mobiles sind unbestimmt genug gehalten, darin mal einen Menschen, mal ein Tier zu sehen, das Mobile macht die Jahreszeiten, es gibt Streit und Frieden, es bewegt sich, es regt sich nicht, würde dieser nicht auf die Welt schließen können, ohne sie sonst gesehen zu haben, würde er nicht bald schon um Rat gefragt, wie es in dieser Welt denn zugehen müsste, damit sie ein Mobile sei, das lautlos, sanft wiegend im Raum schwebt, das Mobile stellt keine Fragen, der keinen Blick wirft nach draußen, der immer nur das schaukelnde, das stillstehende Kinderspiel betrachtet, hat Antworten genug.
Jetzt hängt an einem Ast die singende Amsel am Abend, jetzt sind es die in den Bäumen hockenden Nebelkrähen, die Krähenbande ist es, die das Ding da, die verklemmte Walnuss, aus der Regenrinne holen will. Das ist eine unermüdlich ratternde Nähmaschine, diese tanzenden Schnäbel. Die macht sie ganz wild, diese Nuss. Dass die da aber auch so klemmen muss. Sie hängt im Laubfänger fest. Reihenweise rutschen die Schnabelmeister ab. Die Nuss zeigt ihre Vorderfront. Ein gezielter Hieb auf die Fontanelle und die Sache wäre geritzt. Es ist ja nicht so, dass die Walnuss von sich aus sich wehrt. Die Nuss klemmt da, weil sie keine andere Wahl hat. Sie ist mal hierhin, mal dahin transportiert worden. So hoch wie das Haus steigt gar kein Walnussbaum. Ist es der Wind nicht, der Sturm, haben die Vögel wohl selber die Nuss hierhin gebracht, die sie nicht müde werden auseinanderzunehmen. Die Schnäbel richten nichts aus. Jetzt stürzen die Krähen mit ihren Füßen drauf. Sie attackieren den Provokateur aus der Luft. Ihre Vorgehensweise lässt auf eine wohlerprobte Taktik schließen. Dann ziehen sie ab. Eine Krähe nach der anderen tritt den Rückzug an. Der Feind kapituliert, soll die Nuss denken. Die Fallschirmspringer springen in ihren Fall mit Bedacht. Sie können bis drei zählen und verlassen das Flugzeug am besten in dem Moment, wenn Falltiefe, Höhepunkt und Fallgewicht im Einklang sind. Jetzt lassen die Krähen springend von der Walnuss ab. Von der Nuss aus betrachtet sieht das aus wie ein längst vorbedachter und von langer Hand eingefädelter Selbstmord. Die Krähen knicken seitlich weg. Das heißt, sie machen einen prompten Satz über die Regenrinne. Die Nuss ist noch ganz warm vom Brüten der Krähen. Soeben haben ihre Schnäbel noch wuchtig auf die Walnussschale eingedroschen, nun kippen die Fallschirmspringer mit einem deutlichen Satz seitlich weg in die nie gesehene Tiefe. Kaum sind die Krähen neben der Regenrinne weggetaucht, öffnen sie den Fallschirm, der sie sofort knapp unterhalb der Rinne in der Schwebe hält. Sekunden später sieht sich die Nuss erneut krakeelenden Krähen ausgesetzt. Allein umsonst. Jeder Schnabelhieb treibt sie enger ein. Will sie nicht herausgezogen werden, gibt sie dem Schnabeldolch nicht nach, soll sie durch die Schelle des eisernen Laubfängers gehämmert werden, dann schwimmt sie frei in der Rinne auf den Abfluss zu. Und will sie sich dann doch nicht in Richtung Abfluss aufmachen, kann man sie immer noch mit dem Schnabel vorantreiben. Doch die Nuss sitzt fest. Eine letzte gewaltige Anstrengung, eine letzte selbstlose Verausgabung. Es ist nichts, es ist überhaupt nichts zu machen.
Maulwürfe sind immer so erfolgreich. Ist das ein Trost, dass die Maulwürfe nicht hinaufsehen können, dass diese Blamage unentdeckt bleibt? Jetzt sieht es auch das hüpfende Krähenvolk ein, dass hier nichts mehr zu holen ist. Gescheitert sein, und jeder sieht es einem an. Nur die Krähen sehen es sich an. Windstille. Die Krähen lassen die Köpfe hängen. Sie rühren sich kaum. Die Erkenntnis, alles versucht und nichts erreicht zu haben, ist das Gift, das sich langsam in den Körper füllt. Es entzieht alle Lebensfreude. Wie das dörre Obst an den Bäumen, das niemand mehr beachtet, das bald herabfallen wird, stehen die Krähen einfach traurig da, von Zeit zu Zeit pendeln ihre Köpfe hin und her, die augenscheinlich nichts mehr mit dem übrigen Körper zu tun haben. Ihr Schnabel ist ihnen so schwer, er zieht sie ganz zu Boden.
Was fällt euch ein, so träge zu sein. Man sollte das Fenster öffnen, euch zu verscheuchen. Es kann doch nicht wahr sein, dass hundert Krähen eine einzige Nuss nicht packen. Man hätte sich von Anfang an nicht weiter um euch bekümmern sollen. Zu viel Zeit ist verloren gegangen. Ja, schwirrt nur ab. Euch selbst könnt ihr nicht mehr in die Augen schauen. Die Krähen hüpfen über die Rinne, kippen seitlich weg, heben ab, sind fort. Die Nuss bleibt für immer ungeöffnet. Nüsse sind aber dazu da, dass man sie öffnet. Eine nicht geöffnete Nuss fällt zu Boden und zerspringt. Und diese klemmt in der Regenrinne, bis der Regen sie wegschwemmt. Dass plötzlich etwas nicht mehr ist, das vorher da war. Wie diese Krähen. Und dann ist es immer so lautlos. Alles scheint abgezogen, entwichen. Am Himmel keine Spur. Die Schneespur der Krähen ist so deutlich, erst der Frühling wird sie zum Verschwinden bringen. Dann ist Frühling. Die Spuren schmelzen, man sollte einmal wenigstens abwarten können, bis sie ganz verschwunden sind, einmal unablässig das Schmelzen der Spuren ins Auge fassen, das Verschwinden, das uns immer voraus ist, ist das nicht das Merkwürdigste, dass etwas Spuren hinterlässt, sich eindrückt, abhebt und verschwindet, es drückt sich in den Boden ein, in die Luft, es zeugt von einem Eingriff, einer Besetzung, und es selbst ist nicht mehr da, und das, was wir sehen, was wir ertasten und umreißen, ist das jetzt eine Schande oder ein Denkmal, einmal wenigstens mit den Augen dranbleiben, bis es wieder weg ist, verblasst ist, hier diese Straße, erinnerst du dich, rechts das Haus noch da, aber wie weg, im Dasein schon weg, und die Tanne, die doch immer vor dem Haus gestanden hat, diese Einkreisung am Boden, im Rasen, da hat doch die Tanne gestanden, da steht sie aber nicht mehr, und du führst sie dir vor Augen, obwohl sie nicht mehr da steht, ist das so?, oder weil sie nicht mehr da steht.
Ist es nicht schon Leben genug, dass du dich an diese Tanne erinnerst, eine Tanne ist ja ganz harmlos, und weil diese Tanne so harmlos ist, erinnern wir uns immer an die Tanne, die Tanne löscht alle Spuren, alles, was nicht wiedergutzumachen ist, nimmt diese Tanne in sich auf, ein Denkmal bannt die Geschichte, im Kopf ist nichts als ein Mobile, darein die Wut gefahren ist. Jetzt habe ich mir also vorgenommen, das Verschwinden der Krähenspur zu sein, ich bin jetzt diese Kamera, die das aufnimmt, der stolze Schnee, darin eingestochen dieser Krähenfuß, und weg ist die Krähe, die ist da gar nicht mehr greifbar, es ist irgendeine Krähe, aber ganz genau diese Spur ist es, da im Schnee, siehst du, dieser stolze Schnee, und dann kam ja das Frühjahr, mit einem Riesenschwall kommt das Frühjahr, du verlässt das Haus im fetten Mantel, und es haut dich um, gerade noch kannst du dich am Türknauf festhalten, so bläst es dir entgegen, dieser weit gereiste Wärmeschwall, wo der bloß herkommt, schon während des Telefonierens meintest du, dich umfange eine Wolke, da macht dich etwas ganz dicht, jedenfalls greift dieser Schwall tief ein in den Schnee, der mit einem Mal wie unter Wasser zu sein scheint, Glas scheint da eingedrungen zu sein, der Schnee bäumt sich auf, bildet eine kristalline Kruste, die an den Rändern wegkippt mit hängenden Köpfen, Tropfen rinnen herab, die Krähenspur verflüchtigt sich, dann macht alles kehrt, was dieser Schwall ist, es geht von einem fort und nimmt was mit, man ist ja auch froh, dass es weggeht, schließlich möchte man auch mal wieder alleine sein, unbehelligt, man möchte den Kopf einmal wieder in nichts Bestimmtes stecken, hinausfühlen, und keine Migräne haut einen um, kein Geruch von verbranntem Plastik sticht in die Nase, rast in die Nebenhöhlen, sticht komplett durch, einmal nicht mehr, natürlich ist es so, dass es mehr als auffrischt und erfreut, den Frühjahrsgeruch wiederzuerkennen, wenn man zum Beispiel durch den Wald geht, an den Bäumen vorbei, und völlig unklar bleibt, sind das die Bäume vom letzten Jahr, haben die noch das Laub vom letzten Jahr dran, im Geäst dran, hängt da noch das Laub von vorgestern, und sollte ich mich jetzt auch wie gestern fühlen, geht das jetzt vorwärts oder bleibt es stehen, verharren wir jetzt, zuvor munteren Schrittes vorangerauscht, und mit einem Mal, die Krähen, die schon längst verschwunden sind, steigen ganz sachte auf, kaum merklich, die Krähen schweben ergreifbar vor Augen, schwarzweiß, ein ganzes Heer Krähen bildet ein einziges Flügelpaar, das lautlos und weitausholend nach unten, nach oben geht, diese gespreizten Flügel, die Schlangenbewegung des gesamten Körpers, der viele ist, diese so schöne Gesellschaft, und der geschälte Wald, den muss doch jemand geschält haben, dass er so aussieht, hat das denn keiner bemerkt, und in das Laub von vorgestern mengt sich das Laub von heute, das bald rauskommen müsste, das müsste doch langsam mal in Erscheinung treten, das sind die Weisheitszähne der Bäume, die jetzt kommen, und der Milchzahn hängt noch dran, nagt noch, ein Wald ist immer drei Generationen gleichzeitig, nicht zu vergessen der immergrüne, der immerwährende Boden, auf dem da spaziert wird, wir wissen ja gar nicht, wie historisch der Boden ist, auf dem wir rumlaufen, gäbe es Spurendenkmäler, Bodendenkmäler, Fußabdruckdenkmäler, der deutsche Wald würde erzittern, überall im Wald stünden Denkmäler herum, auch im verbotenen Distrikt, im Sperrbezirk, selbst die Lichtung ist verseucht, da ging der Napoleon hoch, hier folgte Bismarck seinen Spuren, dem Hindenburg folgte, das ist ein großes Durcheinander, die Geschichte ist ein Verhau, ein Drahtseilakt, die Volksnähe der Despoten, die obligatorische Kaffeehaussucht der Despoten, die über den Kuchen das Volk regieren, du kannst keinen unschuldigen Kuchen mehr essen, die in der Kaffeesahne aufleuchtende Krähenspur, die nicht schmilzt, und dann reißen die Lippen, der heiße Atem reißt die Kaffeesahne in den Schlund, wo ist die Romantik geblieben, prospektgeschult reisen wir in diesen romantischen, diesen deutschen Landstrich und suchen die Romantik, kaum steigen wir aus dem klapprigen Taxi, das doch so verheißungsvoll war, knapp der Böschung entgangen, dünkt uns deutlich, hier gibt es gar keine Romantik, hier sieht das ganz anders aus als da auf dem Broschürenfoto, du kannst das erwandern wie du willst, du wirst es nicht finden, du findest es nicht, es ist ein Schweinsgalopp durch die romantischen Tiefen, um das festzustellen, hätte ich ja gleich in die Ferne reisen können, da sieht das auch nicht so aus, und die immer quälende Erholungsbedürftigkeit, kaum kehrst du aus dem so schwerverdienten, so aufgesprungenen Urlaub heim, bist du urlaubsreif, und du fragst dich, ist das doch noch das alte Laub, das an den Bäumen hängt, ist das die Überreife, »die Einzelheiten sind lächerlich und die Gesamtheit der Einzelheiten«, ausscheren, den Weg durch den Wald nehmen und sich einflüstern, das ist kein Weg, das Bedrohliche ist ja nicht der Weg, es ist alles andere als der Weg, der taghell noch einsichtige Waldrand links und rechts des Weges, da kommt es raus, die Rede von einem plötzlichen Vorspringen, Angstbiss, wenn die ihre Jungen haben, dann sind sie besonders aggressiv, Buckelpflaster, der Regen hat den Weg aufgemischt, wenn du nachts den Weg durch den Wald nimmst, auf hundert Meter kein Licht, keine Laterne, die dir leuchtet, da denkst du ganz freiwillig, das System ist nicht an allem schuld, hier gibt es gar kein System, denkst du, es gibt Bewohner der Sowjetunion, die haben bis heute nichts von Stalin gehört, hier gibt es gar keinen Staat, es gibt den Gemüsehändler, den ewigen Bauern, aber doch kein System, bis hierhin kommt das nicht, was soll das auch sonst für einen Vorteil haben, aufs Land zu ziehen, an der Versteppung hier ist nicht unmaßgeblich Wüstensand schuld, der kommt hier in ein Windloch und stürzt ab, bleibt liegen. Als ich das erste Mal den Waldschützpfad durchnehmen wollte, standen nach wenigen Metern schon Wildschweine da. Die schauten einem geduldig entgegen. Kommen lassen. Der Pfad wird von Straßenlaternen gesäumt. Eine ist ausgefallen. Eine Lücke im Reißverschluss. Du stürzt in ein mitten in der Nacht ausgehobenes Loch. Es tut sich was auf. Du hast Fahrt aufgenommen und wirst gegen eine aus der Erde schießende Mauer geklatscht. Umkehren. Die Wildschweine kommen näher. Die tun doch nichts. Das sind doch bloß Wildschweine. Höchstens wenn die Junge haben. Dazu muss es doch erst mal Frühjahr werden, dass die Junge kriegen. Die Jungen sind ja manchmal unergründlich. Die jagen hierhin, rennen dorthin. Unvermindert harmlos, wenn nur diese Lichtlücke nicht wäre. Da fahre ich nicht durch. Ist es das immer, was man mit Überbrücken meint? Laut schreien, Lärm machen, einfach weiterfahren. Die blieben aber stehen. Es herrschte dieses unverwechselbare, mattgelbe Licht, das die Straße in eine günstige Wärme taucht. Eine Ankündigung. Du steigst vom Rad. Was ist das denn? Was machen denn die Schafe hier? Tiere sind immer zu Hause. Die gehören da einfach hin, sagt der Nachbar. Die sitzen im Baum, die schwimmen im See, die scheißen aus der Luft. Die sind auf dem Teller. Die sind immer zuerst da. Kaufst du ein Haus, ist immer schon irgendein Tier da. Der Fuchs, zum Beispiel. Der geht seiner Wege, tauchst du auf, ist er gnädig und verschwindet. Eine Ansprache halten? Hört mal, Wildschweine, es ist so, dass ihr kein System seid. Außerdem könnt ihr euch nicht selbst vernichten. Außerdem könnt ihr euch nicht ausrotten. Und dahinter stehen die Jungen. Das Muttertier steuert Verständnis bei – und rennt dich über den Haufen. Dynamo. Das ist ja das Unabänderliche, dass da kein Licht ist, wenn du stehst. Was geht in den Schweinen vor? Als wäre die Erde aufgebrochen, geht über dem Weg das Laubzelt auseinander, der Himmel strahlt durch die Sonnenschneise, hier gehst du lang, hier erklärst du dich, hier machst du wieder kehrt, nachts, die Schweine stehen da ja nur, weil der bestirnte Himmel immer noch die Schneise wärmt, die hängen da aus, grillen ihren Wams, und du kommst an ihnen nicht vorbei, kein Mumm, aber Braten. Na? Gehst du jetzt doch da durch? Nachts. Nachts ist alles größer. Ich überlege, ob nachts tatsächlich alles größer ist. Es ist starrer. Es starrt alles. Nachts werden alle Risse zugedeckt. Was an Sicht fehlt, gleichen die Ohren durch gezielte Aufmerksamkeit aus. Die Ohren hören jetzt weiter, sie legen größere Distanzen zurück. Weil man da in Ruhe gehen möch - te. Es scheint aber, dass die meisten wanken. Wie kommt es, dass eine Gesellschaft, die im Stillstand ist, wankt? Das Licht ist ausgefallen. Die haben plötzlich das Licht abgedreht. Der ganze Ort liegt völlig im Dunkeln. Zum Waldschützpfad gibt es keine Alternative, will man nicht der Straße folgen, die um den Wald herumführt. Die Autos sehen einen nicht, deren Licht müsste immer um die Kurve gehen, es geht aber immer nur geradeaus, es scheint in den Wald, und du bist in der toten Zone. Ist kein Auto in Sicht, steigst du mit Wucht in die Pedale, siehst zu, dass du vorankommst, geht Licht durch die Bäume, oder dieser jahreszeitbedingte Lichtnebel taucht auf, fährst du seitlich ran, verlangsamst die Trittfrequenz, bleibst schließlich stehen, dicht am Graben, und lässt den Wagen passieren. Fährst du ohne Licht, ist die Vorstellung dein Begleiter, in ein hartes Loch zu fallen, bereits gefressen worden zu sein, du bist verschluckt worden, du rast auf einen Ort zu, der immer in deinem Kopf ist, du hast diesen Ort schon als Kind geträumt, dieser Ort ist hinter allem, was du denkst, wenn in deinem Kopf nichts ist, auch heute nicht, so ist da immer noch dieser Ort, ein kleiner Raum ohne Fenster, der dich umschließt und ganz nervös macht, es gibt nichts zu sehen in diesem Raum, du siehst dich in diesem Raum stehen und musst immer hinschauen, wie du regungslos in diesem Raum stehst. Das macht die Augen müde, du schließt die müden Augen, und jetzt siehst du dich geschlossenen Auges in diesem Raum stehen, um den herum, wenn du einmal drin bist, nichts mehr zu erkennen ist, alles löst sich ab, verliert seine Kontur, Umrisse verschwinden, es gibt keine Tür, aber du weißt, diesen Raum wirst du nicht mehr verlassen können. Der Körper reagiert auf diesen Zustand mit einem Anstieg seiner Temperatur, er strahlt Wärme ab, als könne diese Schutz gewähren und den Raum abhalten, an den Armen und Beinen stellen sich die Härchen auf, die Gänsehaut ist so stark, dass sie schmerzt, erstaunt siehst du, wie lang deine Härchen am Unterarm sind, wie die Stachelhaare eines Insekts stehen sie da, es reißt dich empor, es zerrt an dir, es ist wieder da, sofort sagst du es dir selber, es ist wieder da, wie Es ist es wieder da, Jahre sind vergangen, und plötzlich ist Es wieder da, Es hat sich gar nicht verändert, du aber hast dich verändert, du bist vielleicht trauriger geworden, hast aber gelernt, mit dieser Traurigkeit zu leben, sie ist dein täglicher Umgang geworden, du hast dich als Maschine begreifen gelernt, wenn du traurig bist, stehst du einfach für ein paar Minuten mal da und weinst dich aus, eine Merkwürdigkeit des Menschen ist das, wie das Lachen, du weinst und fragst dich, ob Tiere auch weinen, lachen Tiere denn?, Tiere lachen nicht, Tiere weinen auch nicht, jedes Mal dieser tief greifende Schreck, wenn eine Lachmöwe lacht, hinter deinem Rücken fängt eine Lachmöwe an zu lachen, mit diesem bellenden Schrei, und im selben Moment findest du dich über die Maßen lächerlich, ganz erbärmlich findest du dich, dann überkommt dich diese Traurigkeit, und du könntest auf der Stelle heulen. Ist das nicht ein schönes Bild, die Lachmöwe lacht dir in den Rücken, du stehst vor ihr und weinst, wagst es aber nicht, dich herumzudrehen und der Möwe das zu zeigen, erst wenn du dich ausgeweint hast, drehst du dich herum und siehst der Möwe beim Lachen zu, und die Möwe nimmt gar keine Notiz von dir, sie sieht so ernst aus bei ihrer Lachverrichtung, sie lässt dich einfach da stehen und hebt ab.
Wo ist der Vogel? Halluziniere ich? Nach diesem höchst anstrengenden Aufstieg, der viel anstrengender war, als sie erwartet hatte, nach diesen Umwegen, falschen Pfaden und unwegsamen Verirrungen hinein in Wolken und Nebel gelingt es Marta, die Sturmflut der Bilder anzuhalten und sich für Augenblicke zu besinnen. Die Kälte ist mittlerweile in Bereiche des Körpers eingedrungen, deren Existenz man immer stillschweigend hinnimmt, auf die man nicht weiter achtgibt, solange sie sich nicht bemerkbar machen, der Schmerz ist auch gar nicht genau lokalisierbar, mal scheint er das Ganze zu betreffen, dann wieder sitzt er in den Bronchien, den nächsten Moment aber ist es das Knie, das alles Ziehen und Reißen aushalten muss. Das Ein- und Ausatmen gegen den roten Wollschal befreit die Lippen von der starren Zwinge des Frostes, die Lippen formen ein paar Grimassen und fühlen sich schon wieder recht warm an, während das übrige Gesicht umso stärker von dieser nie erlebten Kälte gefangen ist. Marta ist hierüber ganz erschrocken und fürchtet, als Nächstes könnten die Augen versagen, es sind ja Fälle bekannt geworden, da schützte selbst eine starke Brille vor Schneeblindheit nicht, wohin soll sie hier auch schauen, es geht Weiß in Weiß über, und schon eine kaum wahrnehmbare Graustufe beruhigt sie wieder ein wenig. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nicht verlaufen. Ich war immer eine sehr gute Skifahrerin. Ich bin stets die Piste zu Fuß hoch, habe nie einen Sessellift in Anspruch genommen. Wie konnte das passieren, dass ich mich heute so verlaufe? Aus der Schattenwand herausgetreten, reißt die Eiseskälte, und ein Loch scheint sich aufzutun. Ein paar Schritte noch, dann ist der Scheitelpunkt erreicht.
Der Ausblick von hier oben ist gigantisch. Arlberg, Schindlergrat, Mattunkar. Das muss man einmal gesehen haben. Klirrende Eiseskälte wie dem besten Feind nicht zu wünschen, der Himmel strahlendes Blau. Der Schal vor dem Mund allein richtet nichts aus, man muss das Atmen einstellen. Die Atemwege frieren augenblicklich ein. Frostklare, eisstarrende Lungenflügel. Die Kälte wölbt das Innere nach außen. Die Lungen liegen ganz offen. Froststarre Zapfen der Bronchien. Husten heißt sprengen. Selbst ein Räuspern, ein Nachdenken schafft dich beiseite. Du hast dir also vorgenommen, einmal nachzudenken. Da unten kann ich das nicht, hast du dir gesagt. Es soll dir niemand folgen können. Ein ungewöhnlicher Weg muss eingeschlagen werden, hast du dir gesagt. Zum ersten Mal im Leben hast du dich übernommen.
Die Sonne wärmt schnell. Marta setzt den Rucksack ab, schnallt die Skier unter, setzt die Brille auf, drückt die Skistöcke vor sich in den Schnee. Das ist das Schönste am Leben, denkt sie, hat man die Unüberwindlichkeit überwunden, atmet man frei und neu geboren. Spuren im Schnee zeigen ihr, dass schon jemand vor ihr den Hang hinuntergefahren ist. Zivilisation ist, Spuren zu hinterlassen, denkt sie.
Und jetzt geht es die Piste runter. Da ist weit und breit nichts in Sicht. Es ist eine Unbeschwertheit am Werk wie seit Jahren nicht mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, in letzter Zeit jemals so unbeschwert gewesen zu sein, denkt Marta. Die Skier sind zwar nicht mehr die modernsten, frisch gewachst laufen sie aber tadellos. Marta will nicht mehr nachgrübeln, sie will einfach nur den Hang hinunterfahren. So beschwerlich es war, diese Piste abseits aller offiziellen Pisten zu erreichen, so wenig gelingt es ihr nun, einfach nur die Fahrt zu genießen. Was geht in ihr vor? Warum kann sie das Grübeln nicht lassen? Zu behaupten, das Leben ist kürzer als ein Skihang, ist sicherlich Unsinn, da der Skihang im Leben ja enthalten ist. Das Bewusstsein aber, das einen den Skihang hinunterbegleitet, mit jedem Meter, jeder Sekunde dem Ende der Abfahrt näher zu kommen, bis es ganz da ist, dieses Bewusstsein ist ein falsch gepoltes Leben, das sollten wir eigentlich gar nicht haben, wir sind aber dazu verurteilt, mit diesem Bewusstsein zu uns selbst immer parallel zu laufen. Die vom Schnee schwer zu Boden gedrückten Äste, die in Schnee völlig eingetauchten Bäume, die nicht mehr als Tanne, als Buche, als Fichte zu erkennen sind. Wir könnten jetzt für einen Moment innehalten und das alles ringsumher anschauen, als sähen wir es das letzte Mal. Wir fahren den Abhang hinunter. Ganz. Wir steigen in den Sessellift und fahren zum wiederholten Male hinauf. Auch jetzt nehmen wir das Umliegende kaum wahr. Schnee ist ein Schalldämpfer, er hüllt die Umgebung in einen Kokon. Du fährst durch dein Gehör. Das sofort weiß, etwas schon einmal gehört zu haben. Der Fuß sinkt in den Schnee, er hat den Schnee noch nicht ganz auf den Boden gedrückt, da hält man in der Bewegung inne, für Momente schwebt der Fuß, dann setzt man ihn langsam auf mit dem sicheren Gefühl, genau dieses Geräusch des Gehens durch Schnee wiederzuerkennen, die Lautlosigkeit ringsumher, der stille Hunger, den man, kaum hat man diesen Zustand, diese Veränderung bemerkt, für gestaute Wärme hält, man öffnet die Jacke, die Wärme entweicht aber nicht, es zieht etwas aus dir raus, mit jedem Atem entweicht es. Es ist das eindeutige Gefühl, hier jetzt gar nicht anwesend sein zu wollen. Dieses Verbohrtsein, das bin ich doch nicht etwa ganz. Ich bin doch nicht nur verbohrt, als sei ein Pfahl von oben durch den Schädel und das Becken hindurch in den Boden getrieben worden, der am Vorankommen hindert, den aber niemand sieht. Ich weiß nicht, was du hast, du könntest ruhig ein wenig anders sein, hört man da oft. Es ist ja genau umgekehrt, die Gedanken sind ja schon weiter, die sind schon weit fort, es reißt fast den Kopf vom Rumpf, nur der Körper, der steckt fest, der macht einfach keinen Schritt nach vorne, ich stecke fest. Dann könnte man in sich hineinjagen, ein Tobsuchtsanfall, der steht jetzt an, aus der Haut fahren, wer sagte das nochmal gleich, Mutter sagte das doch, wenn das hier so weitergeht, werde ich noch aus der Haut fahren, sagte Mutter dann immer, was ich mir sogleich auch vorstellte, Mutter fährt augenblicklich aus der Haut, die Haut steht neben ihr und sie neben ihrer Haut, und für einen Moment der Verblüffung stehen beide aufrecht da, dann sinkt die Haut ganz weich zu Boden, niemand sagt was, alle stehen bloß herum, der Schnee ist mächtiger als die Stille, die Haut sinkt in den Schnee, und Mutter, wer soll das sein jetzt, es gibt auch ansatzweise keine Beschreibung für diese Erscheinung ohne Haut, jetzt steht sie ohne Haut da, sie hat es ja nicht anders haben wollen, soll sie halt mal klarkommen ohne Haut, sich mal ohne Haut ins Bett legen oder ein Bad nehmen, nimm doch mal ein Bad ohne deine Haut, lass dich mal blicken, das hast du jetzt davon, von deinen blöden Sprüchen. Und einen bestimmten Geschmack hat man dabei im Mund, wie man das alles in sich auskocht und das Ausgekochte in sich hineinfrisst.
Das Geräusch des niedergetretenen Schnees, der tief in die Kapuze verkrochene Kopf, der sichtbare Atem, der aus der Kapuze strömt, das war schon das sichere Gefühl des Kindes, für kurze Zeit in Frieden zu sein, bei sich zu sein. Man hat die absonderlichsten Gefühle und Neigungen, die man sich nur hinter der Kapuze erlaubt. Ist der Kopf aber frei, ist er ohne Schutz sich selbst und der Kälte, der Familie ausgesetzt, würden diese Gefühle die schlimmsten Gewissensbisse verursachen. Es wäre kaum auszuhalten. Dauernd würde man sich mitteilen wollen, es bliebe aber nicht beim bloßen Mitteilen, die geringste Andeutung, hinter der Kapuze seinen eigenen Gedanken nachzuhängen, käme einer Beichte gleich, was soll das auch sein, eigene Gedanken, was soll man schon denken, mit eigenen Gedanken, man macht sich halt so seine Gedanken, ist schnell gesagt, wenn man nichts über diese Gedanken sagen will. Hinter der Kapuze aber, da fährt man andere Wege, den gesamten Schnee des Abhangs lässt man sich auftürmen, schiebt ihn zusammen, die Skifahrer stehen plötzlich ohne Schnee da, die Bäume nimmt man weg, es sind plötzlich keine Bäume mehr da, alle Leute müssen rückwärtslaufen, rückwärts den Hang hoch, da gibt es gar kein Erbarmen, der Sessellift bleibt stehen, mit einem Ruck rastet er ein, die Leute können aber nicht hochschauen, weil sie immer nur geradeaus schauen können. Wollen sie sehen, was links und rechts vor sich geht, müssen sie ihren ganzen Körper drehen. Hast du die Kapuze über, kannst du sogar immer geradeaus gehen, mitten durch den Hang, du gehst einfach immer geradeaus, keinen Höhenmeter musst du überwinden, der Hang ist dein Tunnel. Du brauchst auch gar keine Luft in diesem Tunnel, der sich vor dir öffnet und sofort wieder schließt. Du kannst beliebig hin und her gehen, hast du den Tunnel durchquert, kannst du sofort wieder zurück. Deine Familie merkt von deiner Abwesenheit gar nichts, schließlich bist du ja gar nicht abwesend. Du bist nur unter deiner Kapuze. Und da kann es richtig warm werden, während die anderen ohne Kapuze ein rotes Gesicht haben, ihnen steht immer eine Atemfahne vor dem Gesicht, ihr Mund dampft gewaltig, ein richtiger Schlot ist das. Stolpern. Jetzt nimm doch mal die Kapuze ab, so kannst du ja auch nichts sehen. Lieber nicht. Die anderen beobachten und gleichzeitig durch den Tunnel dringen, geht also nicht. Das ist die Angst der Eltern, das Kind könne andere Gedanken haben als kindliche. Es könne Gedanken haben, die älter sind als das Kind. Als könne es etwas entdeckt haben, wovon es abgelenkt werden muss. Genau die Gedanken denkt das Kind, denen die Eltern schon immer aus dem Weg gegangen sind. Als hätten sie sich gegenseitig ertappt, schauen Eltern und Kind sich eindringlich an. Das Eindringliche ist aber nur Schutz, es ist ein Aneinander-vorbei-Sehen, das geradeaus geht, dauernd müsste der eine fragen, schaust du mich eigentlich gerade an, natürlich schaue ich dich gerade an, sagt der andere, was soll die Frage, du machst mir irgendwie den Eindruck, als schautest du mich gerade nicht an, der Schein trügt, sagt man doch so schön, und während der andere fragt, geht der Blick immer mehr nach innen, wo schon kein Tunnel mehr eingrenzt, es geht keinen Graben mehr entlang, es geht nur noch runter, du schaust geradeaus und kommst aus dem Gleichgewicht. Hast du gerade etwa gedacht ... Gar nichts habe ich gedacht. Aber du hast doch gerade was gedacht. Was meint ihr denn, was ich denken soll? Das fragen wir ja dich, du machtest den Eindruck, als beschäftige dich was. Nicht wichtig. Sag’s ruhig. Nicht wichtig. Also doch. Nicht wichtig. Solche Gespräche haben kein Ende, solche Gespräche werden beendet. Also komm, den Rest schaffen wir auch noch. Plötzlich wir. Und mach die Jacke zu, schließlich haben wir Winter. Es wird ein Geheimnis hineingesehen, das Geheimnis wird aber schnell wieder hinausgedoktort, da will man ja nichts anbrennen lassen, es muss der Berg bezwungen werden, auch wenn es nur ein Skihang ist. Diese Hitze. Für die ich nicht geradestehe. Die Jacke bleibt offen. Ich kann mir einen Panzer anlegen, dass die Kälte nicht eindringt, dafür brauche ich die Jacke nicht. Der Tunnel ist weg. Sie haben meinen Tunnel zerstört. Allein stehen zu bleiben ist von größter Not. Es sollte vereinbart werden, sich nicht umzudrehen. Jeder darf seinen Gedanken nachhängen, keiner soll ermahnt werden, anderes zu denken. Was gerade gedacht wird, das nachzufragen sei erlaubt, eine Einmischung sollte tabu sein. Es darf aneinander vorbeigegangen werden, ohne dass davon besonderes Aufheben gemacht wird.
Das Ende der Piste ist erreicht. Marta nimmt sich vor, wieder klare Gedanken zu fassen. Vielleicht war es an der Zeit, wirres Zeug zu denken, für das man sich sonst immer schämt, das als infantil gilt. Marta löst die Bindungen ihrer Skier, setzt den Rucksack ab, schnallt die Skier wieder drauf und macht sich auf den Weg zu einer Hütte, die ihrer Karte zufolge noch etwa zwei Kilometer Fußweg entfernt liegen muss. Die Karte war aber schon beim Aufstieg so unzuverlässig, dass Marta lieber jemanden nach dem Weg fragen würde. Es ist aber niemand in Sicht. Im Tiefschnee bin ich nicht versunken, also werde ich auch den Weg zur Hütte finden. Den ganzen Tag über war die Sonne so unzuverlässig, dass Marta schon Angst hat, sie könne Stunden vor ihrer Zeit untergehen. Das treibt sie plötzlich an, veranlasst sie, ihre Schritte zu beschleunigen. Glaubte sie immer, sie kenne sich aus im Schnee, in den Bergen, zweifelt sie nun, nachdem die Last des Aufstiegs ganz von ihr abgefallen ist, ob sie überhaupt noch eine Orientierung habe. Kann denn von heute auf morgen der Orientierungssinn gänzlich abhandengekommen sein, fragt sie sich. Man verfehlt sein Ziel, nimmt einen neuen Anlauf, hält inne, nimmt einen überlegenen Standpunkt ein, den logischen, resümiert die Lage, läuft wieder fehl, berechnet alles anders, kommt langsam in Wallung, reiht nun Fehler an Fehler, hat einen unberechenbaren Feind an Bord, den man erst gar nicht wahrnehmen will, bis Ballast abgeworfen werden muss, weil zu viel Energie unnütz verschwendet wird, der Feind heißt Nervosität. Nervosität lässt das Herz schneller schlagen, lässt es auch stolpern, Aussetzer markieren den Willen umzukehren, wieder gewohnten Tritt zu fassen, dann wird das Stolpern und Aussetzen zum Normalfall. Die Sonne. Noch steht sie. Noch scheint sie. Marta muss das nun in Sichtweite kommende Waldstück passiert haben, bevor die Sonne hinterm Horizont der Tannen versinkt. Schlagartig wird es dann wieder eisig kalt, die Eiseskälte wird einen mutlos machen, dann wird man ein wütendes Kind, das gegen alles aufbegehrt, das Kind tritt mehrfach mit ganzer Kraft in den Schnee, der Schnee stiebt auseinander, wieder herabfallender und hochstiebender Schnee treffen sich auf halber Höhe, das merkt das Kind und versucht, diesen Zustand so lange wie möglich zu halten, bis es völlig verausgabt ist, dann wendet es seine Wut gegen alles, was sich in seiner Nähe befindet, den Schuldigen, Luft, sich selbst. Zuletzt wird das Kind auf den Boden sinken, in den Schnee, es wird eine Weile dort herumtoben, stumm vor sich hin weinen, dann immer lauter, bis es ganz unvermittelt anfängt herumzuschreien. Kann jemand das Kind verstehen? Es kann sich selbst nicht verstehen. Jetzt bekommt es Angst. Es muss noch lauter schreien, um die Angst zu übertönen. Dann versagt die Stimme, dem Kind laufen Tränen die Wangen herunter. Das Kind beschließt, es dabei bewenden zu lassen, nichts mehr zu unternehmen, mit allem einverstanden zu sein, was da auch komme. Es weiß genau, dass dies gar kein Entschluss ist, es ist eine Hilflosigkeit, hat es sich erst einmal in diesen Zustand hineinmanövriert, alles über sich ergehen lassen zu müssen. Diesen Stolz aber hat es noch, entschlussfähig und mutig zu wirken, das soll man ihm nicht nachsagen können, dass es selber schuld sei, dass es eine zu große Klappe habe.
Es brennt, denkt Marta. Deutlich steigt Rauch auf. Auf der Anhöhe stehend erkennt sie in etwa dreihundert Metern Entfernung einen Schornstein, ein schneebedecktes Giebeldach, ein niedriges Holzhaus. Gleich hat sie die Hütte erreicht. Die anstrengendste Skitour ihres Lebens geht ihrem Ende entgegen.
»Grüß Gott, so spät noch unterwegs?«, begrüßt sie der Hüttenwirt.
»Ja, aber nicht ganz freiwillig. Beim Aufstieg habe ich mich dauernd verlaufen.«
»Auch eine Suppe oder lieber Geselchtes? Es gibt auch Wurst oder eine Schinkenplatte.«
»Suppe wäre recht.«
»Und zu trinken? Most? Ein Bier? Oder Wasser vielleicht?«
»Gibt es ein Skiwasser?«
»Selbstverständlich, das gibt’s auch.«
»Der Hitler«, sagt einer am Tisch.
Marta versteht nicht recht.
»Wir trinken auf den Hitler«, prostet ihr ein anderer zu.
»Ich wüsste nicht, warum ..., also ich persönlich ..., ich meine, was ...?«
»Noch nicht gehört? Der Hitler ist jetzt dran!«
»Wie dran?«
»Reichskanzler. Und das sage ich Ihnen, das wird jetzt immer größer, das Reich.«
»Wollen Sie denn nicht anstoßen, gute Frau?«
Sankt Anton, Arlberg, österreichische Alpen, eine Skihütte. Lion ist in Amerika. Und da muss er bleiben. Unter keinen Umständen darf Lion zurück, er muss da bleiben.
»Anstoßen, ja, sicher«, sagt Marta in Gedanken an Lion.
»Ist Ihnen nicht gut, werte Frau?«
»Was? Doch, doch, alles gut, ich frage mich nur ...«
»Fragen müssen Sie sich nun nichts mehr, ab jetzt wird nur noch geantwortet.«
»Ist ein Bett frei?«, fragt Marta den Hüttenwirt.
»Wollen Sie uns schon verlassen, das muss doch gefeiert werden, oder?«
»Gefeiert, sicher. Aber was haben Sie denn da zu feiern? Wir sind doch in Österreich.«
»Noch, meine Liebe, noch. Werden S' sehen. Das heißt nicht mehr lange Österreich. Das heißt bald schon Heimgegangeninsreich.«
Alle lachen, Marta lacht ein bisschen mit.
»Nun kommen S', lassen S' sich doch nicht so gehen, Werteste. Einen Schnaps für die Dame, Hugo, die Dame muss erst noch warm werden.«
»Himbeergeist oder einen ganz gewöhnlichen Obstler, was andres haben wir nicht.«
»Ja dann ... dann den Himbeergeist.«
»Geist ist gut, Geist wird jetzt kommen, liebe Gute, und da werden sich manche noch umsehen.«
Nach dem achten Himbeergeist liegt Marta endlich auf einer Pritsche. Die Runde grölt im Hintergrund, gefährlich wird es wohl nicht mehr. Nach acht Himbeergeist ist es nicht ganz einfach, die wahren Gefühle und Ängste zu unterdrücken, Marta macht sich Vorwürfe, ihre Meinung nicht gesagt zu haben, die betrunkenen Enthusiasten wären aber bestimmt ungemütlich geworden, die hätten sie zur Feier des Tages über die Klinge springen lassen.
Die Nachricht trifft ein, als das Nicht-Ausdenkbare mit kalter Hand schon Alltag ist. Und das Nicht-Ausdenkbare hat sich ja bereits angekündigt. Es ist bereits im Anmarsch gewesen. Man sagte sich aber, es marschiert auch wieder ab. Es ist dann nicht mehr abmarschiert. Für viele wird die Sache mit Hindenburgs Sohn eine große Erleichterung sein. Man kann da erst mal aufatmen und »ach so, deswegen« sagen. Dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann, sagen andere, das sehe man ja. Wirklich? Ging es nicht vielmehr unmerklich ineinander über? Es war also menschliches Fehlverhalten, schreibt Marta am selben Abend in ihr Tagebuch, habe sie soeben in einer österreichischen Skihütte gehört. Da hat also Hindenburgs Sohn Gelder unterschlagen, schreibt sie. Osthilfengrundbesitzernotpfennige. Die hat er für sich behalten. So viel kann das gar nicht gewesen sein. Der Großgrundbesitzer Oskar von Hindenburg, der von Hindenburgs Sohn war. Des Kaisers Sohn. Dass der nämlich, der das Gut seines Vaters verwaltet, das sein Vater vom Reich geschenkt bekommen hatte, diese berühmten Osthilfengrundbesitzernotgroschen unterschlagen hat, um damit seines Vaters Gut zu arrondieren, schreibt Marta. Es muss sich also schon um etwas mehr gehandelt haben.
Die Nachricht hat eine Vorgeschichte, die es erst zu dieser Nachricht hat kommen lassen. Deshalb nämlich ist ein gewisser Hitler an die Macht gekommen. Die Nachricht der Machtergreifung habe sie erreicht, als wieder die herrliche, die friedliche Zeit des Skilaufens ausgebrochen sei. Habe doch zunächst der alte Herr von Hindenburg gegen den Hitler gesprochen, vor ein paar Tagen übers Radio, das habe sie selbst gehört, schreibt Marta. So gegen den Hitler, dass von ihm eigentlich nicht mehr viel übrig war. Kleingeredet hat er ihn. Übersehen hat er ihn nicht. Er hat vielmehr laut und deutlich von ihm gesprochen, als stünde er kurz bevor. Tatsächlich hat er ja nicht erst kurz bevorgestanden, er war ja schon deutlich drüber, die Tür hat ja bereits zu lange offen gestanden, zum Lüften, und da ist er hindurchspaziert, durch die offene Tür, der Hitler. Der Hindenburg sei keineswegs zu alt gewesen, zu begreifen, was Hitler bedeutet. Der Hitler sei praktisch ja schon anwesend gewesen, er habe von den Straßen schon Besitz ergriffen, als seien das alles seine Straßen, schreibt Marta. Der Hindenburg, das sei schon an diesem Tag der Nachricht von Hitlers Machtergreifung klar gewesen, habe sich keineswegs überreden lassen, auch sei er mit ziemlicher Sicherheit nicht bestochen worden, vielmehr hat der Hitler das mit den Osthilfengrundbesitzernotmillionen spitzgekriegt und den Alten erpresst. Und so ist also dieser Hitler jetzt an die Macht gekommen, wo zunächst wohl viele immer noch denken, das macht nichts, das legt sich wieder. Wo doch auch der alte Hindenburg ihn schon deutlich kleingeredet hat. Er hat ihn nicht übersehen, er hätte ihn nur vielleicht so kleinreden müssen, dass man ihn mit bloßem Auge nicht mehr hätte erkennen können. So klein, dass er unter jeden Türspalt gepasst hätte. Eher ein Fall für Mäusefänger als für die Staatssicherheit. Doch plötzlich die Nachricht, dass Hitler an die Macht gekommen ist. Jetzt ist Hitler die Staatssicherheit, die Staatsunsicherheit, der Staatsuntergang. Und dabei sei gerade wieder die herrliche, die friedliche Zeit des Skilaufens ausgebrochen, schreibt Marta. Und dass ausgerechnet der Sohn vom Hindenburg so blöd gewesen ist, es dazu kommen zu lassen, wegen dieser paar Groschen. Diese Unterschlagung hat ihn an die Macht gebracht. Mit dieser Nachricht werde ich hier jeden Hang hinunterfahren. Man vernimmt diese Nachricht, will sie dann nicht vernommen haben, sie fällt einem wieder ein, man fährt den Hang hinunter mit dieser unmissverständlich zur Kenntnis genommenen Nachricht, die besagt, dass Hitler an die Macht gekommen ist, das Gift dieser Nachricht sickert langsam durch den Körper, betäubt ihn, man möchte, dass diese Nachricht den Körper wieder verlässt, dass es ihn nicht so hinzieht in den Schnee, der Geist ist plötzlich aus dem Körper gefahren und fährt da so seitlich mit, begleitet ihn, schaut ihm zu, wie er so matt den Hang hinunter, ob da nicht jemand gelacht hat, soeben, da hat der Freizeitskisportler doch soeben gelacht, der da so ausgehängt den Hang hinunterfährt, gleich wirft es ihn in den Schnee, es ist nur eine Frage der Zeit, dass er hinschlägt, einsinkt, verschwindet, der Schnee soll doch mal selber sagen, was los ist, tut er aber nicht, wir warten, dass er endlich mal was sagt, er sagt aber nichts, wir schieben ihm das in die Schuhe, wenn jemand hinschlägt, aber er sagt nichts, er schluckt das, er nimmt das hin, gibt nach, und niemand hätte je geglaubt, dass er nachgeben würde, er aber gab nach, international sogar gibt er nach, er ist so ununterscheidbar, nur wenigen Spezialisten spürbar, die kommen, gehen hinauf, fahren hinunter, sagen na ja, soundso, aber anders, irgendwie weicher, aber das muss man selber erfahren haben, Sie wissen schon, wovon ich rede, so reden die, schreibt Marta, hier sinkt man nicht so tief ein, sagen die Spezialisten, hier ist es schneller, alles geht glatter, kein Problem.
»Hier haben S’ Ihren Himbeergeist, dann stoßen Sie aber mit uns an, auf den Hitler!« Acht Himbeergeist, weil ich mir das Anstoßen nicht verzeihen konnte. Jetzt habe ich das alles zu Papier gebracht, ab jetzt ist Denken, Reden und Schreiben eine große Gefahr, morgen reise ich ab.
Eine kleine Tür
»Aber Alma, es geht hier doch nicht um einen Staatsempfang. Und um den Wiener Opernball auch nicht. Das ist ja eine Ausstattung für eine ganze Entourage. Hätten Sie das nicht vorher sagen können? Wir hatten das doch in allen Einzelheiten besprochen. Kein Gepäck, kein Aufsehen. Keine Gruppe bilden, nicht flüstern. Und was ist das hier?«
»Das unbedingt Nötige.«
»In zwölf Koffern?«
»In zwölf Koffern.«
Alma hatte das Nötigste in gerade mal zwölf Koffern untergebracht. Ihr sei klar, dass nicht sie das über die Berge schleppe.
»Also über die Berge geht das schon gar nicht. Als ich von Gepäck sprach, dachte ich an vielleicht einen kleinen Koffer pro Person. Was wird der Schaffner, was werden die Zöllner wohl denken, wenn ich mit zwölf Koffern alleine im Zug reise und dann kommt noch das Gepäck der anderen dazu.«
Alma kümmert das nicht. Schließlich ist sie ja nicht freiwillig hier. Und diesen Varian Fry kann sie mittlerweile auch nicht mehr ausstehen. Erst kommt das Ausreisevisum nicht, denkt Alma, wir entschlossen uns, ohne Visum zu fliehen, dann schicken die Amerikaner diesen Fry, der alles andere als zuvorkommend ist und der es auch noch fertigbringt, uns weitere vierzehn Tage warten zu lassen, ohne uns in irgendeiner Form mitzuteilen, wann er denn gedenkt, dass es losgehen solle. Hätten wir nicht auf eine Entscheidung gedrängt, wir säßen immer noch hier. Wenigstens spricht er Deutsch. Das scheint mir zur Zeit sein einziger Vorzug zu sein. Die Pralinen und die Flasche Bénédictine zur Begrüßung im Hotel Louvre & Paix nahm er natürlich gerne. Was denkt der denn? Denkt er vielleicht, dass wir jede Strapaze auf uns nehmen? Die ganze Angelegenheit ist mittlerweile eine ... was war das im Übrigen für ein vornehmes, uns so angemessenes Hotel ... Aber den Herrn Fry vom Emergency Rescue Committee, den interessiert das nicht, der will nur seinen ausgeklügelten Fluchtplan durchsetzen. Wenn alle Amerikaner so sind, dann gute Nacht.
Varian Fry schaut seinen Mitarbeiter Dick Ball an, Ball schaut die Koffer an.
»Gnädige«, unternimmt Fry einen neuen Anlauf, »könnte man nicht ...«
»Auf gar keinen Fall, mein werter Mister Fry, könnte man gar nicht, das muss alles mit. Und wissen Sie auch, warum? Weil ich es nicht schuld bin, und wissen Sie, wer es schuld ist, dass ich überhaupt hier bin und nicht in Wien, wo ich nämlich hingehöre? Die Juden sind es schuld, teurer Fry. Die Juden sind mein Schicksal. Es ist ein ewiger Kampf zwischen Christen und Juden, zwischen Jud und Christ. Die Juden haben in der Politik nichts zu suchen, da können sie gar nichts Rechtes leisten. Was aber machen die Juden? Sie sitzen an den Spitzen fast aller Länder. Bestialische Juden. So, werter Fry, dass Sie das nur wissen ...«
»Alma, ich bitte dich, du kannst uns hier nicht so bloßstellen, das geht unendlich zu weit.«
»Franz, ich würde dich doch ganz gerne bitten, dich da rauszuhalten, ohne dich wäre ich gar nicht hier, und dass dein Herr Fry sich über zwölf Koffer mokiert, wo doch die Gesamtlage eine ganz andere ist, das ist schon eine Frechheit an sich ...«
»Alma, lass ab davon, der Herr Fry versteht nicht nur jedes Wort sehr gut, ohne ihn schaffen wir es gar nicht, er ist Freund, nicht Feind.« Franz ist stark übernächtigt. Hat man nicht gestern erst hier in einem Restaurant am alten Hafen seinen fünfzigsten Geburtstag gefeiert, mit allerlei Zuprosten und Zigarren? Es kommt ihm schon wieder so lange her vor, dass er den Impuls verspürt, Heinrich Mann zu fragen, ob diese Feier denn tatsächlich stattgefunden hat. Seit Tagen verlässt ihn eine unangenehme Nervosität nicht mehr, er will diese ganzen Strapazen endlich vom Leib haben. Da fällt ihm die eine Geschichte wieder ein, dieses pompöse Abschiedsfest in Wien, das Alma und er im Juni neunzehnhundertsiebenunddreißig gegeben hatten, bevor sie aus der Villa auf der Hohen Warte ausgezogen waren. Es war allerhöchste Zeit, dort auszuziehen, träumt Werfel vor sich hin, die Ehe mit Alma schwer angeschlagen, die Villa viel zu offiziell, nicht zum Aushalten und zum Arbeiten schon gar nicht. Wenn wir da nicht ausgezogen wären, ich hätte mich von Alma getrennt. Na, vielleicht auch nicht. Aber ein tolles Fest, das war es, wenn auch ein bisschen zu aufwartend, zuviel feine Gesellschaft, aber der Ödön von Horváth war auch da und wer nicht alles von Adel und Industrie. Ich war in meinem ganzen Leben nicht so betrunken wie an diesem Abend, erinnert sich Werfel. Es lag was in der Luft, das konnte man förmlich riechen. Die Schrammelkapelle mit ihren Wiener Volksliedern gab mir den Rest, das war vor lauter Melancholie ja nicht mehr zum Aushalten. Hätte mich niemand aus dem Gartenteich rausgeholt, ich wäre ertrunken wie der von Thomas Mann verewigte kleine Herr Friedemann. Noch viel toller hatte es der Zuckmayer getrieben. Den fand Alma anderntags doch glatt in der Hundehütte. Behandelt wie ein Hund, wie’s dem Friedemann durch diese Frau von Rinnlingen geschah, ist er aber von keiner Gesellschaftsdame worden, der Zuckmayer ...
»Hörst, Manieren hat er keine, dein Herr Fry, und dass er jedes Wort versteht, das ist doch das Mindeste, oder? Mein lieber Herr Fry, wenn ich das noch ausführen darf, die Juden. Es ist doch sonnenklar, dass die verschiedenen Nationen und Länder sich das nicht gefallen lassen können?«
»Was denn, Alma, was nicht gefallen lassen können?«
»Franz, sei doch so gut, ich sagte doch bereits, die Juden haben in der Politik nichts zu suchen und sie sollten auch nicht über Politik reden, also ... ich danke dir. Eins noch, Mister Fry, eins noch, dann können Sie meine Koffer langsam einsammeln und uns den rechten Weg weisen. Es wird aus alledem eines doch ganz sonnenklar: Es wird noch ganz andre Blutbäder setzen, bevor die Welt gereinigt sein wird. Und darum bin ich, ich sage das hier ganz unmissverständlich, darum bin ich für Hitler.«
»Es reicht jetzt, Alma, die Anna hatte schon Recht, als sie dich mit einem Hakenkreuzabzeichen unterm Mantelkragen gesehen haben will.« Franz Werfel gerät außer sich. Er läuft so rot an im Gesicht, dass Heinrich ihn beiseite nimmt, er möge sich doch einmal hinsetzen und zu sich kommen, das sei eine vorübergehende Verstimmung nur, seine Gattin werde sich schon wieder beruhigen, er solle sich auf diese Bank da setzen, einen Schluck Wasser trinken, das werde schon wieder, alle seien völlig überstrapaziert, niemand könne sich beherrschen, die meisten hätten nur keine Kraft mehr, ihrer angestauten Wut freien Lauf zu lassen.
Franz hockt sich auf die Bank, trinkt einen Schluck aus der ihm von Heinrich gereichten Flasche. »Golo ist immer noch nicht da«, bemerkt Nelly. In der Tat, Golo fehlt. Golo, der immer so pünktlich ist. Golo könnte jetzt sicher schlichten.
»Ein Bahnhof wie jeder Bahnhof«, sagt Heinrich. »Gebäude sind so indifferent. Und weil das so ist, haben die Nazis eine Naziarchitektur erfunden. Damit jeder, der in einer Nazistadt sich aufhält, an jeder Ecke, an jeder Fassade sofort erkennt, ich befinde mich in Naziland. Wenn man nicht wüsste«, sagt Heinrich, »dass wir hier vor der letzten kleinen Tür stehen, nichts deutete darauf hin.«
»Die Stadt quillt über von Flüchtlingen«, sagt Franz, »diese dauernde Bewegung, das Ruhelose« ... Franz zündet eine Zigarre an, Alma stürzt herbei, baut sich mit in die Hüften gestemmten Fäusten vor ihm auf.
»Franz, wirst du bitte dieses Ding ausmachen, ja bist du denn noch ganz bei Sinnen, bekommst keine Luft, rauchst aber bei jeder nächstbesten Gelegenheit.« Franz tut einen weiteren Zug. Von Alma nimmt er keine Notiz.
»Sehen Sie das, mein lieber Herr Fry, das ist es, was ich meine, es gibt keine Verständigung zwischen den Rassen, aber wo die Liebe hinfällt, ich habe mir da auch so meine Gedanken gemacht, die Liebe kennt halt keine Rassengrenzen.«
Franz lässt die Zigarre auf den Boden fallen, sein Schuh zerschmiert die Glut. Den Kopf in die Hände gestützt, die Ellenbogen auf die Oberschenkel, schaut er der drehenden Bewegung seines Fußes zu.
»Vergessen wir nicht unseren Brecht«, tönt Heinrich.
»Brecht?«
»›Auf der Flucht vor meinen Landsleuten/Bin ich nun nach Finnland gelangt. Freunde‹ ... irgendwas mit freundlicher Aufnahme durch Unbekannte ... Der Schluss ist noch ganz präsent: ›Im Lautsprecher / Höre ich die Siegesmeldungen des Abschaums. Neugierig / Betrachte ich die Karte des Erdteils. Hoch oben in Lappland/Nach dem Nördlichen Eismeer zu/ Sehe ich noch eine kleine Tür.‹«
»Ja und?«, fragt Nelly. »Was ist daran so Besonderes?«
»Sieh an, der Schwips betört mit der Zeit auch den Verstand, meine Gute. Der Brecht ist ein Hundsfott. Siegesmeldungen des Abschaums. Ja, aber Siegesmeldungen! Der stellt es schon ganz richtig dar, die Allgegenwart der Deutschen. Natürlich durch seine Tendenz von den Füßen auf den Kopf gestellt, das Ganze.«
»Der Brecht kommt auch nach Amerika, wie man hört, liebe Alma. Vielleicht kannst du dich schon jetzt damit abfinden. Wir werden uns noch mit ganz anderen Dingen abfinden müssen.«