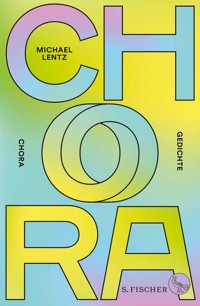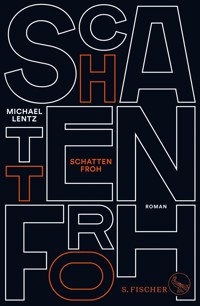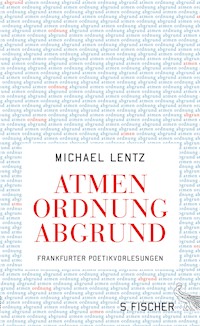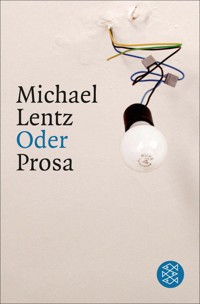19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Herbert Grönemeyer – die erste umfassende Gesamtdarstellung über den Künstler und sein Werk Zum ersten Mal sah ihn die halbe Nation in dem Film »Das Boot«. Dann kam der große Erfolg als Musiker mit »4630 Bochum«, das zusammen mit »Mensch« bis heute zu den zehn meistverkauften Musikalben in Deutschland gehört. Mit Versen wie »Gib mir mein Herz zurück / Bevor es auseinanderbricht« hat Grönemeyer deutsche Popgeschichte geschrieben. Wer aber ist dieser Herbert Grönemeyer? Wie lässt sich die Wucht und Energie, auch das Tröstliche seiner Musik erklären? Wie gelang es ihm über Jahrzehnte hinweg, sich selbst treu zu bleiben? Und warum sieht man in ihm wie bei keinem anderen Star in Deutschland einen von uns? Auf der Grundlage zahlreicher Gespräche mit dem langjährigen Freund erzählt Michael Lentz von der Herkunft und Familie des Ausnahmekünstlers und beschreibt ein faszinierendes Leben im Zeichen von Musik und Literatur, Pop und Politik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Michael Lentz
Grönemeyer
Über dieses Buch
Herbert Grönemeyer – die erste umfassende Gesamtdarstellung zu Leben und Werk
Zum ersten Mal sah ihn die halbe Nation in dem Film »Das Boot«. Dann kam der große Erfolg als Musiker mit »4630 Bochum«, das zusammen mit »Mensch« bis heute zu den zehn meistverkauften Musikalben in Deutschland gehört. Mit Versen wie »Gib mir mein Herz zurück / Bevor es auseinanderbricht« hat Grönemeyer deutsche Popgeschichte geschrieben. Wer aber ist dieser Herbert Grönemeyer? Wie lässt sich die Wucht und Energie, auch das Tröstliche seiner Musik erklären? Wie gelang es ihm über Jahrzehnte hinweg, sich selbst treu zu bleiben? Und warum sieht man in ihm wie bei keinem anderen Star in Deutschland einen von uns?
Auf der Grundlage zahlreicher Gespräche mit dem langjährigen Freund erzählt Michael Lentz von der Herkunft und Familie des Ausnahmekünstlers und beschreibt ein faszinierendes Leben im Zeichen von Musik und Literatur, Pop und Politik.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Michael Lentz, 1964 in Düren geboren, lebt in Berlin. Autor, Musiker, Herausgeber. Zuletzt erschienen: die Frankfurter Poetikvorlesungen »Atmen Ordnung Abgrund« (2013), der Roman »Schattenfroh. Ein Requiem« (2018), der Kommentar »Innehaben. Schattenfroh und die Bilder« (2020), der Gedichtband »Chora« (2023) sowie der Roman »Heimwärts« (2024), alle bei S. FISCHER. Michael Lentz wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Walter-Hasenclever-Literaturpreis.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für diese Ausgabe:
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Für alle Texte und sonstigen Inhalte von Herbert Grönemeyer: © Herbert Grönemeyer
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: TYPO nach einer Idee von BOLD
ISBN 978-3-10-491918-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
1. Herkunft und Familie
Willkommen im Ruhrgebiet
Vater und Mutter
Melancholie
Hausmusik und Chorgesang
Musikalische Selbstfindung
2. Abitur, Studium, Theater
»Bochum, ich komm aus dir«
Pina Bausch und Peter Zadek
Von Bochum nach Köln
Auf der Bühne
3. Die Welt des Films
Das Boot
»Wir müssen das noch mal machen«
Anton Corbijn
Bühnen- und Filmmusik
4. Alles oder nichts — Erste Schallplatten
Eigene Texte, eigene Musik
Selbstbestimmung und Erfolg
5. Neue Wege – Leben in England
»Der Text darf mir die Musik nicht kaputt machen«
Mensch
Englische Platten
6. Melodien
»Raushören«
Wie ein Lied oder Album entsteht
Tonart und Stimmlage
Zwei exemplarische Analysen: »Mensch« und »Roter Mond«
Eigensinn
Drum ’n’ Bass
7. Bananen und Lieder
Bananentexte
Textarbeit und Termindruck
»Wild und konzeptlos«
Die Arbeit am »Blindtext«
Aussortierte und misslungene Texte
Einsingen, letzte Änderungen
8. Zur Poetik der Songs
Wiederholung
Instantsprache und Irritation
Verständlichkeit
Reim und Rhythmus
Tonbeugungen
Lyrik und Lyrics
9. Stimme
Die Rauheit der Stimme
Live
Stimme, konkret
Makro- und Mikrointonation
Periodisierung und Zäsur, Verschlucken und Stolpern
Filter
Das Punctum der Stimme
10. Bögen
11. Auf Deutsch
12. Über die Liebe
»Ankunft und Abflug, und mittendrin wir«
Ich und Du
»Ich trage dich bei mir«
»Liebe liegt nicht in der Luft«
»Ich will zu dir«
»Bleibe mein Versprechen«
»Verlieb, verschleuder mich«
»Urverlust«
Speisen, Cruisen, Kicken
13. Pop und Politik
Ost und West
Sprache und Politik
Rechtsextremismus und Migration
Politische Positionierungen
»Die Wände tapeziert mit Krisen«
14. Streaming oder: Wie bleibt man hörbar?
Anhang
Diskographie
Dank
Vorwort
Am 16. November 1984 wird im WDR nachts live aus der Zeche Bochum der »Rockpalast« übertragen: Da war sie, diese Stimme, die seither zu den eindringlichsten Stimmen Deutschlands gehört. Mit diesem Konzert[1] und mit der LP4630 Bochum, die bereits am 11. Mai 1984 erschienen war, wurde Herbert Grönemeyer zum Popstar.
Was aber zeichnet den Popstar Herbert Grönemeyer aus? Was ist das Besondere seiner Stimme und in welchem Verhältnis steht sie zu den Melodien und Texten?[2] Wie entstehen Grönemeyers Songs vom tastenden Finden der Melodien bis hin zur Produktion des jeweils neuen Albums im Studio? Was sagen die Texte? Und was genau ist das »Geheimnis« von Grönemeyers Erfolg?
Da ist zunächst sein ganz besonderer Stil, der gerade in seinen Abweichungen von gängigen Mustern genau in dem Moment zum entscheidenden Faktor des Erfolgs wurde, als Herbert Grönemeyer entschieden hatte, seine Musik mit all ihren Bestandteilen und Begleiterscheinungen selbst in die Hand zu nehmen. Für den Erfolg zentral ist aber auch, dass Herbert Grönemeyer immer wieder das richtige Lied zur richtigen Zeit singt. Ob »Bochum«, »Bleibt alles anders«, »Mensch«, »Der Weg« oder »Stück vom Himmel« – Herbert Grönemeyer schreibt und singt Texte, die den Nerv der Zeit treffen. Und dann gibt es da noch etwas, eine Grundstimmung, die in ihren Qualitäten oft verkannt wird, einen Stil, eine Haltung, nennen wir sie: Melancholie. Man hat sie oder hat sie nicht. Herbert Grönemeyer hat sie. Sie ist eine Qualität seiner Stimme, die nicht nur für die Musik allein steht, sondern übergreifend für das Außermusikalische, den Alltag, in den die Musik trotz aller Erfolge stets integriert ist.
Vielleicht liegt in genau dieser übergreifenden Melancholie von Grönemeyers Stimme das »Geheimnis« seines Erfolgs. Für Popmusik gilt ja generell, dass sie nie nur Musik ist, sondern ein hochaufgeladener, mit dem Leben verbundener »Zusammenhang aus Bildern, Performances, (meist populärer) Musik, Texten und an reale Personen geknüpften Erzählungen«[3]. Aber in Deutschland gibt es keinen anderen Popstar, für dessen Musik »das Ineinanderübergehen von Musikalischem und Außermusikalischem, von Künstlerischem und Alltäglichem«[4] so charakteristisch ist wie für Herbert Grönemeyer. Seit Jahrzehnten wird seine Musik als tönende Lebenskunst rezipiert.
Für viele wurden die Lieder Herbert Grönemeyers zum Soundtrack der eigenen Biographie. Und daran hat sich von 4630 Bochum an mit jedem Erscheinen eines neuen Albums nichts geändert. Das Format Popmusik entsteht nun einmal »nicht in der Produktion, nicht in der Abspielstelle, sondern in der Rezeption«,[5] im Fan. Und wie die Hörerinnen und Hörer, wie die Fans sich im Lauf ihres Lebens und von Generation zu Generation verändern, so transformiert sich auch Popmusik und ihr sozialer Gebrauch. Dabei müssen die Elemente der Popmusik, also etwa »Star-Körperlichkeit, Sound, spezifische Öffentlichkeit, Intimitätsfunktion« »von allen Beteiligten immer wieder aktiv zusammengesetzt werden«.[6] Und im Akt dieses Zusammensetzens gibt es gerade bei der Musik Herbert Grönemeyers immer wieder Neues zu entdecken. Mit jedem Hören gewinnt seine Musik dazu. Sie verbraucht sich nicht und lässt zugleich eine ganz bestimmte Signatur ihrer jeweiligen Entstehungszeit erkennen.
Das vorliegende Buch unternimmt erstmals den Versuch, sich in umfassender Weise mit dem Werk Herbert Grönemeyers auseinanderzusetzen. Hierzu gehören seine Alben und seine Musik für Theater und Film. Betrachtet werden sollen aber auch seine Karriere als Schauspieler und sein politisches Engagement. Im Zentrum steht dabei stets die künstlerische Arbeit, weniger die Person. Biographisches wird vorrangig im Zusammenhang mit Grönemeyers künstlerischem Werdegang thematisiert. Dieser zeigt sich dabei als ein Prozess zunehmender Selbstbestimmung auf der Höhe zeitgenössischer musikalischer Entwicklungen. Austausch ist für diesen Prozess genauso wichtig wie Autonomie. Was ihn seit Jahrzehnten auszeichnet, sind Beharrlichkeit, Beständigkeit und Energie.
Dieses Buch basiert auf zahlreichen Gesprächen, die der Autor mit Herbert Grönemeyer geführt hat, und auf einer jahrelangen Auseinandersetzung mit seiner Musik.
1.Herkunft und Familie
Willkommen im Ruhrgebiet
»Im Grunde genommen bin ich in Bochum geboren, im Herzen des Ruhrgebiets«, versichert Herbert Grönemeyer. Wer sollte daran zweifeln? Eine Hymne auf Göttingen hat er jedenfalls nicht geschrieben. Bochum und das Ruhrgebiet haben ihn geprägt, seine Liedtexte und ihre zum Teil kürzelhaften Sprachformungen sind der künstlerische Ausdruck dieser Prägung.
Spricht man mit Herbert Grönemeyer über das Ruhrgebiet, kann es passieren, dass er zu einem mentalitätsgeschichtlich fundierten Vortrag ausholt, gekrönt von kuriosen Episoden und Anekdoten. Anschauungsreich spricht er dann vom humorvollen und stolzen Menschenschlag und einer Arbeiterkultur, die jeden Tag einem ungeheuren Druck ausgesetzt war und ist. Im Ruhrgebiet werde man mit einem selbstverständlichen Stolz groß, den auch das Bewusstsein darüber nicht anficht, dass diese Gegend immer leicht belächelt werde. Für den einen oder anderen Mentalitätswitz gut, werde diese Region ansonsten nicht wirklich wahrgenommen.
Der Bergbau war für die Region von existenzieller Bedeutung und zugleich ein Risiko für die Gesundheit und das Leben der Kumpel. Das Bewusstsein, harter Arbeit bei permanentem Risiko ausgesetzt zu sein, ist einem schon als Kind gegenwärtig gewesen und hat einen bei allem begleitet, was man erlebte. Der selbst wieder volksliedhaft gewordene Refrain »Bochum, ich komm aus dir / Bochum, ich häng an dir / Glück auf, Bochum!« bringt mit dem zitierten Bergmannsgruß eine stolze Verbundenheit, aber auch Abhängigkeit zum Ausdruck: Bezieht man das »Ich« des Liedes nicht nur auf Herbert Grönemeyer, sondern auch auf die Bergmänner, bekommen die Wendungen »ich komm aus dir« und »ich häng an dir« im Hinblick auf den im Lied besungenen Bergbaukontext (»Pulsschlag aus Stahl«, »Grubengold«, »hochgeholt«) eine spezifische metaphorische Färbung gefährdeter Existenz.
Im Ruhrgebiet mischten sich zwei Kulturen problemlos, so Herbert Grönemeyer, die polnische und die westfälische. Die Folge sei der schon fast dadaistische Humor gewesen, die relativ undeutsche Selbstironie, der Hang zu alberner Schwermut und in Feierlaune eine Art sizilianische Lebensfreude.
Zusammen mit London weist der Ballungsraum Ruhrgebiet auf europäischer Ebene die regional größte Bevölkerungsdichte auf, doch was weiß man, vom Fußball einmal abgesehen, wirklich über das Ruhrgebiet? Das Ruhrgebiet, so Herbert Grönemeyer, ist unbekannt. Es war Garant für das deutsche Wirtschaftswunder und ist auch heute noch, bei allem wirtschaftlichen Strukturwandel, von großer kultureller Bedeutung.
Die Unbekanntheit des Ruhrgebiets liegt für Herbert Grönemeyer zum einen an der alle Differenzierungen einkassierenden Kohle, zum anderen an der Selbstgenügsamkeit der Menschen, die keiner Imagepolitur und keiner gesteigerten Öffentlichkeitsarbeit bedürften. Sein Vater zum Beispiel sei mit sich selbst gut klargekommen, er sei kein Protzer gewesen, und dieses zurückhaltende, menschenfreundliche Selbstbewusstsein habe auch in der Sprache seinen Ausdruck gefunden.
Was das Image betrifft, das den Menschen aus dem Ruhrgebiet voranläuft, hat Herbert Grönemeyer verschiedentlich seine eigenen Erfahrungen gemacht: Anna Henkel, seine erste Frau, kam aus Hamburg, 1979 spielten beide in dem Film Uns reicht das nicht von Jürgen Flimm, bei den Dreharbeiten wurden sie einander vorgestellt oder stellten sich selbst gegenseitig vor, und die ganze Mimik und Gestik seiner zukünftigen Frau verriet, dass er für sie eine Art Alien, ein Exot, etwas völlig Fremdes war: aus dem Ruhrgebiet, das sagte zunächst einmal alles.
Der französische Film Willkommen bei den Sch’tis könnte in Deutschland im Ruhrgebiet gedreht werden, in das zum Beispiel jemand aus Hamburg »strafversetzt« wird. Den Menschen aus dem Ruhrgebiet haftet das Klischee an, jeden Tag dreimal ihre Wäsche zu waschen; eine Sisyphusarbeit, wird die Wäsche, wenn sie draußen hängt, doch abends schwarz wieder reingeholt. Mit solchen zum Teil abstrusen Vorurteilen sei man im Ruhrgebiet im Allgemeinen aber klargekommen, sagt Herbert Grönemeyer, man habe nicht darunter gelitten. Vielleicht resultiere aus dieser mentalen Disposition auch die Solidarität und innere Verbundenheit mit den Menschen aus den neuen Bundesländern, die er sich einbilde immer verstanden zu haben, sei ihnen doch, gelinde gesagt, oftmals Desinteresse entgegengeschlagen, zum Teil bis heute.
»Mit diesem Desinteresse konnten wir uns zu Hause gut arrangieren, zumal wir, recht untypisch für die deutsche Mentalität, auch Selbstironie pflegten. Über uns sich lustig machen können wir schon selbst. Du kommst ins Ruhrgebiet und fragst, ›Wie geht es denn hier zur Querenburger Straße?‹, und erhältst eine Gegenfrage zur Antwort: ›Wat willst du da denn?‹ Als Fremder muss man sich hier fast schon ›britisch‹ wappnen, man begegnet dir hier nicht berlinerisch flapsig, sondern mit einer Vorurteile vorwegnehmend auskonternden Art«, erzählt Herbert Grönemeyer. Sei man der Möglichkeit einer solchen Situation und Kommunikation nicht gewahr und reagiere auf die unpräzise Wegbeschreibung indigniert mit dem Spruch: »Du kommst aber recht bescheuert rüber hier«, müsse man bei dem solchermaßen zu höflicheren Umgangsformen Angehaltenen damit rechnen, dass er die Kritik als Kompliment verstehe.
Der Humor des Ruhrgebiets ist schnell, verspielt und hintergründig, zuweilen auch bloß albern. Künstler wie Helge Schneider, Hape Kerkeling oder Bastian Pastewka sind, je auf ihre Art, Repräsentanten dieser Art von Komik. Das ist ein eigenes Label: Ruhrgebietskultkomik. »Je härter die Arbeitswelt, desto schneller, leichter, alberner der Humor. Flink im Kopf sein, auf den Punkt kommen, das sind die prägenden Grundtugenden im Ruhrgebiet«, sagt Herbert Grönemeyer.
Die Kürzelsprache, aus der Herbert Grönemeyers Liedtexte zum Teil bestehen, hat mit den sprachlichen und mentalen Eigenheiten des Ruhrgebiets zu tun. Und auch die kulturelle Vielfalt – das Ruhrgebiet als »Vielvölkerstaat« – findet in seinen Texten einen Hallraum.
»Ich bin zu einer Zeit groß geworden«, sagt Herbert Grönemeyer, »als Menschen aus ganz Europa ins Ruhrgebiet kamen, Türken, Italiener, Spanier, Jugoslawen, Polen, Franzosen. Dass wir mit so vielen Kulturen zusammenlebten, empfanden wir als Auszeichnung. Wir waren schlicht und ergreifend beeindruckt, dass diese Menschen überhaupt ins Ruhrgebiet kamen und hier mit uns zusammenleben wollten. Aus diesem Zusammenleben ist eine eigenständige, für die Region typisch gewordene Kulturgemeinschaft entstanden, mit einem Zusammengehörigkeitsgefühl wie bei einer international besetzten Fußballmannschaft. Fortan hatte das Ruhrgebiet viele Namen, Namen wie Szymaniak, Grzyb, Tucholsky oder Kuczewski. Wir dachten nicht darüber nach, wo jemand herkommt und warum er so heißt. Wer hier hingekommen war und hier lebte und arbeitete, gehörte dazu. Das Ruhrgebiet hatte mit die meisten Kneipen in Europa, jeder Fußballverein hatte eine Kneipe, da kamen keine Berührungsängste auf. Man sagte auch, wenn Schalke 04 in Warschau spielt, brauchen Mannschaft und Fans keine Hotels, die wohnen alle bei ›de‹ Verwandten.« Die polnischen Einwanderer hätten den Humor mitgebracht, und dieser Import habe den Unterschied zwischen Ostwestfalen und Westwestfalen begründet: »Die Ostwestfalen haben diesen Einfluss nicht, sie sind wesentlich trockener, während er im Ruhrgebiet zu einer starken Vitalisierung beitrug.«
Das Internationale war in Herbert Grönemeyers Familie schon angelegt. Seine Mutter wurde in Tallinn, der Hauptstadt Estlands, geboren. Vorfahren mütterlicherseits waren Russen, es wurden russische Romane gelesen und auch russische Lieder gesungen. Zu Hause habe man nicht darüber nachgedacht, ob jemand, der im Ruhrgebiet lebe, Türke, Pole, Jugoslawe oder zum Beispiel Spanier sei: »Für uns waren alle schlicht und ergreifend Ruhrgebietsmenschen. Deshalb sind mir auch die Debatten, die über deutsch und nicht deutsch, über einheimisch und nicht einheimisch geführt werden, völlig fremd. Wo liegt das Problem?«
»Das Ruhrgebiet in mir verliert sich nicht«, sagt Herbert Grönemeyer. Sein enger Bezug zum Ruhrgebiet zeige sich zum Beispiel daran, dass zwei Tage Anwesenheit den Umstand, dass er nun schon mehr als vierzig Jahre nicht mehr dort lebe, aufwiegen könnten, die Basis frische sich sofort wieder auf. Diktion und Denkart, Formulierungs- und Erklärungsweise von Sachverhalten seien ihm immer noch eigen, auch wenn er zwischenzeitlich in verschiedenen Städten und Ländern gelebt habe.
Sich selbst immer wieder zu relativieren und alles zunächst einmal auf den Prüfstand zu stellen, nichts vorschnell hinzunehmen, sind für Herbert Grönemeyer Charaktereigenschaften, die mit dem Ruhrgebiet zu tun haben. Oberflächlichkeit ist die Sache des Ruhrgebietlers nicht, er ist ziemlich basisorientiert. Die Ansprache ist direkt und klar. Gelegentliche scheinbare Verunklarungen sind Programm.
»Sprache ist im Ruhrgebiet eher Signalgebung und Brückenschlag als Akrobatik oder Kunst«, so Herbert Grönemeyer am 31. Oktober 2012 in seiner Leipziger Poetikvorlesung. Und weiter: »Hier wurde sie auf das Knappste und Wesentliche reduziert und diente als Morsealphabet zwischen Deutschen und Polen. Die Polen kamen Ende des 19. Jahrhunderts an die Ruhr, um den Anwohnern zu zeigen, wie die Kohle aus der Wand kommt, und das nach dem modernsten polnischen Prinzip, da man im Westen doch noch eher fassungslos vor der schwarzen Wand stand und es zaghaft mit dem Hammer probierte. Zur Verständigung reichten kurze, schroffe Sätze, um auch auf Gefahrensituationen aufmerksam machen zu können oder sich zu Hilfe zu kommen. Wenn man sich aufeinander verlassen muss, weil man aufeinander angewiesen ist, versteht man sich auch wortlos.
Wer einmal 1000 Meter tief unter der Erde gewesen ist – ich war mal auf der zehnten Sohle –, der weiß, dass, wenn man dort seinen Tag verbracht hat, es einem erst einmal die Sprache verschlägt und einem zu allem zumute ist, aber nicht zum Reden. Das Einzige, wonach einem noch der Sinn steht, ist vielleicht, auf seinen Dachboden zu steigen und dort stumme Zwiesprache mit seinen weißen Tauben zu halten, die einen so schönen Gegensatz zur schwarzen Kohle bilden. Aus dieser der Entspannung dienenden Freizeitbeschäftigung ist die Kultur der das Ruhrgebiet prägenden und weithin bekannten Taubenzucht- und Brieftaubenvereine entstanden. Aus dem Ruhrgebiet stammen die besten Taubenzüchter der Welt.
Meine Kindheit war also geprägt von klaren, schnörkellosen Worten, die keine Zeit und keinen Platz hatten, sich zu verkleiden und mehr zu scheinen, als sie sind.«
Vater und Mutter
Die »merkwürdige« bürgerliche Atmosphäre zu Hause hat Herbert Grönemeyer als etwas Besonderes erlebt, auch als Kontrast zum Malocher-Milieu. Hier herrschten heterogene kulturelle Einflüsse, gut- und bildungsbürgerliche Verständigung war angesagt. Nach seiner Herkunft befragt, müsse er in verschiedene Richtungen zeigen, sagt Herbert Grönemeyer.
Für die eigene Identitätsfindung erfüllt die Familie einen doppelten Zweck: Sie ist Vorbild, in der Familiengenealogie ausgeprägte Muster nehmen einem zunächst Entscheidungen ab, Vorgegebenes wird unreflektiert hingenommen, man identifiziert sich sogar damit, die Eltern wie auch die älteren Geschwister haben bis zu einem gewissen Grad Vorbildfunktion, an ihnen richtet man mehr oder weniger bewusst sein Leben, das Heranwachsen aus, bis man die Notwendigkeit von Differenzierungen verspürt. Abgrenzungsbewegungen setzen ein, die sich auch in Form von Eigensinnigkeiten äußern. Herbert Grönemeyer hat diesen Prozess bei sich zu Hause sehr bewusst erlebt. Zu etwas Eigenem zu kommen, seine eigene Identität auszubilden und dabei eine gewisse Willenssturheit zu entwickeln, ließ ihn die Musik entdecken, mit der er schon in seiner Kindheit insbesondere durch seine Mutter in Berührung gekommen war, die »sehr zart und melancholisch« Gitarre, Altblockflöte und Klavier gespielt und gesungen hat. Seine Mutter war die Musische, sein Vater war promovierter Bergbauingenieur, der gerne auch schon mal morgens im Garten in der Turnhose lauthals Heine, Goethe oder Rilke zitierte, erinnert sich Herbert Grönemeyer, dessen Vater seinen eigenen Vater, der Bergwerksdirektor war, im Alter von vier Jahren verloren hatte. Der Großvater musste eines Tages wegen eines Gashahnbruchs in die Grube, er stieg hinab und war sofort tot – er starb vor den Augen seines Sohnes. In Stalingrad hat Herbert Grönemeyers Vater seinen rechten Arm verloren – die Wendung »einarmiger Bandit« in seinem Lied »Blick zurück« aus dem Album Mensch spielt darauf an. Trotz aller Schicksalsschläge war er Herbert Grönemeyer zufolge aber ein Mensch, der das Leben frohgemut genossen hat:
Einarmiger Bandit
Der Hoffnung gibt, Tragik stiehlt
Macht den Herbst zu, es zieht
80 Kalender lang, 80 Kalender lang
Du bist das Beispiel für Zufriedenheit
Eigentlich eine Bezeichnung für einen Glücksspielautomaten, ist »Einarmiger Bandit« hier im Gegensatz zu dem das Geld aus den Taschen ziehenden Automaten positiv besetzt im Sinne eines liebevoll gedachten Kosenamens.
Das Empfinden von Glück habe er von seinem Vater geerbt, sagt Herbert Grönemeyer, als Kind sei er eine sogenannte Frohnatur gewesen. Sein Vater sei der Belesene gewesen, der Bücherverschlinger, stark calvinistisch geprägt, ein lebenslustiger, aber auch selbstkritischer und selbstironischer Mensch. Er habe gerne deklamiert und spielte damals auch mit dem Gedanken, Pfarrer zu werden, liebte neben Gedichten und Prosa vor allem das Gespräch und ging als Linksliberaler keiner politischen Auseinandersetzung aus dem Weg.
Sein Vater sei ein selbst erklärter Humanist gewesen, er habe die Menschen geliebt, seine Freunde, seine Familie und das Essen, Trinken, Rauchen und Lachen. Man hätte das Gefühl gehabt, er »beiße« täglich aufs Neue freudigst in sein Leben hinein, so entzückt sei er gewesen, dass er existierte. »Kinder, ist das nicht wieder herrlich«, kam sehr oft aus seinem Mund. Sein Lieblingssatz lautete: »Dass ein Mann allein so schön sein kann, ist an sich unfair«, erzählt Herbert Grönemeyer. Und über die eigene und die Mentalität der Westfalen habe er eine klare Meinung gehabt: »Wir sind schlicht, aber sehr ergreifend.«
Das Wichtigste im Leben seien die Freunde, so der Vater. Erfolg, Geld, Anerkennung würden irgendwann ihren Stellenwert verlieren, und Familien hätten ihre eigene Qualität und Funktion, würden aber in komplexen Momenten oft nicht so sehr wie enge Freunde helfen, sie gäben einem einen anderen Halt, nicht die gleiche Ruhe, sie liehen einem nicht das gleiche Ohr. Der Vater habe ihm, so Herbert Grönemeyer ein Grundvertrauen mitgegeben, von dem er noch heute zehre.
Goethes Faust spielte im Leben des Vaters – und noch danach – eine besondere Rolle. Als Herbert Grönemeyer 2015 die Theatermusik zum Faust in der Inszenierung von Robert Wilson schrieb, hatte er diesbezüglich einen Termin beim Radio. »Ich möchte Ihnen ein Geschenk machen«, sagte ihm der Rundfunkchef bei der Gelegenheit und bat ihn in sein Zimmer. Er legte ihm einen Briefumschlag vor und zog ein altes Buch heraus: den Faust. »Das ist sehr nett von Ihnen, das ist sehr geschmackvoll«, dankte der Sänger. »Machen Sie es einmal auf«, bat der Rundfunkchef. Es fand sich ein Foto von seinem Vater darin, ein Passfoto, und links auf dem Vorsatzblatt stand »In freudiger Erinnerung an unsere schönen Tage 1945«. 1945 war sein Vater 29 Jahre alt. Er hat den Faust seiner damaligen Geliebten geschenkt, die 2015 in Berlin lebte, sie wollte Herbert Grönemeyer das Buch zukommen lassen und dachte, es ihrem Schwiegersohn, der beim Sender arbeitete, mitzugeben, sei ein guter Weg, dass das Buch ihn auch findet; von seiner Bühnenmusik zum Faust, die er zur selben Zeit schrieb, wusste sie nichts. Das unverhoffte Geschenk weckte Erinnerungen: »Ich sah meinen Vater vor mir, wie er im Garten oder im Haus steht und Goethe zitiert«, erzählt Herbert Grönemeyer. »Er kannte den ganzen Faust auswendig, so schien es: ›Ihr glücklichen Augen, / Was je ihr gesehn, / Es sei wie es wolle, / Es war doch so schön!‹ – ›Ja, Vater, ist ja gut‹, hörte ich mich sagen, ›mach mal langsam, ist in Ordnung.‹ Aber er liebte das, er liebte Sprache, und wir Brüder haben uns darüber lustig gemacht. Wir sind zu Hause intellektuell erzogen worden, und dennoch hatte es etwas Skurriles, ihn, den Bergbauingenieur, lauthals Goethe oder Rilke rezitieren zu hören, für uns waren das alles fremde Namen, wir wussten nicht genau, was das Ganze soll. Auch hat er uns am Abend kleine Gedichte vorgetragen, anstatt ihm zuzuhören, machten wir drei Brüder uns darüber lustig, insgeheim aber waren wir auch stolz auf unseren Vater, der mit seiner laut werdenden Liebe zur Literatur ein bisschen aus der Rolle fiel.«
Seine Mutter sei demgegenüber, so Herbert Grönemeyer, ziemlich abgeklärt und alles andere als sentimental gewesen. Ihren 75. Geburtstag habe sie nicht zum Anlass genommen, die schöne gemeinsame Zeit mit ihrem Mann zu würdigen – die Kinder habe sie gar nicht erwähnt –, das Einzige, was ihr einen Kommentar wert gewesen sei, sei ihr Unverständnis darüber gewesen, wie ein Mensch, sie meinte den Vater, nur so fröhlich sein könne.
Neben Deutsch habe seine Mutter auch Estnisch gesprochen, »eine helle, dem Finnischen sehr ähnliche Sprache, die wie Singsang klingt«. »Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme« – das ist von eins bis zehn gezählt. Estnisch habe seine Mutter zum Beispiel gesprochen, wenn sie in ihren oft Stunden dauernden Telefonaten mit ihren Schwestern wollte, dass die Kinder oder ihr Mann nichts verstehen, aber auch, um sich im für Balten leicht unwirklich wirkenden Bochum etwas Heimatgefühl zu erhalten. Sie habe ein wenig in der Vergangenheit gelebt, eher baltische und russische Literatur gelesen und nur schwer verkraftet, dass sie mit vierzehn Reval verlassen und »heim ins Reich« musste. So sei das Estnische ein ganz starker Halt und Erinnerung gewesen.
Herbert Grönemeyers Mutter kam aus einer baltischen Adelsfamilie, erzählte von ihrem Gut, außerdem, dass ihre Großtante Monika Hunnius Schriftstellerin war und sie selber irgendwie mit Hermann Hesse verwandt sei, der ihr auch zur Hochzeit gratuliert hatte. Den Kindern habe sie viel vorgelesen, sie blieb ihnen mit ihrer Vergangenheit, Welt und Geschichte lange Zeit jedoch fremd.
Die Mutter sei eher der stillere Teil seiner Eltern gewesen. In ihren Gesprächen sei selten ein scharfes Wort gefallen. Soweit er sich erinnern könne, hätten die Eltern auch mit ihren Freunden ein nicht gestelztes, aber dennoch ein eher konservatives, gepflegtes Verhältnis zur Sprache gehabt. Erst nach Alkoholeinnahme sei es »ein wenig westfälisch« geworden.
Es sei auch eher sein Vater mit seiner enorm praktizierten Leselust gewesen, der die Brüder »packte und beeindruckte«, so Herbert Grönemeyer. Sein Vater und sein Onkel waren die Ersten, die studieren durften aus seiner westfälisch-niedersächsischen Bauernfamilie. Mit Heinrich Heine, Graham Greene, Henry Miller, Jean Genet, Thomas Mann, Golo Mann, Klaus Mann, Heinrich Mann, Franz Kafka, Friedrich Nietzsche und vielen Biographien, zum Beispiel über Edith Piaf oder Helmut Schmidt, war seine Bücherwand gespickt. Das hatte Vorbildfunktion, sagt Herbert Grönemeyer: »Vielleicht kam von da der Druck, den ich mir selbst mache, oder dass ich mir zumindest Mühe gebe. Es ist auch eher die Wucht, das Ingenieurhafte meines Vaters, das mich beim Texten treibt. Mein Vater sagte über sich: ›Ich bin hart, aber ungerecht‹ – er zeigte mir, dass Anstrengung und eine gewisse Unnachgiebigkeit sich selbst gegenüber unabdingbar sind, wenn man ein Ziel vor Augen hat.«
Zwischen diesen beiden elterlichen Positionen des Zielstrebig-Fröhlichen und des Abgeklärt-Sentimentalen sind Herbert Grönemeyer und seine beiden Brüder groß geworden. Vielleicht resultiere auch daher die gelegentliche Melancholie. Die Melancholie, die einen aus heiterem Himmel überfallen kann, so dass man von einem Moment auf den anderen abtaucht, hat etwas Stärkendes, Kräftigendes, wenn man sie annimmt, sie durchquert und nicht in ihr verharrt. »Ich betrachte die Melancholie als ein Zimmer, das man betreten kann, man lässt die Tür offen und kann auch immer wieder rausgehen«, sagt Herbert Grönemeyer. Hört man die fröhlichen, aufmunternden Lieder Herbert Grönemeyers, merkt man auch ihnen einen Hauch von Melancholie an, die aus dem Bewusstsein darüber resultiert, dass alles, auch das Glück, einmal endet.
Melancholie
Melancholie kann hinreißend sein im doppelten Sinne des Wortes. Den Melancholiker befällt sie, den Leser und Hörer rührt sie. Die Mutter und die Tanten haben den Brüdern abends, wenn sie im Bett lagen, dreistimmig deutsche, auch estnische und russische Schlaflieder vorgesungen. Dreistimmig eröffnete sich eine imaginäre Landschaft, die die Phantasie entzündete und einen Zustand des Schwebens und der Wärme auslöste. Infolge des Krieges waren die Männer, Herbert Grönemeyers Onkel, fast alle nicht mehr da. Die Tanten hießen Tante Adi, Tante Willa, Tante Lucy, Tante Marga, Tante Sisi, Tante Thedi und Tante Tibbu. Neben dem Singen hatten sie gemeinsam, dass sie einen Dutt auf dem Kopf trugen. Es gab auch einen Onkel Paki. Die estnisch-russische Wehmut, die im Gesang der Tanten lag, zeugte vom Verlust ihrer Heimat, in der sie nicht mehr leben durften und konnten. Ihre Heimat war die Sprache geworden und das Lied, mit dem sie diesen Verlust zum Ausdruck brachten. Herbert Grönemeyer erinnert sich an die für ihn unvorstellbare Ruhe, die sie ausstrahlten. Mit Zeit hätten die Tanten gar kein Problem gehabt, sie hätten dagesessen und einem ihre Lieder vorgesungen, eins nach dem anderen. Sehr früh hat sich ihm eingeprägt, dass Musik die Funktion haben kann loszulassen, indem sie Verlust und Schmerz benennt und ihnen eine Atmosphäre verleiht.
Mit dem songbookgestützten Nachspielen der ersten drei Platten von Leonard Cohen machte Herbert Grönemeyer sehr früh die Erfahrung, dass es einem, ist man durch dieses Tauchbad der Melancholie gegangen, besser geht. Und dass es zuweilen guttut, dieses Bad zu inszenieren, auch wenn man gar nicht in melancholischer Stimmung ist.
Der Vorgang des Singens habe den wunderbaren Nebeneffekt, dem Singenden bewusst zu machen, dass er oder sie – wie die meisten von uns – flach atme, und das sei, so Herbert Grönemeyer, falsch. Flaches Atmen habe seinen Grund nicht zuletzt in dem Dauerstress, dem wir uns tagtäglich mehr oder weniger bewusst aussetzten, um den tatsächlichen oder vermeintlichen Anforderungen des Alltags gerecht zu werden. Musik machen ist ein starkes Antidot gegen Stress, eine Art Ruhe verschaffende Meditation.
Seit Jahrzehnten versucht Herbert Grönemeyer, regelmäßig zwei oder mehr Stunden zu singen, und begleitet sich dabei am Klavier. »Das reguliert das Atmen, entspannt, macht zufrieden und bringt mich mir näher«, sagt er. Das dem Singen adäquate Atmen geschieht sprichwörtlich aus dem Bauch heraus, eine Technik, die unabdingbar ist für ein Konzert. Beim tiefen Atmen setzt die Lunge erst ein, wenn der als Blasebalg fungierende Bauch sein Volumen verbraucht hat. Habe man zwei Stunden im Chor gesungen, gehe es einem richtig gut, vorrangig aber nicht, weil man mit netten Leuten zusammen gewesen sei, sondern weil man besser geatmet habe.
Seine Tanten teilten ihre Exilerfahrung und den Heimatverlust mit der in Berlin geborenen und nach New York emigrierten Dichterin Mascha Kaléko, die in vielen ihrer Gedichte, von Amerika aus, wehmütig ihren Heimatverlust in Sprache setzte. Ihre Gedichte scheinen oft liedartig schlicht und gehen ans Herz, in ihnen arbeiten die Zeitgeschichte und eine Art (psycho)geographisches Parallelbewusstsein, dessen Synthese den Lesern überlassen bleibt. Betrachtet man die Zeilen genauer, entdeckt man die kunstvolle Komplexität der Gedichte, den Reichtum ihrer Reime:
Sozusagen ein Mailied
Manchmal, mitten in jenen Nächten,
Die ein jeglicher von uns kennt,
Wartend auf den Schlaf des Gerechten,
Wie man ihn seltsamerweise nennt,
Denke ich an den Rhein und die Elbe,
Und kleiner, aber meiner, die Spree.
Und immer wieder ist es dasselbe:
Das Denken tut verteufelt weh.
Manchmal, mitten im freien Manhattan,
Unterwegs auf der Jagd nach dem Glück,
Hör ich auf einmal das Rasseln der Ketten.
Und das bringt mich wieder auf Preußen zurück.
Ob dort die Vögel zu singen wagen?
Gibt’s das noch: Werder im Blütenschnee …
Wie mag die Havel das alles ertragen,
Und was sagt der alte Grunewaldsee?
Manchmal, angesichts neuer Bekanntschaft
Mit üppiger Flora – glad to see –,
Sehnt sichs in mir nach magerer Landschaft,
Sandiger Kiefer, weißnichtwie.
Was wissen Primeln und Geranien
Von Rassenkunde und Medizin …
Ob Ecke Uhland die Kastanien
Wohl blühn?[1]
Melancholie ist eine Essenz, die Herbert Grönemeyers Liedtexte mit den Gedichten von Mascha Kaléko verbindet. Sie gehört zu den Dichterinnen des 20. Jahrhunderts, die er am meisten schätzt. Ihr klarer, die Dinge beim Namen nennender Stil transportiert einen Subtext der Trauer, aber auch der ironischen Willensbehauptung, welche die beeindruckende Leichtigkeit der lyrischen Textur existenziell grundieren.
Hausmusik und Chorgesang
Als vom Krieg geprägtes Duo hätten seine Eltern, so Herbert Grönemeyer sich gut ergänzt. Es sei ihre Überzeugung gewesen, dass die Kinder eine klare Strenge brauchen. Gleichzeitig aber hätten seine Eltern versucht, ein dem Leben aufgeschlossenes, buntes, kulinarisches, künstlerisches Zuhause zu schaffen. Die Familie hatte viel Besuch von Freunden und Verwandten. Allein die Tanten waren so zahlreich, dass Herbert Grönemeyer keinen genauen Überblick hatte. Sein Vater hatte im Krieg und in seiner Studienzeit viele Freundschaften geschlossen, an manchen Tagen war das Haus dann voller für ihn unbekannter Leute, was es sehr lebendig machte. Noch heute erinnert sich Herbert Grönemeyer an einen kleinen Rolltisch in der Küche, der höchstens für zwei Personen Platz bot, damals saßen der Vater und die drei Brüder daran, die Mutter stand meistens, zumindest morgens. Saßen der Vater und die drei Brüder also jeden Morgen an diesem kleinen Rolltisch (der Vater war eine ziemlich imposante Person, nicht dick, aber kompakt), musste jeder seinen Platz behaupten, von dem jedem nicht eben viel zur Verfügung stand. In Ruhe in seiner Tasse zu rühren und sich ganz dem Marmeladenbrot zu widmen, war nicht möglich, es ging nämlich gleich zur Sache, und das hieß, Vater gab die Order für den Tag aus, schließlich kam er erst am Abend wieder, und da wollte er sichergehen, dass alles seine Ordnung hatte. Der familienberühmte Leitspruch des Vaters lautete: »Ich hatte das große Glück in meinem Leben, morgens immer gehen zu können.« Immerhin hatte er sich durch seine morgendlichen Küchenrolltischgespräche einen Zugriff auf die Tagesplanung gesichert, was ihm wohl das gute Gefühl gab, das Haus ohne Sorgen verlassen zu können. Von der Familie hat er dann bis zum Abend nichts mehr mitbekommen.
Schimpfworte wurden nie benutzt, den Söhnen wurde sehr schnell das berühmte Ruhrgebiets-Ey, wie in »Hömma ey« oder »Es war gestern tierisch in der Stadt, ey«, ausgetrieben, es wurde früh auf eine gutbürgerliche Erziehung mit kulturellen Schwerpunkten Wert gelegt. Im Urlaub saß die Familie oft im Kreis, jeder in ein Buch vertieft. Wer hat die meisten Karl Mays gelesen? Herbert Grönemeyer kam, soweit er sich erinnern kann, auf dreiundfünfzig, den Rekord hielt aber seine Mutter, die mehr als sechzig seiner Bücher gelesen hatte, sie kannte sogar noch Der Peitschenmüller und Der Wurzelsepp. Ob diese beiden in den bayerischen Bergen spielenden Romane, zu deren Akteuren auch der sagenumwobene König Ludwig II. gehört, noch zu Karl Mays relevanten Büchern zu rechnen waren, war in der Familie lange strittig.
Es wurde jedenfalls »viel geredet, laut und durcheinander, es wurde heftig diskutiert, politisiert, argumentiert, behauptet, gezetert und sich echauffiert«, so Herbert Grönemeyer: »Es war, ganz 68er-like, mit meinen beiden älteren KBW- oder KPDML-affinen Brüdern Wilhelm und Dietrich gut was los.« War sein Urgroßvater mütterlicherseits mit der Peitsche Erzieher der Kadetten am preußischen Hof gewesen, so verkörperte seine Mutter eher die sich sorgende, kümmernde, nüchterne, für die Erziehung und die musikalische Entwicklung zuständige, liebevoll strenge Person.
Wurde in der Innenwelt der Familie also ausgiebig geredet, konnte sich Herbert Grönemeyer in der trockenen, herzlich knappen Sprache der Außenwelt wieder erholen. Die wahre Kommunikationskunst bestand in der umstandslosen Vermischung unterschiedlicher Kategorien, wie in der Aufforderung »Geh mal beim Opa«. Zeitsparend werden hier »zu« und »bei« zu einem Wort verschmolzen. Man geht hin und ist gleichzeitig auch schon da. Der Satz ist verständlich, und man hat einen zweiten Satz gespart, genauso wie bei dem Klassiker »Ich geh auf Schalke«. »Ich geh« zeigt die Richtung an, und mit »auf Schalke« ist man bereits da. Die auf diese sprachökonomische Weise gewonnene Zeit kann man dann mit erholsamem Schweigen verbringen.
Aus diesem Grund steht Herbert Grönemeyer dem Schreiben von SMS spielerisch gegenüber, weil sie eine solche Verkürzung unterstützen können. Deshalb: »Das Leben ist zu kurz und auch zu hart, um Zeit mit zu vielen Worten zu verschwenden. ›Sach, wat Sache is, und mach schnell.‹«
Herbert Grönemeyer war das Nesthäkchen, er wurde nicht so streng angefasst wie seine Brüder, verwöhnt wurde er genauso wenig wie sie. Als Jüngster in seiner Familie war er eher zurückgezogen still, weil er bei den lauten Disputen zwischen seinen Eltern und den älteren Brüdern selten und dann nicht so ausführlich zu Wort kam. Dadurch habe er wohl im Singen seine Chance gesehen, sich hörbar zu machen. Mit sechs Jahren bereits bekam er eine Ukulele, eine viersaitige Kleingitarre, auf der er mit größtmöglicher Ausdauer »rumschrubbte«, begleitet von seiner schon damals selbstbewusst ertönenden Stimme. Mit acht folgten Wandergitarre und Klavier.
Das Beispiel seiner Brüder vor Augen, die ihre Erziehungsstationen vor ihm durchliefen, beschreibt sich Herbert Grönemeyer als »relativ unkompliziert«. Die Verhaltensmuster von Dietrich und Wilhelm seien komplexer gewesen, sie hätten eine bewundernswerte Dynamik gehabt, als Ältere gaben sie die Richtung vor, auch was später das Studium und das politische Denken anging. Sie hatten lange Haare und Hüfthosen. Die Geschwister taillierten sich die Hemden selbst, indem sie sie mit Papphalbmonden abnähten, und machten sich die Hosen kürzer. Das Verständnis untereinander sei ziemlich gut gewesen, was auch am relativ geringen Altersabstand von jeweils etwa zwei beziehungsweise vier Jahren lag.
Es war also sehr lebendig zu Hause. Die Eltern verstanden sich und sind viel verreist. Auf die drei Söhne passte dann eine Tante oder ein Onkel auf, manchmal auch zwei Tanten gleichzeitig, mit Dackel. Das habe stets wunderbar funktioniert. Die Tanten und Onkel brachten viel eigenen Witz mit. Es gab dann noch ein Pfarrerehepaar, das in Bochum Theologie studierte, das ebenfalls auf die Brüder aufpasste. Wie auch immer die familiäre Konstellation gerade war, die drei Brüder waren zusammen und spielten miteinander.
Seit 1958, Herbert Grönemeyer war zwei Jahre alt, fuhr die Familie jede Ferien an die niederländische Südküste, nach Walcheren, der südlichsten Halbinsel, wo die Eltern ein kleines Haus besaßen, das noch heute im Besitz der Brüder ist. Mit diesen Reisen schloss sich die Familie der Gewohnheit des Ruhrgebiets an, das, so schien es, geschlossen den Jahresurlaub in den Niederlanden zu verbringen pflegte. Das Häuschen ist Teil eines Bungalowparks, den Deutsche und Niederländer gleichermaßen bewohnten, ein außergewöhnlicher Umstand angesichts der deutschen Kriegsgräuel, die noch nicht lange her waren.
Da sein Vater als Zweitsprache hervorragend Münsteraner Platt sprach, das dem Niederländischen sehr ähnlich ist, konnte er sich mit den Leuten unterhalten und damals sogar schon Freundschaften schließen. Herbert Grönemeyer beeindruckte das, es zeigte ihm, wie wichtig und hilfreich Fremdsprachen sind. Er selbst versteht 60 bis 70 Prozent Niederländisch, sagt er. Einige der niederländischen Freunde waren Maler, mit denen sich die Eltern auch kulturell austauschten. Diese Offenheit überwand Ressentiments, so kurz nach dem Krieg zählten die Deutschen verständlicherweise fast nirgends zu den beliebten Gästen. Umso mehr bedeuteten diese Freundschaften. Grenzen zu überwinden, vorurteilsfrei auf Leute zuzugehen – auch hier hatte der Vater für Herbert Grönemeyer eine große Vorbildfunktion. Zu wissen, was die eigene Verantwortung ist, und nie zu vergessen, wo man herkommt, was Geschichte heißt, was sie aus den Menschen und einem selbst gemacht hat und macht – das war ein Credo des Vaters und ist auch ein Credo der Musik Herbert Grönemeyers, der bei den Niederländern eine »größere Lässigkeit« wahrnahm und sich in den Ferien mit seinen Brüdern immer einer Gruppe aus vierjährigen bis fünfzehnjährigen Kindern und Jugendlichen anschloss, Deutschen und Niederländern, die alle Unternehmungen gemeinsam machten: Fahrradtouren, in den Dünen verstecken, schwimmen gehen. Das Meer wurde ihm so schon früh zu einem Symbol der Freiheit. Noch heute schwärmt Herbert Grönemeyer von der Unbeschwertheit dieser prägenden Zeit, aus der sich eine Nähe zu den Niederlanden erhalten hat und seine Liebe zu Zartbitterhagelslag, niederländischem Brot, Pommes frites und Pindakaas.
Singen konnte fast jeder aus der Verwandtschaft, Hausmusik hatte Tradition. Mit vier Jahren fing Herbert Grönemeyer selbst an zu singen – und hat damit bis heute nicht aufgehört. Gesangsunterricht hatte er nie, die ununterbrochene Praxis hat den Unterricht ersetzt. An der Berliner Schaubühne habe er einmal eine Gesangslehrerin konsultiert, weil er Ratschläge haben wollte, wie er sich vor einem Konzert stimmlich besser aufwärmen kann. Bei anderer Gelegenheit habe er in Berlin eine Stimmbildnerin aufgesucht, die ihm ein geeignetes Absingen zeigen sollte, das stimmliche Pendant zum Abwärmen beim Sport. Die Kondition der Stimme ist ein wichtiger Bereich stimmlicher Pflege während einer Tournee, der Stimmapparat ist da enormen Beanspruchungen ausgesetzt. Die Kunst, so Grönemeyer, bestehe darin, die Stimme stets geschmeidig und entspannt zu halten.
Seine Tanten, die Halbschwestern seiner Mutter, und auch seine Mutter sangen viel mit den Brüdern, und nicht nur Schlaflieder. Sein Vater habe ebenfalls sehr gerne gesungen, sei aber aus dem Chor geflogen, weil es seine Eigenart gewesen sei, zwar laut, aber des öfteren knapp daneben zu singen. Von seinem Vater habe er demnach eher die Lautstärke. Von der Mutter und den beiden Onkeln, ihren Halbbrüdern, lernten Herbert Grönemeyer und seine Brüder das Gitarrenspiel; die beiden Onkel waren bei den Pfadfindern und in der Kirche. Wenn sie die Familie besuchten, brachten sie ihre Gitarren mit, spielten Lieder und Stücke vor und zeigten den Brüdern die Griffe. Und so kam es, dass die Brüder alle Gitarre spielten und auch Klavier.
Wenn die Familie verreiste, hatten die Brüder immer zwei Gitarren im Auto und die Mundorgel, ein Fahrten-Liederbuch mit deutschen Volksliedern, das 1953 zum ersten Mal erschienen war, 1964 gab es eine Ausgabe mit Gitarrengriffen. Das Buch war mit der Zeit völlig zerfleddert, es gehörte zum guten Ton in der Familie, fast alle Lieder zu kennen, das war ein regelrechter Wettbewerb, die Brüder gingen die Lieder durch, eins nach dem anderen, auf den Fahrten war immer Prüfung, dieses Lied, dann das nächste Lied, konnte jemand ein Lied nicht, musste das unbedingt nachgeholt werden, konnte er es dann immer noch nicht, war er durchgefallen, das habe schon zwanghafte Züge gehabt, niemand habe sich eine Blöße geben wollen, und so kannten alle die Mundorgel besser als die Schullektüre, erinnert sich Herbert Grönemeyer. Das wiederholte Durchnehmen und Singen eines Liedes erübrigte sein Auswendiglernen, und so haben sich die Brüder einen Vorrat vieler Volkslieder ersungen, Lieder wie »Wildgänse rauschen durch die Nacht«, »Winde wehn, Schiffe gehn«, »Schön ist ein Zylinderhut« oder »Bolle reiste jüngst zu Pfingsten«.
Um die Anerkennung seiner Mutter, die zuweilen melancholisch war, habe er sich auf verschiedene Weise bemüht, so Herbert Grönemeyer, zum Beispiel durch Späßemachen und Singen. Die zurückhaltende Art der Mutter habe ihn gereizt, ihr etwas zu beweisen. Dabei hätte es dieser Anstrengungen wahrscheinlich gar nicht bedurft, schließlich war sie ja für die musikalische Erziehung zuständig. Sie stammte selbst aus einer musikalischen Familie: Ihre Mutter hatte eine Opernausbildung und spielte Geige. Ihr im Krieg gefallener Vater, der ebenfalls Herbert hieß, war Musiker, er spielte Cello und Gitarre und schrieb sogar Lieder: »Ich mach mir jüngst den großen Spaß, ich tat, als wollt ich sterben, da kamen die Verwandten alle und dachten, was zu erben.«
Er habe heute noch die schöne Stimme seiner Mutter im Ohr, einige von den Liedern, die damals gesungen wurden, könne er immer noch auswendig, sagt Herbert Grönemeyer. Das Musizieren war ein familiäres Verständigungsmittel, es zeigte ihm, dass und wie man mit Musik Kommunikation und auch Versöhnung stiften kann, wenn Streit ausgebrochen ist oder Konflikte schwelen: Singen beruhigt.
Eine sehr gute, für ihn wichtige Schule war das Singen im Chor. Hier konnte er lernen, sich als Klangfarbe zu begreifen, die ein Farbtupfer des gesamten Spektrums ist, und er konnte seinen Neigungen zum Solieren frönen. Im Schulchor, so Herbert Grönemeyer, sei er sehr ambitioniert gewesen, sprich sehr laut. Es sei ein Glück, wenn man einen guten Musiklehrer hat, er habe gleich zwei hervorragende Musiklehrer gehabt. Der eine, Herr Mäsch, sei sehr streng gewesen, er habe das schuleigene Orchester geleitet. Der andere habe Herr Freisewinkel geheißen und sei der Schulchorleiter gewesen. Beide Musiklehrer hätten ein Verständnis von Musik als regelgeleiteter Freiheit vermittelt, als Disziplin sei Musik nicht zweckgebunden gewesen, und er habe gelernt, dass die eigene Stimme ein Gut sei, über das man selbst verfügt, das man pflegen müsse. Die Stimme ist wie eine Handschrift, an der man erkannt wird, sie ist das ganz eigene, und gleichzeitig kann sie sich einfügen, sie kann Teil werden einer klangfarbenreichen großen Stimme, eine Erfahrung, die das Selbstbewusstsein stärkt. Gleichzeitig bietet der Chor die Möglichkeit, eigene Unsicherheiten auszugleichen, indem man sich zurücknimmt, bis man sich eingefunden hat. Herbert Grönemeyers Stimmlage war Alt, viel später dann Tenor, er sei nie im Stimmbruch gewesen, insofern sei sein Singen von einer übergangslosen Kontinuität gekennzeichnet gewesen und habe von Anfang an eine gewisse Charakteristik gehabt, die ihn bestärkte, auch solo zu singen. Die Selbstwahrnehmung des Singens im Chor ist für die Stimme von besonderem Reiz, sie schult das Gehör, lässt Differenzen erkennen und bietet die Möglichkeit der eigenen Korrektur. Singen im Chor bedeutet, man ist bei sich und gleichzeitig im Ensemble der anderen Stimmen. Das Gemeinschaftsstiftende dieser Art von Singen habe er geliebt, auch im Kirchenchor. Die Stimme im liturgischen Kontext hat eine eigene Tradition, man singt andere Lieder als im Schulchor, wie zum Beispiel Choräle, Motetten oder Messen, die Stimme wird funktionsharmonisch zum Teil anders gehandhabt. A-cappella-Singen könne eine mitreißende Wucht entfalten, sagt Herbert Grönemeyer, das Chorsingen mit Orchester könne so erhebend sein, wie es eine unglaubliche Energie freisetze. Die körperliche Verausgabung beim Singen habe eine nicht zu unterschätzende reinigende Funktion, ein Aspekt, der das Singen in eine sportliche, aber auch meditative Nähe bringe. Neben Schul- und Kirchenchor hat Herbert Grönemeyer, zusammen mit seinem ältesten Bruder, auch in einem Mädchenchor gesungen, der Männerstimmen suchte. Die beiden waren da die einzigen Männer. Und natürlich seien sie hauptsächlich wegen der Musik in den Mädchenchor gegangen.
Auch wenn die Eltern selbst musisch veranlagt waren und die Laufbahn ihres Sohnes mitinitiierten, so waren Theater und Musik als Berufs- oder gar Lebensperspektive doch unvorstellbar für sie. Das möge im Rückblick betrachtet verwunderlich sein, so Grönemeyer, sei aber aus einem gesteigerten Sicherheitsbedürfnis zu erklären, wie es für die Kriegsgeneration nicht untypisch gewesen sei, und aus dem Wunsch seines Vaters, wenigstens einer seiner drei Söhne möge ihm beruflich nachfolgen. Kultur war wichtig für seine Eltern, sie hatten ein Theaterabo und Freunde unter den Schauspielern. Herbert Grönemeyer war ein ziemlich guter Schüler, auch in Mathematik, deshalb träumte sein Vater davon, dass er Maschinenbauer werde oder Ingenieur. Sowohl Musik als auch Rechtswissenschaften zu studieren, war in Anbetracht der Wünsche seiner Eltern sicherlich ein Kompromiss. Der Abbruch des Studiums zeigte einerseits, dass dieser Kompromiss nicht zu leben war, und andererseits, dass die Entscheidung zum beruflichen Werdegang längst gefallen war. Als die beruflichen Entwicklungen seiner Söhne sich ganz klar abzeichneten, bestand eine große Tragik des Vaters darin, dass keiner seiner Söhne in seine Fußstapfen trat. Der Vater konnte deshalb Herbert Grönemeyers Arbeit am Theater und als Musiker längere Zeit nicht anerkennen. Andererseits besuchten seine Eltern Theateraufführungen, an denen er beteiligt war, nicht zuletzt aufgrund ihres Abos. Auch Konzerte, bei denen er mitwirkte, besuchte sein Vater durchaus, sagte dabei aber immer wieder: »Du weißt, du kannst immer noch Professor werden.«
Herbert Grönemeyers zunehmend intensive Beschäftigung mit Musik und Theater verfestigte in seinen Eltern die Meinung, aus ihm werde nichts. Der Abbruch des Studiums tat dann das Übrige. Der Umstand allerdings, dass Herbert Grönemeyer sehr früh schon sein eigenes Geld verdiente und nie welches von seinen Eltern bekommen hat – mit dreizehn hat er seine ersten Gigs gespielt –, machte ihn unabhängig und somit über das Zwangsmittel Geld auch nicht beeinflussbar, in eine Richtung zu gehen, die ihm nicht zusagte. Er konnte seine Wohnung bezahlen und hatte immer Geld zum Leben. So kam es, dass er sich zum Leidwesen seiner Eltern nie Gedanken machte, was aus ihm werden sollte, er hatte sich innerlich ja längst entschieden.
Spätestens mit 4630 Bochum zeichnete sich dann ab, dass er wohl doch so etwas wie einen Plan hatte, auch wenn niemand diesen Plan verstand, und sein Vater konnte nicht verhehlen, stolz auf ihn zu sein, wohingegen seine Mutter eher zurückhaltend blieb und ihre Gedanken über seine Musik für sich behielt.
Musikalische Selbstfindung
Bis zum Erfolg des Albums 4630 Bochum musste Herbert Grönemeyer allerdings erst einen lehrreichen Prozess der musikalischen Selbst(er)findung durchlaufen. Vermeintliche Umwege erwiesen sich im Rückblick als notwendige Stationen auf dem Weg zur musikalischen Selbstbestimmung und ließen ihn für einige Jahre in Coverbands zunächst die Schule des Singens ausschließlich von Fremdtexten absolvieren. Das war insofern eine Herausforderung, als man sich stets am Original messen lassen musste. Herbert Grönemeyer lernte, was es heißt, als Sänger auf der Bühne zu agieren und im Fokus der Wahrnehmung zu stehen. Und er lernte, dass die Identifikation mit der Musik, die man spielt, ein wesentliches Moment der eigenen Entwicklung ist. Es gab für ihn schließlich nur den Weg, vom Liedtext über die Musik und die Plattenproduktion alles selbst in die Hand zu nehmen.
Die erste Band, bei der er als Sänger engagiert war, war eine reine Coverband, sie spielte also nur Stücke nach und präsentierte keine eigenen Lieder. Herausragend in dieser Band war Johannes Vogt, später einer der besten deutschen Flamenco-Gitarristen, der damals schon Hendrix und McLaughlin spielte und alle Stücke von Cream. Die Band war in Wattenscheid bei einer zweitägigen Karnevalsveranstaltung engagiert und hielt es für angezeigt, keine deutschen, sondern ausschließlich englische Stücke aus ihrem Small-Faces-, Cream- und The-Doors-Repertoire zu spielen. Da sie also nur englische Titel spielte und nicht »Auf die Bäume, ihr Affen, der Wald wird gefegt« – Stimmungsmusik oder Schlager waren nicht ihre Sache –, setzten die Veranstalter sie nach dem ersten Abend vor die Tür. »Wir spielten gut, kamen aber nicht so gut an«, sagt Herbert Grönemeyer über ihren antikarnevalesken Auftritt. Zur selben Zeit, Herbert Grönemeyer war dreizehn Jahre alt, war er Frontmann in einem Trio mit dem bezeichnenden Namen Carezza, eine indische Liebestechnik, vier Stunden ohne Höhepunkt. Später nannte sich die Band um in Pulmo Frenona. Herbert Grönemeyer spielte Klavier und sang, Bass spielte Michael Förster, am Schlagzeug saß Andreas Wentzel. Von da an sang Herbert Grönemeyer an jeder roten Ampel, in jedem Jugendheim, in diversen Bands, alleine, in Begegnungsstätten in Oberhausen oder in Feuerwehrzelten im Sauerland, nachts im Winter ohne Heizung und alle total betrunken in den Bänken. »Wo es was zu singen gab, war ich zur Stelle«, so Herbert Grönemeyer. Er sei immer gespannt auf die Reaktion der Leute gewesen, diese Spannung habe ihm Laune gemacht, die Frage, ob man das Publikum in irgendeiner Form bewegt bekomme. Zwar ging die Band ein gewisses Risiko ein, wenn sie eine Reihe von Liedern spielte, die niemand kannte, es sei aber Ehrensache gewesen, nicht nur die Hits rauf und runter zu spielen, sondern auch schon komplexere Titel. Was macht da das Publikum? Kriegt man es trotzdem zum Tanzen? Wendet es sich ab, will unter sich sein? Boykottiert es die Musiker?
In den Jugendheimen habe er »natürlich mehr den empfindsamen Akustikgitarren-Picker gegeben«, mit hochgeschraubter Mundharmonika, auch im Duo zusammen mit Andreas Hahnefeld, seinem besten Freund. Sie spielten hauptsächlich Stücke von Crosby, Stills and Nash, von Bob Dylan, Donovan, Don McLean und Neil Young. Die Musik war ein wunderbares Kommunikationsmittel, das ihnen Worte und Gefühle bereitstellte, mit denen sie versuchten, die Mädchen anzusprechen, ohne dies direkt und mit eigenen Worten und Emotionen tun zu müssen. Das war der besondere Kitzel der Jugendheimauftritte, zu sehen, wie die Mädchen reagieren. Was wollte man mehr als verklärte Blicke? Dass Musik das über Generationen und Grenzen hinweg auslösen kann, ist ihr Alleinstellungsmerkmal, ihr großes affektives Potenzial. War die Verbindung zum Publikum hergestellt, fand da ein Transfer statt, neigte Herbert Grönemeyer nicht dazu, nach dem Absolvieren des Programms zu gehen, er wollte noch ein bisschen bleiben, und das ist auch heute noch so: Wenn er einmal »gut in Schwung« ist, kriegt man ihn nicht so schnell von der Bühne.
Gegenüber aller Eitelkeit, die Auftritte mit sich bringen, hat die Musik vorrangig ein Eigenrecht, sie interessiert als Ausdruckskunst, die sich nach eigenen Gesetzen vollzieht, die musikalischen Unterschiede der einzelnen Stücke interessieren, die Vielfalt an Stimmen und Texten, die es gibt, die Kunst raffinierter harmonischer Abfolgen, die die funktionsharmonischen Schemata nicht einfach nur erfüllen. Es ist das Gesamtpaket, das stimmen muss, die Differenz zum Gängigen, allzu Bekannten, die man erzeugt. Auch wenn die Band also fast ausschließlich englische Coverversionen zum Besten gab, hieß das nicht, dass Herbert Grönemeyer die englische Sprache beherrschte und immer wusste, was er sang. Fehlende Kenntnisse im Englischen kompensierte er dadurch, dass er Radiosendungen auf Tonband aufnahm und die Lieder lautmalerisch in seiner dafür eigens kreierten, dem Englischen verwandten Sprache nachsang. Klang es halbwegs gleich, ohne dass er verstand, worum es eigentlich ging, musste das reichen, weil er ja singen wollte und am Wochenende bereits den nächsten Auftritt hatte.
Mit sechzehn sang Herbert Grönemeyer mit dieser Methode im englischen York, wo er drei Monate eine Schule besuchte, auf einem Folkfestival unter anderem Dylan-Lieder wie »Like a Rolling Stone« oder »Don’t Think Twice«, von denen er immer nur die Endworte der Zeilen kannte und auch die nur so halbwegs, aber das Publikum mochte es und feuerte ihn an.
Die ersten drei Platten von Leonard Cohen, Songs of Leonard Cohen (1967), Songs from a Room (1969) und Songs of Love and Hate (1971), konnte er komplett auf der Gitarre nachspielen, Cohens Lieder gehörten ebenso zu seinem Pseudoenglisch-Repertoire wie Songs von Randy Newman, den er für sich in den Niederlanden entdeckt hatte. Seine Texte habe er »zum Teil sogar verstanden«, sagt Herbert Grönemeyer, er empfand sie immer als präzise, Randy Newman war sein absoluter Hero in den Siebzigern und ist es zum Teil heute noch. Randy Newman ist für ihn vor allem der beste Balladenschreiber. Überzeugt hat ihn sein Kompositionsstil mit seiner Harmonik und seinen komplexen Streicherarrangements. Seine zu Herzen gehenden, mitunter auch bösen Texte seien klug, verständlich, zugänglich und zugleich zynisch wie im Lied »Short People«. In seinen Texten fühle sich Randy Newman in die »Bösartigkeit« anderer ein und mache sie so zu Rollen-Texten, wie zum Beispiel in dem Lied »In Germany Before the War« über einen Düsseldorfer Serienmörder, das seinerseits von Fritz Langs Film M inspiriert wurde:
A little girl has lost her way
With hair of gold and eyes of gray
Reflected in his glasses
As he watches her
A little girl has lost her way
Zwei Zeilen aus diesem Song waren für Herbert Grönemeyer die bildliche Basis von »Zum Meer« (auf dem Album Mensch). Der Rhein von Randy Newman wurde zur Elbe, die bei Cuxhaven ins Meer fließt:
I’m looking at the river
But I’m thinking of the sea
Außer bei Randy Newman, mit dessen Textinhalten er sich auch in späteren Jahren intensiv beschäftigte, setzte Herbert Grönemeyer sich früher kaum mit den Inhalten anderer Lieder auseinander, problemlos hat er ganze Gigs gesungen auch ohne eigentlichen Text. Bei Leonard Cohen verstand er nicht, worum es ging, aber er fand seine Lieder sehr schön melancholisch, sie begleiteten ihn durch die gesamte Pubertät. Wenn er ihn für sich in seinem Zimmer sang, rührte er ihn zu pubertärem Selbstmitleid. Genauso begleitete ihn Bob Dylan, nur dass er deutlich dynamischer, wilder, weniger traurig und noch unverständlicher war. Anstatt sich weiter mit der englischen Sprache auseinanderzusetzen, übte Herbert Grönemeyer lieber Gitarre und Mundharmonika, das fand er »cooler«, wie er sagt, als sich in die Inhalte zu vertiefen. Texte waren für ihn gewissermaßen ein weiterer Klang, der sich über die Musik legte, basierend auf Buchstabenreihen, die er wundervoll auf seine Art frei interpretieren und »wegsingen« konnte.
Ein Sänger wird mit den Texten assoziiert, die er singt, für Herbert Grönemeyer jedoch war Sprache zunächst einmal Material, wie seine Gitarrensaiten: »Zum Singen brauche ich Laute, also formte ich mir einen Quasitext aus den Lauten, die am besten klangen«, und da eigneten sich das Englische und seine dem Englischen verwandte Pseudosprache hervorragend. Nach dieser Methode geht er auch heute noch vor, bevor er dann einen deutschen Liedtext zur Musik bzw. Melodie schreibt, die bei ihm immer zuerst entsteht. Auf die Methode der von Herbert Grönemeyer erfundenen »Bananentexte« wird an späterer Stelle noch ausführlicher einzugehen sein.
Parallel zur Entwicklung seiner »Bananenmethode« fing Herbert Grönemeyer an, sich mit »richtigen«, zum Teil politischen Texten zu beschäftigen, als in den Siebzigern die deutschen Liedermacher beziehungsweise Politsänger und -gruppen bekannt wurden. Dieter Süverkrüp, Wolf Biermann, Floh de Cologne, Franz Josef Degenhardt oder Reinhard Mey. Süverkrüp, Degenhardt und Mey gehörten zusammen mit Hannes Wader, Schobert & Black, Ulrich Roski, Walter Mossmann und Insterburg & Co. zu den Liedermachern, die zwischen 1965 und 1969 bei den »Burg-Waldeck-Festivals« auftraten und in ersten Gehversuchen eine neue, eigenständige deutsche Polit- und Folkloremusik entwickelten. Ihr Repertoire kannte Herbert Grönemeyer mit der Zeit ziemlich gut, schon mit vierzehn, fünfzehn besuchte er einige ihrer Konzerte, sang aber ihre Lieder eher selten nach. Später beschäftigte er sich mit Bands wie Floh de Cologne, Ton Steine Scherben, Ideal, Fehlfarben, speziell auch mit den Texten von Rio Reiser und Annette Humpe. In Frankreich, am Strand von Bénodet, gewann er als Sechzehnjähriger einen mit 200 Francs dotierten Gesangswettbewerb mit den Liedern »Fließbandbaby, manchmal träum ich«, »Komm mit mir ins Wegschmeißwunderland« und »Wenn hinter dem Ford Capri die Sonne versinkt« von Floh de Cologne. Das war ein erster Durchbruch und zaghafter Annäherungsversuch an deutsche Texte. Es reichte zum ersten Platz, die Mischung machte es. Coverversionen, ob nun mit englischen »Bananentexten« oder deutschen Originaltexten, halfen ihm am Anfang seiner Entwicklung, den eigenen Ton zu finden und eine Stil-Lage, mit der er sich identifizieren konnte.
In der Kunst muss man Entscheidungen treffen. Es ist gut zu wissen, was man nicht machen möchte, und wie man etwas nicht machen möchte. Mit der Zeit war ihm klar geworden, dass er keine Fremdtexte mehr interpretieren und keine Coverversionen zum Besten geben wollte; wo Grönemeyer draufstand, sollte auch Grönemeyer drin sein.[1]