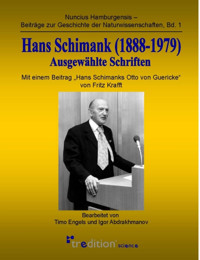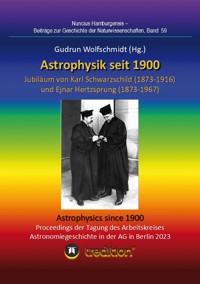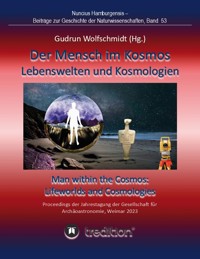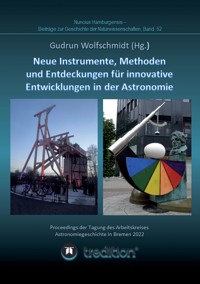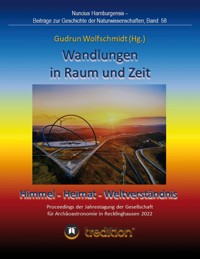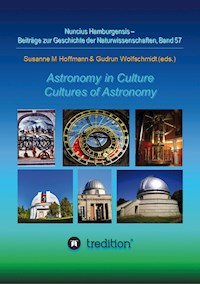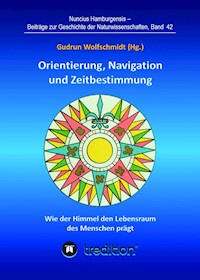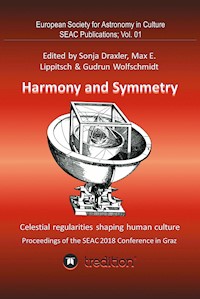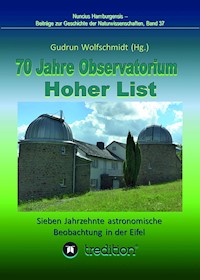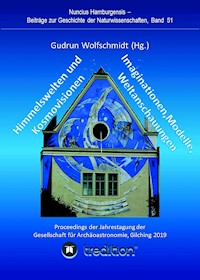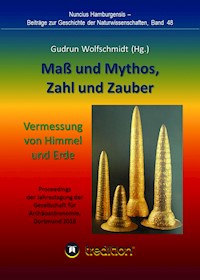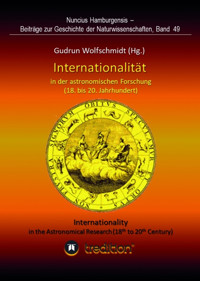
Internationalität in der astronomischen Forschung (18. bis 21. Jahrhundert) E-Book
Gudrun Wolfschmidt
9,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das Buch beleuchtet die Internationalisierung der Astronomie auf dem Wege zur Grossforschung (17.-21. Jahrhundert). Heute ist internationale Kooperation selbstverständlich, man denke an die Messung der Gravitationswellen oder an die Entdeckung des Higgs-Teilchens am CERN oder an Organisationen wie die "Europäische Südsternwarte" (ESO) mit 16 Mitgliedsstaaten oder die Europäische Weltraumorganisation ESA. Aber bereits in der Barockzeit gab es internationale Kontakte und Kooperationen in Form von Briefwechsel, Publikationen und Zeitschriften. Bekannte Astronomen wie Kepler, Maximilian Hell, Cassini III, aber auch unbekanntere wie G.J. de Marinoni werden vorgestellt. Die Athener Sternwarte ist ein gutes Beispiel für den Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und dem jungen griechischen Nationalstaat im 19. Jahrhundert - zwischen Zentrum und Peripherie. Weitere Beispiele bilden die internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung von Veränderlichen Sternen oder die deutsch-österreichische Forschergemeinschaft, die zum fotografischen Palisa-Wolf-Himmelsatlas mit vielen Asteroidenentdeckungen geführt hat. Der Schwerpunkt liegt auf der Gründung wissenschaftlicher Gesellschaften. Vor über 200 Jahren trafen sich erstmals europäische Astronomen in Gotha (1798) und gründeten 1800 die "Vereinigte Astronomische Gesellschaft" in Lilienthal. Das Ziel waren verbesserte Ekliptik-Sternkarten zur Auffindung des fehlenden "Planeten" zwischen Mars und Jupiter. Die 1863 gegründete "Astronomische Gesellschaft" hatte von Anfang an den Anspruch auf Internationalität, was sich in den Mitgliederzahlen spiegelte. Grosse erfolgreiche Projekte mit Kooperationen in aller Welt waren die AGK-Sternkataloge oder die Listen Veränderlicher Sterne. 1919 wurde die "International Astronomical Union" (IAU) gegründet, die 2018 in Wien ihr 100jähriges Bestehen feierte. Schliesslich hat die Neutrinophysik die größten Zuwachsraten an internationalen Kollaborationen auf dem Weg zur "Big Science".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Internationalität in der astronomischen Forschung
(18. bis 21. Jahrhundert)
Internationality in the Astronomical Research
(18th to 21th Century)
Abbildung 0.1:
Vier Laser über Paranal (2016), VLT und adaptive Optik
Four-Laser-Guide-Star-Facility (4LGSF), © ESO (ESO1613g)
Nuncius Hamburgensis
Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften
Hg. von Gudrun Wolfschmidt, Universität Hamburg, Arbeitsgruppe Geschichte der Naturwissenschaft und Technik (ISSN 1610-6164).
Diese Reihe „Nuncius Hamburgensis“ wird gefördert von der Hans Schimank-Gedächtnisstiftung.
Dieser Titel wurde inspiriert von „Sidereus Nuncius“
und von „Wandsbeker Bote“.
Wolfschmidt, Gudrun (Hg.):
Internationalität in der astronomischen Forschung (18. bis 21. Jahrhundert).
Internationality in the Astronomical Research (18th to 21th Century).
Proceedings der Tagung des Arbeitskreises Astronomiegeschichte in der Astronomischen Gesellschaft in Wien 2018.
Hamburg: tredition (Nuncius Hamburgensis –
Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften, Band 49) 2020.
Cover vorne: Logo der VAG (1800)
Frontispiz: Vier Laser über Paranal (2016) (© ESO (ESO1613g))
Titelblatt: Logos AKAG, AG
Cover hinten: Sonnenuntergang am Paranal: VLT, Mond, Venus
(© ESO, Y. Beletsky).
AG Geschichte der Naturwissenschaft und Technik,
Hamburger Sternwarte, MIN Fakultät, Universität Hamburg
Bundesstraße 55 – Geomatikum, 20146 Hamburg, Germany
https://www.physik.uni-hamburg.de/hs/group-wolfschmidt/
Dieser Band wurde gefördert von der Schimank-Stiftung und dem
Arbeitskreis Astronomiegeschichte.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40–44, 22359 Hamburg, Germany
978-3-7482-4975-7 (Paperback), 978-3-7482-4976-4 (Hardcover),
978-3-7482-4977-1 (e-Book), © 2020 Gudrun Wolfschmidt.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort: Internationalität in der astronomischen ForschungWolfschmidt, Gudrun (Hamburg)
1 Internationalität in der astronomischen Forschung vom 17. bis zum 21. JahrhundertGudrun Wolfschmidt (Hamburg)
1.1 Anfänge der internationalen Kooperation im 17. und 18. Jahrhundert
1.1.1 Von Akademiegründungen zu wissenschaftlichen Zeitschriften
1.1.2 Problem des Längengrads – Navigation
1.2 Große Kooperationsprojekte um 1800
1.2.1 Kartographie und Landvermessung
1.2.2 Societas Meteorologica Palatina (1780 bis 1795) – Meteorologie
1.2.3 Der Magnetische Verein Göttingen (1836–1841) – Humboldt, Gauß und Weber
1.2.4 Vereinheitlichung der Maßsysteme
1.3 Die Vereinigte Astronomischen Gesellschaft (VAG) *1800
1.3.1 Erste astronomische Tagung
1.3.2 Gründung und Zielsetzung der Vereinigten Astronomischen Gesellschaft (VAG)
1.3.3 Die weitere Entwicklung der VAG
1.4 Gründung und Entwicklung der Astronomischen Gesellschaft
1.4.1 Gründung der Astronomischen Gesellschaft 1863
1.4.2 Weitere Gründungen von Gesellschaften
1.4.3 Centralstelle für astronomische Telegramme in Kiel (1882/83)
1.4.4 Zielsetzung der Astronomischen Gesellschaft – Internationaler Charakter
1.4.5 Mitgliederstruktur der AG
1.4.6 Entwicklung der AG in den 1920er Jahren
1.5 Neue internationale Gesellschaften im 20. Jahrhundert
1.5.1 International Union for Cooperation in Solar Research, 1905–1913
1.5.2 International Astronomical Union – Gründung in Brüssel (1919)
1.5.3 Astronomische Gesellschaft – Entwicklung ab den 1930er Jahren in Wechselwirkung mit der IAU
1.6 Internationale Kooperationsprojekte
1.6.1 Sonnenfinsternis- und Venustransitexpeditionen
1.6.2 Große Sternkatalog-Projekte
1.6.3 Internationale Erforschung Veränderlicher Sterne
1.6.4 Internationale Jahre
1.7 Europäische Südsternwarte (* 1962)
1.8 Astronomie im 21. Jahrhundert und internationale Kooperation
1.8.1 Beobachtungsinstrumente: Radioastronomie, Satelliten
1.8.2 UNESCO und Großforschungsinstitution CERN
1.8.3 Fazit: Internationale Kooperation in der Astronomie
1.9 Literatur
INTERNATIONALITÄT IN Der BArockzeit, Im 17./18. Jahrhundert
2 Das Rätsel um Johannes Keplers Wohnort in der Linzer Hofgasse – Zum Jubiläum (2018): „400 Jahre Drittes Keplersches Gesetz“Erich Meyer (Linz)
2.1 Einführung
2.2 Linz zur Zeit Keplers im Überblick
2.3 Warum Kepler von Prag nach Linz übersiedelte
2.4 Wohnorte von Kepler in Linz
2.5 Was die einzelnen Recherchen ergeben haben
2.6 Hinweise in Keplers astronomischen Berichten, die sich auf ein bestimmtes Haus beziehen
2.7 Bedeutende in Linz verfasste oder vollendete Werke von Johannes Kepler mit kurzer Erläuterung (Auswahl)
2.7.1 Nova Stereometria Doliorum Vinariorum. Linz 1615
2.7.2 Ephemerides Novae Motuum Coelestium, ab anno vulgaris aerae 1617–1620. Linz 1616
2.7.3 Epitome Astronomiae Copernicanae. Linz 1618, 1620. Frankfurt
2.7.4 Prognosticon, von aller handt bedauerlichen Vorbotten künfftigen Übelstands / in Regiments- und Kirchensachen / sonderlich von Kometen und Erdbidem / auff 1618. und 1619. Jahr
2.7.5 Harmonice mundi libri V. Linz
2.7.6 Prodromus Dissertationum Cosmographicarum continens Mysterium Cosmographicum. (Überarbeitung in Linz 1620–21).
2.7.7 Somnium, Seu Opus Posthumum de Astronomia Lunari. Prag 1609 und Linz
2.7.8 Tabulae Rudolphinae. Linz
2.8 Quellen und Literatur
2.8.1 Archivalien
2.8.2 Literatur
3 Von Kolb zu LaCaille – From Peter Kolb (1675–1726) to Nicolas-Louis de LaCaille (1713–1762)Karsten Markus-Schnabel (Berlin)
3.1 Ausgewählte Literatur und Quellen
4 Johann Jakob von Marinoni – Mathematiker, Astronom, Geodät – Internationale Kontakte eines Wissenschaftlers im Wien des 18. Jahrhunderts Michael Hiermanseder & Heinz König (Wien)
4.1 Marinoni und das „österreichische Jahrhundert“ in Italien
4.1.1 Österreich, Großmacht der Barockzeit
4.1.2 Desolate Finanzen und Kommission „Giunta di nuovo Censimento milanese“
4.2 Johann Jakob von Marinoni (1676–1755)
4.2.1 Marinonis Weg von Udine nach Wien
4.3 Marinoni und die Ingenieur-Akademie
4.3.1 Gründung der ersten polytechnischen Lehranstalt Mitteleuropas
4.3.2 Wünsche und Karrierepläne Marinonis
4.3.3 Marinoni als Leiter der Ingenieur-Akademie
4.4 Marinoni als Kartograph
4.4.1 Plan von Wien
4.4.2 Karten von Herrschaftsbesitz
4.5 Marinoni und der Kataster des Herzogtums Mailand
4.5.1 Landesaufnahme von Mailand
4.5.2 Landkarten als unverzichtbare Dokumente
4.5.3 Vorschläge Marinonis vom 14. Oktober 1719 für die Aufnahme und die Kartenerstellung
4.5.4 Die Versuche im Gebiet von Melegnano und im Comasco
4.6 Adelspatente und Wappen für Joannes Jacobus de Marinoni
4.6.1 Adelsdiplom vom 8. Juli 1726, Adelserhebung in den Reichsadel
4.7 Marinonis wissenschaftliche Hauptwerke
4.7.1 Astronomie
4.7.2 „De re ichnographica“
4.7.3 Fehlertheorie und mathematische Korrespondenz
4.7.4 „De re ichnometrica“
4.8 Finis
4.9 Literatur
INTERNATIONALITÄT IN Der AUfklärung, Im 18. Jahrhundert
5 Die französische Venus-Transit-Beobachtung 1761 an der Wiener JesuitensternwarteThomas Schobesberger (Wien)
5.1 Einleitung
5.1.1 Die Wiener Sternwarten
5.1.2 Die Pariser Sternwarte und die Familie Cassini
5.1.3 Vorbereitungen für den Venustransit 1761
5.1.4 Cassini’s Reisen
5.2 Die Beobachtungsplätze in Wien
5.2.1 Beobachtungsplatz von Maximilian Hell
5.2.2 Beobachtungsplatz von Cassini de Thury
5.3 Der Transit von 1761
5.3.1 Die Wiener Beobachtungen
5.4 Ergebnisse der Wiener und weltweiten Beobachtungen
5.5 Literatur
6 „An den Ehrw. P. Antonius Pilgram S.J. meinen substituirten Astronom in K. K. Observatorio in Wienn“ – Der Briefwechsel zwischen Anton Pilgram und Maximilian Hell während dessen Venustransitexpedition 1768/69 nach VardøIsolde Baum, Günter Bräuhofer & Thomas Posch (1974–2019) (Wien)
6.1 Einleitung
6.1.1 Die Venustransits des 18. Jahrhunderts
6.1.2 Der Venustransit von 1769
6.2 Die Briefentwürfe an Anton Pilgram
6.2.1 Die namentlich bekannten Beteiligten
6.2.2 Die Briefe
6.3 Auszüge aus den Inhalten der Briefentwürfe an Anton Pilgram
6.3.1 Reise, Insel und Observatorium
6.3.2 Naturbeobachtungen und andere Entdeckungen
6.3.3 Hell an den Freund Pilgram
6.4 Ausblick
6.5 Literatur und Archivalien
6.5.1 Literatur
6.5.2 Briefe
INTERNATIONALITÄT Im 19. Jahrhundert
7 Die Internationalität der Astronomischen Gesellschaft in den ersten einhundertundfünfzig Jahren ihres BestehensReinhard E. Schielicke (Jena)
7.1 Literatur
8 Details zum „internationalen“ ersten Leiter der Athener Sternwarte Georgios Constantin Bouris (1802–1860)Maria Gertrude Firneis (Wien)
8.1 Einleitung
8.2 Abstammung und Hintergründe
8.3 Werdegang
8.4 Die Athener Sternwarte
8.5 Oeuvre von Georg Bouris
8.6 Weiterführende Literatur
9 Astronomie zwischen Zentrum und Peripherie – Austausch zwischen deutschsprachigen Raum und jungen griechischen Nationalstaat im 19. Jahrhundert Panagiotis Kitmeridis (Frankfurt am Main)
9.1 Die Zentrum-Peripherie Beziehung
9.2 Zum Stand der Astronomie in Griechenland
9.2.1 Die Athener Universität
9.2.2 Die Astronomie bekommt ihren eignen Tempel
9.3 Die Instrumente der Sternwarte
9.4 Das Gebäude der Sternwarte
9.5 Literatur
10 The First and Second Mach Principle – How Einstein Created the Theory of General RelativityEren Simsek (Wien)
10.1 How Einstein created the theory of general relativity
10.1.1 Mach’s Principle
10.1.2 Mach’s second principle
10.2 References
11 Kalenderreformen im 19. und 20. Jahrhundert – interkonfessionell, interdisziplinär, auch international?Harald Gropp (Heidelberg)
11.1 Literatur
INTERNATIONALITÄT Im 20. Jahrhundert
12 Asteroid Pawona – Ehrung einer deutsch-österreichischen Forschungsgemeinschaft im Reich der kleinen PlanetenDietrich Lemke (Heidelberg)
13 „Überholt vom Fortschritt – die Geschichte einer Koproduktion Heidelberg-Wien“ – Die Wolf-Palisa-Karten (ein früher photographischer Himmelsatlas) Regina Umland (Mannheim)
13.1 Kurzbiografien
13.1.1 Johann Palisa (1848–1925)
13.1.2 Joseph Rheden (1873–1946)
13.1.3 Max Wolf (1863–1932)
13.1.4 In Memoriam Anneliese Schnell (1941–2015)
13.2 Wolf-Palisa-Sternatlas / Palisa-Wolf-Sternatlas
13.3 Überholt vom Fortschritt
13.4 Literatur
14 Die internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung von Veränderlichen Björn Kunzmann (Hamburg)
14.1 Veränderliche Sterne – Geschichte ihrer Entdeckung und frühen Beobachtungs-Kooperationen
14.1.1 Definition
14.1.2 Übersicht über frühe Entdeckungen und Beobachtungen Veränderlicher Sterne
14.1.3 Anfänge internationaler Kooperation zur Forschung Veränderlicher Sterne
14.2 Beginn der Organisation internationaler Zusammenarbeit bei Veränderlichen Sternen
14.2.1 Die Entstehung der Astrophysik und Veränderliche Sterne
14.2.2 Organisation der Veränderlichenforschung durch das Harvard College Observatory ab 1882
14.3 Veränderliche Sterne und Gesellschaften zu ihrer internationalen Beobachtung
14.3.1 Gründungen vor 1914
14.3.2 Etablierung von Organisationen und ihre internationale Zusammenarbeit
14.3.3 Internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung von Veränderlichen in der Gegenwart
14.4 Literatur
15 Dr. Wähnl und die Urania-Sternwarte WienHans-Ulrich Keller (Stuttgart)
15.1 Gründung der Wiener Urania
15.1.1 Zeitbestimmung
15.2 Die Leiter der Sternwarte im Volksbildungshaus Wiener URANIA
15.3 Die Ära Maria Wähnl – Leitung der URANIA 1953 bis 1969
15.4 Ausblick
15.5 Quellen und Publikationen
15.5.1 Quellen zur Biographie von Dr. Maria Wähnl
15.5.2 Publikationen von Dr. Maria Wähnl
INTERNATIONALITÄT IN DER Modernen Astrophysik
16 Revitalization of international exchange on astronomy and astrophysics after 1945 – Wiederbelebung des internationalen Austausches zu Astronomie und Astrophysik nach 1945Rita Meyer-Spasche (Garching)
16.1 Literature
17 Österreichische Wissenschaftler und die Entwicklung der kosmochemischen Forschung am Max-Planck-Institut für Chemie Xian Wu (Dresden)
17.1 Max-Planck-Institut für Chemie
17.1.1 Der Vorgänger
17.1.2 Neue Gründung
17.2 Kosmochemie
17.2.1 Vor dem 20. Jahrhundert
17.2.2 Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
17.3 Österreichische Wissenschaftler und die Kosmochemie am MPI für Chemie
17.3.1 Friedrich Adolf Paneth (1887–1958)
17.3.2 Heinrich Hintenberger (1910–1990)
17.3.3 Heinrich Wänke (1928–2015)
17.3.4 Günter Wilhelm Lugmair (*1940)
17.4 Schlusswort
17.5 Literatur
18 Die Internationalität der astronomischen Forschung am Beispiel der Neutrinophysik Udo Gümpel (Hamburg / Rom)
18.1 Am Anfang stand die Frage: Warum scheint die Sonne?
18.2 Vorgeschichte bis 1900
18.2.1 Der Gelehrtenstreit im 18. Jahrhundert über die Natur der Sonnenenergie
18.2.2 Kohleverbrennung, Meteoriten oder Gravitation?
18.2.3 Charles Darwins: Die Wirkung der Sonne auf die Erde, eine messbare Größe
18.2.4 Die Rolle der Radioaktivität
18.3 Nach dem Ersten Weltkrieg: Die Stunde der Astronomen
18.4 Die Solvay-Konferenzen: Die Internationale der Physik in einem Zimmer
18.5 Der Machtantritt der Nazis – das Ende der „europäischen“ Internationalität
18.6 Die neue Internationalität im amerikanischen Hause: Das Manhattan-Projekt
18.7 Der Kalte Krieg und die Neutrino-Physik – der Nachweis des Neutrinos durch einen „Atombombenbauer“
18.8 Die Teilchenbeschleuniger in der Welt übernehmen die Neutrinophysik – der Zweikampf USA – Europa
18.9 Die Suche nach den Neutrinos aus der Sonne
18.10 Die Sonnenneutrino-Suche in der Goldmine: Das „Homestake Solar Neutrino Observatory“ – Das Sonnenneutrino-Rätsel entsteht
18.11 Der Beginn einer neuen Internationalität der Neutrinophysik und die Oszillations-Hypothese
18.12 Die Revolution der Helioseismologie
18.13 Die Neutrinophysik wird größer und internationaler
18.14 Die Untergrundlaboratorien in Russland, Italien und Japan entstehen
18.15 Die Sonnenneutrino-Physikergemeide wächst
18.16 Das Ringen um die Fördermittel
18.17 Kamiokande (Kamioka Nucleon Decay Experiment – KamiokaNDE) in Japan
18.18 Die Supernova 1987a: Die Geburtsstunde der Neutrino-Astronomie .
18.19 Die Neutrino-Teleskope
18.20 Die Gallium-Großexperimente GALLEX und SAGE
18.21 Das Sonnenneutrino-Defizit – auch im japanischen Cerenkov-Detektor-Kamiokande bestätigt!
18.22 SNO – Ein Experiment in Kanada löst das Rätsel
18.23 Die Theorien dahinter: Oszillationen und Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein Effekt (MSW)
18.24 Neutrinophysik – Entwicklung von Small Science zur Big Science
18.24.1 Wachsende Größe der Kooperationen
18.24.2 Steigende Kosten
18.24.3 Die Nobelpreise in der Neutrinophysik
18.25 Quellen und Literatur
18.25.1 Quellen
18.25.2 Literatur
Anhang
19 Links – Astronomie, Museen in WienGudrun Wolfschmidt (Hamburg)
19.1 Allgemeine Links
19.2 Literatur zu Moriz von Kuffner (1854–1939) und zur Kuffner Sternwarte
19.3 Links zur Astronomie in Wien
19.4 Museen in Wien – Naturwissenschaft, Technik, Kulturgeschichte
19.4.1 Universitätsmuseen
19.4.2 Museen für Naturwissenschafts- und Technikgeschichte
19.4.3 Museen für Architektur
19.4.4 Museen für Kultur- und Kunstgeschichte, auch Römer
19.5 Stadt Wien
20 Tagung des Arbeitskreises Astronomiegeschichte in Wien 2018
20.1 Freitag, 17. August 2018 – Wien
20.2 Samstag, 18. August 2018
20.2.1 Eröffnungs-Session – Opening Session
20.2.2 Session 1: Internationalität in der Barockzeit, im 17./18. Jahrhundert
20.2.3 Session 2: Internationalität in der Aufklärung
20.2.4 Führung / Beobachtung Kuffner-Sternwarte
20.3 Sonntag, 19. August 2018
20.3.1 Stadtrundgang in Wien
20.3.2 Session 3: Internationalität im 19. Jahrhundert
20.3.3 Session 4: Internationalität im 20. Jahrhundert
20.4 Mitgliederversammlung des Arbeitskreises Astronomiegeschichte – 18: 00 Uhr
21 List of Participants – „Internationalität“ – AKAG Wien 2018
Autoren
Nuncius Hamburgensis
Personenindex
Vorwort
Internationalität in der astronomischen Forschung
Wolfschmidt, Gudrun (Hamburg)
In memoriam Thomas Posch (1974–2019)
Die Tagung des „Arbeitskreises Astronomiegeschichte in der Astronomischen Gesellschaft“ (AKAG) mit dem Thema Internationalität in der astronomischen Forschung vom 18. bis zum 20. Jahrhundert (Internationality in the Astronomical Research of the 18th to 20th Century) fand in Wien vom 17. bis 19. August 2018 statt. https://www.FHSeV.de/Wolfschmidt/events/akag-wien-2018.php.
Die Wahl des Tagungsthemas nimmt Bezug auf die Generalversammlung der International Astronomical Union (IAU), die direkt nach unserer Tagung ihr 100. Jubiläum in Wien feierte.
Zum SOC der Tagung des „Arbeitskreises Astronomiegeschichte in der Astronomischen Gesellschaft“ gehörte PD Dr. Dr. Thomas Posch (1974–2019) von der Universitäts-Sternwarte Wien, Vorsitzender des AKAG von 2014 bis 2019. Schockierend war die Nachricht seines Todes 2019 im Alter von nur 45 Jahren. Wir vermissen ihn sehr.
Sein Studium der Astronomie, Physik und Philosophie ab 1992 in Graz, Berlin und Wien schloss Thomas Posch 1999 mit einer Diplomarbeit zum Thema „Zirkumstellarer Staub und die Infrarot-Spektren pulsierender Roter Riesen“ ab. 2002 folgte eine philosophische Dissertation „Die Mechanik der Wärme in Hegels Jenaer Systementwurf von 1805/06“ und 2005 die astronomineralogische Dissertation „Astromineralogy of Circumstellar Oxide Dust“. Seit 2006 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Astrophysik der Universität Wien. Dabei engagierte er sich auch für das historische Institutsarchiv, astronomische Museum und in der Öffentlichkeitsarbeit. 2011 stellte er seine Habilitation „Studies in Astromineralogy and Stellar Mass Loss“ fertig und erhielt die Venia Legendi. Eine weitere wichtige Aktivität war die Messung und Modellierung der Nachthimmelshelligkeit (Galileo-Award der International Dark Sky Association, 2014). Seine Arbeitsschwerpunkte waren kosmischer Staub, Geschichte der Naturwissenschaften und Erkenntnistheorie. In seinem letzten Buch widmete er sich Johannes Kepler – Die Entdeckung der Weltharmonie (Darmstadt 2017). Ein ausführlicher Nachruf von Franz Kerschbaum, mit Beiträgen von Josef Hron, Cornelia Jäger, Harald Mutschke, Johann Schelkshorn, Wilhelm Schwabe und Stefan Wallner erschien im April 2019.1
Abbildung 0.2:
Thomas Posch (1974–2019),
SOC bei der Tagung des AKAG in Wien (2018)
Foto: Gudrun Wolfschmidt
Tagungsort war die Kuffner Sternwarte in Wien-Ottakring. Die Sternwarte wurde als privates Forschungsinstitut nach den Plänen von Franz Ritter von Neumann jun. (1844–1905) erbaut (1884/86); sie steht seit 1977 unter Denkmalschutz. Der Bierbrauer Moriz von Kuffner (1854–1939) trat als großzügiger Mäzen bzgl. Bau und Betrieb der Sternwarte hervor;2 erster Direktor war Norbert Herz (1858–1927). An der Kuffner Sternwarte wirkten international bekannte Wissenschaftler wie Johannes Hartmann (1865–1936), Gustav Eberhard, Carl Wilhelm Wirtz (1876–1939), Leo Anton Carl de Ball (1853–1916) und als wichtigster Astronom Karl Schwarzschild (1873–1916). Die vier Hauptinstrumente stammen von Repsold & Söhne, Hamburg (Montierung), Steinheil, München (Optik):
• der Große Refraktor (Abb. 19.1, S. 452), 1884–1886 / Objektiv 1887,
• der Meridiankreis, 1884 (Abb. 0.3 und Abb. 10.1, S. 274),
• der Vertikalkreis, 1890/1891 (Abb. 22.2, S. 508), und
• das Heliometer, 1894 (Abb. 22.2, S. 508).
Auch dank der instrumentellen Ausstattung entwickelte sich die Sternwarte zu international bekannten Forschungsinstitut.
Mit grossem Engagement hat Günther Wuchterl mit seinem Team von der Kuffner Sternwarte die lokale Organisation perfekt vorbereitet und durchgeführt, alle haben sich sehr wohlgefühlt; ein ausserordentlicher Dank sei ihm dafür ausgesprochen.
Die vorliegenden Proceedings in 18 Kapiteln basieren auf den Beiträgen der Tagung des AKAG in Wien.3
Das Buch beginnt mit einem umfangreichen Überblick mit Beispielen internationaler Kontakte und Kooperationen in Form von Briefwechsel, Zeitschriften und mit dem Schwerpunkt der Gründung von wissenschaftlichen Gesellschaften (VAG, AG, IAU). Ferner werden gemeinsame Projekte, besonders Sternkataloge, thematisiert bis zu einem Ausblick auf den Bau von Grossteleskopen und Satelliten in europäischer oder internationaler Zusammenarbeit (beispielsweise ESO, ESA) im Zeitraum vom 17. zum 21. Jahrhundert.
Zum 17. Jahrhundert präsentiert Erich Meyer anläßlich des Jubiläums „400 Jahre Drittes Keplersches Gesetz (1618)“ Johannes Kepler (1571–1630) und speziell seinen damaligen Wohnort in der Linzer Hofgasse 7. Kepler hat sehr international gewirkt, nicht nur durch seine umfangreichen Briefkontakte, sondern auch aufgrund seiner Wohn- und Wirkungsorte in Europa: geboren in Weil der Stadt, Lateinschule in Leonberg in Württemberg, Besuch der Höheren Evangelischen Klosterschule („Gymnasium“) im ehemaligen Kloster Maulbronn, Studium in Tübingen am Evangelischen Stift (1589 bis 1591), Lehrauftrag für Mathematik an der Evangelischen Stiftsschule in Graz in der Steiermark (1594 bis 1600), kaiserlicher Hofmathematiker in Prag (1601 bis 1627) im Dienste der drei habsburgischen Kaiser Rudolf II., Matthias I. und Ferdinand II., dazu Landschaftsmathematiker (Landvermesser) in Linz (1612 bis 1626), danach in Ulm und in Sagan, Schlesien (1627 bis 1630) und gestorben in Regensburg (1630).
Abbildung 0.3:
Meridiankreis (1884) der Kuffner Sternwarte Wien-Ottakring, Montierung: Repsold & Söhne, Hamburg, Optik: Steinheil & Söhne, München, 1884–1886
Foto: Gudrun Wolfschmidt
Karsten Markus-Schnabel befasst sich mit der Beziehung zwischen dem Astronomen Peter Kolb (1675–1726) aus Franken und dem französischen Nicolas-Louis de La-Caille (1713–1762), die beide am Kap der Guten Hoffnung den südlichen Sternhimmel beobachteten. LaCaille benannte 14 der 88 Sternbilder der südlichen Hemisphäre (adopted by the IAU) und stellte einen Sternenkatalog des Südhimmels mit rund 10.000 Sternen zusammen. Peter Kolb versuchte, die südliche Hemisphäre in einer internationalen Anstrengung Anfang des 18. Jahrhunderts in ein weltweites Beobachtungsund Korrespondenznetzwerk einzubinden.
Michael Hiermanseder und Heinz König stellen in ihrem ausführlichen Beitrag den Mathematiker, Astronomen (Sternwarte auf der Mölkerbastei, 1730) und Geodäten Giovanni Jacopo de [Johann Jakob] Marinoni (1676–1755) und sein vielfältiges Wirken und seine internationalen Kontakte im barocken Wien des frühen 18. Jahrhunderts vor.
Die nächsten zwei Beiträge – zur Internationalität in der Aufklärung, im 18. Jahrhundert – beschäftigen sich mit den Venustransits von 1761 und besonders 1769 (Beobachtungen an 78 Orten), wissenschaftliche Großereignisse mit internationaler Zusammenarbeit. Thomas Schobesberger berichtet über die französische Venus-Transit-Beobachtung 1761 an der Wiener Jesuitensternwarte (Mathematischer Turm, 45 m hoch, *1733 bis 1773),4 eine nicht immer reibungslose Kooperation zwischen César François Cassini de Thury [Cassini III] (1714–1784) und Pater Maximilian Hell (1720–1792), der auf der Universitätssternwarte auf der Neuen Aula (*1756) beobachtet hatte.5 Das Autorenteam Baum, Bräuhofer und Posch analysiert den interessanten Briefwechsel zwischen Maximilian Hell während dessen Venustransitexpedition 1768/69 nach Vardø in Lappland und Anton Pilgram (1730–1793), Stellvertreter von Maximilian Hell in Wien.
Einen Schwerpunkt bilden die Beiträge zur Internationalität im 19. Jahrhundert, beginnend mit der Geschichte der Astronomischen Gesellschaft von Reinhard E. Schielicke. Indizien bilden die Statuten, nachdem die Mitgliedschaft an keine Nationalität gebunden ist und dass bis 1945 der Ausländeranteil bei 50% bis 60% lag (danach bei 10% und 20%), ein Beitrag mit interessanten umfangreichen Analysen von Mitgliederzahlen und Länderverteilung.
Maria Gertrude Firneis stellt den „internationalen“ ersten Leiter der Athener Sternwarte Georgios Constantin Bouris (1802–1860) und seine Familie vor. In vertiefter Form widmet sich Panagiotis Kitmeridis auch der Athener Sternwarte – und zwar dem interessanten Thema Astronomie zwischen Zentrum und Peripherie – Austausch zwischen deutschsprachigen Raum und jungen griechischen Nationalstaat im 19. Jahrhundert.
Eren Simsek untersucht „Das erste und zweite Machsche Prinzip – Wie Einstein die Allgemeine Relativitätstheorie schuf“, insbesondere die Rolle von Mach als exzellenter Experimentalphysiker und thematisiert u. a. die Internationalisierung der Zeit(messung).
Abbildung 0.4:
Kuffner Sternwarte Wien-Ottakring (1884/86)
Foto: Gudrun Wolfschmidt
Harald Gropp stellt die Frage „Kalenderreformen im 19. und 20. Jahrhundert – interkonfessionell, interdisziplinär, auch international?“ Carl Friedrich Gauß (1777–1855) hat den mathematischen Algorithmus der Osterrechnung (Computus)6 geschaffen und wollte „mit seiner Regel ganz bewusst ein praktisches Hilfsmittel an die Hand geben, das ohne die Kenntnis des in ihr komprimiert und verschleiert enthaltenen computus von jedermann angewendet werden kann.“7 Gropp geht speziell auf die Osterterminberechnung im westlichen und östlichen (orthodoxen) Kulturkreis ein und zeigt, dass hier die internationale Zusammenarbeit schlechter funktioniert, da theologische und politische Fragen die „astronomischen“ Aspekte überwiegen.
Die nächsten Beiträge haben den Schwerpunkt Internationalität um 1900 bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts. Dietrich Lemke und Regina Umland widmen sich in ihren Beiträgen der deutsch-österreichischen Forschungsgemeinschaft – Max Wolf (1863–1932) in Heidelberg und Johann Palisa (1848–1925) in Wien; beide haben zahlreiche neue Klein-Planeten entdeckt (und deren Bahnen berechnet), Palisa visuell und Max Wolf mit der neuen Methode der Himmelsphotographie ab 1891 – ein Thema, was 2011/14 schon Anneliese Schnell (1941–2015) thematisiert hatte. Als Ergebnis der Kooperation wurden die photographischen „Wolf-Palisa-Karten“ publiziert, die für die Suche nach Klein-Planeten besser als der visuelle Sternkatalog Bonner Durchmusterung geeignet waren. Diese enge wissenschaftliche Zusammenarbeit wurde geehrt mit der Benennung des Asteroiden Pawona.
Björn Kunzmann beleuchtet in seinem ausführlichen, detailliert recherchierten Beitrag, der die Zeitspanne vom 19. Jahrhundert bis heute umfasst, die internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung von Veränderlichen Sternen – besonders unter Einbeziehung der Aktivitäten von Amateurastronomen, die in diesem Gebiet eine wichtige Rolle spielen.
Hans-Ulrich Keller stellt in seinem Beitrag Dr. Maria Anna Wähnl (1908–1989) und die Urania-Sternwarte Wien vor. Wähnl war die erste professionelle Astronomin in Österreich, die ein Diplom in Astronomie bekam (1938) und leitete die Urania von 1952 bis 1969. Die Gründung der Urania erfolgte bereits 1888 in Berlin zur „Verbreitung der Freude an der Naturerkenntnis“, bestehend aus einer „Volks“-Sternwarte, einem wissenschaftlichen Theater (vgl. später die Idee des Planetariums) und einer Halle für Ausstellungen und interaktives Experimentieren (vgl. später naturwissenschaftlich-technische Museen und Science Center). Die Idee der Urania zur Popularisierung der Astronomie verbreitete sich ab den 1890er Jahren international über Kopenhagen, Wien (als älteste Volkssternwarte Österreichs, 1897/1910), Budapest, Zürich, Jena, Breslau, Stettin, Prag, Graz, Meran, Moskau und St. Petersburg.8
Die letzten Beiträge widmen sich der Internationalität in der modernen Astrophysik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Rita Meyer-Spasche beschäftigt sich in ihrem Kurzbeitrag mit der Wiederbelebung des internationalen Austausches im Bereich der Astronomie und Astrophysik nach 1945.
Xian Wu untersucht die Entwicklung der kosmochemischen Forschung9 am Max-Planck-Institut für Chemie (1948/49) in Mainz, gegründet bereits 1911 als Kaiser-Wilhelm-Instituts (KWI) für Chemie in Berlin-Dahlem, und den Anteil der österreichischen Wissenschaftler.
Udo Gümpel beschäftigt sich mit der jungen Forschungsrichtung, der Neutrinoastronomie, und zeigt die grosse Bedeutung der Internationalität in diesem Bereich, die stürmische Enticklung, die mit der Entdeckung des Neutrinos als „Geisterteilchen“ durch den Italiener Bruno Pontecorvo (1913–1993) und das amerikanische Team um Frederick Reines (1918–1998) und Raymond Davis Jr. (1914–2006) begann. Vom Schreibtisch eines einzelnen Theoretikers (1964) entwickelte sich die Forschung zum Großexperiment unter Beteiligung nahezu der gesamten „Physics Community“ mit hunderten von Physikern. Eine zentrale Rolle spielt das Laboratorio Nazionale Gran Sasso (LNGS) als weltgrößtes Laboratorium der Neutrino- und Astrophysik (1988) mit über tausend Forschern aus 29 Ländern. Heute ist die Neutrinophysik das Teilgebiet der experimentellen Physik mit den größten Zuwachsraten an Experimenten und Forschern in internationalen Kollaborationen – „Big Science“ par excellence – mit einer erstaunlichen Zahl von Nobelpreisen.
1 https://medienportal.univie.ac.at/uniview/uni-intern/detailansicht/artikel/ in-memoriam-thomas-posch-1974-2019/.
2 Siehe: Wolfschmidt, G. (Hg.): Astronomisches Mäzenatentum. [Astronomical Patronage.] Norderstedt: Books on Demand (Nuncius Hamburgensis; Band 11) 2008.
3 Das Booklet of Abstracts der Tagung des AKAG in Wien (2018) istz hier zu finden: https://www.FHSeV.de/Wolfschmidt/events/pdf/Booklet-AKAG-Wien-2018-Abstract. pdf.
4 Die Leitung der Jesuitensternwarte hatte ab 1756 Joseph Liesganig (1719–1799), der auch Mathematikprofessor an der Universität seit 1752 war. An der Stelle des Jesuitenkollegs, Postgasse 7–9, wurde im Mittelelter das Collegium ducale (1384), das Herzogliche Kolleg, als erstes Wiener Universitätsgebäude von Herzog Albrecht III. von Österreich gegründet.
5 Heute befindet sich dort die Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Dr.-Ignaz-Seipel-Platz (48° 12′31, 4″ N, 16°22′38, 6″ O).
6 Gauß, Carl Friedrich: Berechnung des Osterfestes. In: Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde2 (August 1800), S. 121–130 (auch in Gauß Werke, Band 6, 1874, S. 73–79.
7 Graßl, Alfons: Die Gaußsche Osterregel und ihre Grundlagen. In: Sterne und Weltraum 32 (1993), Nr. 4, S. 274–277.
8 Wolfschmidt, Gudrun: URANIA in aller Welt – Ausbreitung und Wirkung der Urania-Idee. In: Bleyer, Ulrich & Dieter B. Herrmann (Hg.): 125 Jahre Urania Berlin. Wissenschaft und Öffentlichkeit. Eugen Goldstein Kolloquium, 19. April 2013. Berlin: Westkreuz-Verlag 2013, S. 103–117.
9 Zu diesem Thema erscheint: Wolfschmidt, Gudrun (Hg.): Kosmochemie – Geschichte der Entdeckung und Erforschung der chemischen Elemente im Kosmos. Hamburg: tredition (Nuncius Hamburgensis; Band 50) 2020.