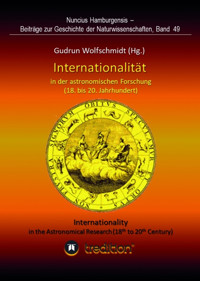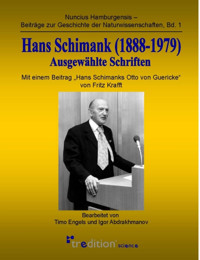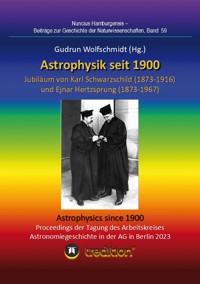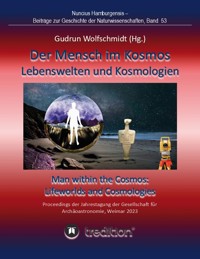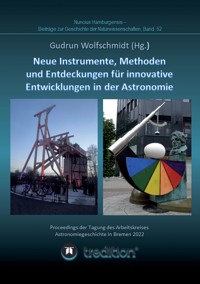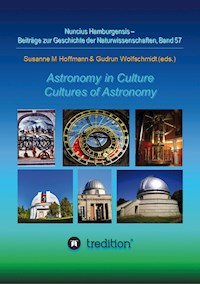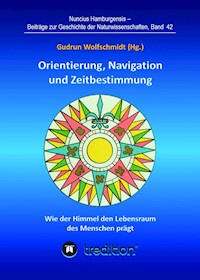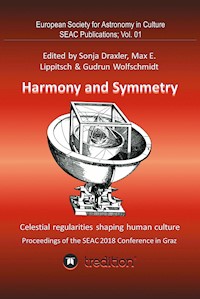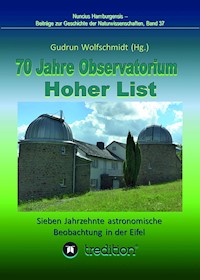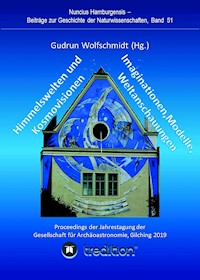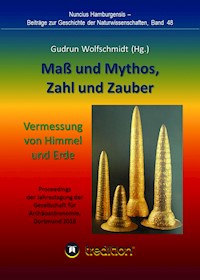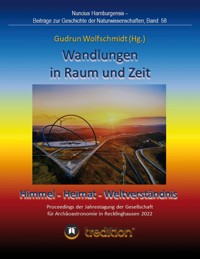
Wandlungen in Raum und Zeit: Himmel -- Heimat -- Weltverständnis. Transformations in Space and Time: Heaven -- Home -- Understanding of the World. E-Book
Gudrun Wolfschmidt
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Nuncius Hamburgensis - Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften
- Sprache: Deutsch
Das Buch "Wandlungen in Raum und Zeit" widmet sich in 14 Kapiteln der Archäo- / Kulturastronomie. Der einführende Beitrag spannt einen weiten kulturellen und thematischen Bogen von der Vorstellung vom Welt-Organismus, vom kosmischen Lebewesen in verschiedenen Kulturen. Es folgt eine Untersuchung der Konstruktion der Kreisgrabenanlage von Stonehenge. Astronomische Bezüge können mit einer astronomisch korrekten Himmelssimulation dargestellt werden. Eindrucksvoll ist das Horizontobservatorium Halde Hoheward und die grosse Sonnenuhr. Ferner wird die astronomische Ausrichtung von Galeriegräbern in der Wartbergkultur analysiert. Sechs Beiträge widmen sich der Astronomie der Bronzezeit, bei den Germanen und Kelten. Die Auszählung von metallenen Scheiben aus der Eisenzeit in Italien deutet auf astronomisches Wissen hin, besonders auf den Saroszyklus, was die Vorhersage von Mondfinsternissen ermöglicht. Aus der Bronzezeit werden Schalensteine aus der Bretagne mit Zirkumpolardarstellung sowie der Goldhut von Schifferstadt mit einer neuen Deutung des Symbols an der Spitze präsentiert. Ein Beitrag widmet sich der germanischen Mythologie, dem Gott Heimdallr, Weltenschöpfer und großer Himmelsgott. Für den Meteoriteneinschlag "Chiemgau Impakt" (900 bis 600 v. Chr.) werden geoarchäologische Belege präsentiert. Auch Astronomie in außereuropäischen Kulturen wird diskutiert, zum Beispiel, ob es den Gilgamesch-Mythos auch in China gibt, oder die Indus- und Inka-Kultur. Bei der hochmittelalterlichen Rundkapelle zu Drüggelte wird Mythos und Kulturhistorik vorgestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Wandlungen in Raum und Zeit:Himmel – Heimat – Weltverständnis
Transformations in Space and Time:Heaven – Home – Understanding of the World
Abbildung 0.1: Horizontobservatorium auf der Halde Hoheward
© Ruben Becker
Nuncius Hamburgensis
Beiträge zur Geschichte der NaturwissenschaftenBand 58
Wolfschmidt, Gudrun (Hg.)
Wandlungen in Raum und Zeit
Himmel – Heimat – Weltverständnis
Tagung der Gesellschaft für
Archäoastronomie in Recklinghausen 2022
Hamburg: tredition 2023
Nuncius Hamburgensis
Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften
Hg. von Gudrun Wolfschmidt, Universität Hamburg,
AG Geschichte der Naturwissenschaft und Technik
(ISSN 1610-6164).
Der Titel „Nuncius Hamburgensis“ wurde inspiriert von
„Sidereus Nuncius“ und von „Wandsbeker Bote“.
Wolfschmidt, Gudrun (Hg.): Wandlungen in Raum und Zeit: Himmel – Heimat – Weltverständnis. Transformations in Space and Time: Heaven – Home – Understanding of the World. Proceedings der Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie in Recklinghausen 2022. Hamburg: tredition (Nuncius Hamburgensis – Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften; Band 58) 2023.
Abbildung – Cover vorne und Frontispiz: Horizontobservatorium Halde Hoheward (© Ruben Becker)
Titelblatt: Logo Sternwarte Recklinghausen
Abbildung – Cover hinten: Trundholm (© John Lee, Dänisches Nationalmuseum); Goldener Hut von Schifferstadt (credit: O. Schmidt, Schifferstadter Tagblatt, 2021); Sonnenaufgang am Wartberg (Foto: Klaus Albrecht); Kapelle zu Drüggelte (1227) (Blankenstein 1854).
AG Geschichte der Naturwissenschaft und Technik, Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg, Bundesstraße 55 – Geomatikum, 20146 Hamburg, Germany https://www.physik.uni-hamburg.de/hs/group-wolfschmidt/
Dieser Band wurde gefördert von der Gesellschaft für Archäoastronomie und der Hans Schimank-Gedächtnisstiftung.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag von tredition GmbH.
Verlag: tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany ISBN: 978-3-347-94266-0 (Hardcover), 978-3-347-94265-3 (Softcover), 978-3-347-94267-7 (e-Book), © 2023 Gudrun Wolfschmidt.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Halbe Titelseite
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort: Wandlungen in Raum und Zeit: Himmel – Heimat – Weltverständnis
Einführung zum Thema
Mensch, Lebenswelt und Welt-Organismus – Die Vorstellung vom kosmischen Lebewesen in verschiedenen Kulturen einst (und heute)
1.1 Das Welt-Ei: Embryologie und Kosmogonie
1.2 Das urzeitliche Opfer des kosmischen Wesens; Kosmogonie und Kosmologie
1.3 Die Körperteile des Weltwesens und der kosmische Rahmen
1.4 Das trennende und verbindende dritte Wesen
1.5 Kosmisches Wesen und menschlicher Körper: Medizinische Astrologie / Iatromantie /Melothesie
1.6 Das Habitat als Modell des kosmischen Lebewesens
1.7 Lebensnetz
1.8 Zusammenfassung mit Bezug zu heutigen Überlegungen
1.9 Literatur
Interpretation des Bauplans von Stonehenge als Abbild der Himmelskugel für den 51. Breitengrad
2.1 Einleitung
2.2 Einführung in das zeichnerische sphärische Rechnen
2.3 Anwendung des zeichnerischen sphärischen Rechnens auf den Bauplan von Stonehenge
2.4 Diskussion
2.5 Anhang 1: Ein Fallbeispiel aus der Archäoastronomie – die Azimute der Sonnenwenden
2.6 Anhang 2: Der Satz des Thales als Werkzeug der zeichnerischen Rechentechnik
2.7 Literatur
Der Satz des Thales und das Tusi-Paar als Gestaltungsprinzipien prähistorischer Sakralgeometrie
3.1 Der Satz des Thales als verbindendes Element von Stonehenge zur Himmelsscheibe
3.2 Darstellung eines modifizierten Tusi-Paares auf der Himmelsscheibe von Nebra
3.3 Ergebnis und Ausblick
3.4 Das Bassin in Bibracte – ein Zustand der TKM für den 47. Breitengrad
3.5 Danksagung
3.6 Literatur
Astronomie der Steinzeit
Mehr als nur ein Steinkreis. Das Stonehenge Hidden Landscape Project
4.1 Literatur
Untersuchungen zur Ausrichtung von Galeriegräbern in der Wartbergkultur
5.1 Einleitung
5.2 Die Gräber im Einzelnen
5.2.1 Züschen
5.2.2 Altendorf
5.2.3 Calden II
5.9.4 Calden I
5.9.5 Rimbeck
5.2.6 Wehrengrund (Lohne)
5.3 Mögliche Bedeutungen der Ausrichtungen der Galeriegräber in der Wartbergkultur
5.3.1 Quarter days und Crossquarter days
5.3.2 Seelenwanderung
5.3.3 Häuser der Toten
5.4 Literatur
Kreise am Himmel erklären die Zyklen der Welt
6.1 Literatur
Megalithik in Westfalen
Astronomie der Bronzezeit, bei den Germanen und Kelten
Astronomische Bezüge auf mittelitalienischen metallenen Scheiben aus der Eisenzeit
8.1 Einleitung
8.2 Zu der Auswahl der vorgelegten Objekte
8.2.1 Spoletoscheibe groß
8.3.2 Spoletoscheibe klein
8.3.3 Scheibe im Metropolitan Museum of Art, Etruscan Art, Cat. No. 3.17
8.2.4 Avezzano Cretaro große Scheibe
8.2.5 Colli del Tronto
8.3 Auswertung
8.3.1 Resümee
8.4 Literatur
Der Schalenstein von Saint GuénaëL, Lanester, Morbihan, Bretagne – Eine Zirkumpolardarstellung aus der späten Bronzezeit, ca. 1000 V. Chr.
9.1 Einführung
9.2 Der Rahmen der Studie
9.3 Datierung anhand des Phänomens der Präzession der Erdachse
9.4 Der Schalenstein von Saint GuénaëL
9.5 Ein astronomischer Kontext?!
9.6 Zusammenfassung und Ausblick
9.7 Literatur
Der Himmelsnordpol an der Spitze der bronzezeitlichen Goldhüte vom Typ Schifferstadt und auf keltischen Münzen
10.1 Die sichtbare Drehung des Sternhimmels um den Himmelspol – in Bronzezeit und Antike ein unverstandenes „Wunder“
10.2 Der Himmelspol an der Spitze der Goldhüte
10.3 Der Goldhut von Schifferstadt
10.4 Der Himmelspol auf anderen bronzezeitlichen Objekten
10.5 Die weitere Nutzung der Goldhutsymbolik in keltischer und römischer Zeit
10.6 Himmelspol-Symbolik und Pferde auf keltischen Münzen
10.7 Keltische Sternbilder
10.8 Literatur
Prähistorische Astronomie: Das Wirken der Frauen: Eine Analyse der archäologischen und mythologischen Symbolik
11.1 Einleitung
11.2 Ein Sonnenkult in der nordischen Bronzezeit?
11.3 Astronomische Symbolik Erkennen und Deuten
11.4 Die Himmelskönigin und der Schmied
11.5 Diskussion
11.6 Literatur
Der Gott Heimdallr
12.1 Der Gott Heimdallr als Vater aller Menschen
12.2 Zusammenfassung zu Heimdallr: Heimdallr als Sinnbild für den Mittwintermond
12.3 Literatur
Menschen erlebten den Chiemgau Impakt – geoarchäologische Belege für einen prähistorischen Meteoriteneinschlag
13.1 Bibliography
Astronomie in außereuropäischen Kulturen
Gilgamesch in China? Dieselben mythologischen und astronomischen Koordinaten?
14.1 References
Binäre und Lunare Gewichtssysteme der Induskultur
15.1 Einführung in die Induskultur
15.2 Vorbemerkungen zur Terminologie
15.3 Ausgrabung von Gewichten
15.3.1 Harappa
15.3.2 Mohenjo-daro
15.3.3 Chanhu-daro
15.3.4 Dholavira
15.4 Klassifikationsmethoden
15.4.1 Histogramme
15.4.2 Plateau-Suche in Diagrammen
15.4.3 Cosinus Quantogramme
15.5 Das Kubische Gewichtssystem
15.8.1 Analyse von B. Wells
15.5.2 Suche nach einen Basiswert kubischer Gewichte
15.5.3 Klassifikation kubischer Gewichte
15.6 Ein Lunares Gewichtssystem?
15.6.1 Analyse von atypischen kubischen Gewichten
15.6.2 Analyse von kugelförmigen Gewichten
15.6.3 Analyse von tonnenförmigen Gewichten
15.6.4 Analyse von zylinderförmigen Gewichten
15.7 Gewichtseinheiten in der Induskultur
15.8 Literatur
Die Schattenphänomene der Zenitsonne am Inkaheiligtum Ollantaytambo
16.1 Incamisana von Ollantaytambo
16.2 Literatur
Archäoastronomie und Kulturgeschichte
Kapelle zu Drüggelte: Mythos und Kulturhistorik
17.1 Vorstellung der Kapelle
17.2 Stand der Forschung und Deutungstheorien
17.3 Vergleichstypen: Rheinische und Nordische Rundkirchen
17.4 Rheinisch-Westfälische Zentralbauten
17.5 Der Bautyp der Absalon-Kirchen
17.6 Der Bautyp der Bornholm-Kirchen
17.7 Der Bautyp der schwedischen Kirchen
17.8 Ansichten verschiedener Rundkirchen
17.9 Vergleiche von Ausstattung und Dekor
17.10 Querschnitte nordischer Rundkirchen
17.11 Die Grafen von Cappenberg zu Arnsberg
17.12 Graf Heinrich von Arnsberg aus dem Hause Cuyk
17.13 Herzog Heinrich „der Löwe“ von Sachsen
17.14 Bischof Absalon von Roskilde und König Waldemar (I.)
17.15 Ergebnis
17.16 Nachlese: die radiomagnetische Messung in der Apsis
17.17 Literatur
17.18 Links im Web
Exkursion: Besuch des Horizontobservatoriums Halde Hoheward und der grossen Sonnenuhr
Stonehenge – Himmelsscheibe – Hoheward. Horizontastronomie damals und heute
18.1 Einleitung – Horizontastronomie in prähistorischer Zeit
18.2 Horizontastronomie heute – eine Chance für ein bewusstes Naturerleben
18.3 Die Halde Hoheward im nördlichen Ruhrgebiet als idealer Standort für horizontastronomische Beobachtungen
18.4 Die Beobachtung des Sonnenlaufs im Horizontobservatorium
18.5 Die Anzeige besonderer Sonnenstände mit den Peilmarken auf der Horizontfläche
18.6 Das Observatorium als astronomische Land- und Zeitmarke
18.7 Zum Schluss
18.8 Literatur
Programm der Tagung Wandlungen in Raum und Zeit
19.1 Tagung Gesellschaft für Archäoastronomie in Recklinghausen, 17.–20. Juni 2022
Autoren
Nuncius Hamburgensis
Personenregister
Wandlungen in Raum und Zeit
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort: Wandlungen in Raum und Zeit: Himmel – Heimat – Weltverständnis
Personenregister
Wandlungen in Raum und Zeit
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Abbildung 0.2: Morgendämmerung in Stonehenge
(Foto: Michael A. Rappenglück)
Vorwort: Wandlungen in Raum und Zeit: Himmel – Heimat – Weltverständnis
Wolfschmidt, Gudrun (Hamburg)
Das Buch „Wandlungen in Raum und Zeit: Himmel – Heimat – Weltverständnis“ (Transformations in Space and Time: Heaven – Home – Understanding of the World) präsentiert die Vorträge der Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie in Recklinghausen 2022 in 18 Kapiteln.1 Die Tagung wurde organisiert in Kooperation mit der Westfälischen Volkssternwarte Recklinghausen vom 17. bis 21. Juni 2022.
Der einführende Beitrag zu Wandlungen in Raum und Zeit von Michael Rappenglück spannt einen weiten kulturellen und thematischen Bogen von der Vorstellung vom Welt-Organismus, vom kosmischen Lebewesen in verschiedenen Kulturen. Interessante Beispiele sind eine Schildkröte, eine Muschel, ein Oktopus, ein Drache, ein Riesenmensch oder das Ur-Ei. Die Anatomie der Lebewesen spiegelt den räumlichen Aufbau der Welt wider. Zeitliche Veränderungen des kosmischen Lebewesens finden sich als Windströme, Wasserkreislauf, Gezeiten, Jahreszeiten, usw. Die Kulturen betrachteten die Landschaft, eine Höhle, ein kultisches Gebäude, in das der Mensch eingebunden ist, als Verkörperung des kosmischen Lebewesens in Miniatur, das die Eigenschaften des makrokosmischen Wesens widerspiegelt – ein Mikrokosmos im Makrokosmos.
Burkard Steinrücken & Daniel Brown untersuchen die Kreisgrabenanlage von Stonehenge (Phase 3, um 1800 v. Chr.) und interpretieren den Bauplan von Stonehenge als Abbild der Himmelskugel für den 51. Breitengrad. Eindrucksvoll wird diskutiert wie bei der Konstruktion des Stonehenge-Bauplans nach der Hypothese [Chechelnitsky 2000] der Satz des Thales verwendet wird. Ein weiterer Beitrag von Burkard Steinrücken widmet sich dem Thema „Der Satz des Thales und das Tusi-Paar als Gestaltungsprinzipien prähistorischer Sakralgeometrie“. Diese Idee wird nicht nur bzgl. Stonehenge untersucht, sondern auch im Kontext der Himmelsscheibe von Nebra und beim Bassin im keltischen Oppidum von Bibracte.
Astronomie der Steinzeit ist auch das Thema der nächsten vier Artikel.
Georg Zotti stellt das Stonehenge Hidden Landscape Project vor. Mit Hilfe der Methoden der archäologischen Prospektion wurde die umgebende Landschaft der UNESCO-Welterbe-Fläche untersucht und weitere bislang unbekannte Monumente dokumentiert. Astronomische Bezüge können dabei mit einer astronomisch korrekten Himmelssimulation dargestellt werden.
Klaus Albrecht untersucht in seinem Beitrag die astronomische Ausrichtung von Galeriegräbern in der Wartbergkultur auf Sonnenaufgangsazimute. Eine Deutung mit religiösen Vorstellungen über heilige Berge, Seelenwanderung, Wiedergeburtsvorstellungen und eine Verehrung der Sonne an besonderen Tagen im Sonnenjahr liegt nahe.
Harald Gropp greift in seinem Kurz-Beitrag Kreise am Himmel erklären die Zyklen der Welt wieder die Himmelsscheibe von Nebra auf.
Leo Klinke führte durch die eindrucksvolle Ausstellung des LWL – Museums für Archäologie Stonehenge in Herne und präsentierte die Megalithik in Westfalen, die Trichterbecherkultur (Ganggräber) und die Wartbergkultur (Galeriegräber).
Die nächsten sechs Beiträge widmen sich Astronomie der Bronzezeit, bei den Germanen und Kelten.
Rahlf Hansen & Christine Rink fanden Astronomische Bezüge auf mittelitalienischen metallenen Scheiben aus der Eisenzeit, die der Archäologe Dr. Joachim Weidig zur Verfügung gestellt hatte. Die Auszählung der Ornamentik ergab deutliche Hinweise auf astronomisches Wissen, besonders auf den Saroszyklus. Damit könnten die Scheiben für die Vorhersagen von Mondfinsternissen genutzt worden sein.
Stefan Mäder stellt den Schalenstein von Saint Guénaël, Lanester, Morbihan, Bretagne, vor und deutet ihn als eine Zirkumpolardarstellung aus der späten Bronzezeit, ca. 1000 v. Chr.
Oskar Schmidt et al. analysiert erneut den bronzezeitlichen Goldhut vom Typ Schifferstadt. Dabei bietet er eine neue Interpretation: Statt wie bisher vermutet, dass an der Spitze der Goldhüte ein Sonnensymbol steht, könnte es sich um die Darstellung des Himmelsnordpol s handeln, der für die Nordhalbkugel eine wichtige Rolle spielt. Das Motiv findet sich auch auf keltischen Münzen. Somit repräsentiert der Goldhut den Himmel und den Kosmos.
Astrid Wokke untersucht Das Wirken der Frauen: Eine Analyse der archäologischen und mythologischen Symbolik in der nordischen Bronzezeit. Der Schwerpunkt liegt auf den Symbolen wie Kreis und Rad, sowie Hüft- und Halsschmuck. Archäologische wie mythologische Spuren führen zu Frauen, die offenbar astronomisches Wissen über die Himmelszyklen aufwiesen. Wie kann dies im Kontext der Strukturen von Wissen und Macht gedeutet werden?
Ralf Koneckis führt uns in die germanische Mythologie zum Gott Heimdallr – „Heimleuchter“, Weltenschöpfer und großer Himmelsgott – ein Sinnbild für den Wintervollmond in der großen nördlichen Wende? Auf der Grundlage des Eddalieds Völospa wird der interessante astronomische Kontext analysiert.
Barbara Rappenglück et al. widmet sich den geoarchäologischen Belegen für einen prähistorischen Meteoriteneinschlag. Große Meteoriteneinschläge werden als Auslöser auch kultureller Umwälzungen angesehen, so erlebten Menschen aus zwei Siedlungen den Chiemgau Impakt mit einem Kraterstreufeld von ca. 60 × 30 km Länge und weit über 100 Krater. Das Ereignis wird auf etwa 900 bis 600 v. Chr. in die ausgehende Bronze- / Frühe Eisenzeit datiert.
Es folgen drei Beiträge zur Astronomie in außereuropäischen Kulturen.
Jörg Bäcker diskutiert Gilgamesch in China? Dieselben mythologischen und astronomischen Koordinaten? Im Gilgamesch-Epos (7. Jh. v. Chr.) durchwandert Gilgamesch die Unterwelt auf der Suche nach Enkidu in den zwölf Monaten des Sonnenlaufes und bewältigt schwierige Aufgaben. Schließlich findet er das Kraut der Unsterblichkeit, das ihm eine Schlange wegschnappt. Eine ähnliche Erzählung gibt es über den chinesischen Hou Yi „König Yi“, das Kraut wird von seiner Frau Chang’e gestohlen (später die Mondgöttin).
Andreas Fuls analysiert Binäre und Lunare Gewichtssysteme der Induskultur, um das damalige Standardgewicht mathematisch zu ermitteln. Seine Ergebnisse zeigen, dass zusätzlich zum Binären Gewichtssystem auch andere mit einen Bezug zum Mondkalender existiert haben könnten.
Georg Zotti präsentiert Die Schattenphänomene der Zenitsonne am Inkaheiligtum Ollantaytambo in Peru zur Dezember-Sonnwende. Dazu erstellte er ein virtuelles photogrammetrisches 3D-Modell zur weiteren Untersuchung im Computerplanetarium Stellarium.
Das Kapitel Archäoastronomie und Kulturgeschichte widmet sich der mittelalterlichen Astronomie.
Christian Wiltsch untersucht in seinem eindrucksvollen Beitrag die Kapelle zu Drüggelte: Mythos und Kulturhistorik. Dieser aussergewöhnliche sakrale Rundbau (1160/66) mit vier Innenstützen und einem Säulenkranz aus zwölf Säulen wird analysiert im Kontext der vergleichenden Kunstgeschichte; es handelt sich um die südlichste Kirche des Typs „nordische Rundkirche“ (Absalon-Kirche).
Schließlich erhalten wir einen Einblick in die Exkursion: Besuch des Horizontobservatoriums Halde Hoheward und der grossen Sonnenuhr.
Burkard Steinrücken berichtet detailliert über Stonehenge – Himmelsscheibe – Hoheward. Die Horizontastronomie erlaubt(e) damals und heute die Beobachtung der sich zyklisch verändernden Auf- und Untergangsrichtungen von Sonne und Mond zur Bestimmung des Sonnenjahres in Hinblick auf Zeitordnung und Kalender.
Abbildung 0.3: Sonnenuhr und Horizontobservatorium auf Halde Hoheward
(Foto: Gudrun Wolfschmidt)
1 Hier das Booklet of Abstracts, hg. von Michael Rappenglück: http://www.archaeoastronomie.org/content/abstractbooks-der-jahrestagungen/.
Abbildung 1.1: Prinzipielle Stufen der Kosmogonie nach archaischer Anschauung
(© Michael A. Rappenglück)