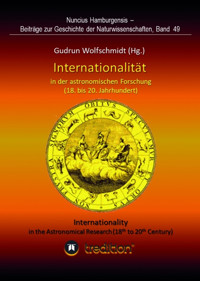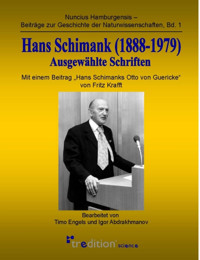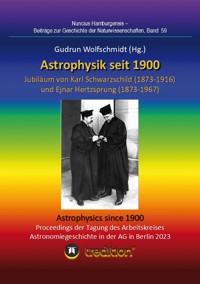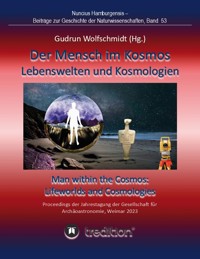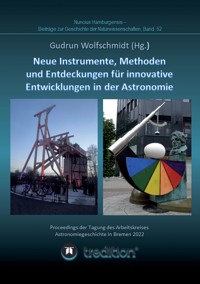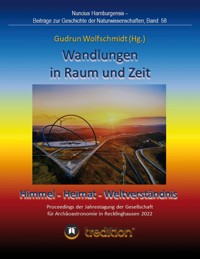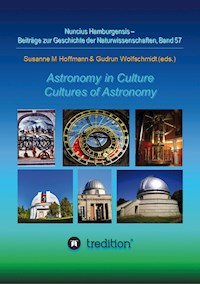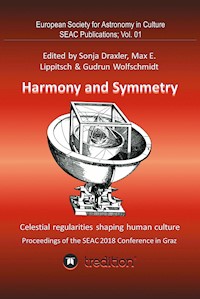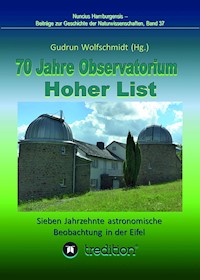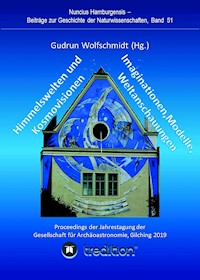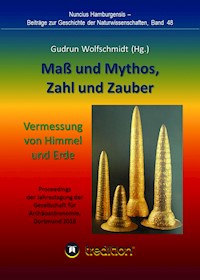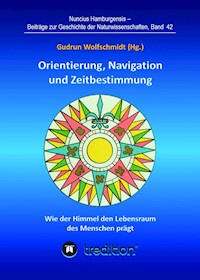
Orientierung, Navigation und Zeitbestimmung - Wie der Himmel den Lebensraum des Menschen prägt E-Book
Gudrun Wolfschmidt
9,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuncius Hamburgensis - Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften
- Sprache: Deutsch
Die Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie in Hamburg stand - passend zur maritimen Tradition - unter dem Thema Orientierung, Navigation und Zeitbestimmung. In 31 Kapiteln werden Beiträge zur Archäo- und Kulturastronomie präsentiert. Die ersten Kapitel widmen sich dem Thema Orientierung von der Steinzeit bis zum Mittelalter. Göbekli Tepe oder megalithische Steinsetzungen werden astral interpretiert. Beim bronzezeitlichen Schmuck oder bei den Externsteinen im Teutoburger Wald wird die astronomische Bedeutung diskutiert. Das Computerplanetarium Stellarium ermöglicht eindrucksvolle zeitlich veränderliche archäologische 3D-Landschaften. Ferner wird die Ausrichtung christlicher Kirchen untersucht. Die zweite Gruppe von Beiträgen thematisiert Orientierung mit Sonne, Mond und Sternen. Die "Sternenkarte" von Malta könnte zur Ausrichtung des Tempels nach Osten gedient haben. Ermöglichten Obsidianspiegel-Teleskope astronomische Beobachtungen bereits in der Steinzeit? Kosmologische Besonderheiten hinduistischer Tempel in Nepal werden untersucht, ferner Weltenbaum oder Weltenberg als zentrale Symbole des Universums. Die nächste Gruppe steht unter dem Titel Navigation - Himmlische Reiseführer. Himmlische Phänomene leiteten die Menschen auf ihren Reisen über Land, zu Wasser, in der Luft. So werden die Entwicklung der Navigationstechniken in Indien, in der Antike, bei den Wikingern bis zu neueren Navigationsmethoden vorgestellt. Die letzte Gruppe heisst Orientierung, Zeitbestimmung und Kalender. Ist der Kalenderstein bei Leodagger eine "Zählmaschine" aus der Bronzezeit oder sind auf den Kernoi in Malia, Kreta, Zyklen von Mond und Sonne dargestellt? Hat Thales sein Wissen um den Termin der totalen Sonnenfinsternis aus der nordischen Bronzezeit übernommen? Welche Rolle spielen die Mondserien für die Datierung des Mayakalenders? Kalenderschätze im Kloster ermöglichen Vorhersagen über Finsternisse. Diese Beispiele zeigen, wie der Himmel den Lebensraum des Menschen prägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 703
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Orientierung, Navigation und Zeitbestimmung –Wie der Himmel den Lebensraum des Menschen prägt
Orientation, Navigation and Time Keeping –How the Sky Shapes People’s Living Space
Abbildung 0.1:
Kompass, Madrid (1345)
Foto: Gudrun Wolfschmidt
Nuncius Hamburgensis
Beiträge zur Geschichte der NaturwissenschaftenBand 42
Wolfschmidt, Gudrun (Hg.)
Orientierung, Navigationund Zeitbestimmung
Wie der Himmel
den Lebensraum des Menschen prägt
Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie
in Hamburg 2017
Hamburg: tredition 2019
Nuncius Hamburgensis
Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften
Hg. von Gudrun Wolfschmidt, Universität Hamburg,Arbeitsgruppe Geschichte der Naturwissenschaft und Technik(ISSN 1610–6164).
Diese Reihe „Nuncius Hamburgensis“wird gefördert von der Hans Schimank-Gedächtnisstiftung.
Dieser Titel wurde inspiriert von „Sidereus Nuncius“und von „Wandsbeker Bote“.
Wolfschmidt, Gudrun (Hg.): Orientierung, Navigation und Zeitbestimmung – Wie der Himmel den Lebensraum des Menschen prägt.
Orientation, Navigation and Time Keeping – How the Sky Shapes People’s Living Space. Proceedings der Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie in Hamburg 2017. Hamburg: tredition (Nuncius Hamburgensis – Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften, Band 42) 2019.
Cover vorne und Frontispiz: Kompass, Madrid (1345), Foto: G. Wolfschmidt Cover hinten: Navigation in Polynesien (© pixabay, C00). Seeastrolab, Armille, Regimento do Norte (Foto: G. Wolfschmidt)
Arbeitsgruppe Geschichte der Naturwissenschaft und Technik,
Hamburger Sternwarte, MIN Fakultät, Universität Hamburg
Bundesstraße 55 – Geomatikum, 20146 Hamburg, Germany
http://www.hs.uni-hamburg.de/DE/GNT/w.htm
Dieser Band wurde gefördert von der Schimank-Stiftung und der Gesellschaft für Archäoastronomie.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40–44, 22359 Hamburg, Germany 978–3-7482–1146-4 (Paperback), 978–3-7482–1141-9 (Hardcover), 978–3-7497–6771-7 (e-Book), © 2019 Gudrun Wolfschmidt.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort: Orientierung, Navigation und Zeitbestimmung
Wolfschmidt, Gudrun (Hamburg)
ORIENTIERUNG VON DER STEINZEIT BIS ZUM MITTELALTER
1 Die Steintäfelchen von Jerf el Ahmar und Göbekli Tepe – Das letzte gemeinsame Projekt
Theodor Schmidt-Kaler (1930–2017), Ralf Koneckis-Bienas (Dortmund), Holger Filling, Max Schmidt-Kaler
1.1 Literatur
2 Die Konstruktionen von megalithischen Steinsetzungen am Beispiel des Höhenheiligtums am Pfitscher Sattel in der Texelgruppe Roland Gröber (Leverkusen)
2.1 Megalithische Steinsetzungen und deren Konstruktion
2.2 Die Umfassungsmauer am Pfitscher Sattel
2.2.1 Astronomische Ausrichtung
2.2.2 Konstruktion der Umfassungsmauer
2.3 Fazit
2.4 Literatur
3 Astronomie der nordischen Bronzezeit: Schmuck der Frauen – Gürtelscheiben und Halskragen astronomisch / geometrisch untersucht Astrid Wokke (Bremen)
3.1 Die Scheiben der nordischen Bronzezeit
3.2 Die Projektion der Himmelskugel
3.3 Die Untersuchung der Scheiben
3.3.1 Die Vorlagen
3.3.2 Die Vermessung
3.3.3 Die Ergebnisse
3.4 Diskussion
3.5 Literatur
4 Geopark „Erz der Alpen“ und die Himmelsscheibe von Nebra
Erich Kutil (Bischofshofen, Österreich)
5 Die Externsteine – ein astronomisches Monument?
Wolfgang Lippek (Lage)
5.1 Allgemeines zu den Externsteinen
5.2 Beobachtungsmöglichkeiten der Sonnen-/Mondaufgänge
5.3 Ein „Lichtphänomen“ in der Kuppelgrotte des Felsens 1
5.3.1 Entdeckung des „Lichtspeers“ sowie die Gründe zur Wahl des Namens
5.3.2 Technische Details zur Entstehung des „Lichtspeeres“
5.3.3 Frühere Funktion des 33 cm Spaltes
5.4 Zur sog. „Petrus-Figur“
5.4.1 Allgemeines
5.4.2 Vier Gründe gegen die Bezeichnung „Petrus-Figur“
5.5 Zusammenfassung
5.6 Literatur
6 3D und mehr: Zeitlich veränderliche 3D-Landschaften in Stellarium
Georg Zotti, Florian Schaukowitsch & Michael Wimmer (Wien, Österreich)
6.1 Einleitung
6.2 Stellarium als „Zeitmaschine“
6.3 Konfiguration von Mehrphasenmodellen
6.4 Diskussion und Ausblick
6.5 Literatur
7 Gebaut für die Sonne der Gerechtigkeit: Zur Ausrichtung christlicher
Kirchen bis zum Spätmittelalter
Christian Wiltsch (Wachtendonk)
7.1 Einleitung
7.2 Definition des Begriffs „Heliometrie“
7.3 Kernthesen
7.4 Ältester Befund
7.5 Stand der Forschung
7.6 Astronomische Grundlagen
7.7 Kulturhistorische Grundlagen
7.8 Messtechnik
7.9 Methodischer Nachweis
7.10 Konsequenz für den Stadtplan
7.11 Aspekte der Bauleitplanung
7.12 Vertiefende Literatur
7.13 Hilfreiche Links
8 Das Ostfenster der Kirche – Justierschraube bei fehlorientiertem Kirchenschiff?
Christian Wiltsch (Wachtendonk)
8.1 Einleitung
8.2 Korrektur im Grundriss
8.2.1 Beispiel Auribeau: absidialer Chor
8.3 Beispiel Dom zu Speyer: jüngerer absidialer Chor auf älterer Krypta
8.4 Beispiel St. Michel de Cuxa: gerader Chorabschluss
8.5 Korrektur im Aufriss
8.5.1 Beispiel Maguelone: Wehrkirche
8.6 Beispiel St. Radegund: Überhöhtes Fenster (nach gotischer Erweiterung)
8.6.1 St. Qurin in Neuss: Korrektur im Bauwerk (Achsknicke)
8.7 Zusammenfassung
8.8 Vertiefende Literatur
ORIENTIERUNG MIT SONNE, MOND UND STERNEN
9 Die „Sternenkarte“ von Tal-Qadi (Malta) und die Ausrichtung des Tempels von Tal-Qadi nach Osten
Klaus Albrecht (Kassel)
9.1 Bisherige Interpretationen
9.2 Ausrichtung des Tempels von Tal-Qadi
9.3 „Sternenkarte“
9.4 Literatur
10 Das Erdwerk von Altheim – astronomische und topografische Analyse seiner Einbettung in den Landschaftsraum und Diskussion der Mondwende-Interpretation
Burkard Steinrücken (Recklinghausen)
10.1 Archäoastronomische Interpretationsmöglichkeit der Ausrichtung des Erdwerkes
10.2 Phänomenologie der Mondwenden und archäoastronomische Relevanz
10.3 Literatur
11 Messung der tiefen Sonnen- und Mondwenden
Hartmut Kaschub (Berlin)
11.1 Literatur
12 Fürstengräber der Frühbronzezeit Leubingen und Helmsdorf)
Hartmut Kaschub (Berlin)
12.1 Einleitung
12.2 Grabhügel von Leubingen
12.3 Grabhügel von Helmsdorf
12.4 Das Gold der beiden Prunkgräber
12.5 Literatur
13 Ko(s)mische Tänze
Ralf Koneckis-Bienas (Dortmund)
14 Neuassyrische Sky Disc of Nineveh
Jörg R. Bauer (Baienfurt)
14.1 Literatur
15 Ein Teleskop mit einem Obsidianspiegel
Josef Vit (Oberbettingen) und Karl-Ludwig Bath (Emmendingen)
15.1 Historische Einleitung – Archäologische Funde
15.2 Steinzeitliche Obsidianspiegel im Museum in Ankara und in der Ausstellung in Karlsruhe
15.3 Bau eines Obsidianspiegel-Teleskops und astronomische Beobachtungen
15.3.1 Zum Mond-Bild
15.3.2 Zur Venus-Sichel
15.4 Fazit
15.5 Quellennachweise und Literatur
16 Planeten oder Götter oder Sonnenflecken – Transits und andere Ok- kultationen in Ost und West
Harald Gropp (Heidelberg)
16.1 Literatur
17 Kosmologische und astronomische Untersuchungen in der archäologischen Praxis am Beispiel des Anantalmgeśvara Mahadeva Tempels in Dhadhikota, Bhaktapur (Nepal)
Perry Lange (Hamburg, Kiel)
17.1 Kosmologische und astronomische Untersuchungen in der archäologischen Praxis
17.2 Kosmologische und astronomische Grundlagen der Tempelarchitektur
17.3 Forschungsgegenstand
17.4 Einordnung des Tempelareals in die Kosmologie
17.5 Das Tempelareal
17.6 Zusammenfassung
17.7 Literatur
18 The Cosmic Pillar and the Cosmic Tree – Macrocosmos and Microcosmos – Types and Areas – Questions of Origin
Jörg Bäcker (Bonn)
18.1 The Cosmic Pillar
18.2 The Cosmic Tree and the three worlds
18.3 The Planetary Tree
18.4 The Sun Tree or Calendar Tree
18.5 The Inverted Cosmic Axis
18.6 Questions of Origin
18.7 Literature
NAVIGATION – HIMMLISCHE REISEFÜHRER
19 Himmlische Reiseführer: Wie sich die alten Kulturen in Raum und Zeit orientierten
Michael Rappenglück (Gilching)
19.1 Biologische Wurzeln der Orientierung und Navigation: Karten und Kompasse
19.2 Story-Tracks und Story-Maps
19.3 Menschen der Urgeschichte auf großer Fahrt – Paläolithische Jäger und Seefahrer
19.4 Das Bezugssystem der Heimatwelt und die Übergänge zwischen Lebensräumen
19.5 Die Modellvorstellung des kosmischen Gehäuses
19.5.1 Selbstbewusstsein und die Mitte der Welt
19.5.2 Trennungen und Grenzen
19.5.3 Gehege, Gehäuse, Kapselungen
19.5.4 Wandungen und Öffnungen: Eingänge, Ausgänge und Passagen
19.5.5 Licht und Schattenspiele: Chronotopos
19.5.6 Orientierung im Weltgehäuse: Die Kosmographische Symbolik der Bauelemente
19.5.7 Die Einbettung der Siedlung in die Umwelt
19.6 Weltraum und Weltinnenraum: Weltenfahrten zu terrestrischen, himmlischen und spirituellen Welten
19.7 Flieg mich zum Mond und darüber hinaus
19.8 Schlussbemerkung: Die Vermessung von Raum und Zeit
19.9 Literatur
20 The evolution of navigational techniques
Shylaja B. S. (Bangalore, India)
20.1 Astronomical Techniques
20.2 Evolution of instruments
20.2.1 Kamaal: achieving the precision
20.2.2 Dhrubhrama Yantra
20.2.3 Astrolabe
20.2.4 Other techniques
20.3 Conclusions
20.4 Appendix A: Altitude measures of stars other than the Pole star to fix the latitude
20.5 Appendix B – Using two stars of equal altitude to fix the latitude of the place
20.6 Literature
21 Navigation in der Antike – Landmarken, Gestirne, Winde, Leuchttürme
Heidemarie Tauber (Hamburg)
21.1 Einleitung
21.2 Seefahrt im östlichen Mittelmeer in der späten Bronzezeit (1600–1050 v. Chr.)
21.2.1 Das Wrack von Gelidonya
21.2.2 Das Wrack von Uluburun
21.2.3 Die Hafenstadt Ugarit
21.3 Schriftliche Quellen zur Schifffahrtskunde
21.3.1 Landmarken, Winde, Sternbilder – Darstellungen in der Odyssee
21.3.2 Sternbilder in den Phainomena des Aratos
21.3.3 Windrichtungen am „Turm der Winde“ in Athen
21.3.4 Handbücher (Fahrtenbücher)
21.4 Häfen und Leuchttürme
21.5 Schlussbetrachtung
21.6 Quellen und Literatur
21.6.1 Quellen
21.6.2 Literatur
22 Wikingerzeitliche Navigation
Perry Lange (Hamburg, Kiel)
22.1 Einleitung
22.2 Das Wikingerschiff
22.3 Die Meere der Wikinger
22.4 Handelswege und Handelsgüter
22.5 Die Navigation der Wikinger
22.5.1 Segelanweisungen
22.5.2 Lot und Peilstange
22.5.3 Seezeichen
22.5.4 Wiederkehrende Winde als Hilfsmittel zur Navigation
22.5.5 Vogelbeobachtung und Navigation
22.5.6 Der Leidarsteinn
22.5.7 Die Peilscheibe vom Siglufjord
22.5.8 Das Sonnenschattenbrett
22.5.9 Die Wasseruhr
22.5.10 Der Sólarsteinn (Sonnenstein)
22.6 Zusammenfassung
22.7 Literatur
23 Der Nachtsprung. Auf den terminologischen Spuren der nautischen Navigationsanfänge
Agnes Czerczer (Hamburg)
23.1 Nachtsprung. Das Kompositum und die Wortbedeutung
23.2 Die ersten „Nachtsprünge“ in der Geschichte der Seefahrt
23.3 Nachtsprung im Sinne einer Fachbezeichnung
23.4 Nachwort
23.5 Literatur
24 Das Astrolabium: das astronomische Rechengerät des Mittelalters
Georg Zotti (Wien, Österreich)
24.1 Einleitung
24.2 Stundensysteme im Spätmittelalter
24.3 Aufbau
24.4 Gebrauch
24.5 Besonderheiten Islamischer Astrolabien
24.6 Seefahrerastrolab
24.7 Universalastrolabien
24.8 Moderne Nachfolger
24.9 Astrolabien aus Holz
24.10 Literatur
25 Sterne weisen den Weg – Geschichte der Navigation
Gudrun Wolfschmidt (Hamburg)
25.1 Einleitung
25.2 Navigation in der Antike
25.3 Navigation im Mittelalter
25.4 Der Weg zum Magnetkompass
25.5 Koppel-Navigation: Sanduhr, Log und Pinnkompaß
25.6 Astronomische Navigation: Vom Seeastrolab und Jakobsstab bis zum Sextanten
25.7 Zeitmessung und Längengrad
25.8 Ausblick
25.9 Literatur
ORIENTIERUNG, ZEITBESTIMMUNG UND KALENDER
26 Der Vorläufer einer Oktaëteris auf dem Kalenderstein bei Leo dagger/Pulkau?
Irene Hager und Stefan Borovits (Wien, Österreich)
26.1 Einleitung
26.2 Eine Hypothese
26.2.1 Ein Exkurs in die Geschichte des Kalenderwesens:
Was ist eine Oktaëteris?
26.2.2 Astronomisch/kalendarische „Zählmaschinen“ aus der Bronzezeit
26.2.3 Warum eine Oktaëteris auf dem Kalenderstein?
26.2.4 Umstände und Funde, welche die Hypothese stützen
26.3 Probleme mit der Hypothese
26.3.1 Schwache methodische Absicherung der Hypothese
26.3.2 Mehrere Erklärungsansätze stehen zur Diskussion
26.3.3 Zeitstellung – eine Oktaëteris in der Bronzezeit?
26.4 Resümee und Ausblick
26.5 Literatur
27 Der minoische Kalender – eine Brücke von Babylon nach Nebra
Rahlf Hansen und Christine Rink (Hamburg)
27.1 Von Babylon nach Nebra
27.2 Der Babylonische Kalender
27.3 Die Himmelsscheibe von Nebra
27.4 Die Kernoi in Malia
27.5 Der Kalender auf den Kernoi
27.6 Mögliche archäologische Hinweise auf die Plejadenschaltung
27.7 Weitere Hinweise auf die Plejaden als Kalendergestirn
27.8 Der Aufstieg von Canopus und die Geburt von Zeus
27.9 Die Woche
27.10 Zusammenfassung
27.11 Literatur
28 Echnatons Monotheismus als Folge kosmischer Umschwünge?
Rahlf Hansen und Christine Rink (Hamburg)
28.1 Einleitung
28.2 Echnaton und seine neue Religion
28.3 Die Astronomie
28.4 Zusammenfassung
28.5 Anhang 1: Vom Verschwinden der Sterne – die Extinktion
28.6 Anhang 2: Die Refraktion
28.7 Literatur
29 Thales als Leuchtturm in der Achsenzeit
Christine Rink und Rahlf Hansen (Hamburg)
29.1 Einleitung
29.2 Die wissenschaftliche Methodik und ihre Erfolge in der nordischen Bronzezeit und darüber hinaus
29.2.1 Die Himmelsscheibe von Nebra
29.2.2 Der Sonnenwagen von Trundholm
29.2.3 Der Berliner Goldhut
29.3 Die Bedeutung und das Scheitern der babylonischen Plejadenschaltregel
29.3.1 Nabonid
29.3.2 Die Perser und Persepolis
29.3.3 Das Alte Testament
29.4 Resümee
29.5 Literatur
30 Die Entzifferung der Mondserien und ihre Relevanz für die Datierung des Mayakalenders
Andreas Fuls (Berlin)
30.1 Der Mayakalender
30.2 Die Mondserien
30.3 Die Finsternistafel im Dresdener Kodex
30.4 Das Mondalter im Mayakalender
30.4.1 Die Entzifferung der Mondaltersglyphen
30.4.2 Vergleich der Mondaltersangaben
30.4.3 Berechnung von Mondaltersangaben
30.4.4 Die Mondphase im Mayakalender
30.5 Die Datierung des Mayakalenders
30.5.1 Das Mondalter in der Datierungsfrage
30.5.2 Mehrdeutigkeit bei der astronomischen Datierung?
30.6 Literatur
31 Über die Vorhersagbarkeit von Sonnenfinsternissen am Beispiel der Maya
Robert Schweitzer (Ober-Ramstadt)
31.1 Quellen und Literatur
32 Mönche als Hüter der Zeit – Kalenderschätze im Stift Rein
Sonja Draxler & Max E. Lippitsch (Graz, Österreich)
32.1 Einleitung
32.2 Wurmprecht-Kalender(1373)
32.3 Kalendertisch im Stift Rein, Andreas Pleninger (1607)
32.4 Weitere Kalender
32.5 Literatur
33 Programm: Orientierung, Navigation und Zeitbestimmung – Wie der Himmel den Lebensraum des Menschen prägt – Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie, Hamburg, 30.9.–3.10.2017
33.0.1 SOC – Scientific Organizing Committee
33.0.2 LOC – Local Organizing Committee
33.1 Samstag, 30. September 2017, Hamburg, Bundesstraße 55, Geomatikum, Seminarraum 241
33.2 Sonntag, 1. Oktober 2017, Hamburger Sternwarte in Bergedorf
33.3 Montag, 2. Oktober 2017, Hamburg, Geomatikum, Hörsaal 5
33.4 Dienstag, 3. Oktober 2017, Hamburg, Geomatikum, Hörsaal 5
33.5 Teilnehmer / List of Participants – Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie 2017
33.6 Links: Auf den Spuren der Astronomie in Hamburg
33.6.1 Allgemeine Links
33.6.2 Museen und Sammlungen in Hamburg
Autoren
Nuncius Hamburgensis
Personenindex
Vorwort: Orientierung, Navigation und Zeitbestimmung – Wie der Himmel den Lebensraum des Menschen prägt
Wolfschmidt, Gudrun (Hamburg)
Die Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie1 in Hamburg (2017) stand – passend zur maritimen Tradition – unter dem Thema Orientierung, Navigation und Zeitbestimmung.2 In 31 Kapiteln werden Beiträge zur Archäo- und Kulturastronomie von mehr als 30 Autoren präsentiert.
Die ersten Kapitel widmen sich dem Thema Orientierung von der Steinzeit bis zum Mittelalter. Die Steintäfelchen von Jerf el Ahmar und Göbekli Tepe werden vom Autorenteam Theodor Schmidt-Kaler (1930–2017), Ralf Koneckis-Bienas et al. astral interpretiert als Reaktion auf zwei Meteoriteneinschläge. Roland Gröber diskutiert die Konstruktion von megalithischen Steinsetzungen und eine geometrische und astronomische Ausrichtung am Beispiel des Höhenheiligtums am Pfitscher Sattel bei Meran.
Astrid Wokke beschäftigt sich mit der Astronomie der nordischen Bronzezeit und untersucht den Schmuck der Frauen, die Gürtelscheiben und Halskragen, geometrisch auf eine astronomische Bedeutung.
Wolfgang Lippek diskutiert die Externsteine im Teutoburger Wald und ihre astronomische Bedeutung. Burkard Steinrücken (2013) hat sich gründlich mit neuer Vermesssung und Analyse der mutmaßlichen astronomischen Peilungen an den Externsteinen auseinandergesetzt. Man hätte eine Rezeption dieser Arbeit erwartet und man sollte sich auch deutlich von der Instrumentalisierung der Externsteine im 3. Reich als germanische Kultstätte absetzen wie z. B. Ute Halle (2002). Lippeks neuer Deutungsvorschlag mit Odins „Lichtspeer“ (statt Petrus) ist zudem nicht genügend belegt.
Georg Zotti et al. erzeugen mit dem Computerplanetarium Stellarium eindrucksvolle zeitlich veränderliche archäologische 3D-Landschaften, um interaktiv Sichtlinien zwischen Monumenten, Landschaftsmerkmalen und dem Himmel alter (oder gegenwärtiger) Kulturen zu erkunden.
In eindrucksvoller Weise präsentiert Christian Wiltsch seinen Beitrag Gebaut für die Sonne der Gerechtigkeit: Zur Ausrichtung christlicher Kirchen bis zumSpätmittelalter, basierend auf seiner Definition des Begriffs „Heliometrie“,3 den er nach einer systematischen Untersuchung von über 1000 Kirchen in NRW eingeführt hat. Bei seinem zweiten Beitrag zeigt Christian Wiltsch die Bedeutung des Ostfensters der Kirche als wichtigen Teil des kirchlichen Baukonzeptes, damit die Gemeinde real einen Sonnenaufgang erleben kann. Zudem kann eine Missweisung des Kirchenschiffs mit Hilfe des Ostfensters korrigiert werden.
Die zweite Gruppe von Beiträgen steht unter dem Thema Orientierung mit Sonne, Mond und Sternen. Klaus Albrecht interpretiert die Linien auf der „Sternenkarte“ von Tal-Qadi (Malta) als wichtige Sonnenaufgangsazimute am Horizont, die ein Hilfsmittel zur Ausrichtung des Tempels von Tal-Qadi nach Osten gedient haben könnten.
Burkard Steinrücken stellt das steinzeitliche Erdwerk von Altheim vor mit einer astronomischen und topografischen Analyse seiner Einbettung in den Landschaftsraum und mit der Ausrichtung der Symmetrieachse der Anlage auf die nördlichsten Monduntergänge in den Zeiten Großer Mondwenden.
Hartmut Kaschub vermißt tiefe Sonnen- und Mondwenden und macht sich Gedanken über die erreichbare Meßgenauigkeit bei den alten Kulturen. Daran schließt sich ein Gold-Fund aus den frühbronzezeitlichen Fürstengräbern Leubingen und Helmsdorf an, für den er eine Interpretation als Meßinstrument für die tiefen Sonnen- und Mondwenden vorschlägt. Ralf Koneckis-Bienas diskutiert die Frage des Zusammenhanges von Tänzen der Völker mit den Bewegungen der Gestirne, dem Tanz von Sonne, Mond und Planeten.
Josef Vit und Karl-Ludwig Bath berichten über den Bau eines Obsidianspiegel-Teleskops und ihre damit erfolgreich gemachten astronomischen Beobachtungen. Harald Gropp weist neben Sonnen- und Mond-Finsternissen und den seltenen Transits auf Okkultationen, totale oder partielle Bedeckungen der fünf Planeten untereinander, hin und wirft die Frage auf, ob solche Ereignisse historisch beobachtet wurden.
Perry Lange nutzt kosmologische und astronomische Besonderheiten hinduistischer Sakralarchitektur – am Beispiel Anantalmgeśvara Mahadeva Śhiva Tempels in Dhadhikota, Bhaktapur (Nepal) – zur Untersuchung baugeschichtlicher Entwicklungen.
Jörg Bäcker präsentiert den Weltenpfeiler, Weltenbaum oder Weltenberg als zentrale Symbole des Universums und deren besondere Bedeutung bei der Abfolge der Weltzeitalter basierend auf „Hamlet’s Mill“ (Santillana & Dechend 1977).
Die nächste Gruppe von Beiträgen steht unter dem Titel Navigation – Himmlische Reiseführer. Michael Rappenglück diskutiert die himmlischen Phänomene, die Menschen auf ihren Wanderungen leiten. Die Bewegung der Sonne, des Mondes, bestimmter Sterne und Sterngruppen oder auch der Milchstraße dienten zur Orientierung und Navigation für Reisen über Land, zu Wasser, in der Luft und dann auch im Weltraum, aber auch für die kosmischen Wege, Himmel- und Unterweltsfahrten in Mythen.
Shylaja B. S. stellt die Entwicklung der Navigationstechniken in Indien vor, insbesondere die Instrumente wie Kamaal, Dhrubhrama Yantra, Astrolab, und prüft deren Genauigkeit. Heidi Tauber beschäftigt sich ausführlich mit der Navigation in der Antike und diskutiert die Rolle von Landmarken (am Beispiel von Homers Odyssee), Sternbildern (Aratos Phainomena), Winden (u.a. Turm der Winde in Athen), Häfen und Leuchttürmen.
Perry Lange präsentiert diverse Navigationsmethoden der Wikinger von der Küsten- zur Überseeschifffahrt – im Kontext der Entwicklung des Handels – und analysiert sie kritisch. Agnes Czerczer beschreibt wie den ersten Seefahrern ein Nachtsprung, eine nächtliche Seereise, mit Hilfe der Orientierung an Sternen nahe dem Himmelspol gelingen konnte. Zudem untersucht sie das Wort Nachtsprung terminologisch.
Georg Zotti analysiert das Astrolabium, das wichtige astronomische Rechengerät des Mittelalters, bzgl. Aufbau, Gebrauch und mit Vorstellung verschiedener Astrolabien.
Gudrun Wolfschmidt gibt mit dem Titel „Sterne weisen den Weg“ einen Überblick über die Geschichte der Navigation beginnend mit Antike und Mittelalter bis zu neueren Navigationsmethoden: Magnetkompass, Koppel-Navigation, Astronomische Navigation (Seeastrolab, Jakobsstab, Sextant), sowie Zeitmessung und Längengrad.
Die letzte Gruppe der Beiträge steht unter dem Thema Orientierung, Zeitbestimmung und Kalender. Irene Hager und Stefan Borovits diskutieren ob der Kalenderstein bei Leodagger, Pulkau, eine „Zählmaschine“ aus der Bronzezeit, einen Vorläufer der Oktaëteris, darstellt, und welche Funde die Hypothese stützen und welche Probleme es dabei gibt.
Rahlf Hansen und Christine Rink vermuten, dass mit Hilfe der Kalender auf den Kernoi in Malia, Kreta, nach der babylonischen Plejaden-Schaltregel die Zyklen von Mond und Sonne harmonisiert wurden, so dass es eine Brücke von Babylon über die minoische Kultur nach Nebra geben könnte. In einem weiteren Beitrag fragen Rahlf Hansen und Christine Rink, ob das Auslaufen der Gültigkeit der babylonischen Schaltregel zur Regelung eines lunisolaren Kalenders zur Entstehung der Monotheismen – nicht nur im Judentum und im Islam – beigetragen haben könnten, sondern auch zum Monotheismus im alten Ägypten unter Echnaton [Amenophis IV.], Pharao der 18. Dynastie von 1351/53 bis 1334/36 v. Chr. Ein dritter Beitrag von Christine Rink und Rahlf Hansen widmet sich der Frage, ob Thales nicht nur das Wissen um den Termin der totalen Sonnenfinsternis aus der nordischen Bronzezeit übernommen hat, sondern auch das dahinterstehende Programm (Himmelsscheibe von Nebra, Sonnenwagen, Goldhüte).
Abbildung 0.2:
Hafen Hamburg
Foto: Gudrun Wolfschmidt
Andreas Fuls diskutiert die Rolle, die die Mondserien, entziffert seit 1925, für die Datierung des Mayakalenders spielen. Vorher mußte aber geklärt werden, ab wann die Maya das Mondalter (Neumond/Neulicht oder Vollmond) zählten, wobei sich ersteres als richtig herausstellte. Robert Schweitzer beschäftigt sich mit der Vorhersagbarkeit von Sonnenfinsternissen am Beispiel der Maya.
Schließlich präsentieren Sonja Draxler & Max E. Lippitsch mit dem Titel Mönche als Hüter der Zeit die Kalenderschätze im Zisterzienserkloster Stift Rein: Wurmprecht-Kalender (1373) mit Vorhersagen über Sonnen- und Mondfinsternisse und der Kalendertisch, Andreas Pleninger (1607), mit Julianischem und Gregorianischen Kalender. Diese Beispiele zeigen, wie der Himmel den Lebensraum des Menschen prägt.
1 http://archaeoastronomie.org/content/aktuelle-tagungen/.
2 https://www.hs.uni-hamburg.de/DE/GNT/events/Archaeo-HH-2017.php.
3 Wiltsch, Christian: Das Prinzip der Heliometrie im Lageplan mittelalterlicher Kirchen: Nachweis der Ausrichtung von Kirchenachsen nach Sonnenständen an Kirchweih und Patronatsfest und den Folgen für die Stadtplanung. Herzogenrath bei Aachen: Shaker 2014.
Abbildung 1.1:
Göbekli Tepe, Pfeiler 2 (Pillar 2), Enclosure A (Layer III), mit Flachreliefs von Stier, Fuchs und Kranich (with low reliefs of what are believed to be a bull, fox, and crane)
(https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe#/media/File: Gobekli_Tepe_2.jpg, Teomancimit)
Die Steintäfelchen von Jerf el Ahmar und Göbekli Tepe – Das letzte gemeinsame Projekt
Theodor Schmidt-Kaler (1930–2017),Ralf Koneckis-Bienas (Dortmund),Holger Filling, Max Schmidt-Kaler
Abstract
The change from the Paleolithic economy of collectors and hunters to the Neolithic beginnings of agriculture and cattle breeding in Upper Mesopotamia is – according to our opinion – due to two cosmic events of the post-glacial period: the asteroid impacts at 10,900 and 10,340 BC. Due to the sudden weather change to cold and dry climatic conditions, reorganization of the economic forms happened.
But after just a few generations a new group of priests and craftsmen developed, dealing with asteroid impacts by carefully observing the sky, the sun, the moon, the planets and other phenomena like shooting stars and fireballs. Representations of these astronomical events can be found on tablets, drawings and sculptures that are interpreted by us, as a suggestion, astral. Impressive testimonies of a cosmic show begin 340 years after the last big impact with the construction of the site D in Göbekli Tepe (9,990 ± 30 BC, DAI Berlin 2016).
Zusammenfassung
Der Wandel von der altsteinzeitlichen Wirtschaftsform des Sammler- und Jägertums zu den jungsteinzeitlichen Anfängen des Ackerbaues und der Viehzucht in Ober-Mesopotamien wird unserer Auffassung nach durch zwei kosmische Ereignisse der
Abbildung 1.2:
Göbekli Tepe, Şanlıurfa
(https://en.wikipedia.org/wiki/File: G%C3%B6bekli_Tepe,_Urfa.jpg, Teomancimit)
Nach-Eiszeit zwar nicht begründet, aber dennoch wegweisend geprägt: Es geht um die Asteroideneinschläge um 10.900 und 10.340 v. Chr. Denn schon kurz nach dem plötzlichen Wetterwandel zu kalten und trockenen Klimabedingungen etwa ab 10.900 v. Chr. folgten weitergehende Umstellungen der Wirtschaftsformen.
Aufgrund der kosmischen Einschläge gab es Rückschläge in der Landwirtschaft. Doch schon nach wenigen Generationen einer erfolgreichen Vorrats- und Viehbewirtschaftung entwickelte sich eine Priester- und Handwerkergeneration, die sich – unserer Auffassung nach – mit der Ursache und mit der rituellen Abwehr der zuvor erlebten Asteroideneinschläge beschäftige. Dazu war eine genaue Beobachtung des bewegten Himmels, der Sonne, des Mondes, der Planeten und anderen Erscheinungen wie Asteroiden, Boliden, Feuerkugeln und Meteoriten notwendig.
Darstellungen astronomischer Ergebnisse lassen sich auf Täfelchen, Zeichnungen und Plastiken finden, die von uns, als Vorschlag, astral gedeutet werden. Ferner mußte der Himmel vermessen und die Zeiten der Gestirne bestimmt und miteinander verglichen werden, um die kosmischen Ereignisse in eine verständliche Bildersprache festhalten zu können. Beeindruckende Zeugnisse einer kosmischen Schau beginnen 340 Jahre nach dem letzten großen Einschlag mit dem Bau der Anlage D in Göbekli Tepe (9.990 ± 30 v. Chr., DAI Berlin 2016). Es folgen weitere Anlagen, bis die Heiligtümer wieder durch rituelles Vergraben und Abwanderung, möglicherweise kurz zuvor oder nach einer weiteren kosmischen Katastrophe in der Mitte des 8. Jahrtausends. v. Chr. (wohl um 7.553 v. Chr.) von den Menschen verlassen wurde.
1.1 Literatur
SCHMIDT, KLAUS:Sie bauten die ersten Tempel: Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger. Die archäologische Entdeckung am Göbekli Tepe. München: C. H. Beck 2008.
BADISCHES LANDESMUSEUM (Hg.): Vor 12.000 Jahren in Anatolien. Die ältesten Monumente der Menschheit. Stuttgart: Theiss 2007.
MENGHIN, WILFRIED (Hg.): Astronomische Orientierung und Kalender in der Vorgeschichte – Internationales Kolloquium vom 9.11.–11.11.2006 im Museum für Vor- und Frühgeschichte. Berlin (Acta Praehistorica et Archaeologica; Band 40) 2008.
HEINLEIN, DIETER: Götterboten – Feuer vom Himmel, eine kleine Meteoritenkunde. Laupheim: Sternwarte Laupheim e.V. 2002 (25 S.).
HAIDINGER, WILHELM KARL VON: Der Meteoreisenfall von Hraschina bei Agram am 26. Mai 1751. In: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Classe, XXXV. Band, No. 11; Wien 1859, S. 361–388.
RENDTEL, JÜRGEN & RAINER ARLT: Meteore – Eine Einführung für Hobbyastronomen. Erlangen: Oculum-Verlag 2012; http://www.imo.net/video/vdemos. html).
Abbildung 2.1:
Kultstein zwischen den beiden Kammern mit „Opferrinne“
Foto: Roland Gröber
Die Konstruktionen von megalithischen Steinsetzungen am Beispiel des Höhenheiligtums am Pfitscher Sattel in der Texelgruppe
Roland Gröber (Leverkusen)
Abstract
In Europe, there are numerous megalithic stone settings in different forms. What many have in common is that their floor plans have not been set aimlessly in the landscape, but have been built according to well-considered rules. In addition to geometric figures (e.g., circles, triangles, trapezoids), unit dimensions and astronomical orientations were integral parts of the designs. The Englishman Alexander Thom (1894–1985) was able to identify common rules on many stone plans based on measurements of floor plans. On the basis of this, the enclosing wall of the mountain sanctuary on the Pfitscher saddle in the Texel group will be examined. Although the place of worship does not correspond to the usual stone settings with large rocks, but consists “only” of a layered drywall, some of the rules can also be demonstrated at the cult site.
Zusammenfassung
In Europa gibt es zahlreiche megalithische Steinsetzungen in unterschiedlichen Formen. Vielen gemeinsam ist, dass deren Grundrisse nicht planlos in die Landschaft gesetzt wurden, sondern nach wohlüberlegten Regeln errichtet wurden. Neben geometrischen Figuren (z. B. Kreise, Dreiecke, Trapeze) waren Einheitsmaße und astronomische Ausrichtungen wesentliche Bestandteile der Konstruktionen. Der Engländer Alexander Thom (1894–1985) konnte aufgrund zahlreicher vermessener Grundrisse an vielen Steinsetzungen gemeinsame Regeln nachweisen. Anhand dieser soll die Umfassungsmauer des Höhenheiligtums am Pfitscher Sattel in der Texelgruppe untersucht werden. Der Kultplatz entspricht zwar nicht den üblichen Steinsetzungen mit großen Felsen, sondern besteht „nur“ aus einer aufgeschichteten Trockenmauer. Einige der Regeln für die Konstruktion megalithischer Steinsetzungen lassen sich jedoch am Kultplatz ebenfalls nachweisen.
Seit vielen Jahren forsche ich über Schalensteine am Pfitscher Sattel in der Texelgruppe bei Meran. Die Kultstätte besteht aus einer Umfassungsmauer aus geschichteten Felsplatten mit zahlreichen Schalensteinen innerhalb der Mauer.1 Ein wesentliches Argument für die These einer frühzeitlichen astronomischen Beobachtungsstätte war neben den Schalensteinen die Umfassungsmauer der gesamten Anlage.
Diese wird von einigen Skeptikern als Teil einer rezenten Almwirtschaft eingeordnet. Obwohl eine zeitweilige landwirtschaftliche Nutzung nicht völlig auszuschließen ist, sind die Ursprünge vermutlich sehr viel älter. – Wie aber weist man dieses nach?
2.1 Megalithische Steinsetzungen und deren Konstruktion
Anhand einiger Beispiele bekannter megalithischer Steinsetzungen und deren Konstruktionsregeln soll dieses hohe Alter, das für einige der Schalensteine nachgewiesen wurde, auch für die Umfassungsmauer gezeigt werden.
Schon vor 7000 Jahren wurden am „Eisernen Tor“ an der Donau in Lepinski Vir mit Schnur und Stab trapezförmige Hausgrundrisse konstruiert. Die Erbauer arbeiteten nach einem ausgefeilten Plan, mit einer festgelegten Folge technischer Verfahren der Geometrie, der Vermessung und des Baus.2
Die fächerförmig angelegten 22 Hütten haben alle als Grundfläche ein gleichschenkeliges Trapez und einen Kreisbogen als Basis. Die regelmäßig gesetzten Löcher der Pfosten für das Dach belegen geometrische Figuren durch drei gleichschenkelige Dreiecke und zwei Kreise. Insgesamt eine sehr komplexe Konstruktion der Häuser.
Abbildung 2.2:
Lepinski Vir, Hausgrundriss Nr. 37 und mathematische Konstruktion
Rappenglück 1995.
Um 4000 v. Chr. beginnt auf den Britischen Inseln die Neolithische Periode. In deren Folge entstanden etwa 1000 Steinsetzungen, vermutlich waren es mehr.
Alexander Thom, Professor für Ingenieurwissenschaften in Oxford und sein Sohn Archibald Stevenson Thom haben in rund 50 Jahren „Feldarbeit“, vor allem in den 1960 und 1970er Jahren etwa 300 Ringe in Großbritannien und Steinalleen in Nordwestfrankreich vermessen. Dabei bemerkten sie, dass die Steinringe sehr unterschiedliche Formen besitzen. Sie bilden Kreise, Ellipsen, auf einer Hälfte abgeflachte Kreise, Eiformen und einige spezielle Formen. Thom gelang es damit als erstem, die megalithischen Ringe nach einer fundierten Klassifizierung zu ordnen und zu systematisieren.3
Abbildung 2.3:
Megalithische Kreisformen (GB)
Grafik: A. Thom
Kreise waren mit einer Schnur und einem Stab im Zentrum recht einfach zu konstruieren. Auch die Ellipsenform war im Prinzip einfach zu erstellen, indem man mit zwei Pflöcken im Abstand der Brennpunkte und einer Seilschlaufe die auf die große und kleine Halbachse abgestimmt war, die Ellipse zeichnen konnte. Diese Technik erforderte bereits eine Grundkenntnis der Geometrie. Noch aufwendiger waren die kreisförmigen Gebilde.
Diese waren nun keine verunglückten Kreise sondern gezielte Abweichungen von der Kreisform, die durch Verwendung von rechtwinkeligen Dreiecken und unterschiedlichen Radien konstruiert wurden.
Alexander Thom fand bei seinen zahlreichen Vermessungen ein Maß, das bei sehr vielen Steinsetzungen immer wieder als Vielfaches in den Längen enthalten war. Die Analyse einiger hundert Plätze ergab eine Standardlänge von 2,72 Fuß, oder im metrischen System von 82,9 cm. Wegen der Nähe zum Yard (= 3 Fuß) nannte er das Einheitsmaß „Megalithisches Yard“, das im deutschen Sprachgebrauch, teilweise mit geringfügigen Abweichungen, von verschiedenen Frühgeschichts-Forschern als Megalithische Elle bezeichnet wird und in ganz Mitteleuropa Verwendung fand.4
Daneben fand Thom noch eine weitere Besonderheit. Die Megalithiker versuchten nach Möglichkeit die Strecken, z. B. die Radien, die Konstruktionsdreiecke oder die Umfänge ganzzahlig zu gestalten. Daraus ergaben sich dann z. B. Dreiecke mit ganzzahligen Seitenlängen, sogenannte pythagoreische Dreiecke.
Abbildung 2.4:
Woodhenge
Grafik, Foto: A. Thom, Roland Gröber
Bei der besonders komplexen Ringanlage Woodhenge sind mehrere dieser Vorgaben erfüllt. Die Anlage, 3 km nordöstlich von Stonehenge gelegen, bestand ursprünglich aus zahlreichen Holzpfosten – daher Woodhege. Die Umfänge der symmetrisch ineinander geschachtelten Steinkreise vom Typ I sind jeweils geradzahlig in 20er Schritten – 120 fehlt – gesetzt. Das Dreieck ABC, und das symmetrische Dreieck ABD, dessen Spitze C bzw. D die Krümmungsmittelpunkte der gegenüber liegenden Verbindungsbogen sind, sind pythagoreische Dreiecke mit den Ausgangswerten 12 – 35 – 37 ME, allerdings in halber Größe als 6 – 17,5 – 18,5 ME gesetzt.
Mit der Ausrichtung der großen Achse auf den Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende ist auch eine Regel eines astronomischen Bezuges erfüllt.
Fasst man die Erkenntnisse von Thom, die hier nur bruchstückweise vorgestellt werden konnten, zusammen, dann ergeben sich die wichtigsten Regeln für megalithische Steinsetzungen:
• Die Anlagen werden nach einem vorbestimmten Plan konstruiert
• Häufig sind astronomische Ausrichtungen enthalten.
• Die Abmessungen enthalten meist ganzzahlige Strecken und Umfänge in einem Einheitsmaß (Megalithisches Yard oder Megalithische Elle).
• Die Anlagen wurden durch geometrische Figuren (z. B. Kreise, rechtwinkelige Dreiecke, Trapeze) mit Schnur und Stab konstruiert.
• Die rechtwinkeligen Dreiecke sind oft pythagoreisch oder fast pythagoreisch, mit geringen Abweichungen.
Um eine Steinsetzung als megalithisch ansprechen zu können, sollten möglichst viele dieser Bedingungen erfüllt werden.
2.2 Die Umfassungsmauer am Pfitscher Sattel
Die Mauerreste bestehen aus geschichteten Glimmerschieferplatten. In der NOEcke sind zwei Kammern, die durch einen großen Block geteilt werden. Die Mauer ist an den W-, N- und O-Seiten mit bis zu 1,50 m Höhe deutlich erkennbar, auf der S-Seite sind durch Bergstürze die Reste oft nur zu erahnen. Der umfriedete Bereich beträgt in OW-Richtung 53,5 m und in NS-Richtung 41,8 m und umfasst eine Fläche von etwa 1600 m2.
Die vom Geometer Aribert Egen mit Theodolit vermessene Mauer bildet ein unregelmäßiges Sechseck. Der Plan der Anlage zeigt 34 Schalensteine, von denen 26 innerhalb der Mauer sind. Es ist nicht zwingend, dass die Umfassungsmauer in direkter Beziehung zu den Schalensteinen steht. Die große Ansammlung innerhalb der Mauer, macht jedoch einen Zusammenhang sehr wahrscheinlich. Die Anlage ist zumindest für Südtirol einzigartig.
2.2.1 Astronomische Ausrichtung
Drei der Hauptachsen sind astronomisch orientiert: Von (1) – (2) auf einen frühzeitlichen Aufgangspunkt von Alkyone in den Plejaden, von (1) – (5) zum Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende am tatsächlichen Horizont und von (3) – (4) nach Norden. Eine Verbindung von (5) zur markanten Kante am großen Block zwischen den Kammern zeigt ebenfalls nach Norden. Weitere astronomische Peilungen sind durch verschiedene Steinsetzungen gegeben. Damit sind schon einmal mehrere astronomische Aussagen gefunden.
Abbildung 2.5:
Umfassungsmauer mit astronomischen Peilungen und Schalensteinen
Grafik: nach Egen (1995)
2.2.2 Konstruktion der Umfassungsmauer
Um einen besseren Überblick über die Anlage zu bekommen, wurde ein Quadrocopter mit Kamera eingesetzt. Dieser steht noch auf einem wichtigen Schalenstein, der Sternplatte.
Aus etwa 40 Meter Höhe lässt sich die gesamte Anlage gut überblicken.
Mit Hilfe von weiteren Verbindungslinien der Ecken und durch 11 rechtwinkelige Dreiecke lässt sich das Sechseck konstruieren. So eine Konstruktion kann man mit jedem Vieleck mit mehr als 3 Ecken machen. Spannend wird es, wenn die Seitenlängen der Dreiecke eingetragen werden.
Wie in den oben stehenden Regeln für megalithische Steinsetzungen erwähnt, sind die Konstruktions-Dreiecke häufig pythagoreische5 bzw. fast pythagoreische Dreiecke (Abweichung <1%). Die dazu erforderliche Ganzzahligkeit der Seitenlängen wird jedoch nur erreicht, wenn diese in megalithischen Ellen gemessen werden.
Abbildung 2.6:
Quadrocopter auf dem Schalenstein Sternplatte (Nr. 37)
Grafik: Roland Gröber
Aribert Egen hat anhand von 20 sorgfältig vermessenen Strecken ein Einheitsmaß von 0,836 m für den Pfitscher Sattel gefunden. Dieses weicht vom megalithischen Yard von Alexander Thom um 7 mm (= 0,8%) ab, entspricht aber fast genau z. B. der späteren bayerischen Elle.
Ergänzend gibt es auf der sog. Archivplatte (Nr. 38) eine speziell gekennzeichnete Anordnung von Schalen, die möglicherweise einen Längenkomparator von 0,5 – 1 – 1,5 – 2 ME darstellt. Ein nach Norden ausgerichtetes T ist der 0-Punkt.
Von den elf rechtwinkeligen Dreiecken sind zwei pythagoreisch (1 – 4 – A und 1 – C – 5) und 4 fast pythagoreisch mit einer Abweichung der Hypotenuse von weniger als 1% zur Ganzzahligkeit. Vier Dreiecke haben jeweils 2 ganzzahlige Seiten und nur ein Dreieck (4 – 2 – 5) hat keine ganzzahlige Seite. Es ist jedoch nicht zwingend zur Konstruktion notwendig.
Die Tabelle zeigt übersichtlich die verschiedenen rechtwinkeligen Konstruktions-Dreiecke. Die Maße sind in Megalithischen Ellen angegeben.
Abbildung 2.7:
Konstruktion der Mauer aus pythagoreischen Dreiecken
Grafik: Roland Gröber
• Grün: 2 × pythagoreisch
• Gelb: 4× fast pythagoreisch (Abweichung < 1%)
• Orange: 4 × 2 Seiten sind ganzzahlig
• Rot: 1× keine Seite ist ganzzahlig.
2.3 Fazit
Es gibt Meinungen, die Mauer als neuzeitliche Viehpferche und Hirtenhütten zu interpretieren.6 Unter Einbeziehung der erwähnten astronomischen Peilrichtungen und der systematischen Konstruktion durch ausgezeichnete Dreiecke glauben wir daher, dass diese Ergebnisse die Vorgaben von Alexander Thom hinreichend erfüllen und in Verbindung mit den weiteren Überlegungen zu den Schalensteinen auf eine Kultstätte aus der Megalith-Zeit hindeuten, also etwa auf 3500 bis 2000 v. Chr.7
Abbildung 2.8:
Tabelle der Konstruktionsdreiecke
Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass im Laufe der Jahrtausende auch künstliche oder natürliche Veränderungen, z. B. durch Steinschlag, entstanden sind.
In der Abb. 2.2 fällt vor allem die Konzentration der astronomischen Peilungen um den großen Kultstein zwischen den beiden Kammern nach Norden, zu Alkyone und den großen Mondwenden auf. Dieser Kultstein ermöglicht aber auch, aufgrund seiner Ausrichtung an der senkrechten Kante, recht genau die Kulmination der Sonne durch Schattenwurf zu ermitteln (Abb. 2.1). Auf der Oberseite des Felsens ist eine Vertiefung und eine Rinne, die zur genau nach Süden ausgerichteten Kante läuft. Ein Flüssigkeitsopfer ist daher denkbar.
Die Geheimnisse am Pfitscher Sattel sind also noch lange nicht gelöst.
2.3 Literatur
DRÖSSLER, RUDOLF: Astronomie in Stein. Archäologen und Astronomen enträtseln alte Bauwerke und Kultstätten. Wiesbaden: Panorama Verlag o.J.
EGEN, ARIBERT: Das Spronser Bergheiligtum bei Meran. Die älteste Sternwarte der Menschheit in situ? In: RICHTER, PETER (Hg.): Sterne, Mond, Kometen. Bremen: Hauschild 1995.
GLEIRSCHER, PAUL: Ein urzeitliches Bergheiligtum am Pfitscher Jöchl über Dorf Tirol? In: Der Schlern – Monatszeitschrift für Südtiroler Landeskunde67 (1993), Heft 6, S. 407–435.
GRÖBER, ROLAND: Das Bergheiligtum am Pfitscher Sattel bei Meran. Schalensteine und astronomische Beobachtungen in der Kupferzeit (ca. 3200 v. Chr.). Leverkusen 2016.
GRÖBER, ROLAND: Astronomie in Südtirol zur Zeit des Ötzi (3350–3100 v. Chr.) – Bergheiligtum und älteste Sternwarte der Welt am Pfitscher Sattel!? In: WOLFSCHMIDT, GUDRUN (Hg.): Baudenkmäler des Himmels – Astronomie in gebautem Raum und gestalteter Landschaft. Proceedings der Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie. Hamburg: tredition (Nuncius Hamburgensis – Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften, Band 35) 2018, S. 26–41.
KRUPP, EDWIN C.: Astronomen, Priester Pyramiden. Das Abenteuer Archäoastronomie. München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1980.
MULLER, ROLF:Der Himmel über dem Menschen der Steinzeit. Astronomie und Mathematik in den Bauten der Megalithkulturen. Berlin, Heidelberg: Springer (Verständliche Wissenschaft; Band 106) 1970.
RAPPENGLÜCK, MICHAEL: Lepinski Vir vor 7000 Jahren: Messen mit Schnur und Stab. München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1980. Wiesbaden: Verlag Chmielorz (VDV Schriftenreihe; Band 8: Zur Geschichte des Vermessungswesens) 1995.
SCHLOSSER, WOLFHARD & JAN CIERNY: Sterne und Steine. Eine praktische Astronomie der Vorzeit. Stuttgart: Theiss Verlag 1996.
THOM, ALEXANDER UND ARCHIBALD STEVENSON THOM: Ringe und Menhire. Geometrie und Astronomie in der Jungsteinzeit. In: KRUPP 1980, S. 45–84.
TSCHOLL, JOSEF: Zum Rätsel der Schalensteine. In: Der Schlern – Monatszeitschrift für Südtiroler Landeskunde14 (1933), S. 440.
1 Die Bedeutung der Schalensteine wurde von Gröber 2018 ausführlich in Baudenkmäler des Himmels (Nuncius Hamburgensis, Bd. 35) behandelt.
2 Rappenglück: Lepinski Vir vor 7000 Jahren, 1980, 1995.
3 Thom, A. & A. S. Thom: In: Krupp: Astronomen, Priester, Pyramiden, 1980, S. 44–84.
4 U.a. Alexander Thom, Rolf Müller 1970, Rudolf Drössler (o.J.).
5 Pythagoreische Dreiecke sind rechtwinkelige Dreiecke mit ganzzahligen Seitenlängen.
6 Josef Tscholl 1933, Paul Gleirscher 1993, u.a.
7 Egen, Aribert: Spronser Bergheiligtum bei Meran, S. 224.
Abbildung 3.1:
Rekonstruktion bronzezeitlicher Frauenkleidung und Schmuck
© Ørjan Engedal (http://www.arkeoreplika.no/).
Astronomie der nordischen Bronzezeit: Schmuck der Frauen – Gürtelscheiben und Halskragen astronomisch / geometrisch untersucht
Astrid Wokke (Bremen)
Abstract
In mythologies there are indications that jewelry was not only decoration. Above all belts and necklaces seem to be of particular meaning. Bronze belt plates are the most striking jewelry of the women of the northern Bronze Age. According to Hertha von Dechend astronomy is the basis of mythology, and astronomical knowledge was already well developed in the Neolithic. In view of this background I measured the belt plates geometrically to find out whether they are planispheres. The results seem to confirm the assumption, but they also show that the patterns on the plates are very complex, and that further research will be necessary.
Zusammenfassung
In den Mythen gibt es Hinweise darauf, dass Schmuckstücke von besonderer Bedeutung sind. Die bronzene Gürtelscheiben sind die auffälligsten Schmuckstücke der Frauen der nordischen Bronzezeit. Nach Hertha von Dechend ist die Astronomie die Grundlage der Mythologie. Sie stellt dass das astronomische Wissen bereits in der Jungsteinzeit voll entwickelt war. Vor diesem Hintergrund habe ich die Gürtelscheiben geometrisch vermessen, um zu untersuchen, ob sie Planisphären sind. Die Ergebnisse scheinen die Annahme zu bestätigen, offenbaren aber auch, dass die Muster auf den Scheiben komplex sind. Weitere Untersuchungen werden nötig sein.
3.1 Die Scheiben der nordischen Bronzezeit
„Halsschmuck und Ringe
Gab Heervater,
für Zukunftwissen
und Zauberkunde:
weit sah ich, weit,
die Welten alle“1
So spricht die Seherin im ersten Lied der Edda. Ihr Schmuck ist nicht bloß Zierrat. Die Halskette der nordischen Göttin Freya hat einen Namen: Brisingamen. Freya wird auch „Menglöd“ genannt, die „Halsbandfrohe“.
Das erste Lied der Edda heißt „Der Seherin Gesicht“, es handelt von der Götterdämmerung. Die Wissenschaftshistorikerin Hertha von Dechend deutet die Geschichte vom Untergang der Welt als eine „auf Mythisch“ erzählte Geschichte der Präzession.2 Es ist die Geschichte vom Ende eines Weltalters, wenn der Frühlingspunkt ein nächstes Zeichen erreicht. Auch die „Welten“, von der die Seherin berichtet, seien als „Weltalter“ zu verstehen.
Es sind viele bronzene Halskragen in Frauengräbern und in Hortfunden der nordischen Bronzezeit gefunden worden (siehe Abb. 3.1). Die Halskragen weisen an den Enden ein ähnliches Muster von Spiralen und Bändern auf wie die bronzene Scheiben, die von einigen Frauen an einem Wollgürtel getragen wurden. Nicht immer werden Scheiben und Halskragen zusammen angetroffen, aber wenn, dann gehören sie dem Muster nach zusammen.
Hertha von Dechend geht davon aus, dass das astronomische Wissen bereits in der Jungsteinzeit voll entwickelt war. Nach diesen Erkenntnissen könnte man bei Untersuchungen an Gegenständen aus der Bronzezeit ein hoch entwickeltes astronomisches Wissen voraussetzen.
Die Scheiben mit ihren ringförmigen Mustern sind eindeutig geometrisch geformt. Jede dieser Scheiben ist einzigartig, aber die Muster ähneln sich. Sie sind alle mit einem ringförmigen Muster gestaltet, das meistens aus Spiralkreisen und Bändern besteht. Kleine Scheiben haben nur einen Spiralkreis in der Mitte, die größten Scheiben bis zu vier, mit verschiedenartig gestalteten Bändern dazwischen. Im astronomischen Sinne verstanden ist eine Scheibe eine Planisphäre, eine Projektion der Himmelskugel. Diese besteht, wie die bronzene Scheiben, aus einem Muster von konzentrischen Kreisen. Um zu überprüfen ob die Gürtelscheiben Planisphären sind, habe ich sie stereografisch vermessen.
Abbildung 3.2:
Die stereografische Projektion
Grafik: A. Wokke.
Abbildung 3.3:
Die stereografische Vermessung einer Gürtelscheibe
Scheibe: Staats und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Grafik: Astrid Wokke. Vgl. Kat.-Nr. 299, Aner & Kersten, Bd. 1 (1973), Tafel 51.
3.2 Die Projektion der Himmelskugel
Die stereografische Projektion (vgl. Abb. 3.2):
Oben im Bild ist die Himmelskugel in Seitenansicht dargestellt. Darauf sind die astronomisch bedeutsamen Deklinationkreise abgebildet. Vom Südpol aus werden Linien gezogen zu den Kreisen an der Himmelskugel die projiziert werden sollen. Die Schnittpunkte dieser Linie mit der Äquatorebene ergeben den Radius der projizierten Kreise.3 Wenn die Äquatorebene als Projektionsebene genommen wird, ist der projizierte Äquator gleich groß wie der Himmelskreis in Seitenansicht. Nur so kann man die Gürtelscheiben vermessen.
3.3 Die Untersuchung der Scheiben
3.3.1 Die Vorlagen
Als Vorlage für die Untersuchung der Scheiben habe ich die Zeichnungen aus den ersten sieben Bänden der Reihe „Die Funde der älteren Bronzezeit“4 genommen. In diesen Zeichnungen werden die Funde maßstabgetreu wiedergegeben. Die Scheiben sind aber nicht flach, sondern gewölbt. Für die zeichnerische Darstellung werden die Scheiben senkrecht von oben betrachtet. Mit Hilfe eines Geodreiecks und eines Stechzirkels werden die jeweiligen Abstände vom Rand aus vermessen. So werden die durch die Wölbung des Stückes bedingten Verkürzungen berücksichtigt.5 Bis auf wenige Ausnahmen werden die Scheiben nicht in Gänze dargestellt, sondern zu einem Viertel.
3.3.2 Die Vermessung
Alle Vermessungen wurden mit einem Geodreieck und einem Zirkel durchgeführt. Für die hier vorgestellte Untersuchung (vgl. Abb. 3.3) habe ich die Scheiben ausgewählt, die ein Muster mit zwei Spiralkreisen aufweisen. Auf denen wurden jeweils acht Kreise vermessen. Die Scheiben wurden nach keinem weiteren Kriterium ausgesucht.
Die Vermessung der Scheiben verläuft umgekehrt wie die stereografische Projektion. Zuerst wird ein Kreuz durch die Mitte gezogen. Dann wird einer der Ringe als Äquator/Himmelskugel gewählt und mit einem Zirkel vervollständigt. Die horizontale des Kreuzes fungiert als Äquatorebene.
Dann werden Linien gezogen vom unteren Punkt des (Himmels)Kreises, so, dass sie die Äquatorebene dort schneiden, wo die verschiedene Ringe des Musters auf die Horizontale treffen. Anschließend wird ermittelt, an welchen Punkten diese Linien den Himmelskreis schneiden. Von der Mitte aus wird der Winkel zur Äquatorebene gemessen. Dieser Winkel entspricht der Deklination. Bei meinen ersten Versuchen habe ich lediglich die Wendekreise berücksichtigt. Der Äquatorkreise wurde nach dem „try and error“ Prinzip irgendwo im mittleren Band des Musters angesetzt, so, dass der südliche Wendekreis zusammenfällt mit dem äußeren Rand des Musters, und gleichzeitig auch der nördliche Wendekreis mit einem der Ringe im Muster zusammenfällt. Die Ergebnisse waren zwar nicht sehr präzise, aber sie zeigten doch eine Übereinstimmung, die mir mehr als zufällig erschien.
Bei der Präsentation dieser Ergebnisse auf der Tagung in Hamburg, bekam ich von Herrn Burkard Steinrücken die Anregung, ebenfalls die Deklinationen der zwischenliegenden Ringe zu berechnen.
Bei der erneuten Vermessung habe ich mich zunächst an die „Perlschnurringe“6 im Muster gehalten, und die Kreise in der Mitte dieser Ringe gezogen. Die meisten der untersuchten Scheiben weisen im mittleren Band des Musters zwei solche Ringe auf. Diese beide wurden jeweils als Äquator / Himmelskreis genommen, und von dort aus die Deklination der übrigen „Perlschnurringe“ auf der Scheibe bestimmt. Es gab durchaus „Treffer“: Ringe die mit den Wendekreisen oder den Mondextremen zusammenfielen. Aber auffällig viele Gradzahlen wichen nur wenig von diesen astronomischen Kreisen ab. Das galt sowohl für die Annahme, der Äquator ist am inneren Ring des mittleren Bandes, wie auch für den äußeren Ring.
Bei der dritten Vermessung habe ich nur noch die Linien berücksichtigt, die die „Perlschnurringe“ begrenzen. Auf Scheiben mit andersartigem Muster die ähnlich gelagerte Linien.
3.3.3 Die Ergebnisse
Jetzt zeigten sich auf allen vermessenen Scheiben Deklinationkreise von den Wendekreisen und den Mondextremen. Es zeigt sich, dass die Gürtelscheiben keine reine Planisphären sind. Das Muster ist komplexer, scheint aber sehr wohl dem Muster der astronomisch bedeutsamen Deklinationskreise zu folgen, jedoch auf verschachtelter Art. In der Darstellung der Ergebnisse werden nur ganze Gradzahlen genannt, weil alles von Hand vermessen wurde. So ist ein Ergebnis von 23,5° als 23° verzeichnet. Lediglich auf der Scheibe von Trundholm sind die Angaben präziser. Die Ergebnisse legen nahe, dass wenn der Äquator am äußeren Rand des mittleren Bandes gewählt wird, eher die Wendekreise zu finden sind, während der Äquator am inneren Rand eher die Mondextreme zeigt. Bei der Vermessung der einzelnen Scheiben wurden immer dieselben Linien genommen, für beide Äquatorsituationen.
Abbildung 3.4:
Die Vermessung an den Linien
Scheibe: Staats und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Grafik: Astrid Wokke.
Vgl. Kat.-Nr. 669c, Aner & Kersten, Bd. 2 (1976), Tafel 14.
Abbildung 3.5:
Tabelle und Grafik: Die Deklinationen der acht Kreise beim Äquator=0° am äußeren Rand des mittleren Bandes
Grafik: Astrid Wokke.
Wokke-Tabelle2.jpg
Abbildung 3.6:
Tabelle und Grafik: Die Deklinationen der acht Kreise beim Äquator=0° am inneren Rand des mittleren Bandes
Grafik: A. Wokke
Abbildung 3.7:
Die astronomisch bedeutsamen Deklinationen auf der Scheibe von Trundholm
Staats und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Grafik: Astrid Wokke.
Vgl. Kat.-Nr. 867, Aner & Kersten, Bd. 2 (1976), Tafel 138.
3.4 Diskussion
Es ist nicht wahrscheinlich, dass in der nordischen Bronzezeit mit der stereografischen Projektion gearbeitet wurde. Gibt es alternative Möglichkeiten, die zu den gleichen Ergebnissen führen?
Wenn die hier gezeigten Ergebnisse sich in weiteren Untersuchungen bestätigen, stellt sich die Frage nach den Anfängen der Himmelskunde, denn solches Wissen und solches Können setzen eine lange Vorgeschichte voraus. Welche Schritte in welcher Reihenfolge braucht es, um so weit zu kommen, und gibt es Spuren von diesen Schritten? Und nicht zuletzt stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen den Trägerinnen der Scheiben und deren Herstellern, den Schmieden. Wer waren die Himmelskundigen der nordischen Bronzezeit?
3.5 Literatur
ANER, EKKEHARD & KARL KERSTEN: Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag, Band 1 (1973), Band 2 (1976), Band 3 (1977), Band 4 (1978), Band 5 (1979), Band 6 (1981), Band 7 (1984), …, Band 21 (2017).
BERGERBRANT, SOPHIE: Bronze Age Identity: Costume, Conflict and Contact in Northern Europe 1600–1300 BC. Lindome: Briceur Press (Stockholm Studies in Archeology; No. 43) 2007.
DECHEND, HERTHA VON: Einführung in die Archaische Kosmologie. Vorlesungen im Wintersemester 1976/77. Hg. von RAINER HERBSTER. München: Differenz-Verlag 2011.
GENZMER, FELIX (Übersetzung) Die Edda: Götterdichtung, Spruchweisheit und Heldengesänge der Germanen. München: Diederichs (1. Auflage) 1981, 2000.
SANTILLANA, GIORGIO DE & HERTHA VON DECHEND:Hamlet’s Mill. An Essay on Myth and the Frame of Time. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1969.
SANTILLANA, GIORGIO DE & HERTHA VON DECHEND:Die Mühle des Hamlet. Ein Essay über Mythos und das Gerüst der Zeit. Berlin: Kammerer & Unverzagt, Computerkultur 1993. Wien, New York: Springer (2. Auflage) 1994.
SCHROEDER, WOLFGANG: Praktische Astronomie für Sternfreude. Stuttgart: Kosmos 1957.
1 Völuspa, 24, in Genzmer 1981/2000, S. 30.
2 Santillana & Dechend 1993, S. 30.
3 Schroeder 1957, S. 67.
4 Aner & Kersten, Band 1 ff (1973) ff.
5 Mündliche Mitteilung von Frau B. Christiansen, Zeichnerin, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Projekt: Funde der älteren Bronzezeit, Arbeitsstelle Schleswig. Aner & Kersten, Band 1 ff (1973) ff.
6 Kreise, bestehend aus einer Doppellinie mit Schraffierung dazwischen, in Aner & Kersten, Band 3 (1977) mit diesem Begriff gekennzeichnet.
Abbildung 4.1:
Oben: Geo Park Erz der Alpen, Kupferlandschaft, Bischofshofen, Unten: Kopie der restaurierten Himmelsscheibe von Nebra © Geopark „Erz der Alpen“, Christina Nöbauer, http://geopark-erzderalpen.at/
Geopark „Erz der Alpen“ und die Himmelsscheibe von Nebra
Erich Kutil (Bischofshofen, Österreich)
Die Globalen Geoparke unter der Schirmherrschaft der UNESCO wie der Geopark „Erz der Alpen“ sind Gebiete außergewöhnlicher geologischer Besonderheiten von internationaler Bedeutung und ausgezeichnet durch eine große Geo-Vielfalt. Aber auch andere Disziplinen wie z.B. Botanik, Archäologie, Kulturgeschichte oder Astronomie spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Zusammenarbeit der Globalen Geoparke mit den Universitäten ergibt immer wieder neue Erkenntnisse. Meine naturgetreue Nachbildung der Himmelsscheibe von Nebra ist Teil des Geoparks „Erz der Alpen“ und wird in Führungen erläutert und in Vorträgen diskutiert.
Zum Tagungsthema 2017 „Orientierung, Navigation und Zeitbestimmung“ möchte ich über neue Erkenntnisse bei der Deutung der Himmelsscheibe berichten. Um das Bildinventar der Scheibe zu interpretieren ist Orientierung von Nöten. Man navigiert zwischen dem Bildaufbau der Scheibe und dem tatsächlichen Himmelsausschnitt zur Herbst-Tag- und Nachtgleiche um ca. 1800 v. Chr. Der geografische Bezug zu einem möglichen Herstellungsort im Land Salzburg wird durch die auf der Himmelsscheibe applizierte Sternenrosette, die als Zenitsymbol angenommen wird, bestimmt. Die Anfertigung der Himmelsscheibe im Land Salzburg wird unabhängig von meiner Deutung auch von Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Sperl (Montanuniversität Leoben) in Betracht gezogen.
KUTIL, ERICH: Faszination Himmelsscheibe. Bischofshofen 2008.
KUTIL, RADE: Ein statistisches Maß für die Ungleichmäßigkeit von Punkten auf einer Fläche zur Bewertung der Stern-Verteilung auf der Nebra-Scheibe. 2014.
SCHLOSSER, WOLFHARD: Die Himmelsscheibe von Nebra – Astronomische Untersuchungen. In: MELLER, HARALD (Hg.): Der geschmiedete Himmel. Stuttgart: Konrad Theiss 2004.
Astronomische Sternkarte Sirius. Bern: Freemedia (veränd. Neuauflage) 2001.
Abbildung 5.1:
Die Externsteine – ein astronomisches Monument (Flyer (2014) als Ergänzung zum Buch von 2012. Anlass war die Entdeckung eines „Lichtspeer des Odins“. Fotoausstellung zu den Externsteinen im Rathaus der Stadt Horn).
© Wolfgang Lippek
Die Externsteine – ein astronomisches Monument?
Wolfgang Lippek (Lage)
Abstract
The Höhenkammer (Eng.: high chamber) turns out to be a complete observatory for both sunrise and moonrise.
Three archaeoastronomical discoveries far exceed what a civilization merely constituted of peasants would have needed:
a. Odin’s left eyebrow; illuminated by the sun
b. The light spear found on floor of the Kuppelgrotte (Eng.: domed grotto)
c. The precisely placed relief of the Greek god of the shepherds, Pan – possibly a Roman faun –, receives a mitre made of sunbeams. The cloven hoof is clearly visible.
The relief in front of the Kuppelgrotte provides substantial evidence in favour of the nomenclature “Odin”: a) his monophthalmia, b) a battle-axe in his right hand, and c) the light spaer directly behind him on the grotto’s floor. Thus, the plausible appellations “Odin” and consequently “Odin’s light spear” have been chosen.
The artist was hugely successful in incorporating the content of the Edda regarding Odin’s epithets. This classification proves the singularity of the relief next to the entrance of the Kuppelgrotte at rock I of the Externsteine, and has without doubt contributed to their fame. A creation like this representing the Saxon’s (and other tribes from Northern Europe’s) religious beliefs is likely to have deeply impressed visitors in the centuries preceding the fateful year 772 AD. The facts on hand allow for the following conclusions: The Externsteine have been a place of bizarre forces of nature for millions of years; – a place of religious worship for millennia; – an astronomical monument for thousands of years.
That makes the Externsteine a unique astronomical monument!
Zusammenfassung
Die Externsteine im Teutoburger Wald nahe Lippe-Detmold sind seit über 2000 Jahren ein vollständiges Sonnen- und Mondaufgangs-Observatorium. Die Aufgänge beider Gestirne, genauer deren Lichtwürfe, sind bei entsprechender Witterung das ganze Jahr über auf den Innenwänden der Höhenkammer zu beobachten.
In dieser Höhenkammer – ehemalige Dunkelkammer – wurden, wie es auch in moderneren Observatorien geschah, „gemessen“: z.B. Tageslängen, Wochenlängen, Mondmonate, das Mondjahr bzw. Sonnenmonate/Sonnenjahr sowie Mond- bzw. Sonnenfinsternisse. An und in den Externsteinen zeigen Arbeitsspuren – sogar aus der Zeit steinerner Werkzeuge – wie der Lebensraum unserer Altvorderen durch die „himmlischen Erscheinungen“ geprägt wurde. In der Höhenkammer sind unter archäoastronomischen Aspekten in jüngster Zeit neue Details erkannt worden, die dem griechischen „Hirtengott Pan“ zugeordnet werden können. Einmalig in Europa ist die Entdeckung des „Lichtspeers“ Odins auf dem Fußboden in der Kuppelgrotte des Felsens Nr. 1. Neben den bisher genannten vorchristlichen, teilweise sogar vorgeschichtlichen Einrichtungen und „Funden“ besticht das Kreuzabnahmerelief sowohl in seinen Dimensionen als auch in seinem hohen künstlerischen Wert nördlich der Alpen jeden interessierten Besucher.
5.1 Allgemeines zu den Externsteinen
Die Externsteine sind eine markante Felsengruppe (s. Abb. 5.2 oben links) im Teutoburger Wald – ca. 10 km von Detmold und ca. 1,5 km vom Zentrum der Stadt Horn entfernt. Nach Springhorn1 bestehen sie aus quarzitären „weißen Sanden“, die sich vor „ca. 135–100 Millionen Jahren“ in einem Meer abgelagert haben. Durch „Magmatogene Vorgänge“ sind diese Ablagerungen vor „ca. 65–70 Millionen Jahren im Zuge einer Einengungstektonik herausgehoben“ worden. Ihr heutiges Erscheinungsbild „als freistehende Felstürme“ wurde durch die „Ausräumungsarbeit der Wiembeke“ bewirkt. Welche Ausformungen über Millionen von Jahren Naturkräfte erzeugen können, ist besonders deutlich (s. Abb. 5.2 oben rechts) am Kopf des Felsens 2 erkennbar – zur Herkunft dieser Abbildung s. Fußnote 6.
Laut Niedhorn finden sich an den Externsteinen überwiegend Arbeitsspuren mit eisernen Werkzeugen2 – vorwiegend nach der Zeitenwende angebracht. Er benennt auch hinreichend genügend Beispiele von Arbeiten mit steinernen
Abbildung 5.2:
Blick auf die NO-Seite der Externsteine,
Kopf des Felsens 2 – Die Formen entstanden über Millionen von Jahren, Blick auf das Rundfenster in der Höhenkammer – von außen, Rundloch im Galeriegrab bei Züschen/Warburg, etwa 3. Jahrtausend v.Chr.
© Wolfgang Lippek
Werkzeugen – z. B. das Rundfenster in der Höhenkammer (s. Abb. 5.2 oben links) und (Niedhorn 1995, s. S. 36–38). In einem Galeriegrab bei Züschen / Warburg (s. Abb. 5.2 oben rechts) befindet sich ein ähnliches Rundloch, welches im Volksmund als Seelenloch bezeichnet wird. Viele Beifunde erlauben eine Datierung ins 4. bis 3. Jahrtausend v. Chr. Das Rundloch kann damals nur mit steinernen Werkzeugen erarbeitet worden sein (Durchmesser 50 cm).
Im zentralen Bereich des Bärensteins sind die Reste eines großen Steinbruchs erkennbar. Hier wie auch auf der nordöstlichen Seite der Externsteine, im Knicken-Hagen, sind Keillochreihen zur Gewinnung von Steinmaterial gut zu sehen. Derartige Keillochreihen finden sich auch direkt an den Externsteinen, z.B. auf der süd-westlichen Seite des „Schiffchens“ – (s. Lippek).3 Sie dienten der Zerstörung von menschlichen Einrichtungen am Felsen 1 und 2 der Externsteine4 – veranlasst durch Karl den Großen im Jahr 772 n. Chr. Das Jahr 772 wurde hier vom Autor gewählt, da niemand eine andere zerstörte Örtlichkeit – unter Anwendung des archäologischen Grundgesetzes – glaubwürdig benannt hat (s. Lippek 2012, S. 11 und S. 32–36).
5.2 Beobachtungsmöglichkeiten der Sonnen-/Mondaufgänge
An den Externsteinen können die Sonnenaufgänge (SA) das ganze Jahr hindurch beobachtet und ihre Lichtwürfe auf den Wänden fotografiert werden. Vom 21. Febr. bis 20. Okt. – acht Monate – gelangen die Strahlen durch das Rundfenster in der Höhenkammer (s. Abb. 5.3 oben links) und (Lippek 2012, S. 47–56 u.a.m.). In ähnlicher Weise gilt dies für den Mond (s. Abb. 5.3 unten rechts) und (Lippek 2012, S. 40) im Winterhalbjahr. Nur in den vier Wintermonaten gelangen die Strahlen der Sonne aus südöstlicher Richtung (s. Abb. 5.3 oben rechts) in die Höhenkammer. Gleiches gilt für den Mond im Sommerhalbjahr.
Schlosser5 schreibt zum Sonnenloch (Schlosser 1995, S. 82–84): „Dabei ist das Rundfenster keineswegs eine schlichte Öffnung, sondern stellt einen Kegelstumpf (Konus) dar“ Weiter: „… daß diese konusförmige Öffnung irgendeine Visur- oder Gnomoneinrichtung aufgenommen haben muß“ Schlosser kommt zu dem Schluss: „Damit haben wir ein selbstzentrierendes System mit automatischem Endanschlag vor uns, das überdies lichtdicht war.“ Dies ermöglicht eine bessere Beobachtung der schwachen Lichtwürfe des Mondes.
Eine wichtige Funktion der Höhenkammer war ihre Verwendung für kalendarische Zwecke, die wohl nur in vorchristlicher Zeit praktiziert worden ist (s. Lippek 2012, S. 57). Die Abb. 5.3, oben rechts, zeigt die Situation am 28. November. Die Strahlen der aufgehenden Sonne befinden sich noch eben über den hohen Fichten und beleuchten den Altarständer im Rundbogen. Der Altarständer ist aus dem vollen Gestein herausgearbeitet – einmalig im gesamten europäisch-christlichen Raum und damit vorchristlich – also heidnisch, d. h. vor 772 n. Chr. (s. Lippek 2012, S. 51–56).
Abbildung 5.3:
Oben: SA am 18.6.2012, 5.04 Uhr; unten: Lichtwurf um 5.05 Uhr, SA am 28.11.2011, 11.38 Uhr; die Sonnenstrahlen erreichen den Altarständer SA zur WSW am 21.12.1985 zur Mittagszeit, Oben: 28.10.2012, 19.29 Uhr; unten: Lichtwurf 20.02 Uhr
© Wolfgang Lippek und Foto von Herrn Conzeth
Für das Rundfenster in der Höhenkammer (s. Lippek 2012, S. 29, 40–41) gilt ein Datierungsansatz „vor Null“ insofern, als das Rundloch mit steinernen Werkzeugen herausgearbeitet worden ist, s. Niedhorn, a.a.O., S. 93–94 und Lippek (Lippek 2012, S. 89–91). Gleiches mag für das runde und das viereckige Loch auf dem höchsten Punkt von Felsen 2 zutreffen (s. Abb. 4).6 Ob es in Deutschland oder Europa eine derartige astronomische Höhenkammer ein zweites Mal gibt, mögen Touristiker herausfinden.
In der Höhenkammer konnten dem vom Autor entdeckten griechischen Hirtengott Pan (s. Abb. 5a/5b) – eventuell ein römischer Faun – archäoastronomische Aspekte zugeordnet werden (s. Lippek 2012, S. 57–59). Die „Bischofsmütze“ ist ca. 16 Tage vor der Abb. 5.4, oben, Kopf vom Felsen 2 mit einem runden und einem eckigen Loch.
Sommersonnenwende und im gleichen zeitlichen Abstand danach zu beobachten. Diese Entdeckung geht weit über die kalendarische Funktion der Höhenkammer hinaus. Aufnahmen zu Sonnenuntergängen entfallen an den Externsteinen derzeit völlig. Verhindert wird dies durch hohe Bewaldung in den Richtungen „Kleiner Rigi“ und „Barnacken“ (SSW) bis „Bärenstein“ (NW). Es darf angenommen werden, dass man in früheren Zeiten mit lebenden Rasenmähern (Ziegen/Schafen) jederzeit Sichtschneisen oder sogar ganze Bergkuppen hätte freihalten können.
5.3 Ein „Lichtphänomen“ in der Kuppelgrotte des Felsens 1
5.3.1 Entdeckung des „Lichtspeers“ sowie die Gründe zur Wahl des Namens
Der Unterzeichner entdeckte am 1. Juli 2013 um 6.16 Uhr ein Lichtgebilde im vorderen Teil des Fußbodens in der Kuppelgrotte (s. Abb. 5.5 links). Die Strahlen der Sonne gelangen durch einen Spalt im linken unteren Register des Kreuzabnahmereliefs in diese Grotte. Eine Untersuchung im Jahr 2017 begrenzt derzeit das Phänomen auf den Zeitraum vom 20. Mai bis 6. August. Das Gebilde besteht aus einem gradlinigen, scharf abgegrenzten Teilstück und einer daran anschließenden, nach vorne auslaufenden, länglichen Spitze. Das gerade Stück zusammen mit der langen Spitze ist im sichtbaren Bereich ca. 2,10 m lang (s. Abb. 5.5 rechts). Einen Sportlehrer erinnert ein derartiges Gebilde vor allem auf Grund seiner Länge eher an einen Speer als an einen Zeiger und wurde deshalb von mir als „Lichtspeer“ bezeichnet, da Lichtstrahlen seine Entstehung bewirken. Auch hier ist eine kalendarische Funktion z. Zt. nicht erkennbar.
Abbildung 5.4:
Rundes und viereckiges Loch auf dem höchsten Punkt von Felsen 2, Griechischer Hirtengott Pan oder römischer Hirtengott Faun?, Hirtengott Pan /Faun? mit einer „Bischofsmütze“ (?)
© Wolfgang Lippek
Abbildung 5.5:
Lichtgebilde am 1.7.2013, um 6.16 Uhr, „Lichtspeer“ am 4.7.2014 um 5.54 Uhr
© Wolfgang Lippek
5.3.2 Technische Details zur Entstehung des „Lichtspeeres“
Ein genauer Blick in den Spalt überrascht. Der Spalt besteht aus zwei Öffnungen (s. Abb. 5.6 oben links) Die dem Betrachter näherliegende Öffnung ist 57 cm hoch – die dahinter liegende 33 cm (s. Abb. 5.6 oben rechts). Von außen betrachtet ist die 57er Öffnung im oberen Bereich leicht gerundet.
Diese keilförmige Ausbuchtung (Abb. 5.6 unten links und rechts) ermöglicht den Durchlass der Lichtstrahlen im oberen Bildbereich und damit den vorderen Teil des optischen Bildes auf dem Fußboden in der Kuppelgrotte (s. Abb. 5.5 rechts).
Rutscht man auf dem Hosenboden in den Luftschacht7 tief hinein ergibt sich eine weitere Überraschung. Von innen betrachtet ist der obere Teil des 57er Spaltes nicht mehr „leicht gerundet“ sondern besitzt – optisch gesehen – eine keilförmige Spitze (s. Abb. 5.7 links).
Abbildung 5.6:
Oben: Zwei Öffnungen im Spalt, Spalt + Zollstock, Unten: Keilförmige Ausbuchtung von außen gesehen, Keilförmige Ausbuchtung von innen gesehen.
© Wolfgang Lippek
Genau dieser Effekt ist durch eine Bearbeitung des inneren älteren 33 cm-Spaltes (s. Abb. 5.6 unten rechts) in Verbindung mit dem offensichtlich vorbedachten und später hergestellten 57er Spalt (s. Abb. 5.6, unten rechts, und 5.7 links) sowie der Abschrägung der Bedachung von 57 cm auf 33 cm erreicht worden – s. hierzu die Arbeitsspuren mit Spitzmeißel in der Abb. 5.7 rechts). Die Längsseiten des 57er Spaltes (s. Abb. 5.6, oben links, und 5.7 links) sind sauber geglättet worden und bewirken so den geraden Teil – den Stiel des Lichtspeeres.
Abbildung 5.7:
Teile des 57er- und 33er Spaltes von innen fotografiert + Sonnenaufgang, Arbeitsspuren eines Spitzmeißels
© Wolfgang Lippek
5.3.3 Frühere Funktion des 33 cm Spaltes
Niedhorn hat plausibel dargelegt (s. Niedhorn 1995, S. 70–78), dass die Kuppelgrotte im Felsen 1 der Externsteine in vorchristlichen Zeiten der Verbrennung von Toten diente. Hinweise zu intensiven Feuern lieferten ihm die stark dunkelbraunen Verfärbungen8 an der Decke (s. Abb. 5.8 links), sowie die dort auch zu beobachtenden großen „Wülste“. Außerdem erkannte er, dass eine deutliche Rotfärbung über der Eingangstür zur Kuppelgrotte (s. Abb. 5.10 oben) nur durch die Abgase starker Feuer entstanden sein kann. Den Spalt9 beurteilt er als den notwendigen „Zugluftkanal“. Er hat nicht dargelegt, dass der längliche Spalt (57 cm hoch) von außen gesehen in Wirklichkeit aus zwei Öffnungen besteht (s. Abb. 5.6 oben rechts). Die innere ältere und grob ausgearbeitete Form ist 33 cm hoch. Erst durch die Aufweitung des Zuluftkanals von innen – auf eine Höhe von ca. 1,20 m (!) – konnte erheblich mehr Frischluft einströmen und als Folge davon höhere Temperaturen in der Brennkammer erreicht werden (s. Abb. 5.8 rechts – Der Autor ist zum Größenvergleich mit im Bild).
Abbildung 5.8:
Decke der Kuppelgrotte mit stark dunkelbraunen Verfärbungen, Aufweitung des 33er Zuluftkanals – Autor zum Größenvergleich im Bild
© Wolfgang Lippek