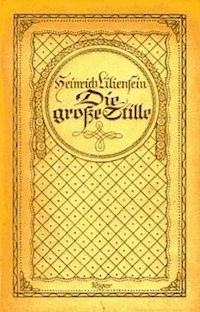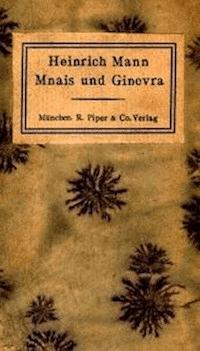0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Ähnliche
IRMELA
Eine Geschichte aus alter Zeit
von
Heinrich Steinhausen.
Achtzehnte Auflage.
Titelbild von W. Steinhausen.
Leipzig 1899.
Verlag von E. Ungleich.
Eingang.
Die heitre Sonne des Pfingstsonntages im Jahre des HErrn 13.. sank hinter die rebenbepflanzten Berge, welche von Westen her das liebliche Thal einschließen, in dem die stattlichen Gebäude der wohlbekannten Cisterzienser-Abtei Maulbronn sich erheben. Eben war der Vespergottesdienst mit dem Magnificat beschlossen, das heute nicht nur von den Brüdern im Chor, sondern auch von dem zahlreich versammelten Volke im vorderen Theile der Kirche gesungen worden war. Nur Bruder Diether ließ das Örglein noch nicht schweigen, vor dem er saß, und drückte die breiten Tasten durch kräftige Schläge nieder, daß sich langhallende Töne hören ließen, während das Gotteshaus sich leerte.
»Wie, schon All’ hinaus?« sagte er, als er, nach kurzer Weile sich umwendend, den ganzen Raum unten verlassen fand. »Sie haben halt Eil’ heut,« setzte er hinzu, »das Volk will des milden Maien genießen unter der Linde, und die Confratres sind dem Refectorio am Pfingstabend auch nicht feind. So wollen wir denn des Tönens genug sein lassen, uns mit dem Paternoster segnen und von hinnen gehn!«
Während er bedächtig die Treppe herniederstieg, welche vom Orgelchor in’s Schiff führte, schritten die Mönche bereits nach Gefallen einzeln oder zu mehreren gesellt dem Klostergarten zu oder wohin sonst einem Jeden sein Sinn stand; denn nach Gewohnheit ward St. Bernhards Regel heut nicht eben ängstlich befolgt und Abt Rothad war zu keiner Zeit der Mann, von dem ein straffes Anziehen derselben zu besorgen war. So war es denn auch bald im Kreuzgang einsam, der sich an die Kirche gegen Mitternacht anschließt und im Viereck einen Friedhof umgibt, der doch schon damals mehr einem mit Bäumen und Gesträuch wohlbepflanzten Gärtlein glich.
Als Diether aus der nördlichen niederen Kirchenpforte in die kunstreich gewölbten Gänge trat, däuchte ihn die abendliche Stille, die ihn so mailich und freundlich anwehte, keineswegs unwillkommen, sondern wie er langsam daherschritt und immer wieder zwischen den Pfeilern still stehend zum blauklaren Himmel emporblickte und vor sich auf die Pracht der Blüthen im frischen Grün, da war’s, als leuchtete die Lenzwonne auch aus seinen dunklen Augen, so froh schauten sie darein, und als fühlte seine Brust mit der Jugend des Jahres auch die Jugend des Herzens wieder, so freudig und kräftig hob sie sich. Dicht neben ihm aus dem Gebüsch erscholl die Stimme einer Nachtigall. Er blieb stehen und lauschte. Ihm schien’s, als wäre das die Seele dieses Maiabends, die wollte all’ ihre reine und himmlische Freude ihm mit zu empfinden geben. Sie schwieg. Aber als nach kurzer Weile ihre Töne wieder erklangen, lang gezogen und klagend, da tauchten sie auch seine Seele in sanfte Schwermuth und seine Gedanken wurden wie mit freundlichem Zwange rückwärts gezogen; und wie um ihn her die Dämmerung ihre ersten Schatten breitete, versank auch vor seinem inneren Auge die Gegenwart allgemach und Blüthenduft und Abendstille trieben ihn der Erinnerung längst vergangener Tage zu. So stößt ein Kahn sanft vom beschatteten Ufer ab und gleitet auf kaum bewegter Fluth dem Eilande zu, das dem Schiffer sonnig entgegenwinkt! –
Leise hatte er sich niedergelassen auf die steinerne Brüstung. Ein Hauch der Abendluft rauschte durch den Garten und wehte wie kleine Sterne weiße Blüthen des Flieders ihm auf Haupt und Gewand. Er blickte auf, als wollt’ er Jemand suchen, und »Irmela« klang es wie im Traume von seinen Lippen. Der Name hallte wieder von den Pfeilern drüben. Er horchte auf wie freudig erschrocken; aber gleich darauf, sich besinnend, sah er lächelnd auf seinen Blüthenschmuck und verharrte schweigend, in sich versunken. –
Da weckten ihn geräuschvolle Schritte; sie kamen von der vorderen Thür, die in die westliche Seite des Kreuzganges führt. Er wandte sich um und sah zwei junge Gesellen munter herbeieilen. Sie grüßten ihn fröhlich und auch er hieß sie von Herzensgrund willkommen; war er doch den Beiden von ganzer Seele zugethan, wie das Alter an der wohlgezogenen Jugend seine Lust hat und wie der Lehrer seine Schüler liebt, an denen seine Arbeit nicht umsonst ist. »Vater, Meister!« rief der Eine, »Zürnet uns nicht, daß wir heute so spät erst nach Euch Nachfrage thun. Mußten wir doch gewärtig sein, hätten es auch wohl verdienet, Euer heut gar nicht mehr ansichtig zu werden. Aber der wonnigliche Lenztag lockte uns in’s Freie und so streiften wir durch Wald und Feld, bis der Abend hereinbrach.«
»Wollten doch auch des Fiedlers Heiner neue Weisen mit anhören, der sich in Hohenklingen auf dem Wiesenplan vernehmen ließ, fiel der Andere ein, »aber als er zum Tanz aufspielte den Dörflern, da war es hier Rupert nicht, der nicht mit mir von dannen wollte und wieder Rupert nicht, der hernach mit des Klosterbauern flachszöpfiger Jutta daherschwenkte.«
»Scherze nur!« unterbrach ihn der Gemeinte. »Es brauchte wenig Überredungskunst, um Dir das Verweilen lieb zu machen. O, Meister! haltet solches Geschwätz unserer Thorheit zu gut. Wir hätten zeitiger bei Euch einsprechen sollen. Ihr waret einsam!«
»Daß Ihr junges Volk Euch doch so gern für unentbehrlich haltet uns Alten!« versetzte Diether mit freundlichem Ernst. »Wüßtet Ihr, welch’ treffliche Gesellschaft ich gehabt habe, da Ihr kamt, so hättet Ihr sicher mich darum geneidet.«
»Wer war denn bei Euch?« fragten die Beiden. »Wir sahen Niemanden!«
»Eine Fraue und gar holde«.
»Wie heißt sie?«
»Erinnerung! – Sie hat mich sanft bei der Hand genommen und gern bin ich ihr gefolgt.«
»So weiß ich auch, Vater«, sprach Waltram, Ruperts Geselle, »was Euch so bewegt, daß Stimme, Auge und Gebärde davon zeugen. Das kommt von den Gedanken, die inwendig in Euch Erinnerung lebendig gemacht hat. Möcht’ es Euch doch gefallen, auch uns davon zu erzählen. Der Abend ist warm und still der Ort.«
»Wohl, ich will’s thun!« erwiederte Diether willfahrend. »Und wie Ihr just mich also angetroffen habt, so soll zu Euch mein Mund sich aufthun von dem, was Erinnerung mir gewiesen und wovon ich bis diesen Tag geschwiegen. Kommt! und laßt uns niedersitzen, wo dort die Halle sich um den Steinbrunnen wölbt. – Aber ob ich’s wohl werde so kurzweilig machen, wie Heiner seine Aventiuren?« fragte er scherzend zu Rupert gewandt, als sie sich setzten.
»Ist’s eine Aventiure?«
»So mögt Ihr sie wohl heißen!«
»Dann gebt ihr einen Namen!«
»Irmela!« sagte Diether nach kurzem Bedenken, »das soll ihr Name sein.«
Diethers Geschichte,
von ihm selbst erzählt.
Erstes Capitel.
Meister Ulrich.
Das war vor Zeiten, da noch Abt Albrecht den Abtstab führte, ein viel ander Wesen allhier im Kloster, als heutzutage. Er war ein gar gestrenger Herr und manchem Novizen vergieng das Verlangen nach St. Bernhards weißer Kutte, weil ihm des Heiligen Regel ein allzuschweres Joch für die Schultern däuchte, und manch’ Anderen, der gern geblieben wäre, trieb der Abt selber hinweg. »Denn«, so pflegt’ er zu sagen: »Unmüßigkeit muß auch in der Muße suchen, wer in’s Kloster taugen will.« Und so mußt’ es denn zu seinen Zeiten hergehen, wie im Bienenkorb, wo Jedes emsig am Werke schafft, das ihm angewiesen ist, von früh bis spät, nur daß unseres Volkes Meister seine Bienen gar selten ausfliegen ließ und wenig darnach fragte, ob sie fröhlich summten bei der Arbeit oder nicht. Für Jeden fand er was zu thun und wußt’ ihn an seinen Ort zu stellen, und dem Zaudern oder Widersprechen war Niemand feinder als er. Und weil er allezeit etwas betrieb, was ihm selbst am Herzen lag, so gab’s auch immer Arbeit genug für Alle.
Dazumal ward des Klosters Gebäu mit Kirche und allem so stattlich hergestellt, wie man sich heut dessen erfreut. Aber ohne viel Seufzen gieng’s bei Denen nicht ab, die sich des Bauwesens anzunehmen hatten. Und der Abt nahm Keinen aus, so oder so mußte Jeglicher mitschaffen. Impendere curam, impendere substantiam, impendere et se ipsum. Diesen Spruch unseres Ordensheiligen legte er oft seinen Mönchen vor, wenn er sie im Capitelsaal um sich versammelt hatte, und sorgte weislich dafür, daß sie durch Übung solches Spruches Verstand um so besser inne würden.
Wie er dann die Trägen, Lässigen und die seinem scharfen Regiment abhold waren, bald herausgefunden hatte, so verhehlten auch diese unter einander ihren Groll nicht und hießen ihn, wenn sie von ihm sprachen, nur immer: Monoceros. Ich fragte, was solches Namens Meinung wäre. Da erfuhr ich: Monoceros sei ein bös Thier, gar ungeschlacht, habe ob dem Haupte ein großes Horn, gewaltiglich damit um sich zu stoßen. Ob dieser Auskunft entsetzt’ ich mich schier und sah Abt Albrecht darauf hin recht bedenklich und bänglich an. Doch konnt’ ich mich von ihm keines Bösen gewärtigen. Denn, wiewohl ich zu der Zeit noch gar jung war, dazu ungeschickt und muthwillig nach Knabenart, so war doch der gefürchtete Abt voll Gütigkeit gegen mich, und sein Angesicht, wenn’s noch so strenge sah, schaute sogleich freundlich drein, wenn ich daher kam, mich ehrbarlich neigte und ihn grüßte: Salve, domine! Ja, er trug eine sonderliche Lieb zu mir und die that mir gar wohl; denn ich war da fast ein schmächtig und schwächlich Bürschlein, stak noch halb in den Kinderschuhen, und des Lernens, dazu Bruder Berthold mich anhielt, den der Abt mir zum Magister bestellt hatte, däuchte mich oft zu viel. Schon bei den ersten Schritten auf der Bahn des Triviums vermeint’ ich, es gienge nimmer weiter mit mir und ich könnte über all’ die Blöcke und Steine, so die Grammatik mir in den Weg warf, gar nimmer hinwegklimmen. Dennoch verfuhr der Abt nach Lindigkeit mit mir, auch wenn Magister Berthold über seinen uneifrigen Scholaren sich hart beklagte; ja, der sonst Monoceros war, begütigte den unzufriedenen Lehrer von meinetwegen.
»Geduldet Euch nur, Berthold«, sagt’ er wohl, »und zwinget Dietherum nicht allzu hart! Aus dem Schwarzaug schaut kein blöder Geist; er wird wohl noch durch gelehrte Kunst unsers Klosters Zierde, wenn ihm erst die Flügel gewachsen sind. Noch ist er ja gar zart und muß sich erst festigen.«
Wie nun aber etliche Jahre herumgegangen waren, da hatte das Dietherlein sich wohl gefestigt und war kräftig in die Höh’ gewachsen, aber von den Flügeln, die sein Geist ansetzen sollte, sich in die gelehrte Kunst zu schwingen, war leider noch gar wenig zu spüren. Dennoch blieb mir unser gestrenger Abt noch immer zugethan. Und das gieng so zu.
Er hatte eine sonderliche Lust an allerlei Werk und Kunst, und wie er vormals in Welschland gewesen war und sein Auge wohl gewöhnt war zu erkennen, was Tugend hatte und Wissenschaft, so trachtete er auch eifrig danach, sein Kloster zu schmücken. Nun hatte er damals Meister Ulrich von Prag herbeigerufen, der war in der Malkunst trefflich geschickt. Welche Freude hat an ihm der Abt gehabt; wie hat er ihn aber auch angespannt und angetrieben, zu schildern und zu schaffen in der Kirch’ und im Capitelsaal und an andern Orten, wie Ihr das Alles nun fertig sehet. Ihm wär’ es schier am liebsten gewesen, Meister Ulrich wäre gar nimmer von seinem Gerüste herabgekommen oder hätte zehn Hände gehabt, und in jeder einen Pinsel.
Was aber Meister Ulrich mit meinem ausbleibenden gelehrten Eifer zu thun hatte, das war dieses. Seitdem er bei uns schuf und bildete, trachtete ich nur danach, um ihn zu sein und ihm zuzuschauen, wenn er am Werk war. Da verbracht’ ich denn, wo er an Wand und Decke zu malen hatte und drüben im Abthaus, wo ihm ein helles Stüblein zur Werkstatt hergerichtet war, am liebsten meine Zeit. Mit Bewunderung sah ich ihm zu, wie unter seiner kunstreichen Hand Christus und Unsre Frau und Engel und Heilige, ja Gott Vater selbst sichtbar wurden, wo zuvor eine weiße Wand oder ein leeres Blatt gewesen war. Ich hatte immer meine Augen an Gestalt und Farbe geweidet und Blumen und Blättlein, auch den Wiesengrund, Baum und Berg fleißig betrachtet, nicht minder den Zug der Wolken, den Glanz des Himmels. Nun dacht’ ich oft: könntest du doch auch so nachbilden, was ringsum ist; und oft betete ich zu St. Niclas, meinem Schutzheiligen, er möchte für mich auch solche Kunst erbitten, wie Meister Ulrich sie verstund. Der hatte mir auch bald abgemerkt, wonach mich’s verlangte, und so sagt’ er einst: »Diether, hast Du wohl auch Lust zu solcher Kunst, sie zu erlernen?«
»Gar gerne, Meister!« antwortete ich. »Wenn Ihr mich unterweisen wolltet, und durch St. Niclasens Hilfe!«
Da sagt’ er: »St. Niclas nicht, sondern St. Lucas Evangelista ist dieser Kunst Patron. Der mag Dir wohl günstig werden, wenn Du fromm bist. Aber unterweisen will ich Dich gern nach allem Vermögen.«
Und von Stund an durft’ ich dann bei ihm nicht mehr müßig sein, sondern mit Stift und Kohle wies er mich an gar sorgfältig. Das geschah heimlich, wenn Niemand bei uns war, weil wir fürchteten, der Abt möcht’s nicht gerne wollen leiden.
Aber je heimlicher, je lieber!
Manche Stunde, die ich sonst draußen vertummelt hatte, die versaß ich jetzt bei Meister Ulrich, auch manche, die mich hätte über den Büchern Magister Berthold’s finden sollen. Der fand denn um so häufiger Ursach’, mich zu tadeln.
»Du hast einen raschen Kopf«, sagt’ er zu mir, »dringest geschwind ein in den Verstand der Sachen; aber Du bleibst nicht im rechten Geleis, bist nicht bedachtsam und ich bring’ Dich nimmer durch’s Quadrivium. Diether, Du setzest nicht Deinen ganzen Eifer in die hohe Wissenschaft! Ich glaube, Pragensis mit seinen Schildereien hat Dir’s angethan.« Ich schwieg und trieb mein’ Sach’ nur um so mehr verhohlen; aber sie blieb’s nicht lange so.
Denn einmal, als Ulrich dort in der Geißelkammer die Geschichte vom reichen Mann malte, wie er in der Flamme Pein leidet, und Lazarum droben in Abraham’s Schooß, da war ich auch bei ihm, und weil’s just die Zeit am Tage war, in der nach der Cisterzienserregel die Brüder in ihren Zellen der Betrachtung obliegen, so waren wir im Geringsten nicht einer Störung gewärtig. Meister Ulrich hatte mich heißen einen leinenen Kittel überthun, wie er selbst trug, wenn er mit Farben umgieng; und da ich so in dieser Tracht vor ihm stund, hat er lachend zu mir gesagt: »Nun trägst Du den Rock wie Unsereiner und ich hab’ Dich für unsern Heerbann angeworben; aber dem Kriegsmann frommt die Rüstung allein nicht, er muß auch bewehrt sein. So geb’ ich denn Dir auch unsrer Mannen Speer und Spieß und verhoffe, Deine Hand wird solchen allezeit mit Weisheit und Verstand Gott und Seinen Heiligen zum Ruhme, unserer Zunft zu Ehren, den Guten zur Herzfreude führen.«
Damit fuhr er mir dreimal mit einem gar langen Pinsel über Rücken und Haupt und händigte mir dann solches Gewaffen aus. Darauf sollt’ ich, wie er sagte, sogleich mit ihm die erste Ausfahrt thun, d. i., ich mußte zu ihm auf sein Gerüst hinauf, allda ihm am Bilde zu helfen. Aber weil er just dabei war, der Hölle Flammen herzustellen, darin die armen Seelen brennen, so hieß er mich rechts hintreten, wo höher oben die Seligen schweben.
»Es möcht’«, sagt’ er dabei, »eine böse Vorbedeutung geben, wenn Du mit der preislichen Kunst an so unseligem Ort anhübest. An die schimmernden Wölklein droben sollst Du Dich machen, aus denen die Engel herfürlugen.«
Mir klopfte schier das Herz vor Freuden, als dräng’ ich selber in den wahrhaftigen Himmel, wie ich die Leiter noch höher hinanstieg, um nach seiner Anweisung am gemalten mitzuhelfen. Ich war bald mit großem Eifer in mein Thun vertieft, als plötzlich die Thür in den Angeln knarrte und laute Schritte die steinernen Stufen herniederkamen. Ich erschrak; denn zwischen den Brettern hindurch, auf denen meine Leiter stund, sah ich Abt Albrecht’s hohe Gestalt und Magister Berthold hinter ihm.
»Gebt Acht«, hört’ ich diesen sagen, »hier ist er und sonst nirgends.«
»Wartet nur«, rief der Abt zorneifrig, »wartet nur; ich will ihn wohl zu Euern Büchern treiben; will er denn keine Gelahrtheit lernen, so soll er doch lernen fleißig sein! He Diether, bist hier? Albertus Abbas hat mit Dir zu sprechen?«
Was half’s! Ich konnt’ ihm doch nicht entgehen. Zudem, wenn er so scharf sprach, war es gefährlich, ihm ungefügig zu sein. So rief ich denn: »Ja, Ew. Gnaden!« aus meinem Himmel, aber meine Stimme klang gar nicht wie eines Seligen.
»Um aller Heiligen willen!« sprach der Abt. »Was schafft der da droben. Sogleich komm hernieder und hurtig!«
Aber ich konnt’ nicht behender; denn mir wankten die Kniee, als ich auf den Sprossen der Leiter ihm näher kam. So trat ich denn vor ihn im leinenen Überkleid mit vielerlei bunten Farben geziert wie eines Stieglitzen, den Pinsel hinter mich haltend, und, wie ich meine, mit gar erbärmlicher Miene.
»O der Possen«, begann er zu schelten, »in meinem Kloster; o des Müßigganges, der solche verschuldet! Otiositas mater nugarum, noverca virtutum! Mißrathener Diether, jetzt sollst Du unsre Strenge fühlen, denn unsre Güte hast Du mit solcher Verkehrtheit gelohnt! Du versäumest das Deine und bist eine Störung und Hinderung für Meister Ulrich obendrein. Fortan wirst Du besser in Zucht genommen werden und Meister Ulrich wird Dein ledig sein.«
Wie ich das vernahm, da entfiel mir mein Herz; ich konnte nichts erwiedern; mir war’s, als würd’ ich aus dem Paradies verwiesen. Da aber ist Ulrich, mein lieber Meister, mein Engel worden, nicht der mit dem hauenden Schwerte, den Eingang zu wehren, sondern wie einer, der die Flügel um uns breitet, zu schirmen und zu erretten. Denn er trat herfür, wagt’ es und sprach:
»Wollet verzeihen, Ew. Gnaden, aber der Diether hier ist mir nie keine Hinderung oder Störung gewesen noch hat er hier Müßiggangs gepflogen oder Possenspiels. In dem Anzug, der Euch so befremdet, steht er wohl mit Fug hier; denn wer beim Malen ist, sollte dem solch Kleid nicht ziemen? Läßt es gleich bunt und scheckig, so bezeugt’s damit die Arbeit, so drin gethan wird. Und glaubt mir, Euch und dem Kloster macht die Kunst keine Schand’, die in Diether ist. – Seht hier!«
Damit zeigte er dem Abt etliche Zeichnungen von mir, die bei der Hand waren. Der nahm sie mit großem Erstaunen und seine Augen glänzten, wie er die Blätter prüfte.
»Das hat Diether gemacht; das hat Diether gemacht?« fragt’ er immer wieder.
»Ja!« sagte Ulrich, »all’ das hat Diether gemacht und, ich sag’ Euch, er wird noch ganz Anderes machen Euch zum Erstaunen, wenn Ihr ihn bei mir laßt, daß er mein Schüler sei, so lang ich hier bin.«
»So nehmt ihn, nehmt ihn immer, lieber Meister!« rief der Abt ganz freudig. »Sünde war’s, solche Gottesgabe zu unterdrücken. Diether, nun magst Du doch noch unseres Klosters Zierde werden; halt Dich recht und nimm Deines Meisters Lehren Dich an! Wie es forthin mit Deinen gelehrten Studien zu halten sein wird, das wollen wir mit Magister Berthold des Weiteren besprechen; aber nun mach’ Dich wieder an Deine Arbeit! – Ei, Meister, Ihr habt wacker geschafft die letzten Tage. Und wie das leuchtet und lebt!« fuhr er fort, während er wieder hinaufstieg.
Darauf giengen sie hinweg und wie sie an der Treppe waren, hört’ ich den Abt noch sagen: »Bruder Berthold, nun wachsen ihm doch noch die Flügel, aber andere, als wir dachten. Wir können’s nicht wehren, wollen’s auch nicht. Wenn Meister Ulrich Recht hätte! Eine Zierde des Klosters! Ich hofft’ es immer!«
Als sie hinaus waren, da sagte mein Meister: »So bist Du denn, Diether, des Malerordens heut wirklich ein Jünger worden. Gott gnade Dir dazu und alle Heiligen. Und zum guten Anfang wollen wir heut Abend beim Klostermeier nach Gebühr in Elsinger einen Trunk thun!«
Aber Magister Berthold bracht’ es auf, daß sie mich von diesem Tage her scherzweise nur nannten: Pencillatus, d. i. Pinselheld.
So war ich nun Ulrich’s Schüler und blieb es, so lang er bei uns war. Das dauerte noch ganze zwei Jahre. Da zog er von dannen nach Speyer, wohin Bischof Gebhard ihn gerufen, allda im Dom zu malen. Sein Abschied geschah von uns mit großen Ehren und der Abt, der sehr wohl mit all’ seinen Werken zufrieden war, lohnte ihm reichlich. Mir aber gieng am meisten sein Scheiden nah, und als ich ihn bis zur Klostermühle am Teich drüben geleitet hatte, mochte ich noch nicht umkehren. Er aber sprach:
»Diether, laß genug hier sein! Gott stärk’ Dich in all’ Deiner Kunst, wie Du meine Freude gewesen bist diese ganze Zeit.«
»Gott laß’ Euch immer fröhlich leben!« sagt’ ich.
Drauf gaben wir uns die Hände, rissen uns von einander und Keiner sah hinter sich.
Zweites Capitel.
Ausfahrt.
Seitdem mein Meister von uns geschieden war, mochte ein Jahr vergangen sein. Die Zeit kam heran, da ich sollte das Gelübd’ ablegen für unsern Convent. Mich bewegte das nicht sonderlich, denn ich wußt’s nicht anders von Kindesbeinen an, als daß ich ein Mönch von St. Bernards Orden werden sollte. Mir war’s weder lieb noch leid, wenigstens glaubt’ ich’s so. Inzwischen hatte ich meine Kunst fleißig geübt und mit dem Vermögen dazu war die Lust daran größer geworden. Damit mein’ ich gar nicht, daß ich immer fröhlich gewesen wäre und guter Dinge von ihretwegen, sondern oft machte sie mir einen sorgenhaften Sinn, als wär’ ich ihrer nicht werth und wäre Gott nicht dankbar genug für ihre Gunst, die er mir zugewandt. Dazu machte sie mir die Einsamkeit lieb, denn ich hatte keinen Genossen bei meiner Arbeit, und so sucht’ ich denn oft allein zu sein, auch wann ich Gesellschaft hätte haben können. Denn da konnt’ ich am besten den Gedanken nachhängen, die mit leuchtenden und glänzenden Farben und himmlischen heiligen Gestalten in meiner Seele aufstiegen, daß ich mich von Herzen daran erlabte und ergetzte. So war ich denn um die Zeit des Lebens, wo die Kraft und Lust der Jugend besonders laut zu werden pflegt, vielmehr stiller und in mich gekehrter worden, denn zuvor. Sie merkten das im Kloster und sagten: das wäre die Melancholia. Ich lachte ganz fröhlich dazu, denn ich wußt’ es besser.
Die heiligen Ostertage waren vorüber. Mit ihnen war der erste Frühling in’s Land gekommen. Der letzte Schnee war zergangen, und in den hellen Strahlen der Sonne lächelte die Erde, wie ein erwachendes Kind die Mutter anlacht, das sich die Wangen roth geschlafen hat. Von den Äckern wehte der frische Erdgeruch, die Wiesen überzogen sich mit jungem Grün und aus den Nußbäumen drüben pfiffen Abends und Morgens mit lustigem Gelärme die heimgekehrten Staaren. Mit einem Wort: Es war just so, wie es alle Jahr’ ist, seit der Herr zu Noah gesprochen: es soll nicht aufhören Sommer und Winter, und hat einen Bund darüber gemacht. Aber mir sind jene ersten Frühlingstage aus sonderlicher Ursach in Erinnerung geblieben.
Denn an einem solchen Tage war ich mit Lust seit langer Zeit zum ersten Male durch Feld und Wald gestreift und kam heim mit frischem Muth, als wäre meine Brust weiter worden von der Frühlingsluft, die sie geschöpft, und schlüge mein Herz höher darin. Und doch wollt’s mir mit dem Malen nicht vorwärts rücken, als ich mich an das Bild machte, das ich vor hatte. Das war im Brüderchor rechts über den Gefühlen, wo mir der Abt eine gar große Arbeit zugewiesen. Ich sollt’ ihm da schildern an der Wand den engelischen Gruß, die Anbetung der heiligen drei Könige und die Darstellung im Tempel, wie es jetzt Alles zu sehen ist. Dazumal war ich mit der Verkündigung, die Unserer lieben Frau geschieht, kaum über den Anfang hinaus, und weil ich die heilige Jungfrau recht in die Maienwonne hineinsetzen wollte, so hatt’ ich mich, wenn in den kurzen Wintertagen des Bildes Entwurf mir gar nicht zu Gefallen gerieth, immer auf den Lenz vertröstet, der sollte Leben schaffen draußen in der Welt und hier auf dem Bilde. Nun hatt’ ich ja seinen Gruß empfangen und griff meine Arbeit mit allem Eifer an. Aber meine Gedanken hafteten nicht daran.
»Es hat keinen Segen heut«, sprach ich da zu mir selbst, legte den Pinsel weg und setzte mich vor den Lettner in’s Gestühl.
Ich war wohl müde vom ungewohnten Gange, den ich im Freien gethan, und so schlief ich ein. Da träumte mir, ich wandelte durch ein lieblich Wiesenthal, allwo die Blumen im Morgenthau glänzten, und die Bäume rauschten über dem Bach, der hart am Wege dahinfloß. Wie ich voll Freude fürder schritt, sah ich vor mir einen seltsamen Wandersmann des Weges ziehen. Sein Kleid war schneeweiß, seine Gestalt hoch, und wie golden wehte sein Gelock im Morgenwinde. Ich eilte ihm nach und bot ihm höfischen Gruß. Jung und holdselig war das Angesicht, das er mir zuwandte. Er dankte mir meinen Gruß gar freundlich, doch wagt’ ich nicht, weiter ihn anzureden, so hochgemuth und feierlich war seine Miene. Er aber erkannte mein Begehren und sagte: »Ich kenne Dich wohl, Diether, aber Dein Weggeselle kann ich nicht sein; denn ich muß meines Herrn Gebot eilend thun.«
Da sagt’ ich: »Das muß ein reicher und milder Herr sein, der solche Boten sendet; und selig mag wohl sein, wem von Euch Botschaft wird.«
»Du findest mich auch wohl wieder«, versetzte er, »wenn Du hier auf diesem Wege beharrst; denn das ist die Straße, die ich ziehe in Maientagen.«
Darauf verschwand er vor meinen Augen, als flög’ er hinweg, und ich betete an zur Erde; denn ich merkte, daß es ein Engel gewesen war, der Gott an einem seiner Heiligen dienen wollte. Ich beschloß, da zu harren, bis er wiederkehrte, um ihn dann zu bitten, daß er mich segnen möchte. So setzt’ ich mich nieder an des Baches Rand. Aber der fieng an zu brausen und zu wallen von den Bergen her und stieg und trieb mich hinweg. Er ward zum reißenden Strome, drin alle Blumen ertranken, und sein Gischt verhüllte die Sonne. Ich schrie: »Wehe!« und entlief, denn wie verderbliche Lindwürmer drangen die Wellen hinter mir her.
Die Angst weckte mich auf. Ich war nicht mehr allein. Der Abt stund vor mir. Ich wollt’ eilig aufstehen vor ihm. Aber er hieß mich sitzen bleiben, ließ sich neben mich in den nächsten Chorstuhl und redete mich ganz freundlich an:
»Diether«, sprach er, »ich sehe, Dir will’s nicht mehr von der Hand gehen mit Deiner Kunst, wie bisher. Ich glaub’ wohl, daß nicht Trägheit daran Schuld ist. Denn Fleiß allein thut’s nicht bei so edlem Werk. Der Wille ist da, aber Seele und Sinn wollen nicht mit der alten Lust dahin, und wo die nicht gefüge sind, müssen wohl auch die Hände feiern. Denn gezwungen gedeiht solche Gotteswirkung nicht. Nun hör’ ich, merk’ es auch selbst zum Theil, daß Deine vorige Munterkeit verschwunden und Du der Einsamkeit und des Sinnirens ein Liebhaber worden bist. Wohl ziemt sich Dir ein ernster Sinn, und heilige Betrachtung schickt sich für Dich, da Du bald dem Convent Dich für immer geloben sollst. Aber weil ein Jeglicher dem Orden und der Kirche mit der Gabe dienen muß, die er von Gott empfangen hat, so müssen wir bedacht sein, Dich in Deiner Kunst zu fördern.«
»Wohlan, Diether«, fuhr er fort, »fast ist mir’s lieb, daß Du mit Deinem Bilde da nicht weiter gekommen bist, wie ich sehe. Denn heut’ hab’ ich Nachricht empfangen aus Speyer, daß dahin zum Bischof ein sonderlich köstliches Bild aus Welschland gebracht worden ist, darauf die gebenedeite Gottesmutter so preislich und herrlich gemalt ist, wie man ihres Gleichen noch nicht gesehen hat in deutschen Landen. Das wäre nun ein löblich und rühmlich Ding und eine rechte Freude für mich, wenn wir davon ein Conterfei hätten hier bei uns. Darum hab’ ich gleich an Dich gedacht, daß Du gen Speyer ziehest mit Briefen von mir, dort vom Bild eine Copey nehmest und dieselbe Gestalt der heiligen Jungfrau gebest hier auf Deinem Bilde. Da wirst Du zugleich Dein Auge an vielen andern Werken Deiner Kunst weiden können, und ich bin gewiß, Du kommst mit erneuerter Lust und erhöhter Kraft zurück. Daß ich Dich aber in die Welt allein hinauslasse, die Du bisher noch weiter nicht gesehen als eine Meile um’s Kloster, das zeigt Dir, ein wie groß Vertrauen ich zu Dir trage, daß Du beständig im Herzen haben wirst, wie Du zu Gottes und Deines Klosters Ehre diese Fahrt thust. Und weil’s Dir«, setzte er lächelnd hinzu, »mit Stift und Pinsel nicht mehr recht vorwärts will diese letzte Zeit, so mögen Wald und Feld und Wiese und Flur Dir vielleicht nützer sein, Dich zu unterweisen, wenn Du ziehest, wie auch St. Bernard gesagt hat: die Bücher, aus denen er das Beste gelernet, seien die Bäume des Waldes.«
Während er so sprach, wußt’ ich selbst nicht, was ich denken sollte. Der Traum, den ich geträumt, stund vor meiner Seele lieblich und zugleich schrecklich, als lockt’ er und drohte auch zugleich. Aus dem Kloster in die Welt hinaus hatte ich nie ein Verlangen gehabt, auch die letzte Zeit keine Wanderlust, wie der Abt zu denken schien. Mich wirrte die unerwartete Aussicht. Fast hätt’ ich den Abt gebeten, mich daheim zu lassen. Aber ich schämte mich dessen, weil es feigen und stumpfen Sinn verrathen hätte. Und so sagt’ ich bloß, als er geendet:
»Hochwürdiger Vater, ich will Euch gern gehorsamen in allen Stücken.«
»Ei, Diether«, rief er und klopfte mich auf die Schulter, »das ist für Deinen Gehorsam wohl kein zu schweres Stück, das ich Dir auflege. Ich wüßte Manchen im Convent, der thät es übergerne an Deiner Statt.« –
Darauf gebot er mir, mich zu rüsten und nach der Vesper zu ihm zu kommen. Da wollt’ er mir Briefe und Vollmacht geben und weitere Anweisung. »Denn morgen in der Frühe«, sagt’ er, »sollst Du von dannen, und um die Pfingstzeit bist Du wieder da durch Gottes unsers Heilands Gnade.«
Darauf reicht’ er mir die Hand und gieng.
So schritt ich denn am anderen Morgen ganz früh wegfertig über den Klosterhof, nachdem ich Abends zuvor von Allen Abschied genommen hatte. Aber Mancher kam mir nach, mir zur Letze nochmal die Hand zu drücken. Am Bronnen blieb ich stehen und sagte: »Laßt mich hier noch einmal aus diesem guten Quell, dessen Rauschen und Plätschern ich so oft mit Freuden betrachtet, mit meinem Reisebecher schöpfen, und wer mit mir wünscht, daß ich ihn fröhlich wieder mit Euch trinke, wenn ich heim bin, der thue mir Bescheid!«
Da trat Rigbold heran, der Bruder Kellermeister, und sagte: »Das ist nicht Brauch, Diether, mit Wasser sich zuzutrinken. Hier hab’ ich Besseres, Dein Glas zu füllen, Liebfrauenmilch, geschöpft zu Worms am Rheine. Du sollst den Wein haben zur Labe auf Deiner Fahrt.« Da schenkt’ ich ein, weil sie so wollten, und auch sie thaten einen Zug und »Gott gesegn’es!« wünschten wir einander dabei. Darnach that mir der Pförtner auf; ich gieng über die Brücke am Thor und war im Freien.
Rüstig stieg ich den Weg hinan, der gen Mitternacht aufwärts führt. Es war noch dunkel und dämmerte kaum. Als ich oben auf der Höh’ war, hatt’ es sich genug erhellt, daß ich rings umschauen konnte. Ich wandte mich und sah das Kloster liegen im Thal, wie ich es zu tausend Malen von hier aus betrachtet hatte. Nun lag doch die weite Welt vor mir, und dennoch war mir’s weh um’s Herz, als ob’s mich zurück sehnte. Die ersten Strahlen der Morgensonne trafen da das Kirchdach und der Wind trug das Geläut herüber, das zur Matutine rief. Mir war’s, als kläng’ es anders wie sonst, lauter, feierlicher, und als wüßten die Glocken, daß ich hier oben stünd’, und wollten mir auch einen Gottessegen herübertönen zum Abschied. Da sprach ich das Benedictus im Stillen mit, winkte noch einmal hinab und zog landein.
Ich schritt tapfer aus. Im ersten Dorf, durch das ich kam, zogen die Leute eben zur Arbeit auf’s Feld. »Sie haben Alle ihr besonderes Tagewerk«, dacht’ ich da, »meines ist heute das Wandern.« Mit dem erwachten Tage wuchs auch meine Wanderlust. Ich hatte meine Freude an Allem, was ich hört’ und sah, und fühlte mich gar nicht einsam. Die hellen Wolken, die über mir herzogen, die Finken, die von den Bäumen am Wege, die Ammern, die aus dem Wald her riefen, die ersten Blumen am Rain, die ich mir zum Sträußlein pflückte, boten mir Gesellschaft genug. Der Laubwald schimmerte im ersten, jungen Grün, als hienge ein zarter Schleier über dem Gezweig. Da hindurch spielten die Sonnenstrahlen gar lieblich, denn es war ein heiterer, wonnesamer Frühlingstag.
Gegen den Mittag kam ich in ein Waldgebirge, wo der Weg in Krümmungen an der Seite der Berge sich hinzog. Unten brauste ein Wasser; aber nur zuweilen sah ich’s durch das dunkle Grün der Bäume hervorblitzen. Denn dicht und ragend stunden die Tannen rings umher, so daß sie, wo der Weg eng war, schier ein Dach über mich bauten mit ihren Wipfeln. Die Sonne war im Mittag, und ich hätte hier gerne gerastet, mein Mahl zu halten. Schon gedacht’ ich, dazu niederzusitzen, als ich vor mir nicht gar ferne Stimmen hörte. Bald darauf ward ich eines Weibes ansichtig, das auf dem Arm ein Kindlein trug, und ein anderes führte sie an der Hand. Das weinte sehr und wollte sich gar nicht beschwichtigen lassen. Da eilt’ ich hinzu, grüßte und fragte das Weib, aus was Ursach’ das Mägdlein weinte und ob ich ihr helfen könnte. Da sagte sie: »’S ist mein Töchterlein, lieber Gesell, Else heißt sie und büßt jetzo ihren Willen. Da seitwärts hinunter steht unsere Hütte, und ich gehe jetzt hinauf dorthin, wo Ihr den Rauch aufsteigen sehet. Der kommt von einem Meiler; da ist mein Mann, der brennt Kohlen dorten für den gnädigen Herrn, deß wir eigen sind. Es ist ein beschwerlicher Weg dahin; aber Else wollt’ nicht daheim bleiben; sie hat müssen mitgenommen sein. Ich hab’s ihr zuvor gesagt, daß ich sie nicht tragen könnt’, wenn sie müd’ würde, weil ich das Büblein da auf dem Arm hab’. – Bist still, Kind, sonst kommst Du nimmer mit zu Deinem Vater.« Da nahm ich die Kleine auf meinen Arm, redete ihr freundlich zu und hatte sie bald so zutraulich, daß sie des Weinens und aller Furcht vergaß und freundlich mich anlachte.
»Ihr versteht’s, Euch die Kinder zu befreunden«, sagte das Weib, »denn sonst geht Elslein ihrer Mutter nicht von der Hand im Angesicht eines Fremden. Das Kind kommt gar selten unter die Leute.«
»So gehören wir wohl zusammen, Elslein«, rief ich ganz fröhlich, »denn auch ich bin fremder Gesellschaft ungewohnt; und daß Du mich magst, thut mir gar wohl!«
»Ja, mit Fug«, sagte die Frau, »denn Kinderlachen bringt Glück, und so mag Euch auch wohl gerathen, was Ihr vorhabt.«
Nicht lange waren wir unter solchen Gesprächen vorwärts geschritten, so kamen wir an eine Rodung, wo die Meiler dampften. Kaum hatte das Kind den Vater erschaut, so mußt ich’s vom Arme lassen, und lustig sprang es dem Köhler entgegen. Da gab’s zwischen den Leuten ein freudiges Grüßen. Sie hielten das Mahl zusammen, ich setzte mich auch dazu und wir theilten einander mit, was wir hatten. Sie sprachen von ihrem Heimwesen, von ihren Sorgen, denn sie waren gar arm, und von ihren Kindern. Ich hört’ ihnen stille zu, denn wir waren das Alles fremde Dinge. Aber wie traurig auch Manches war, was sie sprachen; ich hätte sie nicht besser trösten können, wie sie selbst einander ihre Last erleichterten durch die Herzlichkeit ihrer Rede. Und wie, nachdem das Gratias gesprochen war, der Mann die Kinder beide auf seine Kniee nahm, und sie ihn liebkosten, auch das Elslein nicht von ihm ließ, so geschwärzt und rauh er aussah, und mir öftermals zurief: »Seht, das ist mein Vater lieb!« da wußt’ ich nicht, sollt’ ich den armen Mann oder die Kinder für glücklicher halten, und zum ersten Mal in meinem Leben fragt’ ich mich, ob ich wohl auch je von Mutter oder Vater so gekoset worden wäre oder mit ihnen gekost hätte, und ich wünschte, es möchte geschehen sein, ob ich auch deß nicht mehr gedenken könnte, und die Hände, die mich gestreichelt, eben so arbeitshart gewesen wären, wie dieser Eltern ihre.
»Nehmt’s nicht für ungut«, sagte der Köhler, wie er mich so schweigend sitzen sah, »daß ich Euch versäume. Ich sehe meine Herzkinder selten, und so denken sie, es muß so sein.«
»Gott helf Euch«, sprach ich da, »daß Ihr sie immer so in Freuden sehet, und lasse sie Euch und Eurem Weibe zur Freude gesetzt sein all’ Euer Leben lang.« Darnach gesegnet’ ich sie, denn ich wollte weiter ziehen, und auch Elslein reichte mir ihre Hand, sagte: »Wohlauf zur Fahrt!« und lachte mir fröhlich zu.
Oft noch beim Weitergehen sah ich zurück nach dem Weibe und dem Manne mit den Kindern auf seinen Knieen, und wie ich sie nicht mehr erschauen konnte, tönte doch des Mägdleins Lachen mir im Herzen nach hell und lieblich, wie eines silbernen Glöckleins Klingen beim heiligen Amt, und ich sagte zu mir: »Wohlan, Diether, Kinderlachen bringt Glück!«
Das war mir einsamem Wandersmann, wie es schien, an diesem Tage nicht beschieden. Denn gegen Abend zog ein Wetter herauf mit einem Sturmwind, der die gewaltigen Bäume schier zu entwurzeln drohte. Der Himmel überzog sich mit finstern Wolken und schwere Regentropfen fielen hernieder. Ich beschleunigte meine Schritte, weil das Kloster von Thüngen, welches unseres Ordens ist und wo ich die Nacht herbergen wollte, nicht mehr ferne sein konnte. Aber in dem wilden Gebirg’ verlor ich den rechten Weg. Ich hatte deß eine ganze Meile gar nicht Acht, weil ich so in Hast lief; denn ein wüst Gewitter war losgebrochen. Die Blitze flammten durch den dunkeln Wald und die Donnerschläge hallten brüllend von den Bergen wieder. Dazu goß der Regen in Strömen, daß auch die Tannen mit ihrem dichten Gezweig kein Schirmdach mehr boten und ich über und über durchnäßt war. Doch fragt’ ich wenig darnach; denn wie ich merkte, daß ich irre gegangen, das schuf mir größere Sorge. Ich war auf einen Weg gerathen, der Anfangs abwärts führte, aber allgemach und in gleicher Richtung wie der, auf dem ich bisher gezogen. Dann aber lenkt’ er mich steiler hinab an das Waldwasser und an dessen Rand entlang in ein Thal, das sich in mancherlei Biegungen immer mehr verengte. Da war meine Wanderung beschwerlich und voll Mühsal und ich däuchte mich gar verlassen in dieser Wildniß. Dazu des Gewitters Zorn und des Wassers Getose! »Hilf Gott«, sprach ich, »wo soll ich rasten bei solchem Wetter in der Einöde, wenn die Nacht kommt?« Und ich dachte an das Vespergeläut im Kloster, das alle Abend’ die Brüder in Frieden zu Ruhe und Schutz zusammenruft.
Aber horch! war’s da nicht wirklich wie ein Läuten durch den Wald? Jetzt vernahm ich’s wieder; ich täuschte mich nicht. Wie mir das tröstlich und lockend erscholl! Ich förderte meine Schritte, und bald öffnete sich vor mir das Thal zu einer freien Halde.
Die Berge traten zurück wie in einen Kreis, und an dem Abhang des einen stund freundlich winkend ein Waldkirchlein, von dem das Läuten kam. Ich fand bald den Weg, der dahin führte. Wie ich ihn eingeschlagen hatte, ließ allgemach das Unwetter nach. Der Donner verstummte, der Sturm legte sich und sanft fiel der Regen. Auf einem Felsenvorsprung in halber Höhe des Bergabhanges sah ich das Kirchlein vor mir.
Mir klang das Lied seltsam und fremd, voll Schwermuth und Freudigkeit, voll Sehnsucht und Zuversicht. Aber es schien mir schön zu stimmen zu dem heiteren Abend nach all’ dem Sturm und bösen Wetter, und ich dachte: »Das kann nur das Land der zukünftigen Seligkeit, die himmlische Heimath, sein, darnach das Lied Verlangen trägt, und es ist wohl ein fromm Herz, welches zu solchen Gedanken erweckt wird durch den Bogen Gottes.«
So gieng ich mit gutem Vertrauen auf die Klause zu.
Aber ich ward fast entmuthigt, als ich ihren Bewohner ersah, der unter der offenen Thür stund. Es war ein greiser Mann von gewaltigem Wuchs, bekleidet mit einem Mantel von grobem Zeug, den ein Strick zusammenhielt; unten sahen die Füße bloß hervor. Sein Haupt war mächtig und von breiter Stirn; unter den überhangenden Brauen blickten lebhaft die blauen Augen. Die Nase war vorspringend und gebogen, der Mund von festen entschlossenen Lippen und sein Angesicht tief gefurcht, als stünde da manch Geheimniß früherer Jahre geschrieben. Ich merkte wohl, wie mein Anblick ihm wenig willkommen war; denn forschend sah er mich an und bewegte sich nicht von der Stelle.
»Ehrwürdiger«, redete ich ihn an, »ein wegmüder Wandersmann, der in die Irre gerathen ist, spricht Euch um Obdach an für diese Nacht. Wollet ihm solche Bitte um Gottes Lohn nicht versagen!«
»Das da droben«, antwortete er, »ist St. Wigbert’s Kirchlein, und die ihm da in Andacht dienen wollen, denen helf’ ich dazu und geleite sie. Aber zu herbergen ist meines Amtes und meiner Neigung nicht.«
»So verdienet an mir«, sprach ich, »St. Wigbert’s Fürsprach, in dessen Bann und Schutz ich ohne meinen Willen geführt worden bin durch des reichen Gottes Güte.«
»Du redest wie ein Pfaff«, sagt’ er darauf, »und nach Deinem Kleid möcht’ man Dich für einen Mönch halten; aber Dein Haar fällt Dir lang auf die Schultern, und Dein Auge blickt frei umher, als wär’s nicht eben gewohnt, sich demüthig zu senken. Die falsche Welt liebt sich Gevögel mit allerlei Federn, auch wohl mit falschen, und sie ist weit genug dazu.«
Da sagt’ ich: »Ihr vertraut mir nun viel oder wenig, so will ich Euch doch treulich berichten, wie es um meinen Weg steht, den ich ziehe«, und so erzählt’ ich ihm, von wannen ich käme und wozu der Abt mich ausgesandt hätte.
»Dein Abt ist ein Narr«, rief er mir da zu, »Dich so jung und unbehütet um solches Tandes willen aus dem Kloster zu stoßen, kurz ehe Du gemöncht werden sollst, und weiß nicht, was er thut. Dort die Stufen hinan ist eine Kluft, wohlverwahrt, und reichlich Moos zum Lager darin, wo die Pilger zu rasten pflegen nach der Wallfahrt. Da lagere Dich. Denn in meiner Zelle geht’s nicht an, ich habe mir jede Gesellschaft widersagt für immer. Sogleich komm’ ich nach.«