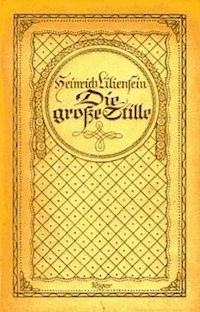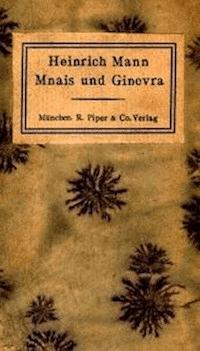0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Ähnliche
Abaellinoder große Bandit.
vonJ h d z.
F. P. Kybnitz.
Frankfurt und Leipzig,1794
Vorrede.
Troz dem, daß man in unserm Decennio nur romantische Szenen der Vorwelt, Rittergeschichten, Sagen der Vorzeit, Begebenheiten aus den Tagen des Faustrechts lesen will, schreib ich doch, wenn ich denn einmal etwas zum Lesen schreiben will, nichts davon. Ich habe den Grundsaz, der Schriftsteller müsse sich nie nach den Launen der Leser, sondern der Leser nach den Launen des Dichters bequemen. All unsre Romanschreiber, die dem Publikum mit Rittermärchen aufwarten, haben eine große Aehnlichkeit mit den Musikanten, die nach der Laune der Tänzer bald eine Menuet leiern, bald einen Walzer geigen müssen.
Sobald ich nun einmahl den Einfall habe meinen Lesern etwas zu erzählen; so ists mir gleichviel, was ich ihnen erzähle, aber mehr darauf denk’ ich wie ich ihnen erzähle. Es gilt mir gleichviel, ob ich ihnen ein morgenländisches oder abendländisches Märchen, eine Lüge oder Wahrheit vorschwazze, aber in allen diesen Plaudereien bemühe ich mich die Natur, wie sie ist, oder sein könnte, darzustellen. Ich nehme gewisse Karaktere und führe sie durch eine Reihe von Situazionen, und beobachte, wie sie sich in all diesen Verhältnissen ausnehmen. Darüber freu’ ich mich selber.
Aber diese Karaktere, so genau ich sie auch immerhin zeichnen mag, pflegen gewöhnlich am Ende der Geschichte ganz anders dazustehn, als im Anfang. Nun muß man darüber nicht böse werden und denken: die Karaktere werden sich untreu! nein. Ein andres ists mit der Schilderung des Menschen im Roman, und ein andres in dem Drama.
Das Drama umfaßt, wenn es regelmäßig ist, nur einen kurzen Zeitraum. In einem Tage oder drei Stunden verwandeln sich die Menschen nicht so leicht — hier kann sich ihr Karakter von der ersten bis zur lezten Szene gleich bleiben; hier veranlassen die Karaktere gewisse Ereignisse, Handlungen, und große Begebenheiten.
Aber im Roman veranlassen und bilden gewisse Ereignisse und Begebenheiten den Karakter des Menschen, wiewohl auch dieser Einfluß auf jene hat; das menschliche Gemüth wenn es durch eine Reihe von Begebenheiten geführt wird, nimmt von der Farbe einer jeden etwas an sich, diese vermischet sich endlich und daher oft der bunte Karakter mancher Menschen. Drängt sich der Sterbliche durch viele schwarze Situazionen, kein Wunder, wenn seine Gemüthsstimmung zulezt dunkel und ernst wird; wird er geführt durch rosenfarbne Verhältnisse, wer wundert sich dann noch über seinen frohen Humor?
Aber nicht genug, daß ich Menschenkaraktere unter allerlei Gesichtspunkten und Verhältnissen betrachte: so hab ich auch das einzig mögliche Prinzip jeder psychologischen Aesthetik, den Zwek der edlen Kunst stets vor mir, wodurch die Künste allein zur möglich erhabensten Stufe der Vollkommenheit emporgeführt werden können:
Regelmäßige Mittheilung guter Empfindungen.
Und erreiche ich diesen Zwek, errege ich in meinen Lesern nur dann und wann das moralische Gefühl, jenes reine Wohlgefallen an große, tugendhafte Handlungen und Gesinnungen, schwillt von Liebe, Mitleid und Freundschaft nur ein Busen; spricht nur ein Leser zu sich selber: handle in deinen Verhältnissen, bei deiner Erziehung, bei deinen Kenntnissen so gut, so schön, als dieser, oder jener in dieser Erzählung; fache ich nur einem Herzen den Enthusiasmus für Sittlichkeit und Tugend an, dann — dann hab ich überwunden, dann ruf’ ich: Triumph! auch die mir sparsam zugemessenen Augenblikke der Einsamkeit und Erhohlung von ernstern Geschäften sind meinen Mitbrüdern wohlthätig geworden!
So, meine Leser, kleid’ ich in das Gewand der Fabel Natur und Wahrheit, und bezielte jeder Dichter diesen herrlichen Gegenstand, wahrlich: so würden wir nicht so viel unleidliches, geistloses Gewäsch anhören müssen, woran sich heuer unsre entnervten Knaben und Mädchen bas ergözzen; so würden unsre Kunstrichter und Rezensenten nicht auf die Fabel, sondern auf ihren innern Werth, nicht auf das Continens sondern das Contentum sehn. Der Dichter ist in dieser Rüksicht zu beurtheilen wie ein Maler, der Ideale oder Wirklichkeiten, Menschen mit Flügeln, oder im Uiberrok hinzeichnet, nicht um der Flügeln, oder um des Uiberroks willen, sondern um Empfindungen des Guten, Edlen und Schönen im Zuschauer zu entwikkeln.
Leute, die mich persönlich kennen, dürften mir auch hier wieder den Vorwurf machen: warum schreiben Sie nichts solideres, nichts nüzlicheres?
Antwort: sobald ich fühle, etwas Neues, Gutes, Nüzliches in andern Disziplinen der menschlichen Erkenntniß anzeigen zu können, werde ich nicht dazu träge sein. Aber das Sprüchwort: quid valeant humeri, quid ferre recusent bedenk’ ich auch hier.
Der Dichter ist überdies, wenn er den Zwek seiner Bestimmung erreicht, der menschlichen Gesellschaft so nützlich, als der Staatsmann im Ministerio und der Gelehrte auf dem Katheder. Ein elender Dichter im Gegentheil ist eine eben so große Null in der Schöpfung, als das Genie eines Holzhakkers im Ministerio und ein geistloser Kohlkopf auf dem Katheder.
Ich wünschte gern durch Winke guter Kunstrichter das erhabne Ziel des Dichters erreichen zu können — also keinen Vorwurf darüber, daß ich — nur einen Roman schrieb! —
Amen!
Innhalt.
Abaellino,dergroße Bandit.
Erstes Buch.
Erstes Kapitel.Venedig.
Es war Abend. Ungeheure Wolkenstreifen, halb vom Schimmer des Mondes erleuchtet, bogen sich rippenförmig am Horizont hinab und durch ihnen schwamm der Vollmond in stiller Majestät hin, und sah sich verherrlicht von jeder Welle des adriatischen Meers. Still wars umher, leise tanzten die Wogen am Winde, leise hauchte der Nachtwind über die todten Palläste Venedigs hin.
Da sas noch ein junger Mann, einsam und traurig in der Mitternachtsstunde am langen Kanal; bald hob er das Auge zu den stolzen Zinnen und Thürmen von Venedig empor, bald senkte er den Blik in die Wellen. Nach einer Weile sprach er:
„Verdammt! da sizze ich nun in Venedig, und weis nicht, wie weiter! Was soll daraus werden? Alles schläft, nur ich nicht. Der Doge wälzt sich auf seinem Dunenlager, der Bettler auf seinem Strohbett — und ich lieg hier auf der kalten, nakten Erde. Der elendeste Gondelier, der ärmste Bootsknecht kennt am Tage seine Arbeiten und Nachts seine Ruhestatt, und ich — und ich — o es ist ein schrekliches Schiksal, das mit mir sein Spiel treibt! —“
Er fing an seine Taschen zu untersuchen, mit den Fingern jede Falte des Kleides zu biegen, und zu visitiren.
„Auch keinen Heller! — und mich hungert doch!“
Er besah seinen Degen im Mondschein und seufzte: „Nein, alter, treuer Gefährte, dich verkauf ich nicht; sollst mein bleiben und wenn ich verhungerte. Nicht wahr, damahls wars noch goldne Zeit, als dich Emmoine mir gab, mir das Bandelier über die Achseln warf, und ich dich und Emmoinen küßte — (Pause) Sie ist nun tod, wir beide leben noch!“
Er wischte sich eine Thräne von den Wimpern.
„Nein, das war keine Thräne; die Nachtluft geht kühl und da wird das Auge leicht nas. (Lächelnd) Hm, ich weinen! — weinen! ha, ha, ha! —“
Der Unglükliche, dies schien er, wenigstens seinen Reden nach zu sein, stämmte den Ellbogen auf die Erde, wollte mit den Zähnen knirschen — und pfiff. — „Ich müßte nicht Ich sein, dachte er bei sich: wenn ich kleinmüthig würde unter dem Fluch des Schiksals.“
In dem Augenblik hörte er in der Nachbarschaft ein Geräusch. Er sah in einem vom Monde halbhellen Nebengäschen einen Kerl auf und niederschleichen.
„Den führt mir Gott zu — ich will — ich will betteln! Betteln ist keine Schande, aber neapolitanische Schurkereien schänden. Auch, der Bettler kann gros denken.“
Mit diesen Worten sprang er auf und ging in die Winkelstraße. In eben den Moment trat von der andern Seite ein Mensch in diese Gasse. Der schleichende Kerl trat mit einemmale in den Schatten zurük, als verstekte er sich vor dem Ankommenden.
„Was soll das bedeuten?“ dachte unser Bettler: „ist der Schleicher dort etwa ein unbefugter Handlanger des Todes? haben ihn auch Vettern und Basen bestochen, um das Geld desto ruhiger in Besiz zu nehmen, was dem armen Schelm izt noch angehört, der dort so unbefangen herschlendert? warte!“
Er zog sich in den Schatten zurük und schlich dem Lauerer nahe, der keine Bewegung machte. Der fremde Mann war schon dem Lauerer und unserem Bettler vorüber, als jener mit bangen Schritten rasch hinter ihn her schlich, die rechte Hand erhob, worinn ein Dolch schimmerte, und eh’ er sich versah von dem Bettler zu Boden gestürzt wurde.
Der fremde Herr drehte sich um; der Bandit sprang auf und entfloh; der Bettler lachte.
„Was war das?“ fragte der Fremde?
„„Ein Spas, der Euch, mein Herr, das Leben rettete.““
„Mir? Wie so?“
„„Die flüchtige Massette schlich hinter Euch her wie ein lauernder Kater und hatte den Dolch schon gehoben. — Ich dachte Ihr gäbet mir dafür ein Stück Geld, denn bey meiner armen Seele, mich hungert und dürstet und friert.““
„Euch Spitzbuben, und eure Kniffe kennt man; Ihr habt euch zu dem Spas beredet, um mir die Börse abzuplündern und einen großen Dank für mein gerettetes Leben dazu. Geht mir, geht, und grellt die Leichtgläubigkeit des Dogen selber, nur an Buonarotti wagt euch nicht!“
Der arme, hungernde Bettler stand bestürzt da und sah den pfiffigen Herrn an.
„Nein, so wahr ich lebe, Herr, ich lüge Euch nichts vor — es ist mein Ernst, ich sterbe die Nacht vor Hunger.“
„„Geht, sag ich Euch, oder — —““ der Unbarmherzige zog bey diesen Worten ein geheimes Schiesgewehr hervor und drohte.
„Donner und Wetter, bezahlt man in Venedig die guten Thaten so?“
„„Die Sbirren sind in der Nähe, wie Ihr wißt, also — —““
„Zum Teufel, seht Ihr mich denn für einen Banditen an?“
„„Ich sage Euch, mache keinen Lärmen!““
„Hört, Buonarotti heißt Ihr? ich will mir doch den Namen des zweiten Schurken aufschreiben, den ich in Venedig kennen lernte. (Mit schreklicher Stimme) Und wenn du, Buonarotti, jemals den Namen Abaellino hören solltest, dann zittre!“
Abaellino drehte sich um und verlies den Unerbittlichen.
Zweites Kapitel.Die Banditen.
Der Unglükliche durchkreuzte izt Venedig, er haderte mit dem Schiksal, lachte und fluchte, stand zuweilen still, als übersänn’ er einen großen Plan, eilte zuweilen fort, als flög er ihn zu vollführen.
An einem Ekstein der prächtigen Signoria gelehnt, überdachte er die ganze Summe seines Elendes. Es schien sein irres Auge Trost zu suchen, aber er fand ihn nicht.
„Das Schiksal bat mich zum Abentheurer oder gar zum Bösewicht verdammt! tief er in einer Ekstase seines Mismuths: denn warum muß der Sohn des reichsten Neapolitaners als Bettler, die Barmherzigkeit der Venetianer anflehen? Ich, der ich Geist und Kraft zu großen Thaten in mir fühle, muß hier umherschleichen und darauf sinnen, wodurch ich mir das Leben wider den Hunger bewahre. Menschen, die ich sonst satt fütterte, die an meiner Tafel im Cyprier ihre Mükkenseelen berauschten und die Lekkerbissen fremder Welttheile von meinen Schüsseln naschten, werfen mir jezt keine verschimmelte Brodrinde zu. — O, das ist abscheulich, abscheulich von Menschen und vom Himmel! —“ Er schwieg, schlug die Arme untereinander und seufzte: „Doch, nein, so ists recht, ich will alle Grade des menschlichen Elendes durchwandern, und allenthalben mir gleich bleiben, und allenthalben gros sein. — Jezt bin ich nicht mehr der Graf Obizzo, um den Neapel einst buhlte — ich bin der Bettler Abaellino. Ein Bettler! in der Ordnung menschlicher Stände der lezte, aber doch — im alphabetischen Namenverzeichnis aller Hungerer, Pflastertreter und Taugenichtse der erste!“
Ein Geräusch entstand. Abaellino horchte umher, er war den Schleicher gewahr, den er vor einer halben Stunde zu Boden geworfen hatte, in Gesellschaft dreier andern. — Sie suchten. „Und sie suchen dich!“ sagte Abaellino leise zu sich selber, und gieng ein paar Schritt vor, und pfiff ihnen.
Die Kerls blieben stehn. Sie besprachen sich unter einander und schienen unentschlossen zu sein.
Abaellino pfiff zum andernmal.
„Er ists!“ hörte er einen von ihnen deutlich genug sprechen — und in dem Augenblik kamen sie langsam gegen ihn angewandert.
Abaellino blieb stehn, und zog den Degen. Die drey Verkappten standen einige Schritte von ihm entfernt.
„Was soll das? he, warum ziehst du Gauch den Degen?“ fragte einer von ihnen.
„„Wir müssen uns nicht zu nahe kommen, denn Ihr guten Leute lebt vom Leben anderer, ich kenn’ euch;““ antwortete Abaellino.
Ein Kerl. Galt nicht dein Pfeifen uns?
Abaellino. Nun ja.
Ein Kerl. Was willst du?
Abaellino. Hört, ich bin ein armer Schelm, gebt mir doch von eurer Beute ein Allmosen.
Ein Kerl. Allmosen? ha, ha, ha! mein Seel, das ist lustig! Allmosen von uns! doch, es gefällt mir, warum nicht?
Abaellino. Oder strekt mir funfzig Zechinen vor, ich will mich zu euch in den Dienst geben und die Schuld abarbeiten.
Ein andrer. Wer bist du denn?
Abaellino. Zur Stunde der ärmste Schlucker in der Republik. Kräfte hab ich, und lägen drei Panzer vor einem Herz, ich durchbohr’ es; und Augen, daß ich in egyptische Finsternis nicht fehlstoßen würde.
Ein dritter. Warum warfst du mich vorhin nieder?
Abällino. Geld zu verdienen; aber der Kerl gab mir für sein Leben keinen rothen Heller.
Ein andrer. Das gefällt mir! meinsts redlich?
Abällino. Die Verzweiflung lügt nicht.
Der dritte. Kerl, wenn du aber ein Schurke wärst!
Abaellino. So wären wir nicht weit von einander — und eure Dolche sind ja immer geschliffen.
Die drei gefährlichen Burschen sprachen leise mit einander und stekten ihre Gewehre ein.
„Na, komm zu uns, hier auf der Straße läßt sichs nicht gut von gewissen Sachen reden.“ Sprach einer.
„„Aber weh euch, wenn einer feindseelig wider mich handelt! Du Kerl, vergieb mir, daß ich dir vorhin die Rippen etwas zerdrükte — es soll nicht wieder geschehn! Ich will euer Gesell werden!““ sagte Abaellino.
„Auf Ehre, riefen alle; wir thun dir nichts Leides; der ist unser Feind, der dir übel thut, ein Kerl wie du, gefällt uns! komm!“
Sie giengen, Abaellino in ihrer Mitte. Mistrauisch schielte er von allen Seiten, aber in den Banditen schien kein böser Gedanke zu erwachen, Sie führten ihn seitwärts, gelangten an einen Kanal, sie banden eine Gondel los, sezten sich ein und ruderten zur entlegensten Spitze Venedigs. Man stieg aus; durchkroch verschiedne enge Straßen; klopfte endlich an ein niedliches Haus; ein junges Weib schlos auf, führte die Herrn in ein simples, aber reinliches Zimmer und beantlizte den bestürzten halbfrohen, halbängstlichen Abaellino, der noch immer nicht wußte, woran er war, und immer noch an der Sicherheit der Banditenparole zweifelte.
Drittes Kapitel.Die Banditenwohnung.
Die drey Herrn vermehrten sich bald durch zwei Neuankommende, die ihren unbekannten Gast von allen Seiten betrachteten.
„Nun laß dich doch beschauen!“ riefen die Führer und Bekannten des Abaellino, und stellten sich beym Schimmer einer brennenden Lampe um ihn her.
„Pfui, ein häslicher Bube!“ rief Molla, so hies die Wirthin und drehte sich von ihm hinweg und Abaellino wälzte einen gräslichen Blik auf sie hin.
„Kerl, sezte ein andrer hinzu: dich hat die Natur schon zum Banditen gestämpelt; welchem Zuchthause bist du entronnen, welcher Galeere hast du Valet gesagt?“
Abaellino stämmte die Arme in die Seite. „Desto besser, sagte er mit einer heisern, fürchterlichen Stimme: so darf der Himmel zu meiner künftigen Lebensart nicht sauer sehn, wenn er mich selber dazu geschaffen hat.“
Die fünf Herrn giengen beiseite und besprachen sich mit einander; den Stof ihrer Unterhaltung können wir leicht errathen. Abaellino warf sich schweigend auf einen Sessel.
Nach einigen Minuten kamen sie wieder zu ihm. Der stärkste und wildeste von ihnen trat hervor, und redete Abaellino’n an.
„Höre, Venedig ernährt fünf Banditen, wie du sie hier siehst, und für den sechsten, der du bist, wird sich auch Brod finden. Ich bin Matteo und der älteste von allen, der Rothkopf dort heißt Baluzzo, der mit dem glimmernden Kazzenauge da ist Thomas, ein Erzschelm; der Kerl dort, dem du die Rippen zerschelltest, ist Petrini, und der Wicht, der da bei der Molla steht, mit den dikken Mohrenlippen, ist Struzza. Jezt kennst du uns alle. Wir wollen dich zünftig machen, weil du ein armer Teufel bist; aber höre, bist du auch ein ehrlicher Kerl?“
Abaellino lächelte, oder vielmehr grinste, und brummte: mich hungert!
„Bist du ein ehrlicher Kerl?“
„„Das soll die Folge entscheiden.““