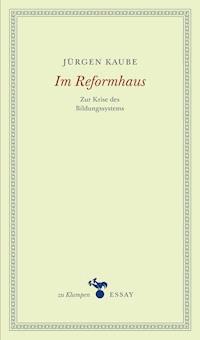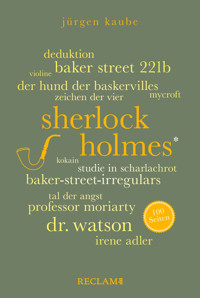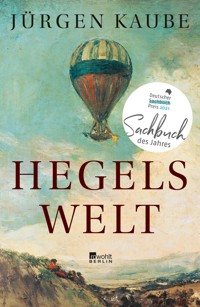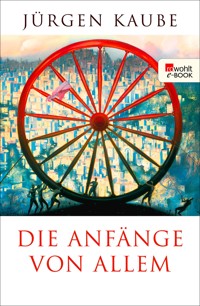12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Jürgen Kaube ist Herausgeber und Bildungsexperte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" – und Vater von drei Kindern. Aus dieser doppelten Erfahrung heraus formuliert er eine provokante These: Schule, wie sie jetzt ist, ist zu blöd für unsere Kinder, eine Fehlkonstruktion. Sie bringt den Kindern bei, was diese weder brauchen noch wissen wollen – und zuverlässig fast komplett wieder vergessen. Schlimmer noch: Die Schule heute reagiert viel zu stark auf immer neue Anforderungen, die von außen an sie gestellt werden. Die Digitalisierung des Klassenzimmers ist genauso Unsinn, wie es die Rechtschreibreform oder das Sprachlabor waren. Was jetzt gebraucht wird, sagt Kaube, ist eine Reduktion auf das Wesentliche: Kinder sollen denken lernen, darum und nur darum geht es in der Schule. Heute bringt sie ihnen vor allem bei, was leicht abgefragt werden kann. Und das ist das genaue Gegenteil von Denken lernen und damit von wahrer Bildung. Daraus leitet Kaube ebenso klare wie unbequeme Forderungen ab, die die Bildung unserer Kinder von unsinnigen Zwängen befreien. Jürgen Kaube legt ein Buch vor, das quer steht zu der bisherigen Bildungsdebatte, nicht einzuordnen ist in ein Schema von Links und Rechts, Konservativ und Progressiv. Gerade deshalb wird es heftige Diskussionen auslösen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jürgen Kaube
Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder?
Über dieses Buch
Jürgen Kaube ist Herausgeber und Bildungsexperte der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» – und Vater von zwei Töchtern. Aus dieser doppelten Erfahrung heraus formuliert er eine provokante These: Die Schule, wie sie jetzt ist, ist eine Fehlkonstruktion. Sie bringt den Kindern oft nur bei, was diese weder brauchen noch verstehen – und zuverlässig fast komplett wieder vergessen. Schlimmer noch: Die Schule reagiert dabei viel zu stark auf immer neue Anforderungen, die von außen an sie gestellt werden. Die Digitalisierung des Klassenzimmers ist genauso Unsinn, wie es die Rechtschreibreform oder das Sprachlabor waren. Was jetzt gebraucht wird, sagt Kaube, ist eine Reduktion auf das Wesentliche: Kinder sollen denken lernen, darum und nur darum geht es in der Schule. Heute bringt sie ihnen vor allem bei, was leicht abgefragt werden kann. Und das ist das genaue Gegenteil von denken lernen, Urteilskraft und Weltverständnis. Daraus leitet Kaube ebenso klare wie unbequeme Forderungen ab, die die Bildung unserer Kinder von unsinnigen Zwängen befreien.
Jürgen Kaube legt ein Buch vor, das quer steht zu der bisherigen Bildungsdebatte, nicht einzuordnen ist in ein Schema von links und rechts, konservativ und progressiv. Ein Plädoyer für eine Schule, die wirklich schlau macht.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
ISBN 978-3-644-10076-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
I. Kapitel Was die Schule angeblich können soll: alles
II. Kapitel Was die Schule vergeblich versucht: gesellschaftliche Zukunft zu sichern
III. Kapitel Was von der Schule vergeblich verlangt wird: sozialer Aufstieg für alle
IV. Kapitel Was die Schule kann: Denken lehren
V. Kapitel Was die Schule muss: Lesen, Schreiben, Rechnen unterrichten
VI. Kapitel Der Sinn von Prüfungen
VII. Kapitel Die Freiheiten des Unterrichts
VIII. Kapitel Wovon man die Schule befreien muss: Digitalisierungsphantasien
IX. Kapitel Wovon man die Schule befreien muss: Lehrillusionen
X. Kapitel Wovon man die Schule befreien muss: Zentralismus
XI. Kapitel Schüler sind Kinder, Kinder sind Schüler
XII. Kapitel Was zu tun ist: Lehrerbildung
XIII. Kapitel Was zu tun ist: Wettbewerb
XIV. Kapitel Was zu tun ist: Erziehung
Literaturhinweise
Für Helmut Hofmann
Zum Ziele der Erziehungskunst, das uns vorher klar und groß vorstehen muß, ehe wir die bestimmten Wege dazu messen, gehört die Erhebung über den Zeitgeist. Nicht für die Gegenwart ist das Kind zu erziehen – denn diese tut es ohnehin unaufhörlich und gewaltsam –, sondern für die Zukunft, ja oft noch wider die nächste. Man muß aber den Geist kennen, den man fliehen will.
Jean Paul, Levana oder Erziehlehre, § 32
Warum soll man seine Zeit mit Lernen verschwenden, wenn man Dummheit sofort kriegen kann?
Calvin und Hobbes
I. KapitelWas die Schule angeblich können soll: alles
Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtsanalyse schreiben. In 4 Sprachen.
Die Kölner Gymnasiastin, die das im Januar 2015 unter ihrem Vornamen Naina twitterte, bekam danach etwas mehr als die fünfzehn Minuten Ruhm, die einem jeden nach Warhol zustehen. In Deutschland war sie in aller Munde. Sie löste nämlich aus, was hierzulande eine Bildungsdebatte genannt wird: ein Meinungs-, Beschwerde- und Reformforderungsgewitter, bei dem der Schall schneller ist als das Licht, was zu eigentümlichen Kulturschauspielen führt.
So wurde Naina recht gegeben, in der Schule lerne man nicht für das Leben, sondern nur für die Schule selbst, mithin unnützes Zeug. Das hatte sie zwar gar nicht behauptet und wollte sie, wie sie in Talkshows umgehend erläuterte, auch gar nicht behauptet haben. Sie hatte nicht schlecht über das Analysieren von Gedichten geredet. Nur dass sie eben über das, was ihr als nächste Schritte im Leben vorschwebte – von zu Hause ausziehen, Geld verdienen, sich versichern –, auf der Schule nichts und auch sonst nirgendwo etwas erfahren habe.
Manche glaubten ihr nicht einmal das mit den Gedichten, sie wurde angegriffen, es heiße nicht «Gedichtsanalyse». Die Kenner der Fugenmorphologie bei Determinativkomposita im Deutschen – haben wir auch nachschlagen müssen – sind seit Jean Paul – der war uns noch erinnerlich – sehr strenge Leute, aber selbst ihnen fällt es schwer zu erklären, weshalb es Geduldsfaden heißt und Gehaltszahlung, jedoch nicht Gedichtsanalyse.
Das mit den vier Sprachen, ging es weiter, sei überdies auch ganz unglaubwürdig. Wer es weit bringt an deutschen Schulen, kann sich danach leidlich in dreien verständigen. Aber wer weiß, vielleicht meinte sie die Sprachen der Gedichte: Goethe, Shakespeare, Catull und Verlaine? Dann hätten in Köln tatsächlich Gedichte eine große Rolle gespielt. Doch weshalb sollte eine Bildungsdebatte denn nur anstoßen dürfen, wer selbst mehr Bildung nachgewiesen hat als ihre eilfertigen Teilnehmer? Andere wiesen die Schülerin darauf hin, dass man im Internet leicht die wichtigsten Informationen zu Mieten und Steuern finden könne. «Es ist eh lächerlich, was im Gym verlangt wird», meldete sich beispielsweise eine Stimme aus Österreich, «die anderen Sachen kann man echt auch selbst lernen.» Weniger höflich: «Für Buchhalter gibt’s die Handelsschule.» Aber sie wollte doch gar nicht Buchhalterin werden, sondern nur orientiert sein. Der Präsident des Lehrerverbandes fand, für die Alltagstauglichkeit der Jugend seien die Familien zuständiger als die Handelsschulen. «Auch Humanisten dürfen wissen, wo es langgeht in der Welt», sprang Naina jemand bei, «wobei ich jetzt gar nicht behaupten will, dass Buchhalter wissen, wo es langgeht. Wir züchten Fachidioten.» So, als sei Steuerrecht vor Fachidiotentum geschützt.
Näher an der Frage, die der Tweet aufgeworfen hatte, lag die Bemerkung, es sei schon komisch, für die Kenntnis von Steuern und Mieten werde man mehr oder weniger freundlich ans Internet verwiesen, aber Gedichte zu analysieren werde unterrichtet. Gedichte bilden den Charakter, wurde entgegnet, Steuererklärungen «eher» nicht, und der damalige «Ressortleiter Auto» von Spiegel Online, der dies schrieb, ermahnte die Schülerin, nicht zu schnell erwachsen werden zu wollen. In der Schule Zeit verplempern zu dürfen, sei doch ein Privileg. Die Sinnlosigkeit dessen, was dort gelehrt werde, bereite außerdem aufs Leben vor, denn man lerne so, sich mit unangenehmen Situationen zu arrangieren und die Frage zu beantworten: «Wie schaffe ich es, mir Materie draufzuschaffen, die mich nicht interessiert?»
Spätestens hier hatte der Tweet Nainas seine Qualität als großartiges schulpädagogisches Rorschach-Bild bewiesen, denn noch einmal: Die Schülerin hatte nichts in Richtung «Gedichte zu analysieren ist sinnlos», «Deutschunterricht, was für eine unangenehme Situation» oder «Interpretieren interessiert mich nicht» geschrieben. Und was wollte der Auto-Onliner ihr und uns nun sagen: «Verschwende deine Jugend», «Bilde deinen Charakter an Gedichten» oder «Absitzen von Zeit ist als Lektion fürs Spätere Gold wert»? Zum Schluss meinte er nämlich noch, sich Dinge anzueignen, die keinen Spaß machen – für ihn offenbar Gedichte –, bereite doch gerade auf Steuererklärungen ganz gut vor. Dann würden ja, möchte man sagen, umgekehrt auch Steuererklärungen auf Gedichte vorbereiten, charakterlich jedenfalls, oder nicht?
Lassen wir es mit diesem Höhepunkt der Kunst, einer jungen Frau zu etwas Bescheid zu geben, das sie nicht gesagt hat, vorerst bewenden. Bildungsdebatten verlaufen oft so. Sie greifen ein Ereignis auf und teilen so schnell eine Meinung dazu mit, dass die Vermutung naheliegt, die Meinung sei ganz unabhängig vom Ereignis und schon vorher gebildet worden. Mitunter hat die Meinung mit dem Ereignis entsprechend wenig zu tun. Die meisten impliziten Fragen der vielen Stellungnahmen werden im Zuge der Debatte auch nicht geprüft. Was kann jemand, der Gedichte analysieren kann? Eignen sich Steuern, Mieten und Versicherungen als Gegenstand der Fächer «Sozialwissenschaften/Wirtschaft» und «Recht», die es an nordrhein-westfälischen Gymnasien ja gibt? Kann die Schule alltagstechnisch instruktiv sein, soll sie es? Teilt die Jurisprudenz, das Fachgebiet für Steuern und Mieten, mit der Gedichtanalyse die Eigenschaft, Worte so lange anzuschauen, bis sie einen zweiten Sinn, einen Hintersinn zeigen? Wer entscheidet, welche Fächer unterrichtet werden, was in ihnen unterrichtet wird und weshalb, wozu? Sind die Begründungen, die einst dafür galten, noch immer zutreffend – oder gibt es heute erst recht gute Gründe für einen Unterricht, der Dinge lehrt, die man fast nur in der Schule gebrauchen kann, sonst «eher» nirgends?
Die kurz aufflammende Debatte um Nainas Tweet wurde, bevor überhaupt klar war, was denn die damit verbundenen Fragen sein könnten, schnell beendet. Dazu trug auch die damalige Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) mit dem Satz bei, sie finde es «sehr positiv», dass diese Debatte angestoßen worden sei, es sei wichtig, in der Schule stärker Alltagswissen zu vermitteln, aber es bleibe wichtig, Gedichte zu lernen und zu interpretieren. So enden viele Schuldebatten: Man findet das eine gut und das andere, Gedichte und Steuern, Leistung und Gleichheit, Abendland und Ausbildung, Persönlichkeitsbildung und Digitalkompetenz, Zentralismus und lokale Autonomie, G8 und G9 – die Liste dessen, was für Schulen gut gefunden wird, ist lang.
Ein halbes Jahr später regte Wanka an, über ein Schulfach «Alltagswissen» nachzudenken, was implizit den Rest des Stundenplans als «Sonntagswissen» kennzeichnete, demgegenüber das neue Fach beispielsweise über Fallen in Handyverträgen, Behördengänge und richtige Ernährung unterrichten solle. Auch das war mehr so dahingesagt, erkennbar nur als Meinung geäußert – «fände ich gut» –, und blieb selbstverständlich seinerseits ein ganz unpraktischer, operativ folgenloser, von keinerlei politischer Energie angetriebener Vorschlag.
Die Debatte um Nainas Tweet war die soundsovielte Schuldebatte seit dem Pisa-Schock im Jahr 2001. Deutschland hatte in dieser internationalen Vergleichsstudie zu Leistungen Fünfzehnjähriger nicht so gut abgeschnitten, wie es offenbar viele erwartet hatten. Das Echo war, anders als in den meisten anderen Ländern, ungeheuer. Wie konnte es sein, dass deutsche Schulen schlechter als finnische oder belgische Schulen abschnitten? Ganze Armeen von Bildungsforschern wurden ausgehoben, ganze Armeen von Schulreformern setzten sich, vor allem aber die Schule in Bewegung. Es änderte sich alles und nichts. Inzwischen liegt Deutschland etwas weiter vorne, aber immer noch hinter Estland, Macau und Singapur – hinter Singapur schon deshalb, weil dessen Schüler fast in allen Gebieten (Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften) Spitzenreiter sind.
Was das heißt, ist allerdings ebenso unklar, wie es in der ersten Runde unklar war, was das deutsche Schulsystem vom damaligen Klassenbesten, Finnland, zu lernen habe. Ob die Aufgaben, die in den Pisa-Tests gestellt werden, tatsächlich Aufschluss über die Klugheit von Schülern geben können, ist kontrovers. Welche Folgerungen aus Rangtabellen zu ziehen wären, in denen so unterschiedliche Schulsysteme wie das finnische, das südkoreanische, das kanadische und das der Schweiz gut abschneiden, kann niemand sagen. Ja, es ist nicht einmal klar, ob «Schulsysteme» auf Schüler wirken, oder deren Leistungen nicht vielmehr von sehr lokalen Umständen abhängen, zum Beispiel den Lehrern. Kurz: Es gibt kaum eine Frage zum Thema Schule, die von Pisa beantwortet worden ist. Aber es war eine große Diskussion, und alle können sagen, sie sind dabei gewesen.
Sie hatte vor allem drei Folgen: 1.) Das umfangreiche Zahlenmaterial über die Lese-, Denk- und Rechenfähigkeit der Fünfzehnjährigen, ihre Schulen sowie über ihre sozialen Hintergründe, das die Pisa-Vergleichstests hervorgebracht hatten, tat seine Wirkung über den Moment hinaus, indem an den Hochschulen die empirischen Bildungsforscher, die derlei Zahlen erzeugen und analysieren, das Heft in den Erziehungswissenschaften in die Hand nahmen. Laien mochten sich fragen, was es denn noch für eine andere als «empirische» Bildungsforschung geben könne, worauf also die Argumente der anderen, nichtempirischen Pädagogen beruhen, wenn nicht auf Tatsachen. Die Antwort gaben all die Schülertests, die nun folgten oder durch Pisa prominent geworden waren: Empirie ist, was Vergleichstests mit großen Schülerzahlen ergeben.
2.) Jedes dieser Ergebnisse diente den bekannten bildungspolitischen Positionen dazu, mit Verweis auf solche Zahlen zu bekräftigen, was auch ganz unabhängig von den Zahlen für die jeweiligen Sprecher schon feststand. Ob es sich um «länger gemeinsam lernen» handelt, um das Beenden des «Akademisierungswahns», die Stadtteilschule oder die Zwangszuteilung von Kindern aus bürgerlichen Vierteln an integrale Gesamtschulen, die stärkere Differenzierung nach Leistung, das Abschaffen von Nichtversetzungen, die endgültige Abkehr vom oder die Rückkehr zum Frontalunterricht – es gibt nichts, was nicht schon unter Berufung auf Pisa-Studien gefordert worden wäre, genauso wie sein Gegenteil.
3.) Die Berichterstattung über Siegerländer und die bildungspolitischen Besuche dort nahmen zu. Zuerst fuhren alle nach Finnland. Dort wurde ihnen mitgeteilt, dass man sich mit dem finnischen Schulsystem an dem der DDR orientiert habe, die durchschnittliche finnische Schule sehr klein sei, nur die besten Studenten Lehrer werden dürften und die Haupteinwanderergruppe nach Finnland Schweden seien. Hm. Dann wurden andere unvergleichliche Länder besucht: Japan und Korea zum Beispiel. Das kühlte die These ab, Leistungsstärke im Pisa-Test liege an einem wenig autoritären Schulsystem. Aus den relativ guten Resultaten der Schweiz und den mäßigen Resultaten in Island, mit zehn Jahren gemeinsamem Lernen, und in Norwegen, das wie Finnland die Gesamtschule neun Jahre lang hat, konnte geschlossen werden, dass die Schulstruktur nicht ausschlaggebend sein kann. Was aber den Gebrauch dieser Behauptung nicht unattraktiv hat werden lassen. Womit wir wieder bei dem Umstand wären, dass Bildungsdebatten selbst ein Beispiel für die Schwierigkeit sind zu lernen.
In Deutschland meinte man, vor allem daraus lernen zu können, dass es eine stärkere Vergleichbarkeit der Schulen auch außerhalb der Pisa-Tests bedürfe. Zwischen 2005 und 2008 führten alle Bundesländer außer Rheinland-Pfalz das Zentralabitur ein. Nächste Debatte: Man stellte fest, dass die Länder, die schon immer Zentralabitur hatten, zunächst besser abschnitten als die anderen. Das war eines der Argumente für die zentrale schriftliche Prüfung aller Schüler eines Bundeslandes gewesen: Das Zentralabitur erlaubt keine lokale Nachgiebigkeit, um durch Aufgaben, die an den Kenntnisstand vor Ort angepasst sind, dessen Schwächen zu verdecken. Kaum war aber das Zentralabitur eingeführt, verloren sich die Unterschiede zwischen den Bundesländern.
Es bedurfte keiner großen Phantasie, um zu fragen, ob der Grund dafür nicht die Absicht war, Schüler aus sehr unterschiedlich guten Schulen das Abitur gleichermaßen gut bestehen zu lassen. Dass also nicht nur Unterschiede zwischen den Bundesländern, sondern auch zwischen den Schulen auffällig sind, man aber verhindern muss, den Schülern eines Gymnasiums, das bis dahin ungestört vor sich hin arbeitete, per Zentralabitur mitzuteilen, dass sie sich am unteren Ende der Leistungsskala befinden und ihre «Einsen» in Wahrheit «Dreier» sind. Der Übergang vom Vergleich zwischen Schülern einer Klasse untereinander zum Vergleich zwischen Klassen verschiedener Schulen sollte nicht zu krassen Bewertungsabstürzen führen. Die Bildungspolitik braucht eine Erfolgsquote, und der Protest gegen Schulen wäre ungeheuer, wenn durch das Zentralabitur nachgewiesen würde, wie groß die Unterschiede zwischen Schulen wirklich sind.
Das aber ist am besten dadurch zu erreichen, dass man die schriftlichen Prüfungsaufgaben und die Korrekturvorgaben – fünfundvierzig Prozent der Lösungen genügen für ein «bestanden» statt bislang fünfzig Prozent – an das Niveau der schwächeren Schulen anpasst. «Stopp dem Abi-Schwindel» («Stop à l’arnaque du bac») hieß eine französische Streitschrift, in der 2007 der ehemalige Präsident der Sorbonne, Jean-Robert Pitte, das bekannteste zentrale Prüfungssystem Europas dafür attackierte, dass es aus politischen Gründen fast nur noch wertlose Zertifikate verteile. Sie hat nicht verhindert, dass die Forderung nach einem bundesweiten Zentralabitur in Deutschland weiter erhoben wird und erste Schritte in diese Richtung erfolgen. Das konnte auch ein Experiment nicht aufhalten, das der Frankfurter Biologiedidaktiker Hans Peter Klein durchführte, indem er 2009 die Aufgaben einer nordrhein-westfälischen Biologie-Leistungskurs-Prüfung Schülern einer neunten Klasse vorlegte, denen das Thema vorher unbekannt war. Nur vier von siebenundzwanzig Schülern und Schülerinnen hätten das Abitur nicht bestanden, eine Arbeit landete bei «sehr gut». Sie war ihrer Klasse in gewisser Hinsicht also drei Jahre voraus. Im Lesen allerdings mehr als in Biologie. Denn es waren die wesentlichen Erwartungen der Abiturklausur durch einfache Umformulierung der Aufgabenstellung zu erfüllen. Eine Klausur aus den Zeiten des dezentralen Abiturs vermochten die Neuntklässler nicht zu lösen, weil sie Wissen voraussetzte und nicht nur das Sich-Zurechtfinden in einem Text. Die Pädagogik, die lieber von «Kompetenzen» spricht als von Können und Wissen, liefert für den entsprechenden Übergang zum leichteren Abitur das Vokabular.
Auch dies ist eine Eigenschaft vieler Bildungsdebatten. Was von der Schule und vom Bildungssystem verlangt wird, ist widersprüchlich. Die Zertifikate sollen Fähigkeiten dokumentieren, aber wenn sie Fähigkeiten nur symbolisieren, ist es auch recht. Es soll gerecht zugehen – alle machen dieselbe Prüfung –, aber wenn die Gerechtigkeit unerwünschte Ergebnisse hervorzubringen droht, wird ein Verfahren bevorzugt, das Gerechtigkeit nur vortäuscht. Ob die Schüler sich dann beispielsweise in der Welt des Lebendigen orientieren können, Kenntnis von ihr erlangt haben, biologisch zu denken vermögen, wird gleichgültig, wenn sie nur mit ansprechenden Zensuren durch die Prüfung kommen. Man lügt sich in die Tasche. So, wie man in der Naina-Frage, ob für die Schule oder für das Leben gelernt werden soll und zu welchen Anteilen für das eine wie das andere, die abschließende ministerielle Auskunft ist: irgendwie für beides. Widersprüchen weicht man am besten nicht aus. Nein, viel besser, man leugnet, dass es sie überhaupt gibt.
Mit dem Hinweis auf die Pisa-Folge Zentralabitur haben wir aber im Zeitablauf der Bildungsdiskussionen vorgegriffen. Geht es am oberen Ende der Schulen um die Frage, was gewusst und gekonnt wird, so geht es am unteren Ende darum, ob überhaupt noch Unterricht im engeren Sinne des Wortes erteilt werden kann. Im März 2006 wurde über die Rütli-Schule in Berlin-Neukölln diskutiert; deren Lehrer hatten wegen der Gewalttätigkeit der Schüler gefordert, sie zu schließen. Im Oktober desselben Jahres kam die Herbert-Hoover-Schule in Berlin-Wedding in die Schlagzeilen. Hier drehte es sich darum, dass Eltern, Schüler und Lehrer verabredet hatten, auf dem Pausenhof der Schule, deren Schüler sehr unterschiedlicher Herkunft sind, solle nur noch Deutsch gesprochen werden. Das, fanden manche Außenstehende, sei eine «Zwangsgermanisierung», auch wenn weder Zwangsmaßnahmen erkennbar waren, noch viele Germanen dabei entstanden.
In beiden Fällen ging es um die Häufung von Sprachbarrieren und abweichendem Verhalten in Hauptschulen. In «Restschulen», wie man sie oft nennt, weil in ihnen vielerorts unter dem Eindruck unterrichtet wird, dass ihre Schüler keine Zukunft außerhalb der sozialstaatlichen Versorgungssysteme haben. Die sozialen Probleme, die sich in solchen Schulen niederschlagen, verflüchtigen sich selbstverständlich auch dann nicht, wenn man sie aufgelöst, mit Realschulen zusammengelegt oder in Gesamtschulen überführt hat.
Aus der Rütli-Schule scheint inzwischen eine geworden zu sein, an der Unterricht wieder in der Bandbreite des Normalen stattfinden kann. Aber kein Bericht darüber vergisst bei den Gründen dafür neben einem Personalwechsel, der Zusammenlegung mit anderen Schulen und staatlichen Fördermitteln zu erwähnen, dass sich auch das Einzugsgebiet der Schule verändert, «gentrifiziert» hat. Andernorts sind die sozialen Brennpunkte, die solchen Schulen inzwischen den Namen geben, nicht verschwunden. Und es entstehen neue: Die Polizeistatistik einzelner Bundesländer – Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen – verzeichnet einen Anstieg der Straftaten an Schulen, insbesondere der angezeigten Gewalt. Zuletzt war es im Winter 2017 eine saarländische Gemeinschaftsschule, deren Lehrer ihrem Ministerium mitteilten, von 350 Schülern seien 86 Prozent nichtdeutscher Herkunft, darunter 61 ohne oder nur mit geringen Deutschkenntnissen sowie 14 Prozent sogenannte Inklusionskinder mit besonderem Förderbedarf auch sozialpädagogischer Natur. Mit anderen Worten: eine Häufung von Krisenfällen in ihrer Schule, an der sich ein erhebliches Maß an Aggression, Gewalttätigkeit und Angst breitmache. Die Durchsetzung elementarer Normen sei nicht mehr möglich.
Ebenfalls 2006, es war ein Jahr reich an Schuldebatten, erschien das Buch des ehemaligen Direktors der Internatsschule Salem, Bernhard Bueb, in dem er das «Lob der Disziplin» anstimmte und beklagte, nach 1968 seien grundsätzliche Erziehungswerte verlorengegangen: Ordnung, Selbstüberwindung, Gehorsam. Das Buch wurde ein Bestseller, es erschienen Gegenschriften, Talkshows ernährten sich wochenlang von der Frage, ob die Jugend nicht härter angefasst werden sollte. Sie konnten auch darum so lebendig sein, weil der Autor keinerlei Hinweise gab, wie man denn nun die Zeit vor 1968 zurückerobern soll, vor allem wenn man gerade kein Internat am Bodensee zur Verfügung hat, sondern in Neukölln oder Gelsenkirchen lebt. Auch das ist ein Merkmal der Schuldebatten als querelles allemandes, wie der Schweizer Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers einmal bemerkt hat: Streit um Werte und Prinzipien, zu denen dann jeweils die Gegenwerte und Gegenprinzipien aufgerufen und ebenfalls gelobt werden, was aber auf beiden Seiten folgenlos bleibe, weil die Anwendung und damit die heikle Frage ausgespart werde, wie weit das Prinzip gehen soll.
Zwei Jahre später veröffentlichte der Jugendpsychiater Michael Winterhoff mit erheblichem Erfolg sein Buch «Warum unsere Kinder Tyrannen werden». Das war zwar kein Buch über Schulen, sondern eines über Familien. Es stellte aber – zusammen mit den Nachfolgebänden, die erklärten, weshalb Kinder, wenn man weitere Bücher des Autors kauft, nicht zu Tyrannen werden müssen – alarmierende Erziehungsprobleme dar, die, wenn es sie denn so gäbe, keine Schule gleichgültig lassen könnten. Zwei Drittel bis vier Fünftel aller Schüler, hieß es dort, wiesen Störungen auf, fast kein Schulkind sei mehr unauffällig. Die meisten davon gingen auf einen Mangel an psychischer Reife zurück, den Eltern durch einen nicht-hierarchischen Erziehungsstil verursachen. Für all das gab es allerdings keine Belege außer den sicherlich wertvollen Eindrücken aus Winterhoffs ärztlicher Praxis. Gesundheitsstudien kommen im selben Zeitraum auf umgekehrte Zahlen von etwa achtzig Prozent psychisch unauffälligen Kindern und etwa acht bis elf Prozent, deren Sozialverhalten stark abweicht. Für eine Schulklasse und das, was die Schule kann, ist es aber schon ein Unterschied, ob von fünfundzwanzig Schülern vier oder zwanzig verhaltensauffällig sind. Was weder heißt, dass es keine dramatischen Häufungen solcher Auffälligkeiten gibt, noch dass Unterricht nicht auch durch das Verhalten von vier Kindern geprägt oder verhindert werden kann. Aber was an Schulen und in der Erziehung tatsächlich der Fall ist, wird durch Übertreibungen, freihändig entwickelte Trenddiagnosen und eine Kombination aus Untergangs- und Rettungsvokabular nicht klarer: Bildungskatastrophe, Erziehungsnotstand, Pisa-Schock, digitale Demenz und so weiter.
Das waren nur einige Beispiele für das Problem unserer Schuldebatten. Sie werden zu prinzipiell geführt. Sie beschwören Werte ohne Anschauung des Unterrichtsgeschehens, zünden Kerzen an, sobald das Wort «Bildung» fällt, operieren mit nahezu uninterpretierbaren Zahlen («520 Punkte in Lesekompetenz») und überziehen die Schulen mit Dutzenden von Sollenserwartungen, hinter denen sie nur zurückbleiben können, was die Debatte mit Daueralarm versorgt. Als wäre das Erziehungsgeschehen in den Familien und den Schulen nicht schon schwer genug und als würde irgendjemand rundum gelungene Bildung durch Schule kennen. Es gibt immer etwas an ihr auszusetzen, aber es hat keinen guten Sinn, auf den Beschwerdelisten auch Einträge zu führen, die sich darüber beklagen, dass die Abschaffung der Klassengesellschaft nicht von der Schule verwirklicht wird, dass sie zu wenig zur pädagogischen Auflösung der Unterschicht beiträgt, dass dem Abitur keine Abendländer im vollumfänglichen Sinne entspringen oder Leute, die auf die Herausforderungen des Weltmarkts ausreichend vorbereitet sind, wobei sie natürlich auch klassische Musik machen können sollen.
Auffällig an solchen Erwartungen ist aber nicht nur, wie überzogen sie sind und wie wenig Wirklichkeit sie unterstellen, an der die Schule nichts ändern kann. Erstaunlich ist auch, dass die Schule oft nur noch als Vorstufe zum Eigentlichen betrachtet wird, als eine Art sozialer und persönlicher Durchlauferhitzer. Sozial für gesellschaftlichen Aufstieg, mit Bildungspolitik als wahrer Sozialpolitik. Persönlich als Einrichtung, die irgendwo anders hinführt: zur Lehre, zum Abitur, zum Studium, zum Beruf, zur Karriere. Das gilt jedenfalls für gut drei Viertel eines Jahrgangs, für die anderen wird sie zum Symbol dafür, wie unwahrscheinlich es für sie sein wird, irgendetwas von alledem je zu erreichen. Der Sinn der Schule liegt dann in beiden Fällen außerhalb der Schule. Und weil viele aus nachvollziehbaren Gründen wie aus Mangel an Verständnis, denn sie sind jung, keinen Zusammenhang erkennen können zwischen dem, was an Schulen geschieht, und der Welt außerhalb, erscheint ihnen, was ein Durchlauferhitzer sein soll, in Wahrheit als Warteraum, in dem sinnlos Zeit vergeht. Nicht wenige Eltern unterstützen ihre Kinder in diesem Gefühl, indem die Schule auch für sie vor allem Anlass zur Klage ist. Das eigentliche Leben, diesem Eindruck können sich Schüler nur schwer entziehen, findet woanders statt, was eine deprimierende Einsicht für jemanden ist, der Zigtausende von Stunden des seinen – etwa fünfzehntausend Schulstunden können bis zum Abitur zusammenkommen – in der Schule zu verbringen hat. Die Maxime «Verschwende deine Jugend» erhält so eine merkwürdige Bedeutung.
Dass die Schule auf diese abenteuerliche Weise schlechtgeredet wird, heißt nicht, dass sie durchweg gut ist. «Die» Schule gibt es ohnehin nicht, jeder Schüler muss auf eine ganz bestimmte gehen, die dann wiederum eine Klasse, eine Reihe von Lehrern, eine Abfolge von Stunden, ein Pausenhof und eine mehr oder weniger gut funktionierende Immobilie ist. Außerdem ist sie eine Stundentafel, eine Reihe von Lehrmitteln, eine Reihe von Unterrichtsausfällen (wegen Krankenstand, Fortbildung, Brückentagen, Bundesjugendspielen, Prüfungen), ein paar Elternabende und Lehrergespräche und ab und an eine Klassenfahrt.
Fast alles daran sind Festlegungen, die auch anders getroffen werden könnten und die andernorts auch anders getroffen werden. Halbtag oder Ganztag. Ganztag mit nachmittäglichem Unterricht oder mit anderen Aktivitäten. Koedukativ oder getrennt. 45-Minuten-Stunde, Doppelstunde oder andere Zeiteinheiten. Eine Lehrkraft oder zwei oder gar keine (Vertretungsstunden mit desengagierter Aufsicht). Fachunterricht, freies Spiel, AGs, Projektunterricht, Projektwoche. Schulbuch, Arbeitsblatt, Heft, neue Medien. Von der Vielfalt denkbarer und praktizierter Unterrichtsstile haben wir dann noch gar nicht gesprochen, auch nicht vom sinnvollen Gehorsam oder sinnvollen Ungehorsam gegenüber dem Lehrplan, von Beurteilungsstrenge und Beurteilungsmilde oder Beurteilungsindifferenz.
Zu allem gibt es eine andere Möglichkeit, nur zur Schule selbst nicht. Und weil es zu allem andere Möglichkeiten gibt, kann in ihrem Licht alles kritisiert werden. Wir kommen darauf zurück, dass selbst jahrzehntelang bewährte Arten des Unterrichtens, etwa im Schrifterwerb, auf einmal Reformen unterzogen werden, oder Schulen, die keinerlei Probleme mit neun Klassenstufen hatten, auf acht verpflichtet werden, um kurz danach wieder auf neun verpflichtet zu werden. Wir haben neulich von jemandem gehört, der seinen Hund «Reform» genannt haben soll, weil von diesem Namen die meiste Angst ausgeht.
Gibt es also Kriterien dafür, was die Schule soll, die weder unsachlich sind, weil sie etwas Unmögliches von ihr verlangen, noch an ihrer Praxis vorbeigreifen, indem sie unter Einsatz von Glücks- und Fortschrittsversprechen – «Erziehung vom Kinde aus», «employability», «fit für die digitale Welt» – den Unterrichtserfolg gefährden? Was ist Unterrichtserfolg? Gibt es realistische Sollenserwartungen an die Schule, die in Rechnung stellen, wer dort handelt: Lehrkräfte, Schüler, Verwaltungen, Eltern?
Für die Antwort, die ich im Folgenden versuche, sind drei Begriffe wichtig: Freude, Anregung und Denken. Schulen sind schlecht, wenn sie der Langeweile, der Ablenkungsgeneigtheit und dem Desinteresse nichts entgegensetzen. Das Wachhalten von Aufmerksamkeit, die nicht von vornherein unterstellt werden kann, das Hervorbringen von Lernfreude, von Freude an Konzentration also, von der das Gleiche gilt, sind zentrale Möglichkeiten der Schule. Kinder, heißt es, sind neugierig. Sie sind aber auch das Gegenteil. Lehrer, heißt es, sind von ihren Unterrichtsgegenständen begeistert. Manche sind es, manche waren es einmal, manche nicht einmal das. Schlechter Unterricht ist langweiliger Unterricht, wobei mir die Durststrecken rund um den Ablativus absolutus, Sinus und Cosinus oder den Unterschied zwischen Sulfat und Sulfit bewusst sind. Keine Lehrkraft erreicht alle Schüler, aber eine Lehrkraft, die niemandes Lernfreude weckt, nicht einmal die eigene, macht Fehler. Schlechter Unterricht ist also Unterricht, der für alle langweilig ist.
Dabei geht es aber nicht um Spaß. Im Vergleich zu YouTubern können die meisten Lehrer nur verlieren, im Vergleich zu dem, was Computerspiele, Einkaufen und Musikhören bieten, fallen viele Unterrichtsstoffe stark ab. Vielleicht kann hier eine Unterscheidung helfen, die für die Auseinandersetzung mit Kunstwerken in der europäischen Ideengeschichte weichenstellend war. Sind Kunstwerke, so die Frage, Gegenstände, die dem Geschmack, der Sinnenfreude, dem Unterhaltungsbedürfnis ihrer Betrachter entgegenkommen? Sind sie eine höhere Form von Speiseeis, wo dem einen Zitrone und der anderen Pistazie besser schmeckt? Es liegt auf der Hand, dass Kunstwerke sich an die Sinne wenden und noch bei tragischen Gegenständen vom «Vergnügen» des Publikums gesprochen werden kann. Doch dieses Vergnügen, so der Einwand jener Philosophen, die auch für die Theorie der Bildung ausschlaggebend wurden, ist nicht ganz von derselben Art wie das an den Leistungen der Kochkunst. Denn es ist ein Vergnügen daran, zu Gedanken angeregt zu werden, Gedanken über Gefühle, Erzählungen, Taten, Konflikte, Farben, Zeit und Raum und Sprache. Kunstwerke reizen also nicht nur die Sinne, sondern sagen, indem sie es tun, auch etwas über die Welt.
Unterricht, der nicht langweilt, dient nicht der Unterhaltung, sondern regt an (und auf und ab). Er kann von der Gewissheit getragen sein, dass es schlechterdings nichts gibt, was an sich langweilig ist. Weder Mathematik noch die Nebenflüsse der Donau oder die Kiemenatmung der Fische müssen langweilig sein. Noch über Leute, die langweilig sind, und über die Langeweile selbst lässt sich gedankenanregend reden. Über Gedichte und Mieten sowieso. Das Unterrichtsgespräch in der Zone zu halten, in der es für einige Motive erzeugt, sich daran zu beteiligen, weil Gespräche, Kontroversen, unerwartete Beiträge das Gegenteil von Langeweile sein können, wäre eine daraus abgeleitete Aufgabe. Es wird in den Schulen nicht immer gelingen, deshalb lautet die Formulierung ja auch «Was die Schule soll». Wenn es durchgehend nicht gelingt, bleibt wenig mehr als ihre sozial durchaus nicht geringe Aufbewahrungsfunktion übrig. Von Bildung müsste man dann nicht weiter sprechen.
Schließlich das Denken. Es steckt schon in den Gedanken, zu denen guter Unterricht anregen sollte. Der Begriff markiert darüber hinaus, dass Gedanken einer bestimmten Ordnung folgen, wenn sie sich von Vorstellungen, Einfällen oder Worten unterscheiden. Etwas zu sagen ist leichter, als einen Gedanken zu haben. Unterricht soll es den Schülern nicht leichtmachen. Denn er dient der Übung, Schwierigkeiten zu überwinden. Schwierigkeiten, die sich an Gedichten und an Mieten wie an Steuern zeigen, sprachliche, rechnerische und (was nicht dasselbe ist) mathematische Schwierigkeiten, solche der genauen Beobachtung und solche des handwerklichen Geschicks, technische Schwierigkeiten, solche des Gedächtnisses und solche des Körpereinsatzes. «Wo andere einen Abgrund sahen, dachte er an eine Brücke», heißt es bei Paul Valéry über Leonardo da Vinci. Wo man angesichts von Schwierigkeiten an jemanden denken kann, der sie für einen löst – ein Taschenrechner, eine Enzyklopädie, ein Experte, Leonardo da Vinci –, ist es die Aufgabe der Schule, den Sinn für die Fähigkeit wachzuhalten, die Schwierigkeiten selbst zu lösen oder es auch nur zu versuchen. Das heißt nicht zuletzt, den Sinn für verschiedene Arten von Schwierigkeiten zu entwickeln: ästhetische und logische, rhetorische und rechtliche, kommunikative und emotionale. Und es heißt, urteilsfähig in Bezug auf Lösungen zu machen. Was ist eine, was ist keine, was ist eine befriedigende und was eine großartige? Was sind Nebenfolgen von Lösungen? Was war das Problem, was war nicht das Problem?
In der Schule, hat Jürgen Oelkers einmal formuliert, ist nicht entscheidend, ob es mehr Stellen gibt, sondern was die Schulen damit anfangen. Und entscheidend ist auch nicht, dass Stunden ausfallen, sondern was geschieht, wenn sie stattfinden. Über alles andere kann man reden, die Schulstruktur und die Finanzierung, die Bürokratie und den Föderalismus. Ich werde es beim Entwickeln meines Argumentes tun. Doch im Zentrum steht, dass Struktur- und Ressourcen- und Verteilungsfragen allein im Dienste dessen beantwortet werden sollten, worum es in einer Schule gehen muss, die unseren Kindern und den Lehrern nicht zu blöd erscheint: um Lernfreude bei der Lösung schwieriger Probleme.
II. KapitelWas die Schule vergeblich versucht: gesellschaftliche Zukunft zu sichern
Auf die Frage, wofür die Schule da ist, gibt es zwei gängige Antworten. Zum einen stattet die Schule Individuen mit Wissen über die Welt aus. Sie vermittelt zwischen denen, die neu in ihr sind, und deren Zukunft. Zum anderen macht sie Gesellschaften zukunftsfähig. Das Erste führt zum Zweiten. Individuen erdulden die Schule, weil sie alle auf das vorbereitet, was unvermeidlich für sie kommt, das Erwachsenenleben, vor allem das berufliche, aber auch das staatsbürgerliche und kulturelle. Die Gesellschaften wiederum investieren in Bildung, weil sie das wohlhabender macht, wobei Wohlstand durchaus in einem mehr als ökonomischen Sinne verstanden werden kann.
Beide Antworten leiten die Aufgabe der Schule aus der Gesellschaft ab, in der wir leben. Die Schule, wenn sie richtig eingerichtet sein soll, muss zu dieser Gesellschaft passen. Viele Antworten auf die Frage, wie sie richtig eingerichtet werden kann, benutzen deshalb das Wort «heute», denn sie schreiben der Schule heute eine andere Aufgabe zu als früher. Heute, so lautet die Diagnose, befinden wir uns in einer Wissensgesellschaft. In ihr leben die meisten Menschen davon, dass ständig besonderes Wissen hervorgebracht wird. Es ist eine Gesellschaft, die sich stark von wissenschaftlichem Fortschritt abhängig gemacht hat, und zwar von solchen Erkenntnissen, die nützlich sind, die sich in Technologien, Rezepte, Programme umsetzen lassen. Gesundheit, Ernährung, Mobilität und Energieversorgung sind heute nicht ohne die Anwendung neuen Wissens denkbar. Aber auch die Filmindustrie, die Versicherungen, die Museen und die Gerichte leben von neuen Kenntnissen.
Außerdem heißt es, dass diese Kenntnisse schnell veralten. Angeblich leben wir in einer Gesellschaft bislang unbekannter Veränderungsgeschwindigkeit. Es ist zwar unklar, wie man das genau messen soll und ob die Leute, die im Zeitalter der Reformation, um 1789 oder im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gelebt haben, nicht mindestens so großem Wandel ausgesetzt waren wie wir. Fast wäre das ein Thema für den Geschichtsunterricht am Gymnasium: Was ist wirklich neu? Und ist die Welt nicht in vielen Hinsichten auch alt, stabil, bekannt? Die Schule sieht sich heute jedenfalls aufgefordert, weniger Wissen als solches zu vermitteln, als vielmehr seine Aneignung, den kreativen Umgang damit, die kooperative Hervorbringung von neuem Wissen und seine Kommunikation.
Dieses «Heute» der Schule hat spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Seitdem expandiert der Bildungssektor auf historisch beispiellose Weise, und zwar weltweit. Etwa zwanzig Prozent der Weltbevölkerung befinden sich in Schulen und Hochschulen, die dazugehörigen Lehrer gar nicht mitgerechnet. Um 1970 war dabei die Zahl der Lehrer im Grundschulbereich, im Bereich der weiterführenden Schulen und im Bereich der Hochschulen weltweit etwa gleich groß. Seitdem sind vor allem die Sekundarschulen (je nach Bildungssystem ab Klasse 4, 6, 9 oder sogar 10) und der Hochschulsektor gewachsen. Die Zeit, die an Schulen verbracht wird, hat sich entsprechend ausgedehnt. Schulische Erziehung ist heute eine Erfahrung aller, eine lange Erfahrung und eine Tatsache, die auf der Seite der Unterrichtsinstitutionen mit einem riesigen, fast immer staatlich beschäftigten Personal einhergeht. In Deutschland waren es im Schuljahr 2016/17 allein an allgemeinbildenden Schulen mehr als 750000 Lehrer. Nur zum Vergleich: Beamte insgesamt gibt es hierzulande 1,9 Millionen; Ingenieure etwa 1,6 Millionen; Juristen nicht mehr als 250000; die Post beschäftigt rund 520000 Angestellte. Soll heißen: Die Schule ist, sowohl was ihre «Kundschaft» als auch was ihre Vertreter anlangt, einer der auffälligsten Bereiche der modernen Gesellschaft.
Wenn davon gesprochen wird, dass Bildung eine Investition ist, die dem wirtschaftlichen Wohlergehen Einzelner wie ganzer Nationen nutzt, dann ist also zunächst festzuhalten, dass es sich beim Bildungssektor selbst um eine riesige gesellschaftliche Institution handelt. Zu den Schülern und Lehrern, den Gebäuden und Verwaltungskosten der Schulen kommen noch die Ausgaben für Lehrmittel hinzu, die für ständige Weiterbildung im Bereich Erziehungswissenschaften, Pädagogik und Didaktik, also für die Ausbildung der Lehrer. Dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Erziehung und Bildung in historisch beispiellosem Umfang betrieben werden, steht außer Frage.
Die Schule wirkt also auf die Lebensläufe, und sie bringt Personen hervor, die an der Produktion von Wohlstand in der Wissensgesellschaft beteiligt sind. Ohne mehrere Schulen erfolgreich absolviert zu haben, wird es einerseits immer schwieriger, einen Beruf zu finden. Ohne dass in Bildung investiert würde, scheint andererseits Wirtschaftswachstum nicht möglich. Bildung soll zu einer zufriedenstellenden Karriere befähigen, und sie wird als entscheidende Ressource der Wirtschaft wie der Demokratie betrachtet. Wann immer ein gesellschaftliches Problem auftaucht – Fortschrittsrückstände gegenüber China oder Estland, Migration, Rechtsradikalismus, Cybermobbing –, lautet die Antwort «mehr Bildung» und insofern mehr Schule.
Von beiden Antworten auf die Frage nach dem Sinn der Schule gibt es dabei politisch eine eher sozialstaatliche und eine eher wirtschaftsliberale Variante. Die linke Variante sieht die Schule in engem Zusammenhang mit den Aufstiegschancen von Kindern wirtschaftlich schwacher Herkunft. Für sie ist Bildungspolitik ein Instrument der Sozialpolitik. Der Staat soll sozialen Ungleichheiten entgegentreten, die sich durch das dafür unempfindliche Wirtschaftsgeschehen ergeben. Kinder können nichts dafür, wenn ihre Eltern arbeitslos oder bildungsarm sind, und jedem Kind sollte ungeachtet der Nachteile, die seine Herkunft mit sich bringt, die Möglichkeit zu einem aufsteigenden Lebenslauf gegeben werden.
Durch schulischen Ausgleich sozialer Nachteile, so die Vorstellung, hebt der Staat die sogenannte Begabungsreserve. Der englische Ökonom, Labour-Abgeordnete und Bildungsminister Anthony Crosland hat dieses Argument in seinem Buch «Die Zukunft des Sozialismus» von 1956 vielleicht als Erster vorgetragen. Damals machten die Sozialdemokraten ihren Frieden mit einem Kapitalismus, der zu Vollbeschäftigung und humaner Arbeit zu führen schien, und schalteten von ihrem Ziel eines gesellschaftlich tiefgreifenden Wandels auf die Forderung um, alle Schichten müssten an den Erträgen der Wirtschaft beteiligt werden, und zwar möglichst gleichmäßig. Die Umverteilung von Einkommen über große Investitionen in ein Bildungssystem, das mehr Schüler auf weiterführende Schulen und zu höheren Abschlüssen bringt, lohne sich dabei für alle, weil so einerseits Begabungen nicht verlorengehen und andererseits die sozialstaatlichen Kosten der Vorsorge für Bürger, die sich nicht selbst versorgen können, begrenzt werden. Gerechtigkeit ist effizient, so lautet das Argument.
Die wirtschaftsliberale Sicht auf die Schule ist hiervon nicht weit entfernt. Auch sie betont, dass in der Wissensgesellschaft alles darauf ankomme, an zukünftige Wachstumschancen zu denken und in Bildung zu investieren. Wohlstand hänge in fortgeschrittenen Industriegesellschaften immer mehr «von den Köpfen» ab. Die Schulen sollen auf die nächste Zukunft dieses Wirtschaftens ausgerichtet werden. Sie und die Hochschulen haben für die «employability», die Beschäftigungsreife der Jugendlichen zu sorgen, nicht zuletzt, weil das die Schüler selbst und ihre Eltern so wollen. Unter den Bedingungen einer Ökonomie, die von technologischen Innovationen lebt, etwa von Maschinenbau, Chemie und Kommunikationstechnik, heißt das heute, dass die Schulen auf eine digitalisierte Welt, vor allem auf eine digitalisierte Wirtschaft vorbereiten sollen. Immer weniger werden gering qualifizierte Arbeitskräfte, wird manuelle Arbeit eine Rolle spielen; es gibt fast keinen Beruf, der nicht von wissenschaftlich hervorgebrachten Neuerungen berührt würde. Bildungspolitik ist insofern ein Instrument der Wirtschaftspolitik. Weil nur verteilt werden kann, was zuvor erwirtschaftet wurde, lautet hier das Argument: Innovation ist die Voraussetzung für Gerechtigkeit.
Soweit die beiden Deutungen der gängigen Antworten auf die Frage, was Schulen sind. Im Zuge der starken Angleichung politischer Programme haben diese Vorstellungen seit gut zwanzig Jahren Eingang in die bildungspolitischen Grundsätze fast jeder Partei gefunden. Hinzugekommen ist ein erweitertes Verständnis der sozialpolitischen Aufgabe von Schulen, weil wir unterdessen in einer stark von Migration geprägten Gesellschaft leben, in der ein erheblicher Teil von Einwanderern unter erzieherisch ungünstigen Umständen aufwächst. Manche Forscher sprechen von «ethnischer Unterschichtung», um die Kombination von Nachteilen zu bezeichnen, die sich aus sozioökonomischer Schwäche, Fremdsprachigkeit und kultureller Herkunft ergeben können. Die Aufgabenstellung, Schulen hätten hier für Ausgleich zu sorgen, gehört ebenfalls zum breiten Konsens der bildungspolitischen Positionen. Wer eine Rede hört, in der beim Thema Schule von «Investition in die Köpfe», «Chancengleichheit», «Vorbereitung auf die Digitalisierung» und «Integration» gesprochen wird, weiß darum noch nicht, aus welcher Richtung diese Rede kommt. Alle reden inzwischen so. Bildungspolitisch kontrovers wird es, wenn die Frage folgt, wie die Schulen denn die Aufgaben erfüllen sollen.
Doch diese Frage lohnt sich erst, wenn zuvor zwei andere gestellt worden sind. Erstens: Können Schulen diese Aufgaben überhaupt erfüllen? Und zweitens: Hat die Schule nicht ganz andere Aufgaben, als Individuen auf die Zukunft vorzubereiten und den nationalen Wohlstand durch den Bildungsaufstieg für alle zu steigern? Anders formuliert: Gibt es nicht etwas Besseres, das Bildung bewirken kann, als beruflichen Aufstieg? Und etwas Besseres als Wirtschaftswachstum in einer global digitalisierten Welt?
Um an dieser Stelle richtig verstanden zu werden: Es ist nichts gegen beruflichen Aufstieg, nichts gegen Wirtschaftswachstum als solches einzuwenden und nichts gegen soziale Chancengleichheit. Das alles sind Werte, und Werte haben die Eigenschaft, schwer ablehnbar zu sein, freilich auch einander im Wege zu stehen und keine konkrete Information zu geben, wie sie sich verwirklichen lassen. Für die Schule ist aber entscheidend, was sie zu all dem beitragen kann und ob das, wozu sie am meisten beitragen kann, irgendetwas mit diesen Zwecken zu tun hat. Können die Schulen, was sie sollen, und wenn nicht, was können sie stattdessen?
Beginnen wir mit der Frage, ob Bildung geeignet ist, die Zukunft von Individuen und nationalen Wohlstand zu sichern. Und beginnen wir mit Zweifeln, die aus einer unverdächtigen Richtung kommen, nämlich von Ökonomen. In ihrem Buch «Does Education Matter?» hat sich die englische Ökonomin Alison Wolf, die inzwischen als Baroness Wolf of Dulwich im Oberhaus des britischen Parlaments sitzt, mit der Behauptung beschäftigt, Bildungsinvestitionen seien der Schlüssel zum Überleben auf dem Weltmarkt und Lernen sei der Schlüssel zu individuellem Wohlstand. Was Letzteres angeht, scheint die Sache klar. Nach zwanzig Jahren beruflicher Tätigkeit hat eine Person mit einem akademischen Abschluss durchschnittlich doppelt so viel verdient wie jemand, der keinen Abschluss vorweisen kann, aber dafür zehn Jahre früher begonnen hat, Einkommen zu erzielen. Ein Jahr länger im Bildungssystem zu bleiben, führe zu einem Gehaltszuwachs von etwa zehn Prozent, schätzen manche Arbeitsökonomen. Die Abstände sind je nach Land unterschiedlich, doch das Bild, das sich ergibt, ist einheitlich: Leute ohne Abitur verdienen ungefähr ein Viertel weniger als Leute mit Abitur, die mit einem Hochschulabschluss ungefähr zwei Drittel mehr.
Andere Vorteile wie Arbeitsplatzsicherheit, Festanstellung oder sogar eine erhöhte Lebenserwartung kommen hinzu. Natürlich gilt das alles nicht für jede Person, die mit einem höheren Zertifikat abschließt. Grundschullehrerinnen verdienen weniger als selbständige Schreiner, der berühmte Taxifahrer mit Magister in Philosophie verdient insgesamt weniger als jemand, der mit achtzehn schon ins gleiche Auto stieg, und das Lebenseinkommen von Mesut Özil wird auch ein Chefarzt in der Herzchirurgie nicht so leicht einholen. Aber es gilt im Durchschnitt. Für Deutschland ist errechnet worden, dass jemand mit Hochschulabschluss durchschnittlich siebzig Prozent mehr verdient als jemand mit abgeschlossener Lehre: Bildung zahlt sich aus, und das trifft auch zu, wenn man die Erträge mit den Kosten der verschiedenen Schullaufbahnen verrechnet.
Diese Berechnungen beruhen alle auf einer Annahme: dass die Gehälter an die Produktivität der Arbeitnehmer geknüpft sind und die Produktivität an deren schulische Bildung. Unterstellt wird also, dass die Arbeit eines Hochschulabsolventen, der das doppelte Gehalt eines ungelernten Arbeiters bezieht, für die Volkswirtschaft auch ungefähr doppelt so wertvoll ist, weil er sich so viel Wissen und Können auf Schulen und Hochschulen angeeignet hat. Unterstellt wird weiterhin, dass wenn sowohl der Hochschulabsolvent als auch der ungelernte Arbeiter je eine Tochter haben, die Volkswirtschaft davon profitiert, wenn nun beide ihrerseits Hochschulabsolventen werden. Dass die Töchter selbst davon profitieren, liegt auf der Hand.
Lassen wir zunächst Alison Wolfs Scherz beiseite, dass diese Logik «Wenn Bildung uns wohlhabend macht, macht uns mehr Bildung noch wohlhabender» auf den Satz «Vier Aspirin sind besser als zwei» hinausläuft. Er deutet an, dass die Steigerung von etwas Gutem eine Sache nicht notwendig besser macht, weil jede Steigerung auch etwas kostet – Zeit, Geld, die Beschäftigung mit anderem als Bildung – und die zusätzlichen Erträge eines verlängerten Aufenthalts im Schulsystem stark davon abhängen, was dort mit den Schülern geschieht. Das gilt schon für jeden Einzelnen. Natürlich variieren die Gehälter auch innerhalb der Gruppe der Hochschulabsolventen oder innerhalb der Gruppe derjenigen, die mit einem Realschulabschluss eine Lehre durchlaufen haben. Wie viel die jungen Erwachsenen von ihrem Studium profitieren, hängt unter anderem davon ab, was sie studieren: Germanistik oder Flugzeugtechnik. Und davon, wie sie studieren: gleichgültig, ängstlich, nachdenklich. Gerade der Umstand, dass nicht alle, die das Abitur bestanden haben, daran ein Studium anschließen, sondern einige von ihnen ihren Abschluss einsetzen, um eine attraktive Lehrstelle zu bekommen, macht deutlich, dass es auch Handwerksberufe gibt, die als mindestens so erstrebenswert und ertragreich empfunden werden wie Berufe, für die man sich nur durch ein Studium qualifizieren kann. Dass Akademiker durchschnittlich mehr verdienen, nützt denjenigen nichts, die zu dieser Durchschnittsbildung von unten beitragen, weil sie gegenüber denjenigen, die die richtige Lehre machen, das – rein ökonomisch betrachtet – Falsche studiert haben. Es gibt außerdem Tätigkeiten, deren Produktivität zu messen, vor einige Probleme stellt: Bei Anwälten, Lehrern, Polizisten beispielsweise dürfte es nicht einfach sein.
Das entscheidende Argument gilt aber dem Zusammenhang von schulischer Bildung und Einkommen. Er symbolisiert inzwischen geradezu den Sinn, der dem langen Aufenthalt an Schulen und dem Erwerb mehrerer Bildungszertifikate (Abitur, Bachelor, Master, Promotion) zugeschrieben wird, und zwar auch dann, wenn richtigerweise ergänzt wird, dass Geld nicht alles ist, was im Leben zählt. Geld allein macht nicht unglücklich. Doch auch wer einen Beruf nicht wegen des damit verbundenen Einkommens anstrebt, sieht sich der Forderung gegenüber, entsprechende Abschlüsse vorzuweisen. Wodurch also wird jener Zusammenhang von schulischen Leistungen und Beruf hergestellt? Wie kommt es dazu, dass Leute, die in Schulen und Hochschulen erfolgreich waren, durchschnittlich mehr Gehalt beziehen als diejenigen, die früher ausgestiegen sind?
Die naheliegende Antwort lautet: weil sie dort Fähigkeiten erworben haben, die nachgefragt sind. Sie können und wissen etwas, das nützlich ist und das andere nicht können oder nicht wissen, und die Schulen haben ihnen dieses Etwas vermittelt. Wir sind wieder bei Naina. Denn inwiefern steigert die Kenntnis von Goethes erstem Roman, von «Gedichtsanalyse in vier Sprachen» und der Grundzüge des pflanzlichen Stoffwechsels sinnvollerweise die Attraktivität von Bewerbern um eine Lehrstelle als Kunstschreiner oder die Chancen beim Zugang zum Medizinstudium? Schüler quälen sich, um eine Eins vor dem Komma ihrer Abiturnote zu haben, damit sie Psychologie, Zahnheilkunde oder «BWL in Mannheim» studieren können – aber wieso sie das eher dürfen, wenn sie einmal viel über den Föderalismus, Napoleon oder lineare Algebra gewusst haben, ist unklar. Was trägt die Schule durch Geographieunterricht, die Bestimmung von Wendepunkten in kubischen Funktionen und durch Wissen über den Konjunktiv im Französischen zur «employability» ihrer Absolventen bei?
Wie immer die Antwort lautet, sie liegt nicht auf der Hand. Auf der Hand liegt zu sagen: so gut wie nichts. Wenn es die Absicht der Schulen und Hochschulen wäre, aus ihren Klienten allesamt Wissenschaftler zu machen, könnte man leicht begreifen, weshalb sie unterrichten, was sie unterrichten. Denn die meisten Schulfächer leiten sich aus wissenschaftlichen Disziplinen ab, die Lehrer erhalten ihre Ausbildung in diesen Disziplinen, und sogar das Lehren selbst hat man, nach einigem Zögern, unter den Titeln «Pädagogik», «Didaktik» und «Erziehungswissenschaft» zu einer wissenschaftlichen Angelegenheit gemacht. Da der Sinn der Schule aber nicht darin liegen kann, aus Kindern vornehmlich Wissenschaftler oder Lehrer zu machen, muss sich die Erklärung dafür, dass hohe Bildungsabschlüsse auch außerhalb wissenschaftlicher Berufsfelder honoriert werden, von den unterrichteten Fächern und Stoffen lösen. Wir lernen nicht die Photosynthese, um Biologen, nicht Shakespeare, um Literaturhistoriker zu werden.
Das Rätsel der schulischen und universitären Bildung liegt also nicht darin, dass wir leider für die Schule lernen, obwohl wir besser für das Leben lernen würden. Sondern darin, dass wir für die Schule lernen und sich das in einem Leben auszahlt, das außerhalb der Schule stattfindet und auch ganz anders als die Schule ist. So formuliert es der Ökonom Bryan Caplan: Nicht die schwache Verbindung zwischen den Inhalten des Unterrichts und dem, was wir später tun, ist das Rätsel, sondern diese schwache Verbindung bei einer zugleich ganz engen Verbindung von Bildungserfolg und Berufserfolg.
Dass Elektronen kleiner als Atome sind, weiß unter den Erwachsenen ungefähr noch ein Drittel aller dazu Befragten. Gewiss, Sie und ich wussten es natürlich – aber wüssten wir auch noch, wozu mathematische Matrizen da sind, was «erlebte Rede» ist und wo Zitronensäure eine Rolle spielt? Wir erinnern gegebenenfalls diese Worte. Menschen mit Abitur erkennt man manchmal daran, dass der Begriff «Zitronensäure» bei ihnen ein Déjà-vu, ein Déjà-entendu, ein Déjà-lu auslöst. Meistens aber nicht viel mehr. Immerhin, sagt man dann, ich glaube, ich wüsste ungefähr, wo ich nachschauen müsste, es war irgendetwas mit Pflanzen, und vielleicht würde ich mich wieder hineinfinden.
Das Vergessen des meisten, das einmal «dran war», hängt damit zusammen, dass die Elementarteilchen wirklich sehr klein sind und genauso wenig wie das Wissen von Zitronensäure und erlebter Rede im Alltag der meisten Erwachsenen eine Rolle spielen. Doch die spätere Kenntnis ist nicht nur bei speziellen Schulstoffen wie Latein oder dem Beweis von Unstetigkeitsstellen in Kurven schwach, die nur von den wenigsten weiterverwendet werden. Selbst das, was wichtig sein könnte, wird später nicht mehr erinnert. An den Universitäten werden Nachholkurse mit Themen wie Potenzrechnung eingerichtet, bevor man Abiturienten auf Volks- und Betriebswirtschaftslehre loslässt, oder diese auf sie. Wie man Potenzzahlen addiert oder dividiert, ist Stoff im Mathematikunterricht der Klasse 8. Manche behaupten sogar, so etwas werde von den meisten Schülern nicht erst nach Jahren, sondern ziemlich sofort wieder vergessen, nämlich kurz nachdem es dabei half, durch die entsprechende Prüfung zu kommen. Regelmäßig regt sich die Öffentlichkeit auf, wenn bei Siebzehnjährigen festgestellt wird, dass sie nicht über elementare Daten der Geschichte verfügen, obwohl Auschwitz, die Wiedervereinigung, Willy Brandt oder die DDR gerade erst im Unterricht behandelt wurden. Die meisten Sachen gehen, mit einem Wort von Karl Kraus, bei den Schülern zum einen Ohr rein und zum selben Ohr wieder heraus.
Das gilt, nebenbei gesagt, dann natürlich auch für alle Zukunftsthemen. Die Forderung, man müsse an den Schulen unbedingt mehr Wirtschaft unterrichten, mehr Programmieren, mehr Ökologie, mehr Gesundheits- und Ernährungskunde, ist verständlich. Man stellt sich den entsprechenden Unterricht wie einen Erste-Hilfe-Kurs vor, dessen Absolventen danach in Notsituationen elementare Techniken beherrschen. Es ist an sich auch gar nichts dagegen zu sagen, solche Themen und Fächer aufzugreifen. Allerdings werden die neuesten Erkenntnisse über Banken, die jüngsten Programmiersprachen, die aktuellsten Befunde der Medizin bereits veraltet sein, wenn die Schüler aus der Schule heraustreten. Es ereilt also gerade die erwartete Zukunft das sichere Schicksal, Vergangenheit zu werden, manchmal sogar, ohne jemals Gegenwart geworden