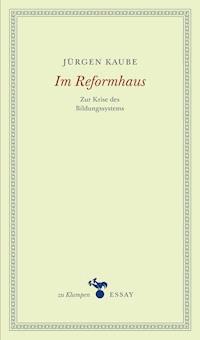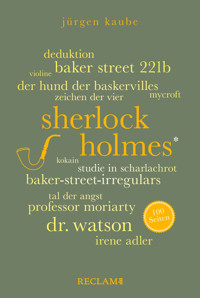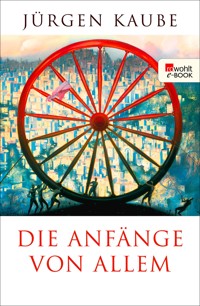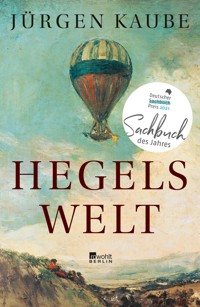
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Sachbuchpreis 2021, Sachbuch des Jahres. Durch keinen anderen Denker lernt man so gut kennen, was auch die «Sattelzeit» genannt wurde: der Übergang des alten Europa in die moderne Gesellschaft. Ob Aufklärung, die Herrschaft Napoleons oder die Befreiungskriege, ob Industrialisierung, Vormärz oder die großen Entdeckungen – die Welt ändert sich während der Lebensjahrzehnte Georg Wilhelm Friedrich Hegels von Grund auf. Und zwar durch Ideen, die zu Revolutionen führten: politische, industrielle, ästhetische und pädagogische. Nicht umsonst hat Hegel von der Philosophie verlangt, ihre eigene Zeit auf den Begriff zu bringen; nicht ewige Wahrheiten, nicht den Grund allen Seins, sondern die eigene Zeit in Gedanken. Jürgen Kaube erzählt Hegels Leben, erläutert sein Werk und zeigt, wie jene epochalen Umbrüche zum Versuch einer letzten Revolution führen: der des Denkens. Hegel wirkte unter anderem in Jena, dem intellektuellen Zentrum der Klassik mit inspirierender Nähe zu Schiller und Goethe, die er kannte wie die anderen Großen seiner Zeit. Als begnadeter Polemiker stritt er gern, etwa mit den Romantikern; als allseits Interessierter nahm er alles Neue auf. Aber auch dem Persönlichen schenkt Kaube alle Aufmerksamkeit: dem unehelichen Sohn Hegels etwa, der in Indonesien am Tropenfieber starb, oder Hegels Schwester, die an der republikanischen Verschwörung in Württemberg mittat. – Eine faszinierende Biographie – und eine Zeit, in der sich die Welt, unsere Welt, neu formierte. Letzteres lässt dieses Buch auch zu unserer Gegenwart sprechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 848
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Jürgen Kaube
Hegels Welt
Über dieses Buch
Jürgen Kaube legt die erste umfassende Biographie dieses großen deutschen Philosophen seit Jahrzehnten vor: Er erzählt Hegels Leben, führt ein in sein Denken und zeigt, wie sich in beidem eine ganze Epoche spiegelt. Eine Epoche des gewaltigen Umbruchs. Durch keinen anderen Denker lernt man so gut kennen, was auch die «Sattelzeit», die «Achsenzeit» genannt wurde: den Übergang des alten Europa in die moderne Gesellschaft. Ob Französische Revolution, napoleonische Ära oder Befreiungskriege, ob Technik, Industrie oder die Kolonisierung fremder Kontinente – in diesen Jahrzehnten veränderte sich die Welt grundlegend. Nicht umsonst steht Hegel für den Beginn einer Philosophie, die versucht, ihre Zeit auf den Begriff zu bringen.
Hegel wirkte unter anderem in Jena, dem intellektuellen Zentrum der Klassik mit inspirierender Nähe zu Schiller und Goethe, die er kannte wie die anderen Großen seiner Zeit. Als begnadeter Polemiker stritt er gern, etwa mit den Romantikern; als allseits Interessierter nahm er alles Neue auf. Aber auch dem persönlichen Umfeld Hegels schenkt Kaube alle Aufmerksamkeit: der Gattin aus reichem Hause ebenso wie der Zimmerwirtin, mit der Hegel einen unehelichen Sohn zeugte, der später in Indonesien am Tropenfieber starb; oder Hegels Schwester, die an der republikanischen Verschwörung in Württemberg mittat.
Jürgen Kaube erzählt die faszinierende Biographie eines großen Geistes und von einer Zeit, in der sich die Welt neu formierte. Vielleicht ist es Letzteres, was dieses Buch auch zu unserer Gegenwart sprechen läßt.
Vita
Jürgen Kaube, geboren 1962, ist Herausgeber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Zuvor leitete er dort das Ressort Geisteswissenschaften und war stellvertretender Feuilletonchef. 2012 wurde er vom «medium magazin» als Journalist des Jahres im Bereich Wissenschaft ausgezeichnet, 2015 erhielt er den Ludwig-Börne-Preis. Seine vielgelobte Max-Weber-Biographie (2014) war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Über den Bestseller «Die Anfänge von allem» (2017) schrieb die «Süddeutsche Zeitung»: «ein ungemein lesenswertes Buch, unfassbar interessant».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung akg-images/Erich Lessing (Der Luftballon. Gemälde von Francisco de Goya, um 1813/16. Agen, Musée des Beaux-Arts)
ISBN 978-3-644-11981-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Einleitung Was ist Idealismus?
Erstes Kapitel Hegel geht zur Schule
Zweites Kapitel Der Mönch in der Revolte – Tübingen als Lebensform
Drittes Kapitel Das Pensum der Gruppe 1788. Was Hegel, Hölderlin und Schelling lasen
Viertes Kapitel Der Hofmeister oder Nachteile der Privaterziehung
Fünftes Kapitel Im Haus zur Goldenen Kette – Hegel mit und ohne Hölderlin in Frankfurt
Sechstes Kapitel Wie tot ist Gott in Jena? Hegel wird Philosoph
Siebtes Kapitel Die Nacht im Menschen – Hegels «Phänomenologie des Geistes»
Achtes Kapitel Die Zeitung, Schelling und die Frage «Wer denkt abstrakt?»
Neuntes Kapitel Hauptsache anstrengend: Schule, Logik, Ehe
Zehntes Kapitel Ein Quantum Sinn: das schwierigste Buch der Welt
Elftes Kapitel Geist- und Leibzuständigkeit: das kurze Vergnügen in Heidelberg
Zwölftes Kapitel Die Universität des Mittelpunktes – Hegel kommt nach Berlin
Dreizehntes Kapitel Es wird politisch ungemütlich: Waschlappen, Strudelköpfe und der Herr Geheimrat Knarrpanti
Vierzehntes Kapitel Vernünftig, wirklich, wirklich vernünftig? Hegel in einem Satz
Fünfzehntes Kapitel Christiane, Ludwig und die herrlichste Gestalt aller Zeiten – Hegel über die Familie
Sechzehntes Kapitel Nach dem Ende der Kunst eilt Hegel in die Oper
Siebzehntes Kapitel System oder Roman? Die Philosophie der Geschichte
Achtzehntes Kapitel Der Hund als Christ und der Geschmack für das Unendliche
Neunzehntes Kapitel Beweisaufnahme. Rede des lebendigen Philosophen vom Katheder herab, dass Gott sei
Zwanzigstes Kapitel Wenn mehr endet als beginnt: Hegel über die Zukunft und im Streit
Einundzwanzigstes Kapitel Von keiner Revolution: Freizeit und Unruhe in Hegels letzten Jahren
Zweiundzwanzigstes Kapitel Das Ende
Epilog
Literatur
Personen
Dank
Bildnachweis
Tafelteil I
Tafelteil II
Tafelteil III
In Erinnerung an meinen Großvater, Franz Jauch (1901–1982)
EinleitungWas ist Idealismus?
Noch scheint alles ruhig. Die Welt, überwiegend aufgeteilt in Monarchien, ihre Kolonien und viele weiße Flecken auf der Landkarte, befindet sich um 1770 augenscheinlich nicht in revolutionärem Aufruhr. Es gibt Kriege, aber die gab es immer. So wie den Handel. Überall in Europa kommt jetzt Industrie auf, fabrikförmige Wirtschaft mit hoher Arbeitsteilung, sowie das wissenschaftliche Denken und Forschen. Es stützt sich auf immer mehr Teilnehmer, die untereinander zunehmend vernetzt sind und ständig neue Einsichten hervorbringen. Die chemischen Elemente werden entdeckt: 1766 der Wasserstoff, 1772 der Sauerstoff, 1775 der Kohlenstoff und 1777 der Schwefel. Die Zusammensetzung des Natürlichen wird also experimentell neu betrachtet, höher aufgelöst. Auch sonst wird viel publiziert, und zwar zu «weltlichen» Fragen, nicht mehr überwiegend zu solchen der Religion. 1775 findet in Deutschland ein Hexenprozess statt. Immer noch, mag man sich heute entsetzen, aber es ist der letzte, und sein Urteil wird nicht vollstreckt. Manche neigen deshalb dazu, vom Vordringen des Rationalismus zu sprechen. Doch wissenschaftlicher Verstand und die Versuche, Vorurteile zurückzudrängen, bilden keinen Gegensatz zur Entfaltung von Phantasie. Just um 1770 schießt die europäische Romanproduktion in die Höhe und wird nicht mehr abnehmen. Allein in England werden damals durchschnittlich dreihundert bis fünfhundert Romane pro Jahrzehnt veröffentlicht, nicht mehr nur fünfzig wie in den hundert Jahren zuvor.
Die Welt befindet sich also nicht im Umsturz, sie ist aber äußerst geschäftig. Es ist tatsächlich die Epoche der Aufklärung, von der Hegel sagen wird, ihre Devise sei: «Alles ist nützlich.»[1] Auf allen Gebieten werden die Grenzen des Erfahrbaren stark erweitert. Fast möchte man meinen, dass sich erstmals in der Geschichte überhaupt «Welt» als sinnvoller Begriff für eine Wirklichkeit abzeichnet, die nicht nur von einem überirdischen Beobachter überblickt werden kann, sondern auch für den Menschen erreichbar ist. Erreichbar und nicht nur imaginierbar, weil alles expandiert, die Einbildungskraft wie das Wissen, die politischen Ambitionen wie das technische Vermögen. Zunehmend scheint auf dem Erdball alles mit allem zusammenzuhängen.
Der britische Kapitän James Cook etwa, der sich als Sohn eines Landarbeiters aus kärglichsten Verhältnissen in der Royal Navy nach oben gearbeitet hatte, nicht zuletzt aufgrund seiner außerordenlichen kartographischen Begabung, befindet sich 1770 auf seiner ersten Südseeexpedition. Als Georg Wilhelm Friedrich Hegel im August desselben Jahres in Stuttgart geboren wird, hat Cook, nachdem er kurz zuvor fast Schiffbruch erlitten hatte, gerade die Endeavour-Enge oberhalb Australiens, damals «Neuholland» genannt, durchquert und ist auf dem Weg nach Neuguinea. Cook war im Dienst der Wissenschaft unterwegs. Zusammen mit zwei Astronomen sollte er Daten liefern, um anhand des Venusdurchgangs vor der Sonne, der Anfang 1769 auf Tahiti gut zu beobachten war, die Entfernungen zwischen allen Planeten des Sonnensystems und der Sonne selbst exakt berechenbar zu machen. Andere astronomische Stationen dieser weltweiten Messaktion lagen an der mexikanischen Westküste, auf Haiti, in Pennsylvania, in Russland und in Norwegen. Ans Ende der Welt zu reisen, um den Abstand der Erde zu anderen Planeten zu messen, wodurch die Bewohner bislang vor sich hin lebender Gesellschaften erfahren, dass es andere Gesellschaften gibt – das ist Globalisierung, lange bevor das Wort in Umlauf kommt. «Welt», wird es sehr viel später heißen, ist ein Begriff, der nichts außer sich hat und zu nichts in Gegensatz gebracht werden kann. Auch die Venus ist «in der Welt», auch die Sonne, selbst Gott. Die Zeit, in die Hegel hineingeboren wird, ist also eine Zeit, in der das Weltganze immer mehr erschlossen und immer mehr in die Immanenz eines Wissens hineingezogen wird, das dem bloßen Meinen wie dem bloßen Glauben entgegensteht. So jedenfalls stellen es sich diejenigen vor, die sich auf der Seite des Wissens sehen.
Alles ist nützlich. James Cook hatte man damals über seine himmelskundliche Aufgabe hinaus mit dem Auftrag betraut, Schiffspassagen und damit Handelswege zu erkunden. Vor allem aber sollte er die Existenz des «Südlandes» überprüfen, also die auf antike Spekulationen zurückgehende Vorstellung, dass aus Gleichgewichtsgründen im Pazifik eine riesige Erdmasse liegen müsse, von ähnlichem Ausmaß wie Eurasien. In den Instruktionen der britischen Admiralität hieß es, jene fernen Teile des Erdenrunds seien zwar entdeckt, aber unzureichend erforscht.
«Das Bekannte überhaupt», wird Hegel 1807 in seiner «Phänomenologie des Geistes» schreiben, «ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt.»[2] Das soll zum einen heißen: Es ist nur darum, weil es bekannt ist, noch lange nicht erkannt, denn Erkennen geht über Vertrautsein hinaus. Es heißt aber auch, und wir werden uns an solche Mehrdeutigkeiten in Hegels Schreibart gewöhnen müssen: Eben weil es bekannt ist, ist es nicht erkannt, denn Vertrautheit kann als Gefühl des «so ist es eben» geradezu ein Erkenntnishindernis sein. Weil man nicht zu dicht dran sein darf an dem, was man erkennen will, und weil man leicht Vertrautsein mit Erkannthaben verwechselt. Wir treten in eine Zeit ein, die eine Präferenz für Unvertrautes und das Unvertrautmachen von Bekanntem hat. Hegel wird beides als Merkmal von wissenschaftlichem Vorgehen festhalten.
Der Begriff der Welt erhielt jedoch nicht nur durch die Entdeckungsreisen eine neue Bedeutung. Cooks Fahrten konnten auch deshalb als Symbol eines entstehenden Weltreichs («Empire») gedeutet werden, weil Großbritannien und Preußen erfolgreich aus einem von 1756 bis 1763 währenden Krieg mit der Habsburger Monarchie, dem Heiligen Römischen Reich, Frankreich und Russland hervorgegangen waren, den manche als den ersten Weltkrieg bezeichnet haben. Denn es war auch ein Krieg um Kolonien, in Kolonien und um eine Dominanz, die nicht länger auf Europa beschränkt war, sondern dem galt, was später «der Weltmarkt» heißen sollte. Angefangen hatte dieser Krieg mit britisch-französischen Konflikten in Nordamerika, geendet hatte er mit der Verschuldung aller beteiligten Mächte. 1775 beginnt der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg, ausgelöst durch den Versuch Großbritanniens, seine militärischen Ausgaben über Steuererhöhungen in den Kolonien zu refinanzieren. Und die Lage in Frankreich, das durch seine Kriege und seine Haushaltsführung finanziell völlig erschöpft ist, dokumentiert ebenfalls, wie sehr damals schon alle Staaten nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch miteinander verflochten sind. Es zeichnet sich ein Weltmarkt ab: für Güter, für Kapital, für Schulden.
Die Welt, in die Hegel hineingeboren wird, lebt außerdem im Gefühl der ständigen Verbesserung von allem. Zwischen 1769 und 1788 beispielsweise entwickelt James Watt die Dampfmaschine weiter, indem er sie mit einem Kondensator versieht, der die Temperatur des dampfbewegten Zylinders stabilisiert; indem er die Hebebewegung des Kolbens in eine Kreisbewegung transformiert; indem er ein eigenes Gestänge entwickelt; indem er zur Umgehung bestehender Patente ein anderes Getriebe einsetzt; indem er einen Fliehkraftregler konstruiert und so weiter. Watt erfindet also nicht die Dampfmaschine, er verbessert sie. Diese Einsicht ist für die moderne Welt zentral: Es gibt keine «Creatio ex nihilo», keine Schöpfung aus dem Nichts, alles hat Voraussetzungen, jede Erfindung ist eine Verbesserung.
Watt war schon vorher von Beruf ein Verbesserer mechanischer Geräte gewesen, und immer wieder sollte er sich als eine Art öffentlicher Bauingenieur damit beschäftigen, Kanäle zu vermessen und Flüsse umzulenken. Im Winter 1763 wird er gebeten, eine Dampfmaschine zu reparieren, die an der Universität Glasgow in Seminaren zur Naturphilosophie eingesetzt wird. Dabei fällt ihm der hohe Verbrauch an Dampf und Kondenswasser des Apparats auf, und sein Interesse ist geweckt. Sowohl die wirtschaftlichen Erträge wie die konstruktiven Probleme ziehen ihn in den Maschinenbau hinein. Schließlich kann die nach und nach verbesserte Maschine dann auch zu Zwecken eingesetzt werden, die nichts mit der ursprünglichen Aufgabe, Wasser aus Bergwerken abzupumpen, zu tun haben. Zur wichtigsten Energiequelle in der Textilindustrie wird die Dampfmaschine aber erst nach Hegels Tod.[3]
Ob man sich die Erfindungen Watts anschaut, die Innovationen in der Textiltechnologie oder die Fortschritte in der Herstellung von Chemikalien – ganz gleich, wohin man blickt: Das Ende des 18. Jahrhunderts erscheint als eine Zeit der sich wechselseitig stimulierenden Neuerungen. Und als Zeit der sich ausbreitenden Nebenfolgen solcher Verbesserungen. Um nur ein Beispiel zu geben: Das fliegende mechanische Webschiffchen steigert die Produktivität der Weber, die zu erhöhtem Bedarf an Garn als Vorprodukt von Tüchern führt, also steigen seine Preise. Der erhöhte Bedarf wird durch den Einsatz von automatisierten Spinnrädern gedeckt. Diese wiederum führen zu Protesten von Arbeitern, die im Zuge der Ablösung der vormaligen Heimindustrie durch Fabriken ihre Arbeit verloren haben.
Und nun das Rätsel. Wenn die Gesellschaft um 1770 und bis weit ins erste Drittel des 19. Jahrhunderts hinein die geschilderten Züge annimmt, wie kommt es dann, dass die Philosophie, die diese Zeit in Gedanken zu erfassen sucht, eine idealistische Philosophie ist? Hegel weist dem Philosophieren genau diese Aufgabe zu: seine eigene Zeit zu erfassen.[4] Nicht ewige Wahrheiten, nicht den Grund allen Seins, sondern die eigene Zeit in Gedanken. Wie kommt es also, dass er so viel Energie in Theorien steckt, die sich mit der Struktur des Bewusstseins und des Selbstbewusstseins befassen? Weshalb heißen die philosophischen Schlüsseltexte jener Epoche «Kritik der reinen Vernunft», «Wissenschaftslehre» und «Phänomenologie des Geistes» oder «Wissenschaft der Logik»? Wie kommt es unter den Umständen technischer, wissenschaftlicher und ökonomischer Innovationsbeschleunigung zu einer philosophischen Bewegung, die unter der Selbstbezeichnung «Idealismus» oder der Fremdbezeichnung «Deutscher Idealismus» in die Geistesgeschichte eingehen wird? Wäre nicht ein «Deutscher Materialismus», ein «Deutscher Szientismus», ein «Deutscher Empirismus» oder ein «Deutscher Utilitarismus» zu erwarten gewesen? In anderen Ländern, vor allem in Großbritannien und Frankreich, entstehen solche Ideen. Die Aufklärung treibt dort materialistische und empiristische Denkschulen hervor.
Der deutsche Beitrag zur Ideengeschichte um 1800 aber ist ein anderer. Ein vollkommen anderer. In rascher, um nicht zu sagen: rasender Abfolge werden zwischen 1781 und 1816 Gedankengebäude entworfen, die das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein, das Subjekt, das Denken und den Geist als Zentrum der Welt begreifen: Kant, Jacobi, Reinhold, Fichte, Schelling, Hölderlin, Hegel lauten die wichtigsten Namen. Die Welt wird buchstäblich auf den Kopf gestellt.
Außerhalb der Philosophiegeschichte nennen wir jemanden einen Idealisten, der im Glauben lebt, am Ende würden sich gute Absichten und «Projekte» in der Geschichte durchsetzen, weswegen man Idealen auch einiges opfern dürfe. Innerhalb der Philosophiegeschichte war Immanuel Kant der erste, der sich selbst einen Idealisten nannte. Und zwar deshalb: Wenn wir etwas in unserer Erfahrung finden, sagen wir beispielsweise Wasser, dann richten wir unseren Begriff davon nach den einzelnen Eigenschaften dieses Objekts. Wasser ist eine Flüssigkeit, es gefriert und verdampft bei bestimmten Temperaturen, es kann erfrischen, Leben bedarf seiner, es lösen sich manche feste Stoffe in ihm auf, sodass es zum Beispiel Salzwasser gibt. Unser Begriff des Wassers richtet sich nach dem Gegenstand. Demgegenüber gibt es Gegenstände, die wir hervorbringen, weil wir es wollen. Sie finden sich also nicht in der Natur vor – jenem «großen Etwas» (Voltaire) –, sondern ihre Eigenschaften beruhen auf individuellen oder gesellschaftlichen Entscheidungen: die Vornamen meiner Töchter, dieses Buch, die Institution des Frühstücks oder die der britischen Monarchie, Kinderspielzeug, Eheverträge, Gottesdienste. Worum es sich bei ihnen handelt, lässt sich nicht ermitteln, indem wir ihre «Natur» untersuchen, denn sie sind nicht wie Pilze aus dem feuchten Boden geschossen, sondern wir müssen fragen, wie sie konstruiert worden sind.
So weit, so leicht zu unterscheiden. Vertrackterweise gibt es aber Sachverhalte, die sich auf keiner Seite dieser Unterscheidung unterbringen lassen.[5] Denn wie verhält es sich mit den «Gegenständen», die wir weder vorfinden noch hervorgebracht haben? Die Seele mit ihrer angeblichen Eigenschaft, unsterblich zu sein, ist so etwas. Was können wir über Gott oder die Freiheit sagen, die wir zu haben glauben, ohne sie nachweisen zu können? Aber auch Kausalität kann man nicht sehen oder die Zeit. Dass etwas nach etwas anderem geschehen ist, setzt den Begriff der Zeit voraus, der sich nicht einfach aus dem Nacheinander der Ereignisse gewinnen lässt. Oder nicht? Wenn wir sagen: «Hegel lebte nach Newton», scheint das eine empirische Tatsache, die sich den Geburts- und Todesdaten beider entnehmen lässt. Doch schon die Formulierung «Newton und Hegel lebten in derselben Epoche» zwingt uns nachzudenken. Das Urteil, dass sie nacheinander lebten, nimmt eine Skala in Anspruch, auf der es keine Rolle spielt, dass sie irgendwie derselben historischen Zeit angehörten, sondern nur dass Zeit zwischen dem Leben des einen und dem Leben des anderen verronnen ist. Das gilt auch von jedem Sinneseindruck eines «Nacheinander»: Er setzt das Konzept «verschiedene Zeitpunkte» voraus.
Die Insistenz der Idealisten, sich mit solchen Begriffen und Konzepten in der Absicht zu beschäftigen, wahre Sätze über die entsprechenden Gegenstände zu formulieren, obwohl es sich nicht um sinnlich wahrnehmbare Sachverhalte – eben nicht um «Dinge» – handelt, geht dabei nicht nur auf erkenntnistheoretische Interessen zurück. Ihr liegt auch die Vermutung zugrunde, dass von Urteilen über Gott der Glaube und die Einstellung zu Gottesdiensten abhängt, von Urteilen über Freiheit die Form der Verträge und die Akzeptanz der Monarchie, von Urteilen über die Seele die Kindererziehung und die Einstellung zur Moral. Die Welt wird also idealistisch auf den Kopf gestellt, weil in das, was wir hervorbringen, aber auch in die Analyse der empirischen Objekte – wie etwa des Wassers – eine ganze Reihe von Begriffen eingehen, die ihrerseits nicht empirisch sind. Das betrifft nicht zuletzt das Konzept «Erfahrung» selbst.
Im Idealismus liegt, mit anderen Worten, die Behauptung, dass wir die Welt durch Denken begreifen können, weil sie selbst «denkförmig» und zu wesentlichen Teilen unsere Hervorbringung ist. Das Bewusstsein ist tätig. Es unterscheidet Eindrücke nach Begriffen: Das ist die Tänzerin, das ist der Tanz. Es kombiniert Eindrücke: Das Ohr gehört zum Hund, die Leine nicht. Es vergleicht Eindrücke: dieselbe Person heute und gestern. Zusammengehalten werden solche Zuordnungen, Kombinationen und Vergleiche für Idealisten vom «Ich».
Beim philosophischen Idealismus, von Kants «Kritik der reinen Vernunft», die 1781 herauskommt, bis zu Hegels «Wissenschaft der Logik», die zwischen 1812 und 1816 erscheint, handelt es sich um den Versuch, alle wesentlichen Begriffe des menschlichen Selbstverständnisses, der Wissenschaft von natürlichen wie historischen Phänomenen und der wichtigsten Lebensmächte – Religion, Kunst, Politik, Recht und Moral – aus einigen wenigen Gedanken herzuleiten. Und zwar sollen es Gedanken sein, die sich auf die Struktur und die Arbeitsweise des menschlichen Bewusstseins richten. Die Art unseres Wahrnehmens, Denkens und Reflektierens zu verstehen heißt, die Welt in ihrer Gesamtheit zu begreifen – das ist die Prämisse des Idealismus. Für Hegel ist Idealismus darum die Überwindung von Gegensätzen – Geist und Welt, Seele und Leib, Ich und Natur, Begriff und Anschauung – im Wissen.[6]
Durch die technischen, wissenschaftlichen und ökonomischen Fortschritte sieht sich also gerade der Idealismus als eine Philosophie aufgerufen, für die das Weltgeschehen das Gepräge der Freiheit, der sinnhaften Konstruktion und des Gedankens trägt – «das eigene Gepräge des Geistes: stets Fortschreiten zum Vollkommeneren in einer geraden Linie, die in die Unendlichkeit geht», wie es Fichte in seiner «Bestimmung des Menschen» von 1800 formuliert.[7] Zu der Zeit, als so gesprochen wurde, hatten die Amerikanische und vor allem die Französische Revolution schon stattgefunden. Zu den Anfängen der wissenschaftlichen und industriellen Revolution waren die politischen Revolutionen hinzugekommen, die sich von der Unabhängigkeitserklärung Nordamerikas 1776, der Erstürmung der Bastille 1789 sowie der allgemeinen Menschenrechtserklärung und «Bill of Rights» im selben Jahr bis zur Eroberung Europas durch Napoleon und seiner Niederlage 1815 zogen.
In Deutschland, das damals weder eine Nation noch ein Staat war, fand stattdessen eine weitere, für die moderne Gesellschaft ebenfalls bedeutende Revolution statt: die Bildungsrevolution.[8] Mit dem Idealismus hängt sie nicht nur dadurch zusammen, dass seine Philosophen zur ersten Generation gehören, deren Bildungsweg von den einsetzenden Reformen des Schulwesens bestimmt ist. Sie selbst werden zu diesen Reformen beitragen und viel über Bildung, Schule, Universität nachdenken und publizieren, ja, sie werden das Bildungswesen verändern. Der Autor der einflussreichen Reformschrift «Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus in der Theorie des Erziehungs-Unterrichts unserer Zeit» von 1808 ist Friedrich Immanuel Niethammer, der mit Hegel, Schelling und Hölderlin seit Tübinger Studientagen in engem Austausch steht.
Darüber hinaus geht der Idealismus mit dem Aufbau eines öffentlichen Schulsystems einher. Zunächst ist ein Titel wie «Die Erziehung des Menschengeschlechts» von Lessing aus dem Jahr 1780 nur metaphorisch gemeint, das gilt genauso für Herders «Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit» von 1774. Denn wie sollte man die Menschheit als solche erziehen und bilden können? Was Redensarten jener Art jedoch dokumentieren, ist Folgendes: Schon kurz vor dem Auftreten der im engeren Sinne idealistischen Denkweise wird in Deutschland der Bildung, intellektuellen Lehrern und einer Revolution von Denkweisen die entscheidende gesellschaftliche Bedeutung im Epochenwandel hin zur modernen Gesellschaft zugeschrieben. Es kommt zu Diskussionen über den Stellenwert des «Selbstdenkens», über die Anteile des berufsbildenden und des theoretischen Unterrichts und über die Bedeutung, die alte Sprachen für die Schulung der bürgerlichen Eliten haben können. Das Erziehungsgeschehen verlagert sich immer mehr von den Häusern in die Schulen und Universitäten. Der enge Zusammenhang zwischen Ausbildung und Zugehörigkeit zu einem sozialen Stand löst sich, der Lehr- und Lernmarkt der Frühneuzeit mit seinem Variantenreichtum an Privaterziehung und Lateinschulen wächst stetig, die Verbindung zwischen Bildung und Staat wird immer stärker.[9] Es liegt auf der Hand, dass dies auch eine Ausweichbewegung war. Der Verzicht auf das Risiko einer politischen Veränderung wurde mit dem Hinweis auf Bildung kompensiert.
In allen Revolutionen, den politischen, industriellen, pädagogischen und wissenschaftlichen, geht es darum, die Gesellschaft aus «natürlichen» Vorgaben zu lösen. Noch heißt das nicht, dass sich die europäischen Nationen in der Versorgung ihrer Einwohner durch industrielle Produktion von Naturumständen befreit hätten. Im Gefolge der «Kleinen Eiszeit» kommt es zu drei verheerenden, ganz Europa betreffenden Missernten. Das Jahr 1770, in dem sie begannen, erlebt einen Wechsel von Frösten und Schneefällen bis weit ins Frühjahr hinein sowie unablässigen Regen danach, der die geringe Ernte dann auch noch in den Scheunen verfaulen lässt. Erst fünf Jahre später normalisiert sich die Ernährungslage wieder, ohne dass Hungerkrisen aus dem europäischen Erfahrungsraum verschwinden. Doch sie werden seltener, bleiben bei aller Schrecklichkeit – Irland! – lokal begrenzt, und die Gesellschaft lebt mehr und mehr im Gefühl, sich von den Zyklen der Natur und einer Ausgesetztheit gegenüber unverfügbaren Prozessen unabhängig machen zu können. Hegels Philosophie wird, zur Empörung vieler ihrer Kritiker, der Gesellschaft Vernunft zuschreiben und der Weltgeschichte einen Fortschritt, der auf seine eigene Zeit zuläuft.
Was also ist Idealismus? Vielleicht ist ein Beispiel aus der Technikgeschichte als Antwort viel instruktiver als jeder Hinweis auf philosophische Leistungen. Die Brüder Montgolfier, Joseph Michel und Jacques Étienne, Papierfabrikanten aus Annonay bei Lyon, hatten dort am 4. Juni 1783 ihren ersten Heißluftballon aus Leinwand fliegen lassen. Zehn Minuten lang soll er unterwegs gewesen sein und zweitausend Meter hoch gestiegen. Wenig später wiederholten sie ihren Versuch vor den Augen des Königs, Ludwig XVI., und mit drei luftreisenden Tieren: Hammel, Ente und Hahn. Die erste bemannte Fahrt in einem Luftschiff gelang dann kurz darauf, am 21. November desselben Jahres, mit dem Physiker Jean-François Pilâtre de Rozier als Steuermann und dem Offizier François d’Arlandes als Passagier. Fünfundzwanzig Minuten benötigten sie, um mit einer Montgolfière, wie die Gefährte sofort hießen, acht Kilometer vom Schloss La Muette in Passy über die Seine bis zum Hügel Butte aux Cailles zurückzulegen. Anderthalb Jahre später stürzte Rozier beim Versuch, mit einem selbstgebauten Ballon den Ärmelkanal zu überqueren, in den Atlantik und starb zusammen mit seinem Mitfahrer – die ersten Todesopfer der Luftschifffahrt –, weil sich der Wasserstoff in der Ballonhülle entzündet hatte.[10]
Das war Idealismus: Sich durch fast nichts und einen Gedanken – hier, dass erhitzte Luft Auftrieb erzeugt – in eine Höhe zu erheben, die es erlaubte, die Erde aus einer nie gekannten Perspektive zu betrachten, ohne dass dabei unmittelbar kommerzielle, politische oder religiöse Motive im Spiel waren. Oder genauer: Welche Motive auch immer eine Rolle gespielt haben, das Resultat der Anstrengungen, die sie auslösten, ließ die Frage nach den Interessen, die dahintersteckten, völlig verblassen. Die Luftfahrt war ein Resultat der Forschungen über Gase und der Experimente mit ihnen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stark zugenommen hatten. Dem König und seinem Hof zu demonstrieren, wozu man sich imstande sah, spielte gewiss eine Rolle. «Könnensbewusstsein» hat man diese Einstellung einmal genannt: Jemand handelt, nicht um etwas zu erlangen, sondern weil er oder sie es kann, weil es geht. Idealismus ist philosophisches Könnensbewusstsein: Sich durch fast nichts, das Selbstbewusstsein, in eine Höhe zu erheben, die es erlaubt, die Welt aus einer bislang unbekannten Perspektive zu betrachten, und zwar als Ganzes, dessen Teile sinnvoll miteinander zusammenhängen, als etwas Bewundernswertes, in das die Arbeit ganzer historischer Epochen eingegangen ist, und als etwas, das verstanden werden kann, sofern nur die richtige Entfernung zu ihm eingenommen wird. Nicht zu nah, nicht zu fern.
Erstes KapitelHegel geht zur Schule
«Soviel ist aber gewiß, daß nicht einzelne Menschen, bey aller Bildung ihrer Zöglinge, es dahin bringen können, daß dieselben ihre Bestimmung erreichen. Nicht einzelne Menschen, sondern die Menschengattung soll dahin gelangen.»
Immanuel Kant
Wir wissen nicht sehr viel von Hegels Kindheit und Jugend. Er selbst hat kaum etwas darüber mitgeteilt; das gilt auch für die Anfänge seines Studiums in Tübingen und die Zeit danach. Den Drang zum Autobiographischen verspürte er nie. Eine der wenigen Bemerkungen fällt 1825, als er an seine Schwester Christiane schreibt: «Heute ist der Jahrestag des Todes unserer Mutter, den ich immer im Gedächtnis behalte.»[1] Die Mutter war, erst einundvierzig Jahre alt, am 20. September 1783 gestorben, als Hegel dreizehn war und wie die ganze Familie am «Gallenfieber» darniederlag – vermutlich Typhus: «Hegel war so krank, daß er schon die Bräune hatte», erinnert sich die Schwester später.[2]
Die spärlichen Erinnerungen an seine frühen Jahre, die darüber hinaus überliefert sind, stammen nicht von ihm, und die wenigen Dokumente, die er in Gestalt von Tagebuchnotizen, Abschriften aus Büchern und kleinen Aufsätzen hinterlassen hat, beziehen sich nahezu ausschließlich auf seine Schulzeit, seine Lektüren und Gedanken, die von ihnen ausgingen. Würde man sie für eine komplette Beschreibung der ersten Jahre halten, bestünde Hegels Leben aus nichts als Bildung, aus zwei, drei lebensbedrohlichen Krankheiten und aus moralischen Erwägungen, die tugendhaftes Verhalten, das Streben nach Glück und mitunter den Tod zum Thema haben.
Was wir von ihm wissen, ist also zunächst, dass er gelernt und gelesen hat, viel gelernt und viel gelesen. Mit fünfzehn trägt er in sein Tagebuch ein, welche Bücher er sich gerade aus dem Nachlass eines früh verstorbenen Lehrers gekauft hat: die «Nikomachische Ethik» von Aristoteles, Reden der griechischen Rhetoren Demosthenes und Isokrates, die philosophischen Schriften Ciceros, die «Attischen Nächte» des Aulus Gellius sowie Werke weiterer zwölf römischer Schriftsteller. Die Sphäre der Bildung, der «Bildung zu den Wissenschaften», wie er später in einem Lebenslauf formuliert, wird er zeit seines Lebens nicht verlassen: Schüler, Student, Privatlehrer, Universitätsdozent, Journalist, Gymnasiallehrer und Schuldirektor, Professor schließlich – das werden am Ende seine Berufe gewesen sein.
Schon Schüler war für ihn ein Beruf, und zwar ein offensichtlich gern ausgeübter. Mit drei Jahren wird er eingeschult und noch vor dem sechsten Lebensjahr in Latein unterrichtet; seine Mutter übt mit ihm die Deklinationen und das Vokabular. Mit acht erkrankt er lebensgefährlich an Windpocken, die ihn tagelang erblinden lassen, der Arzt gibt ihn schon auf. Hegel aber wird wieder gesund und lernt weiter. Er ist stets unter den Besten seiner Klasse auf dem Stuttgarter «Gymnasium Illustre», der «Hohen Schule», auf die er seit dem Herbst 1776 geht und die nur hundert Meter von seinem Elternhaus – zwei Wohnetagen samt Dachaufbau, Waschhaus, Gewölbekeller, «Höfle» und kleinem Garten – entfernt liegt. Die Lehrer schätzen ihn. Einer, der junge Präzeptor Johann Jakob Löffler, den Hegel als Vorbild bezeichnet, schenkt dem Achtjährigen die Werke Shakespeares mit der Bemerkung, er werde sie jetzt noch nicht verstehen, aber bald. Präzeptoren waren Lehrer, die im «Untergymnasium» der Klasse den gesamten Unterricht erteilten, während am «Obergymnasium» Professoren in ihrem jeweiligen Fach Vorlesungen hielten. Unterrichtet wurde im Winter von acht bis elf Uhr, im Sommer von sieben bis zehn Uhr sowie viermal in der Woche von vierzehn bis sechzehn Uhr. Hinzu kam Privatunterricht, Hegel bekommt ihn unter anderem in Geometrie, Messkunst und Astronomie, durch einen naturkundlich versierten Lehrer der Karlsschule, aber auch durch jenen Präzeptor sowie den Physik- und Mathematikprofessor Philipp Heinrich Hopf, der ihn für seine Fächer begeistert.[3]
Zur Schule gehörte damals, dass ständig «examiniert» wurde, um den Zugang zu den begehrten Klosterschulen des Landes, in deren Händen die Theologenausbildung lag, zu verknappen. Hegel wurde von seinem zehnten Lebensjahr an insgesamt fünfmal in einem landesweiten Examen der Lateinschüler geprüft, obwohl er am Ende dann doch den nur für Stuttgarter Gymnasiasten möglichen Zugang zum Tübinger Stift über das Obergymnasium wählte.[4] Acht Stunden Latein, drei in Griechisch, zwei in Hebräisch und zwei oder drei in Geschichte waren Pflicht, Hegel lernte überdies Französisch. Manche Lehrer schlugen ihre Schüler noch, aber andere wussten schon etwas mit ihnen anzufangen. Hegel ist kein Autodidakt, niemand, der sich, wie viele Intellektuelle des späten 18. Jahrhunderts, unter Qualen und gegen Widerstände den Bildungsraum erkämpfen muss, den ihm eine unfreundliche Umwelt nicht gönnt. Es ist seitens der Eltern und vieler Lehrer gewollt, dass er lerne und nicht nur pauke. Wiederholt hält er fest, mit Erwachsenen auch außerhalb der Schule im Spaziergangsgespräch über Unterrichtsstoffe gewesen zu sein.
Das wäre fast schon alles, was über Hegels frühe Jahre bekannt ist. Wenn es nicht die Notizen zu seinen Lektüren und einige kleine Aufsätze gäbe. In seinem zu Übungszwecken teils lateinisch, teils deutsch verfassten «Tagebuch», das er zwischen Juni 1785 und Januar 1787 unregelmäßig führt, hält er vor allem sein Pensum fest, geht einzelnen Überlegungen zum geselligen Verhalten nach und zu moralischen Problemen, verarbeitet Lektüren. «Noch keine Weltgeschichte hat mir besser gefallen als Schröks. Er vermeidet den Ekel der vielen Namen in einer Spezial-Historie»[5] – man fragt sich, wie viele Weltgeschichten und Spezial-Historien der Fünfzehnjährige da schon hinter sich hatte. Festgehalten werden Mathematikaufgaben, Lateinübungen, Altklugheiten aus vermischten Schriften wie die des Mediziners Zimmermann «Ueber die Einsamkeit» von 1784 oder aus aufklärerischen Durchschnittsbelehrungen wie Johann Heinrich Campes «Theophron oder der erfahrne Rathgeber für die unerfahrne Jugend» von 1783, aus dem er beispielsweise notiert: «Habent enim laudique infamiaeque monopolium», die Frauen hätten das Monopol über Lob und Tadel und trügen so zur Verfeinerung der Sitten bei. Hegel übersetzt: das Handbuch der stoischen Morallehre Epiktets, den Traktat über das Erhabene des Pseudo-Longinus, Stellen aus den Dramen des Sophokles. Dazwischen notiert er Anekdoten, entwirft zwei, drei Seiten eines Aufsatzes über das Exzerpieren und zur Frage, worin der Sinn des Lateinlernens bestehe, schreibt etwas über eine totale Mondfinsternis, sammelt dann wieder Lesefrüchte.
Hegel liest, weil die Bibliothek an einem Samstag kein anderes Buch anbot, den französischen Ästheten Charles Batteux, aber auch Herodot, Livius und mit großer Begeisterung den Briefroman «Sophiens Reise von Memel nach Sachsen» von Johann Timotheus Hermes, einen zeitgenössischen Bestseller. Später wird sich der gehässige Schopenhauer, der nie verlegen war, Hegel am Zeug zu flicken, darüber lustig machen und sagen, er seinerseits habe als Jugendlicher Homer der «Reise von Memel nach Sachsen» vorgezogen. Aber dass einem Schüler um 1785, der selbstverständlich auch im Homer bewandert war und sich an Übersetzungen aus der «Ilias» versuchte, eine imaginierte Reise ins zeitgenössische Sachsen lebendig vorkam, wird man verstehen können. Hegel dürfte zu dieser Zeit die Stuttgarter Stadtgrenzen noch nicht oft überschritten haben und kannte nicht nur Sachsen, sondern auch den Rest der Welt bloß aus Lektüren. «Sophiens Reise» zu lesen hieß damals vor allem, die Gefühle zu genießen, die der Autor beim Leser zu erwecken wusste. Eine junge Frau auf Reisen – was lagen darin nicht alles für Perspektiven, Gefahren und Gelegenheiten, dem Äußersten nachzusinnen: «‹Mademoiselle ich muß die Thür öffnen: aber ich fürchte daß Sie sich erkälten werden: Sie sind zu zart …› Er brach hier ab, und ris mit Gewalt die Augen von mir weg. Und nun unternehm ich es nicht, Ihnen die demüthigende Beschämung zu beschreiben, mit welcher ich mich auf einmal erblikte! Jezt gewis ganz sicher gegen die Ohnmacht welcher ich vorher nah gewesen war, sprang ich auf, mein Tuch zu suchen: und er selbst warf es mir hin.»[6] Hegel ging, wie alle, die lesen konnten, ins Kino, bevor es das Kino gab. Kurz gesagt, Hegel liest einfach alles, was ihm in die Hände kommt, vom Schwierigsten bis zum Einfachsten. Er liest querbeet. «Bücher», formulierte es Novalis wenig später, «sind eine moderne Gattung historischer Wesen – aber eine höchstbedeutende. Sie sind vielleicht an die Stelle der Traditionen getreten.»[7]
Manchmal trägt Hegel auch nur einfach etwas in sein Tagebuch «in fugam vacui» ein: weil er die Blätter nicht leer lassen will.[8] Es gibt kein Thema, das ihn länger als ein paar Tage festhält. Überhaupt ist Ausgeglichenheit etwas, das er in Gedanken anstrebt. Das Sinnliche, heißt es, ist nicht als solches böse; Gut und Böse koexistieren im Menschen, alles Schlechte hat auch sein Gutes, das Lob der Tugend darf uns nicht der Welt abspenstig machen – es sind solche Abwägungen in harmonisierender Absicht, die sein Journal durchziehen. Ab und an wird der Aberglaube attackiert, nicht zuletzt der katholische, aber auch hier lenkt Hegel sofort wieder ein und lobt eine katholische Predigt, die er gehört hat, für ihren Verzicht auf konfessionelle Polemik.
Die umfangreichen Exzerpte, die er nach Auskunft seines ersten Biographen, Karl Rosenkranz, aus dem aktuellen Schrifttum aufklärerischer Intellektueller anfertigte, von Mendelssohn und Gottsched über Rousseau und Wieland bis zu Lessing und Ferguson, sind leider nicht erhalten geblieben. Immerhin aber ein vierseitiger Aufsatz «Über einige charakteristische Unterschiede der alten Dichter» von 1788, der deutliche Spuren solcher Lektüre trägt. Hegel steht hier unter dem Eindruck von Christian Garves «Betrachtung einiger Verschiedenheiten in den Werken der ältesten und neuern Schriftsteller, besonders der Dichter», die 1770 erschienen war. In ihr schreibt der zu Unrecht als bloßer Popular- und Damenphilosoph bezeichnete Gelehrte den antiken Schriftstellern eine größere Konzentration auf ihre Gegenstände zu, während die modernen Dichter durch die Aussicht auf Beifall davon abgelenkt würden. Der alte Schriftsteller sei ein Kind, das ganz in der Gegenwart lebe, der moderne reflektiere ständig auf sein Tun und also auf das, was er schon getan habe, sowie das, was noch vor ihm liege. Die Alten lernten durch die Natur und mittels sinnlicher Wahrnehmung, die Neuen blieben stets in der Nähe ihrer Bücher, «ihre Beschäftigungen und ihre Zeitvertreibe sind größtentheils innerhalb der vier Wände ihres Zimmers». «Wir beobachten also», so Garve, «sehr wenig selbst. Viele Dinge geschehen täglich vor unsern Augen, oder sind nur wenige Schritte von uns, die wir doch kaum eher bemerken, als bis wir sie in Büchern gefunden haben.»[9] Musste Hegel dies nicht auch auf seine eigene Erfahrung beziehen?
«Wir lernen», kommentiert das der fast achtzehnjährige Hegel, «von unserer Jugend auf die gangbare Menge Wörter und Zeichen von Ideen und sie ruhen in unserem Kopfe ohne Thätigkeit und ohne Gebrauch.» Man habe zunächst die Wörter, dann erst die Erfahrungen, die erlauben, sich etwas bei ihnen zu denken. Zugleich seien die Wörter Formen, die das Denken und die Art, etwas zu sehen, die Erfahrung also, «modeln».[10] Hegel hält fest, die Art, sich auf diese Weise zu bilden, führe bei vielen zu nebeneinanderher laufenden Reihen von Gedanken, die nicht zu einem System verbunden seien, ja sich nicht einmal berührten. Man liest also dieses und jenes, das eine leuchtet einem ein, aber auch etwas anderes, ob es zueinander passt, sieht man nicht sofort und manchmal nie. Es wird noch deutlich werden, wie genau diese Beobachtung die Situation eines jungen Intellektuellen umschreibt, der bald um den Nachweis bemüht ist, dass die Aufklärung, die griechische Philosophie, das Christentum und Kant im Grunde alle auf ähnliche Gedanken zielten. Wenn viel später in seinem Leben der Begriff «System» prominent wird, mag man sich an diese Notiz des Jugendlichen über das Unbehagen an Unverbundenem erinnern.
Hegel wurde nicht als Idealist geboren.[11] Niemand wird das. Doch selbst das gedankliche Feuer seiner späteren Werke und auch nur die literarische Kraft der ersten Entwürfe zur Deutung der christlichen Religion sucht man vergeblich in seinen Jugendschriften. Was wir finden, ist der Wille eines fleißigen, aber nicht gerade leidenschaftlichen Knaben, eine Vielfalt an Ansichten über die Welt aufzunehmen, nebeneinanderzulegen und zu kommentieren. Seine spätere Polemik gegen das «Dafürhalten aus eigener Meinung», die sich unter anderem in seinen Schriften als Schullehrer in Nürnberg wiederfindet, hätte sich auf den eigenen Werdegang berufen können. Es haben, wird sie lauten, originelle Irrtümer gegenüber angelesenen Irrtümern keinen Vorteil, und auch das Selbstdenken bedarf der Nahrung, der Objekte, der Vorgaben, an denen es sich bewähren kann, nachdem ein Stoff zuvor verstanden worden ist. Das Ich holt nicht alles aus dem Ich heraus. Erst lesen, dann denken, dann schreiben.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, den sie zu Hause «Wilhelm» rufen, kommt am 27. August 1770 in Stuttgart in einer württembergischen Familie protestantischer Honoratioren zur Welt. Honoratioren heißt hier: Pfarrer, Advokaten, Schullehrer, Verwaltungsleute. In der Sprache der Zeit gehörten sie der «Ehrbarkeit» an. Mit den Geistlichen freilich ist es in direkter Linie schon eine ganze Weile her, in der Familie der Mutter finden sie sich gar nicht. Hegel wächst also anders als seine Studienfreunde Hölderlin und Schelling nicht im sprichwörtlichen evangelischen Pfarrhaus auf, auch wenn solche Pfarrhäuser immer in der Nähe sind: «Noch der Pfarrer, welcher Schiller taufte, war nach Gustav Schwabs Bericht ein Hegel.»[12]
Mehrere seiner Vorfahren bekleideten das Amt des «Landschaftsregistrators», sein Urgroßvater mütterlicherseits beispielsweise. Wodurch der Mann aber nichts mit Wäldern oder Verkehrswegen zu tun hatte, die «Landschaft» war nach damaligem Sprachgebrauch im Gegensatz zur «Herrschaft» die Vertretung der bürgerlichen Bevölkerung in den sogenannten Amtsstädten. Stuttgart, die «Fürstin der Heimath» (Hölderlin), war der Sitz der Residenz und dieser ständischen Vertretung. Andere Familienmitglieder waren Regierungssekretäre und Oberamtmänner, wie sein Großvater, der neun Jahre vor Hegels Geburt starb. Viel älter als sechzig wurden die Erwachsenen damals meistens nicht. Hegels Vater wiederum, Georg Ludwig Hegel, der Jurisprudenz in seiner Geburtsstadt Tübingen studiert hatte und sechsundsechzig wurde, war Rentkammersekretär und später Rentkammer-Expeditionsrat. Er verwaltete also die Einnahmen («Renten») des Landesfürsten. Heute würde man vielleicht sagen, er arbeitete im Finanzamt von Stuttgart. Von sechs Geschwistern überleben drei die Kindheit: der erstgeborene Hegel, sein Bruder Georg, der als Offizier 1812 nicht aus dem Russlandfeldzug Napoleons zurückkehren wird, und seine Schwester Christiane Luise, von der wir noch hören werden.
Eine Familie von Beamten mittlerer Stellung also. Wessen Beamte waren sie? Württemberg wurde seit 1744 von Herzog Karl Eugen regiert, der mit sechzehn Jahren die Geschäfte des Landes übernommen hatte, nachdem ihn seine protestantischen Vormünder zuvor in Preußen, am Hof Friedrichs II., hatten erziehen lassen, um den jungen katholischen Prinzen dem Einfluss Habsburgs zu entziehen. Viel geholfen hatte es zunächst nicht. Der Monarch interessierte sich nach seinem Amtsantritt in spätbarockem Habitus vor allem für höfische Selbstdarstellung durch repräsentative Bauten, das Abhalten von Jagden und Feierlichkeiten, die mitunter vierzehn Tage am Stück dauerten, die Pflege der musikalischen Künste sowie die Zuwendung zu Bühnenkünstlerinnen. Noch zwei Jahre vor Hegels Geburt erlebte das Residenzschloss im nahen Ludwigsburg die Aufführung der Oper «Fetonte» des Hofkapellmeisters Niccolò Jommelli mit mehr als vierhundert Statisten, darunter dreihundertvierzig Soldaten, sechsundachtzig von ihnen zu Pferde.[13] Karl Eugens Gemahlin, Elisabeth Friederike Sophie, hielt die Mätressenwirtschaft nicht lange aus und floh 1756 in die Arme ihrer Bayreuther Familie. In seiner Regierungszeit versorgte der Herzog das Land gleich mit vier neuen Schlössern, darunter Montrepos und Solitude sowie das Neue Schloss in Stuttgart, das er den Stadtbewohnern mit der Drohung abpresste, andernfalls mitsamt seinem Hofstaat nach Ludwigsburg, das sie im Volk auch «Lumpenburg» nannten, auszuweichen. Was er dann auch tat. Als Hegel geboren wird, ist die «Residenzstadt auf Abruf» mit ihren fünfzehntausend Einwohnern schon seit sechs Jahren keine Residenzstadt mehr. Als Hegel eingeschult wird, ist sie es bereits wieder.[14]
Dieser schwankende Regierungs- und Lebensstil, in dessen Zentrum die Ruhmsucht stand, führte zu erheblichen Ausgaben, zu denen von 1756 an die Kosten für die Beteiligung Württembergs am Siebenjährigen Krieg hinzukamen. Sie durch Steuern zu finanzieren, lehnte die «Landschaft» ab. Das war nicht unerheblich, denn den Landständen als Versammlung aus Rittern, Kirchenvertretern und der «Landschaft» war schon mehr als zweihundert Jahre zuvor das Recht zugesichert worden, Steuern zu bewilligen. So sperrten sich Bürgermeister gegen Versuche des Hofes, die Steuern mit militärischer Gewalt einzutreiben. Dass sich Karl Eugen außerdem – zur Finanzierung seiner Hofhaltung und für eine entsprechende Vorauszahlung – verpflichtet hatte, im Kriegsfall sechstausend Männer als Soldaten an Frankreich «auszuleihen», was der württembergischen Verfassung widersprach, steigerte den Konflikt zwischen Bürgerschaft und Hof noch. Einen Landtag, den der Herzog 1764 einberufen hatte, um an Geld zu kommen, löste er, als die Stände sich uneinsichtig zeigten, gleich wieder auf.
Hegels Familie gehörte also einer bürgerlichen Schicht an, die für das Herzogtum arbeitete und insofern keineswegs «republikanisch» gesinnt war. Sie bestand aber auf den hergebrachten Rechten der städtischen Bürgerschaft und der Heilung des mehrfachen Verfassungsbruchs, dessen sich der Monarch schuldig gemacht hatte. Der Beamte dient seinem Herrn, jedoch nur im Rahmen von dessen gesetzlich festgelegtem Entscheidungsspielraum. Das Plündern von Kassen, um Vergnügungen zu finanzieren, fiel nach Auffassung der württembergischen Amtsstädte nicht in diesen Spielraum.
1770 kam es vor dem Wiener Reichshofrat des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, zu dem Württemberg gehörte, zum sogenannten Erbvergleich. Die Rechte der Stände, die den Rat angerufen hatten, wurden vom Kaiser bekräftigt; der Landtag, hieß es, sei der repräsentative Körper des Vaterlandes. Der Herzog musste sein Regierungsgebaren ändern und von seinen hohen Ausgaben herunterkommen. Er tat es. Acht Jahre nach diesem Urteil ließ Karl Eugen von allen Kanzeln des Landes eine Bußerklärung verlesen, in der er unter Appell auch an seine Beamten politische Besserung und seine Hinwendung zur Rolle des fürsorglichen Landesvaters gelobte. Weniger Prunk, weniger Ambition, weniger Militär hieß das.
Und stattdessen? Bildung. Es wirkt tatsächlich wie ein Witz der Geschichte, dass sich der Wandel vom spätbarocken zum «aufgeklärten» – soll heißen: maßvolleren und nüchternen – Absolutismus in Württemberg genau in dem Moment zutrug, als die künftigen Vertreter des philosophischen Bildungsgedankens als Landeskinder auf die Welt kamen. Schon im Frühjahr 1770 hatte der Herzog im Schloss Solitude ein «Militärisches Waisenhaus» gegründet, das ein Jahr später in «Militärische Pflanzschule» umbenannt wurde, um weitere zwei Jahre danach «Militärische Akademie» zu heißen und schließlich als jene «Carlsschule» nach Stuttgart umzuziehen, deren berühmtester Zögling Friedrich Schiller wurde. 1765 war dem die Öffnung der herzoglichen Bibliothek für alle des Lesens Mächtigen vorausgegangen, «Mittwochs und Samstags von 2 bis 5»[15], wie Hegel schreibt.
Auch in Hegels Gymnasium wirkte das erwachte Interesse des Herzogs an schulischer Erziehung spannungsvoll hinein. Die Lehrer wurden von ihm ernannt, doch die Schulaufsicht lag bei der protestantischen Kirche. So kam es nicht nur, dass viele Lehrer vom Herzog gegen kirchlichen Widerstand durchgesetzt wurden; es bildeten sich auch in der Schule die unterschiedlichen Auffassungen vom Sinn der höheren Erziehung ab, die damals in Deutschland diskutiert wurden. Das «Gymnasium Illustre» verwandelte sich unter ihrem Einfluss allmählich von einer Einrichtung, die in erster Linie auf theologische Studien in Tübingen vorbereitete, zu einer allgemeinbildenden höheren Schule. So wurde Fächern wie Mathematik, Physik und Geographie mehr Gewicht gegeben. Bis dahin hatte die Schule nicht einmal das Besteck für physikalische Experimente gehabt. Alte Texte wiederum sollten nicht länger mehr nur wegen der Bedeutung ihrer Sprache für die christliche Überlieferung gelernt werden, sondern um der Kenntnis der Antike, also um ihrer Inhalte willen.
Allerdings war der Lehrkörper in diesen Fragen uneins. Es gab Professoren, die aus leidvoller Erfahrung mit der gewalttätigen Frömmelei pietistischer Erziehungsmethoden der kritischen Vernunft im Umgang mit religiösen Fragen den absoluten Vorrang einräumten, während andere im Geist des sogenannten Neuhumanismus sich der historischen Welt und den Naturwissenschaften öffneten. Der herrschende Gegensatz war also nicht der zwischen Dogmatismus und Aufklärung, sondern der zwischen unhistorischem und historischem Denken. Eine illustrative Anekdote in diesem Zusammenhang, die Hegel in seinem Tagebuch mitteilt, betrifft den zum Tode verurteilten Sokrates. Der bat, Platons «Apologie» zufolge, in seinen letzten Stunden, man möge auf seine Kosten dem Gott der Heilkunst, Äskulap, einen Hahn opfern. Die rationalistische Erklärung von Hegels Schullehrer Philipp August Offterdinger lautete: Sokrates, die Personifikation der griechischen Aufklärung, handelt so unvernünftig abergläubisch, weil das Gift, mit dem er aus dem Leben scheidet, schon Wirkung zeigt. Hegel hingegen: «Ich halte neben dieser Ursache auch davor [dafür], er habe gedacht, weil es Sitte sei, wolle er durch Unterlassung dieser geringen Gabe den Pöbel nicht vollends vor den Kopf stoßen.»[16] Sokrates handelt für Hegel also vielleicht sachlich unvernünftig, aber sozial verständig. Der Glaube, den man auch Aberglauben nennen mag, ist, so aufgefasst, nicht nur eine Behauptung über die Erbittlichkeit der Götter, sondern auch ein gemeinschaftliches Ritual. Man darf, um das zu sehen, eben nur keinen zu engen Begriff von Vernunft, von gesundem Menschenverstand und von Aufklärung haben. Ein knappes Jahr später findet Hegel in den «Briefen zur Bildung des Geschmacks» von Johann Jakob Dusch die dem französischen Dramatiker Racine zugeschriebene Bemerkung, Sokrates habe mit «Wir schulden dem Äskulap einen Hahn» ein griechisches Sprichwort so zitiert, wie es ein aufgeklärter Franzose tue, der zu einem Freund sage, man müsse jetzt eine Kerze anzünden («nous devons une belle chandelle»).[17]
Hegel ist, mit anderen Worten, früh auf eine Reihe intellektueller Spannungen seiner Zeit aufmerksam geworden. Hegels Lieblingslehrer Johann Jakob Löffler beispielsweise wurde vorgeworfen, er vernachlässige das Auswendiglernen.[18] Sein Schüler hingegen dürfte an den Gesprächen mit ihm, der ihm auch Privatunterricht erteilte, gerade das Inwendiglernen geschätzt haben, die Diskussion über Unterrichtsstoffe, die Demonstration der Gründe, weshalb man sich mit ihnen beschäftigte. 1785 muss er den Tod dieses verehrten Menschen hinnehmen – «ewig werde ich sein Andenken unverrükt in meinem Herzen tragen», notiert der Fünfzehnjährige und schreibt Löffler gewissermaßen auf den Grabstein: «Er kannte den Wert der Wissenschafften, und den Trost, den sie einem bei verschidenen Zufällen gereichen.»[19] Dass ein Fünfzehnjähriger an der Wissenschaft ihre Fähigkeit schätzt, Trost zu vermitteln, ist keine nebensächliche Beobachtung. Zwei Jahre ist es damals erst her, dass Hegel seine Mutter verloren hatte und beinahe selbst gestorben war. Der Bedarf an Trost war groß, dass er ihn durch Nachdenken und Kenntnis der Welt gestillt sehen konnte, sagt viel über den jungen Hegel.
Das Auswendiglernen, das zu wenig zu fördern Hegels Lieblingslehrer vorgeworfen wurde, passte zu einer Zeit, in der verlässlich eingeschätzt werden konnte, was ein Schüler brauchte, um sich im Leben zurechtzufinden. Die in der Zeit um Hegels Geburt einsetzende Bildungsrevolution fand aber in einer gesellschaftlichen Lage statt, in der die Schulen ihre Zöglinge allmählich nicht mehr in «Haus und Stand» einfügen, sondern zu Selbstbestimmung anleiten sollten.[20] Um 1770, so der Bildungshistoriker Heinrich Bosse, erlebte in Deutschland nämlich weniger die Gesellschaft eine Krise als die Tradition. Es wurden inzwischen einfach zu viele Bücher und Kommentare zu Büchern publiziert, als dass die Illusion hätte aufrechterhalten werden können, es sei ganz klar, welche davon Pflichtlektüre seien. Nicht die Kopie der Vorbilder konnte länger die Norm abgeben, sondern die sachliche Überprüfung ihrer Maßgeblichkeit. Nicht Gelehrsamkeit um ihrer selbst willen erschien geboten, weil alles Wissen irgendwo schon dargestellt sei, sondern der Vergleich fremder Erfahrung, wie sie in Büchern niedergelegt ist, mit den Ergebnissen des eigenen Nachdenkens.
Der Polemik des von Hegel früh verehrten Rousseau gegen die Bücher – «Ich hasse die Bücher! Sie lehren nur, von dem zu reden, was man nicht versteht»[21] – folgen in dieser Zeit Lessing, Herder, Goethe und Schiller. Im Rückblick erstaunt daran nicht nur das Paradox, dass es äußerst belesene Leute waren, die hier gegen das Lesen polemisierten. Sie waren auch unbekümmert um den noch viel größeren Widerspruch, dass sie, wie schon Rousseau, den Widerstand gegen Erfahrung aus zweiter Hand ihrerseits zum Druck beförderten. Folgt keinen Autoritäten, sondern eurer eigenen Erfahrung, sagte – jemand, der dadurch Anspruch auf Autorität erhob. Hegel kultiviert diese Geste nicht, sich von der Tradition dadurch zu befreien, dass man ihr den Rücken zuwendet. Als Originalgenie empfindet er sich nicht. Dazu war er ein zu bewusster Leser, angefüllt von Jugend an mit einer schwer begreiflichen Anzahl an Lektüren. Vielmehr wird er zu verstehen suchen, was es mit der Tradition auf sich hat und wo die Grenzen ihrer Tradierbarkeit liegen. Gegen das Lesen und das Schreiben von Büchern hätte er sich schon deshalb niemals gewendet, weil ihm das rhetorisch glänzende Sprechen stets fremd blieb. Die ersten Einwände, die ihm in der Schule gemacht werden, betreffen nicht seine Argumente, sondern seinen Vortrag.
Das alles zeigt, wie der junge Hegel sich gebildet hat. Doch was hat er gedacht, was war ihm wichtig? Nicht einfach zu sagen. Er kam aus keiner auffällig religiösen Familie. Passion ist ihm so fremd wie die Vorstellung, man gewinne etwas, wenn man sich seinem pochenden Herz überlässt. Er ist kein Schwärmer, neigt nicht zu riskanten oder experimentellen Gedanken. Er interessiert sich für die griechische Tragödie so sehr wie für Physik oder die auf den ersten Blick banalen Meinungen deutscher Rousseau-Adepten. Was ihm plausibel erscheint, ist die Glückseligkeitslehre einer gemäßigten, jedwedem Radikalismus abholden Aufklärung. «Alle Menschen haben die Absicht sich glücklich zu machen», notiert Hegel 1786 in sein Tagebuch, um sogleich festzuhalten, dass es auch solche gibt, die sich aufopfern, um andere glücklich zu machen. «Doch diese haben, glaub’ ich, nicht wahre Glückseligkeit aufgeopfert, sondern nur zeitliche Vortheile, zeitliches Glük, auch Leben.»[22] Selbst Märtyrer, heißt das, stellen das eigene Verhalten in einer Glückseligkeitsbilanz ein. Die sokratische Behauptung, die Tugend, und also das gute Handeln, beruhe auf Erkenntnis, nicht auf einem Entschluss, leuchtet ihm ein. Aus dem «Neuen Emil» des Philosophen Johann Georg Heinrich Feder, dem Werk, aus dem er am meisten exzerpiert hat, schreibt er sich 1785 heraus: «Einen Grundtrieb zum Bösen, d.i. zum eigenen Verderben und Nachteil anderer, habe ich nie ausfindig gemacht. Der Mensch liebt sich und kann sein Verderben auf keine Art wollen. Er schadet sich bloß aus Irrtum.»[23]
Es sind also Orientierungen einer gemäßigten, deutschen Aufklärung, denen Hegel während seiner Schulzeit folgt. Während Rousseaus «Émile» in der Gesellschaft die Quelle allen Übels sah, bemühte sich Feders «Der neue Emil» gerade umgekehrt darum, den Zögling an die hergebrachte Moral heranzuführen. Hegel interessieren daran aber weniger die pädagogischen Ansichten des Autors als dessen Moralpsychologie, die er im Kapitel «Von den Gründen der Neigungen, sonderlich derjenigen, die das Recht- oder Übelverhalten eines Menschen hauptsächlich bestimmen» ausgeführt hat. Hegel findet nur auf acht von vierundsiebzig Seiten dieses Kapitels, in dem erläutert wird, dass von der Natur nur Gutes kommt, die Selbstliebe Liebe zu anderen impliziert und Tugend nur Vorteile hat, nichts für sein Notizbuch. So schreibt er sich heraus, dass die Tugend noch nicht vollkommen sei, solange sie noch von der Erwartung eigener Vorteile und Furcht unterstützt werde. Aber er bricht an der Stelle ab, an der Feder die typisch pragmatische Einschränkung anschließt, für die Gesellschaft wie das Individuum sei eine unvollkommene Tugend besser als gar keine.[24]
Das Nützlichkeitsdenken der Aufklärung zieht Hegel an, weil es die Intelligenz mit ihren sozialen Umständen verbindet. Alles, was gedacht wird, hat sich im Leben zu bewähren, und wenn es nur in den Büchern steht, führt es eben nur ein Leben in Büchern. Zugleich sieht er früh, dass es sowohl die Gedanken wie die Handlungen selbst unfrei macht, wenn Letztere zu eng an die Befriedigung sinnlicher Bedürfnisse gebunden werden. Die menschliche Sinnlichkeit ist für ihn also einerseits nichts Schlechtes, weil auch Phantasie, Einbildungskraft und die Gefühle mit ihr zusammenhängen. Andererseits kann die Sinnlichkeit des Menschen als «Abhängigkeit von der äußeren und inneren Natur – von dem, was ihn umgibt und in dem er lebt, und von den sinnlichen Neigungen und dem blinden Instinkt», wie Hegel kurz darauf schreiben wird, seinen besten Möglichkeiten im Wege stehen.[25]
Auch wenn damals weder der Begriff des «Idealismus» noch der des «Materialismus» zur Verfügung standen, schwanten schon dem Gymnasiasten Hegel die Widersprüche von philosophischen Theorien, die sich strikt an diese Unterscheidung hielten. Einerseits ist der Mensch abhängig von äußeren Kräften, die auf ihn einwirken: Religion, Klima, Gesetzgebung, Moral. Andererseits ist er frei, soll er alle seine Kräfte entwickeln, was er aber nur kann auf der Grundlage seiner Verflochtenheit in konkrete Lebensweisen. Freiheit ist nicht ein abstraktes Dagegensein, sondern die Entfaltung von Möglichkeiten in einer gegebenen Situation. Doch woran lässt sich erkennen, welche sinnvollen Möglichkeiten in der Situation stecken? Was bewegt Sokrates, in das Urteil der Athener über ihn einzuwilligen, anstatt zu fliehen? Weshalb kann es richtig sein, etwas zu tun, das dem eigenen Wohlergehen widerspricht? Ein Vokabular, um sich in solchen Widersprüchen zurechtzufinden, hat Hegel damals noch nicht.
Am Ende seiner Schulzeit kam die Frage auf, worauf es bei ihm hinauslaufen sollte. Der Wunsch der Mutter war gewesen, ihn zum Pfarrer auszubilden. Er fügte sich dem, weil man sich damals überhaupt dem elterlichen Willen fügte und weil die Ausbildung dafür ihm alle denkbaren Weltausschnitte anbot. Aber schon dem Achtzehnjährigen schien klar, dass die Verkündigung des Neuen Testaments seine Sache nicht sein wird. Wofür er sich interessierte und was er aufgrund von Lektüren plausibel fand, hatte mit dieser Aufgabe gar nichts zu tun. Das Studium, das sich an seine Schulzeit anschließen würde, musste Hegel nicht als Ausbildung zu einem Beruf verstehen, sondern als geschenkte Zeit, die es ihm erlaubte herauszufinden, was sich mit all den Lektüren und Gedanken, zu denen ihn die Schulzeit geführt hatte, im Leben anfangen ließe – mal sehen, was kommt.
Ziehen wir ein erstes Resümee: Hegel wächst in einer Ja-aber-Welt auf. Er gehört einer Familie an, die monarchisch gesinnt ist, aber voller Bürgerstolz lebt. Man ist protestantisch, aber der Souverän ist katholisch. Er ist der Souverän, aber er unterliegt den Landständen und ihren verfassungsmäßigen Rechten. Er pflegt die barocke Ruhmsucht, aber wendet sich, wenn auch spät, mit großer Strenge der Verbesserung seines Staates zu. Die Aufklärung ist dominant, aber der lutherische Glaube ebenfalls. Man pflegt die Vorstellung, Tugend sei nützlich, aber in Königsberg ist Immanuel Kant schon dabei, das Verhältnis zu Moral und Religion so zu revolutionieren, dass der Egoismus als undurchdacht erscheint. Die Schulen unterrichten die Vorbildlichkeit der Antike, aber auch des Christentums und des gesunden Menschenverstandes. Ja, Sokrates, aber auch Jesus. Ja, Monarchie, aber auch Republik. Ja, die Tradition, aber auch der Widerspruch gegen sie.
Es sind mithin viele Vorbehalte, die am Beginn dieser Biographie stehen. Niemand hätte am Ende von Hegels Schulzeit sagen können, was aus ihm werden würde. Das ist bezeichnend für die Bildungssituation dieser Zeit. Der Nachwuchs rückt nicht mehr selbstverständlich in die Positionen ein, die seine Herkunft für ihn vorsieht. Hegel nimmt ein Studium auf, das zum Beruf des Pfarrers führt, aber er denkt keine Sekunde daran, diesen Beruf zu ergreifen. Welchen anderen, weiß er noch nicht. Bildung heißt, dass man lange Zeit von einer Antwort auf die Frage absehen kann, was man werden will.
Zweites KapitelDer Mönch in der Revolte – Tübingen als Lebensform
Ludwig XVI.: «C’est une révolte?»
Graf Liancourt: «Non, Sire, c’est une révolution.»
Hegel wird Magister. Aber was ist ein Magister? Ein Magister, sagt die Zeitschrift «Das graue Ungeheur» im Jahr 1784, ist ein «Geschöpf in schwarzes Tuch gekleidet, mit rund verschnittenen Haaren, einem Mantel und Halskrägchen». Durch theologische Studien habe es dieses in Tübingen einheimische Wesen bis an die Schwelle der Kirchentüren gebracht. Aber es ist weich wie der «Thon Japet’s», also der Lehm, aus dem Gott den Menschen schuf. Man kann einen Vikar, einen Hofmeister, einen Pfarrer, einen Professor, einen Feldprediger oder einen Diakon aus ihm formen. Es wohnt in einem alten, schwarzen, verrauchten Bau mit seinesgleichen eng gedrängt zusammen. Innen ist es «das absurdeste, steifeste und bissigste Ding». Es wird gefüttert, geweidet und gegängelt. Und endlos geprüft. Kommt es aber an die Luft, so verwandelt es sich zuweilen in ein liebenswürdiges Wesen und macht sich lustig über seine «Zuchtvögte».
Ob der aufklärerisch aufgeregte Publizist Wilhelm Ludwig Wekhrlin irgendeine unmittelbare Anschauung vom Leben im Tübinger Stift hatte, dessen Insassen er in seiner eigenen Zeitschrift so eindrücklich schilderte, ist unklar. Dass seine Beschreibung traf, ist hingegen sicher. Die Studenten der Theologie, die in jenem Stift unterrichtet wurden, sollten tatsächlich einem Leben des ständigen Instruiertwerdens und Predigens unterworfen werden. Nichts Weltliches, nichts Schönes sollte ihren Alltag bestimmen. Ihre einzige Lektüre, so die Vorstellung der Lehrer, sei die Bibel und ihre theologische Auslegung sowie alte Schriftsteller. In der Welt sollten sie inmitten einer «fürchterlichen Burg» außerweltlich leben.[1]
Die Burg war ein ehemaliges Augustinerkloster und lag inmitten einer furchteinflößenden Stadt. Als Friedrich Nicolai, der Berliner Verleger und aufklärerische Kopf, 1781 nach Tübingen kommt, beschreibt er es so: Die Stadt liege unbequem auf einem Bergrücken, ihre Straßen seien äußerst uneben. «Man muß schief herauf und herabgehen, oft mehrere Stufen steigen, ja in einigen Häusern (z.B. in dem Hause des Herrn Prof. Uhland) steigt man von der Spitze des Dachs in eine andere Straße.»[2] Alles sehr eng, ungepflastert, gar nicht beleuchtet und dreckig. Misthaufen vor vielen Häusern, die kleine schmutzige Fenster haben. Nicolai findet, das gehöre sich nicht für eine Stadt, die sich die zweite Residenzstadt des Landes nenne und ein Hofgericht sowie eine berühmte Universität in ihren Mauern habe. Tübingen ist für ihn die hässlichste bedeutende Stadt Deutschlands, hässlicher noch, wie er notiert, als Kassel und Braunschweig. Hegel selbst spricht in einem Fragment jener Jahre von der «scheusliche[n] Larve des Todes», die das gotische Bauen zeige.[3]
Tübingen war damals eine für unsere Verhältnisse kleine Universitätsstadt. In einem Staat von etwa sechshunderttausend Bewohnern – in Paris lebten mehr Menschen als in Württemberg – machte sie mit ihren 6140 Einwohnern 1788 aber auch dann etwas her, wenn man wie Hegel aus dem mehr als doppelt so großen Stuttgart kam. Heute liegt Tübingen mit knapp neunzigtausend Einwohnern auf sechs Millionen Württemberger deutlich über der einstigen Größe. Zu Hegels Studienzeit stellten die Studenten, Professoren und Mitarbeiter nur etwa acht Prozent der Einwohnerschaft, heute bilden sie ein Drittel. Die Mehrheit der Tübinger war in der Landwirtschaft, im Gewerbe und in der Verwaltung tätig.
Das Bild der Studenten, das Wekhrlin zeichnete, war das protestantischer Mönche.[4] So sahen sie es auch selbst, wenn sie den Abschied aus Tübingen wie folgt datierten: «Am letzten Tag meines Klosterlebens.»[5] Zwar war die Kuttenpflicht, die noch 1704 verordnet wurde, von 1752 an durch die Anweisung ersetzt worden, «in habitu decenti» eine einheitliche Tracht zu tragen. Aber die Stiftler hatten auf herzoglichen Befehl weiterhin alle denselben Haarschnitt, der Besuch von Wirtshäusern war ihnen untersagt, vom Umgang mit Mädchen ganz zu schweigen. Verboten waren außerdem: Rauchen, Ausreiten, Schlittenfahren, Tanzen und die Teilnahme an Fastnacht.[6] Hegel wird zeit seines Lebens nicht gut auf Mönche oder auf die Erwartung zu sprechen sein, die an Mönche gerichtet ist: das eigentlich fromme Leben zu führen. Tatsächlich war es ja eine Pointe des Protestantismus, der von einem entflohenen Mönch angestoßen wurde, dass Gottesfurcht und Frömmigkeit nicht delegiert werden können. In der protestantischen Welt sollte es keine Mönche geben. Das ließ allerdings die Möglichkeit offen, dass alle ein wenig Mönchen ähneln sollten.
Im Stift, dem theologischen Kolleg und Zentrum der Tübinger Universität, ging es jedoch nicht um die tägliche Selbstprüfung aller, sondern um das fortwährende Prüfen der künftigen Kirchenmänner: in den Fächern, die sie studierten, im Gottesglauben und in der Disziplin. «Außer China wird in keinem Lande so viel examinirt und locirt, als in diesem», heißt es über Württemberg.[7] Schelling wird nach seiner Zeit im Stift von einem «moralischen Despotismus» sprechen, dem die Studenten ausgesetzt waren. Hier sollte der mit Bibeln und orthodoxer Theologie bewaffnete Arm des Fürstenstaats herangezogen werden. Hegel wird das noch stärker als manche seiner Kommilitonen empfunden haben, kam er doch aus der Residenzstadt und von einem Gymnasium, an dem die Aufklärung ihre pädagogische Wirkung schon getan hatte. Davon konnte in Tübingen nur sehr eingeschränkt die Rede sein. Der berühmteste Theologe des Stifts, Gottlob Christian Storr, lehrte geradezu gegen jeden Versuch, den Sinn der christlichen Botschaft vom Wortsinn des Neuen Testaments abzulösen und es «vernünftig» zu interpretieren.[8] Eine Prüfung der Texte am Maßstab der Verständigkeit – etwa: Soll man die Wundertaten Christi glauben? Hat er die Fünftausend nicht nur gespeist, sondern auch satt gemacht? Wie kann es sein, dass Gott Christus opfert und dadurch dem Rest die Sünden verziehen werden? – wurde nicht eingeräumt. Eine solche Prüfung hätte nämlich mit der kirchlichen auch die obrigkeitliche Autorität untergraben. Die Religion war einzuüben und auswendig zu kennen; nicht zu durchdenken, sondern als kompaktes System wahrer Sätze zu erschließen. «Wie gut habens andere», klagt Friedrich Hölderlin seiner Mutter, nachdem ihn die von Stuttgart neu eingetroffenen Hegel und Märklin 1789 in den Prüfungen vom sechsten auf den achten Rang verdrängt hatten, «die ununterbrochen durch solche Schulfüchsereien in ihren Studien fort machen können!»[9] Die Studenten träumten vom Studieren.