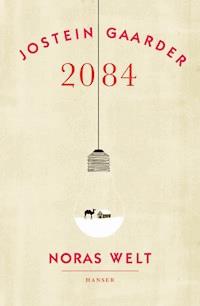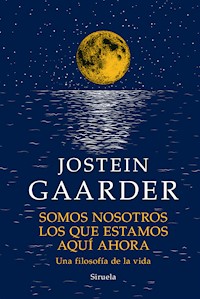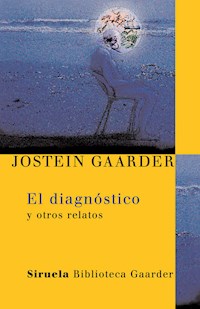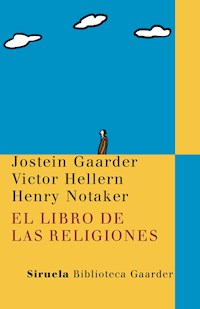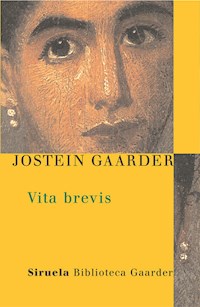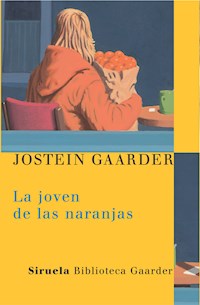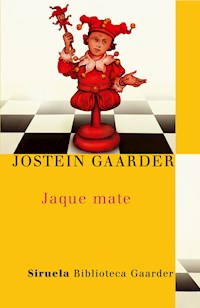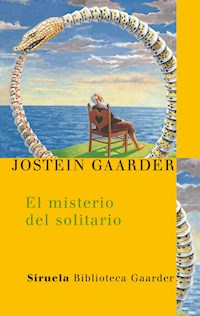Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Jostein Gaarder über das Wunder der Erde und des Lebens. Eine inspirierende Lebensphilosophie, die zum Nachdenken anregt – und ein kurzweiliges Leseerlebnis
30 Jahre nach der Veröffentlichung von "Sofies Welt" widmet sich Bestsellerautor Jostein Gaarder seiner ganz eigenen Lebensphilosophie, als Brief an seine Enkel. Dabei verknüpft er Erfahrungen und Erlebnisse aus seinem Leben mit Themen, die ihn schon immer beschäftigt haben, wie Natur, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Religion, Liebe, Leben, Tod und das Wunder unserer Existenz. Und er setzt sich intensiv mit Fragen auseinander, die die Zukunft seiner Enkel betreffen. Die wichtigste: Wie kann es uns gelingen, die menschliche Zivilisation und die Lebensgrundlage auf unserem Planeten zu bewahren? Ein neugieriger und kluger Blick auf das Privileg, auf dieser Erde zu leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Bestsellerautor Jostein Gaarder über das Wunder der Erde und des Lebens. Eine inspirierende Lebensphilosophie, die zum Nachdenken anregt — und ein kurzweiliges Leseerlebnis30 Jahre nach der Veröffentlichung von »Sofies Welt« widmet sich Bestsellerautor Jostein Gaarder seiner ganz eigenen Lebensphilosophie, als Brief an seine Enkel. Dabei verknüpft er Erfahrungen und Erlebnisse aus seinem Leben mit Themen, die ihn schon immer beschäftigt haben, wie Natur, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Religion, Liebe, Leben, Tod und das Wunder unserer Existenz. Und er setzt sich intensiv mit Fragen auseinander, die die Zukunft seiner Enkel betreffen. Die wichtigste: Wie kann es uns gelingen, die menschliche Zivilisation und die Lebensgrundlage auf unserem Planeten zu bewahren? Ein neugieriger und kluger Blick auf das Privileg, auf dieser Erde zu leben.
Jostein Gaarder
Ist es nicht ein Wunder,dass es uns gibt?
Eine Lebensphilosophie
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Hanser
Mein besonders herzlicher Dank gilt Anne Sverdrup-Thygesen, Dag O. Hessen und Øystein Elgarøy, die bereitwillig das Manuskript zu diesem Buch gelesen und kluge, humorvolle und kenntnisreiche Kommentare beigesteuert haben.
J. G.
VORWORT
Leo, Aurora, Noah, Alba, Julia und Máni,ihr Lieben alle!
Jetzt habe ich mich vor den Computer gesetzt, um euch einen Brief zu schreiben, und dabei kitzelt es mich ein bisschen im Bauch. Es kommt mir seltsam vor, auf diese Weise mit euch in Kontakt zu treten.
Ich habe nämlich vor, aus diesem Brief an euch ein kleines Buch zu machen, das auch andere Menschen lesen können. Ein solcher Text, der für alle zugänglich ist, obwohl er sich eigentlich an einen bestimmten Menschen richtet, wird auch ein »offener Brief« genannt.
Ihr werdet ihn also nicht lesen können, ehe er gedruckt ist. Aber das wird euch nicht weiter stören, denn ich werde euch nichts von diesem Buch erzählen, solange es nicht in einem Verlag veröffentlicht ist. Ich freue mich darauf, es jeder und jedem von euch in die Hände zu drücken, und ich kann mir vorstellen, dass es ein feierlicher Augenblick sein wird, für euch und für mich. Entweder könnt ihr diesen Brief dann jeweils allein entgegennehmen, oder wir machen ein großes Fest daraus.
Ich schreibe nicht zum ersten Mal so einen literarischen Brief. Mehrere meiner Bücher hatten diese Form, aber sie waren an Personen gerichtet, die ich mir ausgedacht hatte.
Die einzige Ausnahme war der Brief einer Frau — und es hat mir Spaß gemacht, mich in diese Rolle zu versetzen — an einen berühmten Bischof und »Kirchenvater«, der vor sechzehnhundert Jahren in Nordafrika gelebt hat. Ich wollte dieser Frau sozusagen eine Stimme geben. Sie war eine reale Person, die wir aus den Bekenntnissen des Bischofs kennen, aber wir wissen über sie eigentlich nur, dass dieser Mann sie eines Tages nach langjährigem Zusammenleben einfach vor die Tür setzte. Wir kennen nicht einmal ihren Namen, in meinem Buch Das Leben ist kurz habe ich sie Floria Aemilia genannt.
Der Bischof konnte diesen Brief von Floria natürlich niemals lesen, aber ich wollte seinen heutigen Anhängern diese Chance geben, und es könnte ja durchaus sein, dass Augustinus, so hieß er, wirklich einen Brief von dieser unglücklichen Frau bekommen hat, die er einmal so sehr geliebt hatte. Der Kirchenvater aber hatte beschlossen, auf ein ewiges Leben im Jenseits zu setzen statt auf die Liebe zu einer Frau im diesseitigen Leben. Er vertrat nämlich die Ansicht, das eine könne ein Hindernis für das andere sein.
Für uns ist die Beobachtung wichtig, dass er so viel von seinem Leben in dieser Welt für seine Vorstellungen von einer anderen Welt geopfert hat. Diese Problematik ist auch nach über sechzehnhundert Jahren noch aktuell, und dieses Buch hier wird unter anderem von solchen lebensphilosophischen Fragen handeln.
Es ist eine ganz neue Erfahrung für mich, an junge Menschen zu schreiben, die heute leben und die ich gut kenne. Während ich diesen offenen Brief schreibe, seid ihr, drei Mädchen und drei Jungen, zwischen ein paar Wochen und fast achtzehn Jahren alt. Aber ihr habt eine Gemeinsamkeit — nein, nicht nur, dass ich euer Großvater bin —, ich denke an etwas anderes und viel Wichtigeres: Ihr wurdet alle im 21. Jahrhundert geboren. Ihr werdet, zumindest die meisten von euch, dieses ganze Jahrhundert durchleben, ehe ihr in euren alten Tagen hoffentlich noch einen Blick ins 22. Jahrhundert werfen könnt.
Ich selbst wurde mitten im 20. Jahrhundert geboren. Also muss ich in diesem Buch einen Bogen über mehr als hundertfünfzig Jahre schlagen. Ich würde, ohne zu zögern, behaupten, dass diese hundertfünfzig Jahre zu den entscheidenden Jahren in der Geschichte der Menschheit und damit auch in der Geschichte unseres Planeten gehören könnten.
Ich habe euch etwas zu erzählen, und ich habe ein kleines Bündel an Themen, das ich euch gern vorlegen möchte. Es sind verschiedene Blickwinkel auf das Leben, auf die menschliche Zivilisation und auf unseren eigenen verletzlichen Planeten im Weltraum. Ich werde versuchen, mich jeweils auf ein klar umrissenes Thema zu konzentrieren, aber ich möchte das Ganze auch als eine mehr oder weniger zusammenhängende Überlegung darstellen. Unterwegs werde ich euch gelegentlich Fragen stellen. Bei manchen werde ich selbst die Antwort nicht mehr erfahren. Wenn ihr diesen Brief gegen Ende des 21. Jahrhunderts (noch einmal!) lest, werdet ihr viele dieser Antworten kennen. Aber versucht nicht, mir zu schreiben. Die Antworten würden mich so wenig erreichen, wie Florias Brief den Bischof Augustinus erreichen konnte.
Man kann sich sehr gut an die eigenen Nachkommen oder an zukünftige Generationen wenden. Doch die, die nach uns kommen, werden uns keine Antwort mehr zurufen können.
Ich will euch gleich ein Beispiel dafür geben, was ich meine.
Wie wird die Welt gegen Ende des 21. Jahrhunderts aussehen?
Es lohnt sich sicher, diese Frage jetzt schon zu stellen — je eher, desto besser —, denn obwohl heute niemand die Antwort kennt, liegt es an uns, die wir jetzt leben, die Welt am Ende des 21. Jahrhunderts zu erschaffen. Na ja, das ist vielleicht eine ziemlich hochgestochene Formulierung, hochgestochener geht es kaum. Aber ihr versteht sicher, was ich meine, und dort, weit in der Zukunft, wird euch klar werden, warum ich mich so und nicht anders ausgedrückt habe.
Die Jüngsten von euch müssen ja noch ein paar Jahre warten, ehe sie lesen können, was ich hier schreibe. Ich wende mich heute also an meine erwachsenen Enkelkinder, und mit erwachsen meine ich so ungefähr sechzehn, siebzehn. Aurora und Leo sind schon alt genug, um mich auf meinem Gedankenflug zu begleiten, jedenfalls ein großes Stück weit. (Ab und zu werdet ihr allerdings etwas im Internet nachsehen müssen, denn ohne einige ungewohnte Wörter und Begriffe wird es nicht abgehen.) Ich hoffe aber, dass dieses Buch auch mehrmals gelesen werden kann, wenn ihr älter werdet und mehr Lebenserfahrung habt. Deshalb schreibe ich genauso an Noah, Alba und Julia. Und an dich, kleiner Máni. Willkommen auf der Welt! Beim Schreiben habe ich euch alle vor Augen.
Ich habe sechs junge Gesichter vor mir, denen ich etwas sagen möchte. Was für eine Gelegenheit, was für ein Privileg! Sechs junge Weltbürger und Weltbürgerinnen!
eine Zauberwelt
Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, die einmal ein funkelnagelneuer Vorort von Oslo war. Tonsenhagen heißt dieser Stadtteil, und ich bin mit drei oder vier Jahren dort hingezogen. Etwa zehn Jahre habe ich dort gewohnt, und aus diesen Kindertagen in der Satellitenstadt habe ich eine Reihe klarer, aber unzusammenhängender Bilder behalten, die wie aus der Tiefe eines dunklen Kaleidoskops aufsteigen.
Eines dieser Fragmente werde ich euch jetzt zeigen, es ist eine meiner deutlichsten Erinnerungen.
Einmal, mitten am Tag, vielleicht war es ein Sonntag, sah ich wie in einem Schock die Welt sozusagen zum ersten Mal. Es war, als hätte ich die Augen in einer Zauberwelt aufgeschlagen. Der Gesang der Vögel klang plötzlich wie Flöten und Glas. Auf den Straßen spielten die Kinder auf eine fast verklärte Weise. Alles war Märchen, Wunder. Und hier war ich. Ich befand mich auf der Innenseite eines tiefen, ergreifenden Geheimnisses, in einem Rätsel, das niemand lösen konnte, war darin eingekapselt, als hätte ich mich in eine andere Wirklichkeit verirrt, in eine andere Blase, ein bisschen wie bei Schneewittchen oder Aschenputtel. Rapunzel. Rotkäppchen.
Der Zauber war nur von sehr kurzer Dauer, aber der süße Schock steckte mir noch lange in den Knochen, und er hat mich seither nie mehr ganz losgelassen.
Innerhalb dieser wenigen Sekunden wusste ich zum ersten Mal, dass ich sterben würde. Das war der Preis dafür, dass ich auf der Welt war.
Ich befand mich hier in einem Märchen, und das war ein wunderbares Gefühl, wie die Erfüllung eines unmöglichen Wunsches. Aber auf dieser Welt war ich nur zu Besuch. Dieser Gedanke war unerträglich. Dass ich hier nicht zu Hause war, dass ich keine feste Bleibe besaß.
Ich hatte nur eine lose Verbindung zu dieser Welt, und die nur für kurze Zeit. Für mein kurzes Dasein.
Ich war allein auf der Welt, wie man allein in einem Traum ist. Wenn der Traum von anderen besucht wird — in Gastrollen des Traumes —, bleiben wir trotzdem uns selbst überlassen. Seelen fließen nicht ineinander, sie fließen nur — nebeneinander.
Etwas von dieser schläfrigen Distanz zu anderen Menschen spürte ich manchmal auch, wenn ich wach war. Und dennoch: Ich musste jemandem von dem erzählen, was ich erlebt hatte.
Aber ich versuchte das nicht bei meinen Freunden. Wie hätte ich denen das erklären sollen?
Auf dem Schulweg sprachen wir über Juri Gagarin — der im Weltraum gewesen war! —, über die Pferde auf der Trabrennbahn Bjerke oder über die Olympischen Winterspiele in Innsbruck … Wenn wir einen Geigerzähler gehabt hätten, glaubten wir, hätten wir eine Menge Uran finden und steinreich werden können … und falls ein Rolls-Royce eine Panne hätte, würde sofort ein Hubschrauber mit Mechanikern angeschwebt kommen, um die Luxuskarre an Ort und Stelle zu reparieren …
Ich konnte meinen Kumpels nicht anvertrauen, dass ich es »sonderbar« fand zu leben oder dass ich, ein gesunder Junge von elf oder zwölf, Angst vor dem Sterben hatte. Das hätte gegen unseren üblichen Jargon verstoßen, der ziemlich vorhersagbar war. Hier durfte kein Scheiß gebaut werden!
Also ging ich zu Lehrern und Eltern. Die mussten doch ein tieferes Verständnis für das haben, was mit Leben und Tod zu tun hatte. Die waren doch erwachsen!
Ich versuchte, sie herauszufordern. Ist es nicht sonderbar, dass wir leben?, fragte ich. Ist es nicht sonderbar, dass es diese Welt gibt? Oder dass es überhaupt etwas gibt?
Aber die Erwachsenen waren leerer als Kinder. Sie waren jedenfalls leerer, als ich mich selbst fühlte. Das musste daran liegen, dass sie aus diesen Fragen herausgewachsen waren.
Sie sahen mich an, als ob ich selbst sonderbar wäre.
Warum sagten sie nicht einfach Ja? Ja, es ist wirklich eine sonderbare Vorstellung, dass wir leben, hätten sie sagen können. Sie hätten sogar zugeben können, dass es ein bisschen mystisch war. Oder total wahnsinnig, verrückt! Aber soweit ich sehen konnte, fanden sie es nur peinlich, mit meinen Fragen konfrontiert zu werden. Sie hatten vielleicht Angst davor, auf welche Fragen ich noch verfallen könnte. Ihr Blick wurde unsicher und wich mir aus. Das war ein harter Schlag, denn ich hatte doch die Welt entdeckt!
Zunächst wirkte ich vielleicht suchend und unsicher, unbeholfen. War ich es, der hier begriffsstutzig war? Konnte es sein, dass ich etwas übersehen oder nicht verstanden hatte, etwas über den Tod vielleicht, denn was wusste ich darüber eigentlich?
Oder war es einfach nur so, dass die Erwachsenen nicht über die Welt reden wollten?
Dass es etwas gab! Dass etwas existierte!
Zu diesen Tatsachen gab es aus ihrer Sicht nichts zu sagen.
Das war Anfang der 1960er-Jahre und vielleicht zu einer Zeit, als die meisten Erwachsenen nicht mehr ganz so sicher waren, ob wirklich ein allmächtiger Gott innerhalb von sechs Tagen Himmel und Erde erschaffen hatte.
Ich kannte die Schöpfungsgeschichte gut, wir hatten sie in der Schule gelernt. Diese ganze gewaltige Geschichte konnte uns als Hausaufgabe aufgegeben werden, und einmal sogar mit der direkten Gefahr, am nächsten Tag dazu abgehört zu werden. Aber jetzt brachte niemand von den Erwachsenen sie zur Sprache.
Das, wonach ich gefragt hatte, hatte offenbar nichts mit der christlichen Lehre zu tun, nicht mit Heimatkunde, nicht einmal mit Erdkunde. Es war einfach unpassend, danach zu fragen, ungefähr so unpassend wie die Frage, woher eigentlich die Babys kamen, bevor sie dann im Bauch der Mutter wuchsen. Diese Frage hatte ich allerdings schon ergründet.
Hinter den anderen Büchern im Bücherregal hatte ich ein illustriertes Buch gefunden, und mir war klar geworden, dass aus einem unaussprechlichen Grund nagelneue Kinder im Leib der Mutter entstehen, aber so war die Welt nun einmal eingerichtet, man durfte nur den Kindern nicht genau verraten, wie das vor sich ging, denn Kinder konnten die Last der elterlichen Schande nicht ertragen, und ich war da keine Ausnahme. Ich würde nie wieder dasselbe gelassene und alltägliche Verhältnis zum Anblick einer Frau mit einem Kinderwagen bekommen, nachdem ich in diesem Buch geblättert hatte.
Aber noch peinlicher war es, in der Küche oder im Wohnzimmer zu stehen und bei helllichtem Tage mit Mutter oder Vater über die Frage zu sprechen — woher kommt die Welt?
Ich konnte zu ihnen hochschauen und hinzufügen, fast bettelnd: Ihr findet die Welt also ganz normal, oder?
Und das war dann der Gipfel! Ja, die Welt ist normal, wurde mir versichert, sicher ist sie das, total normal.
Vielleicht wurde es auf eher energische Weise gesagt. Und vielleicht mit dem Zusatz: Ich finde, du solltest nicht zu viel über solche Dinge nachdenken.
Über solche Dinge? Ich glaube zu verstehen, was sie meinten. Sie meinten, ich könnte verrückt werden, wenn ich zu viel darüber nachdächte, dass die Welt nicht normal war.
Eltern und Lehrer hielten also offenbar die Welt — diese Welt! — im Grunde für total normal. Das sagten sie jedenfalls. Aber ich wusste, wenn sie nicht logen, dann irrten sie sich.
Ich wusste, dass ich recht hatte, und ich beschloss, niemals erwachsen zu werden. Ich versprach mir selbst, niemals einer zu werden, der die Welt als selbstverständlich hinnimmt.
Viele Jahre später sah ich Steven Spielberg Film Unheimliche Begegnung der dritten Art.
Der Titel hat damit zu tun, dass jemand, der am Himmel ein UFO sieht, damit eine »Begegnung« der ersten Art hat. Wer physische Beweise für einen Besuch von »Aliens« aus dem Weltraum findet, hat eine Begegnung der zweiten Art. Und wer das Glück hat — oder das Pech —, in physischen Kontakt zu den Fremden zu kommen, hat eine Begegnung der dritten Art. Ach! Sensation!
Aber als ich an jenem Abend den Kinosaal verließ, ging mir auf, dass das eigentlich gar nicht so besonders toll war. Ich hatte schließlich eine Begegnung der vierten Art erlebt.
Ich war selbst so ein rätselhaftes Weltraumwesen, und das konnte ich durch ein Zittern am ganzen Leib spüren.
Ich habe seither viele Male darüber nachgedacht. Jeden Morgen erwache ich mit einem »Alien« in meinem Bett. Und dieser Fremde bin ich!
Marienkäfer
Ein ganz anderes Erlebnis hatte ich einmal als Teenager. Ich war allein tief in den Wald gegangen, es war im frühen Herbst, ich erinnere mich noch an die Vogelbeeren, das Blaubeergestrüpp und das kühle Heidekraut.
Ich war draußen im Heidekraut aufgewacht, in einem grünen Schlafsack, den ich bei allen Pfadfindertouren benutzt hatte, aber diese Zeit war jetzt vorbei.
Warum war ich hier? Also, ich hatte über etwas nachdenken müssen, über etwas, das wehtat, und ich hatte die Beine in die Hand genommen und mich am Ende unter freiem Himmel schlafen gelegt.
Aber als ich aufwachte, konnte ich über mir keinen Himmel sehen. Dichter Nebel hatte sich über die Landschaft gelegt, vielleicht auch nur über die Baumkronen, und ich blieb im Morgengrauen liegen und betrachtete Marienkäfer, Spinnen und Ameisen auf dem Waldboden unter mir, diese winzigen Tiere waren so ungeheuer lebendig!
Und plötzlich spürte ich in Leib und Seele, dass auch ich Natur war, genau wie dieses mikroskopisch kleine Gewimmel in Moos und Heidekraut. Bald kam mir ein noch weiter reichender Gedanke: Ich war aus den gleichen Molekülen zusammengesetzt wie alles Lebende um mich herum. Das Repertoire unterschied sich, aber die Noten waren genau dieselben.
Ich war nicht nur zu einer hastigen Stippvisite auf der Welt, in einem psychedelischen Märchen. Ich befand mich mitten in meinem rechtmäßigen Element, wie der Fisch im Wasser oder die Spinne im Heidekraut.
Ich war zu Hause, in meiner eigenen Welt, denn ich gehörte zu dieser Welt, war diese Welt. Und so würde es auch weitergehen, wenn mein eigener Körper eines Tages verschwunden wäre …
Mich überkam eine fast unbeschreibliche Ruhe, ein ungeahnter Friede, der nichts mit Ausgeruhtheit zu tun hatte, denn ich hatte schlecht geschlafen. Innerhalb von ein oder zwei Sekunden ließ ich mich selbst los und ergab mich etwas anderem, etwas Größerem und Wärmerem. Oder ging in diesem anderen auf, ließ mich davon absorbieren. Es kam mir vor wie eine geistige Übertragung zwischen mir und allem, was existierte, eine Übertragung von Identität, oder vielleicht wäre es besser, von einer Rückführung zu sprechen: Ich führte etwas aus mir selbst zurück zur Natur.
Dieser Zustand dauerte nur wenige Sekunden an, aber die dauerte er. Gerade so lange, dass ich mich umschauen und die weißen Birkenstämme am Rand der kleinen Lichtung erkennen konnte, wo ich mein Lager aufgeschlagen hatte. Diese Stämme gehörten mir, auch sie waren ich. Und ich spürte eine ferne Verwandtschaft mit den winzigen Wesen auf dem Waldboden. Erlebte die hauchdünne Verwandtschaft mit einem Marienkäfer, die nur davon abhing, wie tief ich mich auf sie einließ.
Für einige Augenblicke hatte ich Kontakt zu einer tieferen Schicht in der Natur und in mir selbst, oder in dem, was ich in Gedanken viele Jahre später den »Urgrund« nennen würde.
Und dann lag ich wieder im Schlafsack. Ich glitt zurück in meine eigene individuelle Existenz.
Und ich merkte, dass es kühl war. Ich fror.
Und dann? War das, was ich an diesem Morgen erlebt hatte, einfach nur eine Sinnestäuschung gewesen? Kam es vielleicht daher, dass ich hier im Heidekraut etwas geträumt hatte? Oder sagte es doch etwas über mich aus und über die Welt?
Menschen erleben ja so vieles. Manche behaupten, Gottes Nähe zu erleben — oder dass Gott oder die Ahnen mit ihnen sprechen. Ich selbst habe das nie von mir sagen können.
Aber was ich an diesem Morgen erlebte, kann wohl auch dem kritischsten Rückblick standhalten. Denn ist ein fast überbordender Individualismus nicht ebenso anstrengend — oder übertrieben — wie das eher entspannte Erlebnis, mit allem eins zu sein, oder einfacher: zu sein?
In den kommenden Jahren würde ich immer weiter über solche Erlebnisse nachdenken.
Damals im Wald hatte ich eine ausgesprochen passive Rolle gespielt. Plötzlich war ich in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt worden. Schwupp! Und abermals schwupp — schon war es vorüber!
Aber wenn ich später daran zurückdachte, kam mir der Gedanke, dass so ein Übergang auch auf eine aktivere und eher vom Willen gesteuerte Weise vor sich gehen könnte. Ich könnte mich jederzeit entschließen, ein größeres Segel zu setzen und für mehr zu stehen, als wofür ich im Alltag selbst und mit dem, was mir gehörte, stand. Ich könnte — jedenfalls immer wieder für einen Moment — solche befreienden Gedankensprünge ausführen.
Ich war nicht nur in der Natur. Ich war Natur …
Der Gedankenleser
Bevor ich richtig erwachsen wurde, hatte ich also zwei intensive, aber zugleich widersprüchliche Erfahrungen gemacht: zuerst das bittersüße Gefühl, auf einer kurzen Stippvisite in einer Zauberwelt zu sein, und einige Jahre später das Erlebnis, etwas Größeres und Dauerhafteres zu repräsentieren als mich selbst.