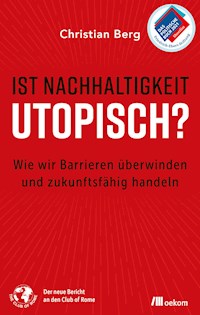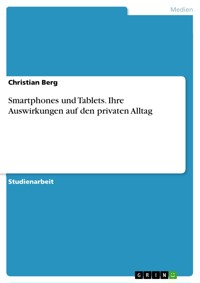Für Daniela –in Dankbarkeit fürtreue Begleitung,beständigen Zuspruch,beglückendes Leben.
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung: Nachhaltigkeit – ein utopisches Ideal?
1.1 Ist Nachhaltigkeit ein »erschöpftes Konzept«?
1.2 Phasenübergang zur Nachhaltigkeit
1.3 Nachhaltigkeitsbarrieren verstehen
1.4 Prinzipien für nachhaltiges Handeln entwickeln
1.5 Das Konzept Nachhaltigkeit
1.6 Struktur des Buchs
1.7 Methodologischer Ansatz
1.8 Zusammenfassung der bisherigen Kerngedanken
Teil 1 Nachhaltigkeitsbarrieren
Intrinsische Barrieren
2 Barrieren der physischen Wirklichkeit
2.1 Erntefaktor, Ressourcen und Umweltverschmutzung
2.2 Komplexität
3 Barrieren der menschlichen Natur
3.1 Kognitive Begrenzungen: Lineares Denken in kurzen Zeiträumen
3.2 Moralische Beschränkungen – Gier, Egoismus und Ignoranz
3.3 Die Kluft zwischen Werten und Verhalten (value-action gap)
3.4 Zielkonflikte
4 Soziale Barrieren
4.1 Systemträgheiten und Pfadabhängigkeiten
4.2 »Die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigen …«
4.3 Populismus und Fundamentalismus
4.4 Ungleichheiten
4.5 Interessenkonflikte
Extrinsische Barrieren I – Institutionelle Defizite
5 Wirtschaft: Marktversagen
5.1 Marktversagen
5.2 Die Proliferation ökonomischen Effizienzdenkens
6 Politik: Fehlende Governance für globale Herausforderungen
6.1 Herausforderungen der IGOs und multilateraler Verträge
6.2 Geopolitik und der Kampf um die Errichtung einer Weltordnung
7 Recht: Rechtliche Schwierigkeiten mit Blick auf Nachhaltigkeit
7.1 Fehlende Institutionalisierung einer Perspektive der Nachhaltigkeit
7.2 Einschränkung individueller Freiheiten zugunsten des Gemeinwohls?
8 Technologie: Diskrepanz zwischen Wirkmächtigkeit und Steuerungsfähigkeit
9 Strukturelle Silos: Fragmentierung von Wissen, Verwaltung und Verantwortung
9.1 Fragmentierung von Wissen
9.2 Fragmentierung der Administration
9.3 Fragmentierung von Verantwortung
Extrinsische Barrieren II – Zeitgeistabhängige Barrieren
10 Beschleunigung und kurzfristiges Denken
11 Konsumismus
Teil 2 Handlungsprinzipien
12 Warum Handlungsprinzipien?
12.1 Perspektivwechsel: die Sicht der Akteure
12.2 Warum »Prinzipien« für nachhaltiges Handeln?
12.3 Arten von Prinzipien
13 Naturbezogene Prinzipien
13.1 Dekarbonisieren
13.2 Kombination von Effizienz, Suffizienz und Konsistenz
13.3 Kapitalbilanz netto-positiv aufbauen – in ökologischer und sozialer Hinsicht!
13.4 Nachhaltig konsumieren: lokal, saisonal und vegetarisch
13.5 Verursacherprinzip
13.6 Vorsorgeprinzip
13.7 Faszination für die Wunder und die Schönheit der Natur kultivieren
14 Persönliche Prinzipien
14.1 Warum persönliche Prinzipien wichtig sind
14.2 Kontemplation und praxis einüben
14.3 Nicht zu sicher sein und Maßnahmen umsichtig anwenden
14.4 Genügsamkeit feiern
15 Gesellschaftsbezogene Prinzipien
15.1 Die meiste Unterstützung für die am wenigsten Privilegierten
15.2 Sich um wechselseitiges Verständnis, Vertrauen und multiple Vorteile bemühen
15.3 Den sozialen Zusammenhalt stärken
15.4 Die Stakeholder einbinden
15.5 Bildung befördern – Wissen teilen und zusammenarbeiten
16 Systembezogene Prinzipien
16.1 Systemisch denken und handeln
16.2 Vielfalt fördern
16.3 Transparenz erhöhen über öffentlich Relevantes
16.4 Optionenvielfalt erhalten oder erhöhen
17 Schlussfolgerung: Prinzipien nachhaltigen Handelns können Phasenübergang auslösen
17.1 Zusammenfassung: Barrieren überwinden
17.2 Das Ziel ist Lebenswohl/Futeranity: die Zukunft der Erde und des Menschlichen
17.3 Ausblick: Die Veränderung kommt
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Danksagung
Abkürzungen
Abbildungen
Über den Autor
Diese Publikation ist ein »Bericht an den Club of Rome«
Als der Club of Rome im Jahr 1968 gegründet wurde, beschränkte sich die Verwendung des Begriffs »Nachhaltigkeit« noch auf den Bereich der Forstwirtschaft. Er bezeichnete jenes forstwirtschaftliche Prinzip, nach dem nicht mehr Holz gefällt werden dürfe, als jeweils nachwachsen könne. Darüber hinaus war das Konzept nachhaltiger Entwicklung im gesellschaftlichen Diskurs kaum von Bedeutung: Auf dem Planeten lebten gerade einmal halb so viele Menschen wie heute, die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre betrug noch unter 330 ppm (heute etwa 415 ppm) und das stetige Wachsen der Wirtschaft schien zumindest in den westlichen Industrieländern mit einem bis dahin beispiellosen Wohlstand einherzugehen. Die Löhne stiegen; es blieb von Jahr zu Jahr mehr Geld für den privaten Konsum übrig. Bildung, Gesundheit, Sozialleistungen und allgemeine Lebensbedingungen schienen sich stetig zu verbessern.
Der erste Bericht an den Club of Rome, »Die Grenzen des Wachstums«, warf im Jahr 1972 dann erstmals auch umweltpolitisch die Frage auf, wie lange diese vordergründig positive Entwicklung eigentlich anhalten könne. In seiner Schlussfolgerung warnte der Bericht davor, dass, hielten die Wachstumsraten der Jahre 1900 bis 1972 an, die Menschheit die Grenzen des Planeten zwischen dem Jahr 2000 und 2100 überschreiten würde.
Die Erkenntnis des Widerspruchs eines unbegrenzten und ungehemmten Wachstums des materiellen Konsums in einer Welt mit klar begrenzten Ressourcen schlug damals ein wie eine Bombe: Über 12 Millionen Exemplare des Berichts, in mehr als 30 Sprachen übersetzt, wurden verkauft. Im Verlaufe der kontroversen Debatten, wüsten Angriffe und Diskreditierungen von Seiten derer, die ihre Interessen durch diese Erkenntnis bedroht sahen, kristallisierte sich die Idee einer »Nachhaltigkeit« menschlicher Aktivitäten auf dem Planeten heraus.
In den Folgejahren formierte sich die internationale Umweltbewegung, mehrere Länder führten Umweltministerien ein und die Anerkennung der gegenseitigen Abhängigkeit von Natur und Wirtschaft trug maßgeblich zur Weiterentwicklung des Konzepts der Nachhaltigkeit bei.
»Die Grenzen des Wachstums« erwähnte im Besonderen, dass es möglich ist, Wachstumstrends zu verändern und neue Voraussetzungen für eine gerechtere und wünschenswerte Welt festzulegen, die Stabilität und globales Gleichgewicht ermöglichen. Heute besteht das zentrale Problem nicht mehr in der Frage, ob wir einen globalen Lebensstandard, der die Grenzen des Planeten nicht sprengt, erreichen können, sondern wie wir dies tun können. Dabei sind die Voraussetzungen zur Umsetzung zwar besser geworden, aber die Herausforderungen in der Zukunft sind ebenfalls stetig gewachsen.
Mit dem an der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 getroffenen Übereinkommen zur Begrenzung der globalen Erwärmung, der Verabschiedung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die 2016 in Kraft traten, und den zunehmenden sowie immer ehrgeizigeren Verpflichtungen zur Klimaneutralität zahlreicher Volkswirtschaften, Großstädte und Regionen weltweit ist heute zwar einerseits durchaus zu beobachten, dass die Weltgemeinschaft sich mehr und mehr den Herausforderungen für die Zukunft unseres Planeten stellt. Nichtsdestotrotz bleiben das globale Engagement, die Geschwindigkeit und das Ausmaß nachhaltiger Entwicklungen sowie die vereinbarten Maßnahmen noch immer weit hinter den Notwendigkeiten für eine stabile, lebenswerte und gerechtere Zukunft zurück.
Der vorliegende Bericht an den Club of Rome »Ist Nachhaltigkeit utopisch? Wie wir Barrieren überwinden und zukunftsfähig handeln« (engl. »Sustainable Action – Overcoming the Barriers«) widmet sich bemerkenswert ganzheitlich einer konzeptionellen, analytischen, moralischen, philosophischen, manchmal historischen Bestandsaufnahme des Begriffs der Nachhaltigkeit. Christian Berg arbeitet sich vor zu den Barrieren und Hürden für den so dringend benötigten Umbruch und Wandel, stellt die Frage nach Prinzipien und Verantwortung, schlägt konkrete und abstrakte Lösungswege vor, um den Leserinnen und Lesern zu ermöglichen, schließlich und schlussfolgernd, das eigene Konzept des »Lebenswohls« (engl. »Futeranity«) zu entwickeln, welches Nachhaltigkeit als utopisches Ideal und übergeordnetes, gemeinsames Ziel definiert.
Christian Berg stellt sich durchgängig dem aktuellen Stand der Debatten um die Herausforderungen für die Zukunft des Planeten und der Menschheit. Dabei benennt und beleuchtet der Bericht die Spannungsfelder unserer Zeit: zwischen Hoffnung, Zynismus, Radikalität und Verzweiflung, individueller und kollektiver Verantwortung, »Fridays for Future« und »fake news«, zentralen Machtstrukturen und lokalen Initiativen, moralischen Ansprüchen und globaler Handlungsunfähigkeit.
Ein ausschlaggebender Grund für das Executive Committee des Club of Rome, das vorliegende Buch als »Bericht an den Club of Rome« anzunehmen, ist allerdings vor allem, ganz in der Tradition des Clubs und seiner analytischen Denkweise, der stete, systemische Blick auf Sachverhalte, Konzepte, Zusammenhänge und Lösungen. Für den Autor ist die Anerkennung der Komplexität aller Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit Grundvoraussetzung und Ausgangspunkt, um den Leserinnen und Lesern eine Fülle an neuen Gedanken, Erkenntnissen, Einsichten und Fakten – und nicht zuletzt das Konzept des Lebenswohls bzw. der »Futeranity« – zu präsentieren.
Wir befinden uns an einem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte; auch das zeigt dieser Bericht klar auf. Im kollektiven Bewusstsein wächst das Verständnis für die grundlegende Frage, wie die Welt aussehen soll, in der wir künftig leben wollen: eine globale Gesellschaft, die es schafft, nachhaltig von ihren Ressourcen leben zu können, die der endliche Planet und der unendliche menschliche Einfallsreichtum zur Verfügung stellen; eine gerechte Gesellschaft, die realen Wohlstand besitzt und glücklicher ist als heute. Die Vision des Club of Rome ist die einer aufgeklärten Welt, geleitet von Werten der Zusammenarbeit.
Die Welt kann in Zukunft ein sichererer und widerstandsfähigerer Ort sein als die Welt von heute. Die Menschheit besitzt alle Möglichkeiten, Hilfsmittel, Wissenschaft und Technologie sowie die nötige Einsicht, die aktuelle systemische Krise zu überwinden und sich hin zu einer besseren Welt zu bewegen. Ob wir dies schaffen, wird von jedem und jeder einzelnen von uns abhängen; und von den Maßnahmen, die wir in Gemeinschaft ergreifen werden. »Ist Nachhaltigkeit utopisch?« bietet einen exzellenten Startpunkt, um Nachhaltigkeit in diesem Sinne neu zu denken.
Winterthur, Schweiz, 02. Dezember 2019
Dr. Mamphela Ramphele & Sandrine Dixson-Declève
Co-Präsidentinnen des Club of Rome
1 Einleitung: Nachhaltigkeit – ein utopisches Ideal?
1.1 Ist Nachhaltigkeit ein »erschöpftes Konzept«?
Das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung hat eine bemerkenswerte Karriere erlebt.
1987 stellte die UN-Kommission für Umwelt und Entwicklung (World Commission on Environment and Development, WCED) ihren Abschlussbericht vor. Das darin beschriebene Konzept, die »Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation zu befriedigen, ohne die der künftigen Generationen zu gefährden« ist als »Brundtland-Definition« seither einschlägig geworden (WCED 1987, Abschnitt 27). Nur fünf Jahre später, 1992, einigte sich die Weltgemeinschaft in Rio de Janeiro darauf, Nachhaltigkeit als gemeinsames Ziel der Menschheit zu verfolgen. 2015 schließlich konnten sich die Staaten der Welt auf die Agenda 2030 mit ihren Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) einigen, die 17 sehr konkrete Ziele für eine nachhaltige Entwicklung benennt, denen 169 Unterziele mit entsprechenden Indikatoren zugeordnet sind.
Im selben Jahr wurde mit dem Pariser Klimaabkommen ein weiterer wichtiger Meilenstein für nachhaltige Entwicklung erreicht. Es gibt unzählige weitere Programme, Initiativen, Maßnahmen und Organisationen, die sich der Herausforderung einer zukünftigen, einer nachhaltigen Entwicklung verschrieben haben – aber was hat das alles gebracht?
Wir Menschen prägen das Gesicht der Erde in einer nie dagewesenen Weise, was der Begriff »Anthropozän« zum Ausdruck bringt – der Mensch ist mittlerweile zur dominierenden Einflussgröße auf unserem Planeten geworden (Crutzen 2002).
Gibt es Fortschritte beim Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen? Gelingt es uns, Ressourcen gerechter zu verteilen? Haben sich die Bemühungen um den Klimaschutz ausgezahlt?
Gewiss, es hat einige Fortschritte in Sachen Entwicklung gegeben: So haben die UN-Millennium-Entwicklungsziele, die Millennium Development Goals, zum Beispiel geholfen, die Kindersterblichkeit zu senken und die Armut zu bekämpfen.
In vielen ökologischen Fragen ist die Bilanz aber sehr ernüchternd. Besonders dramatisch sieht man dies an der Entwicklung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre.
Abbildung 1: Keeling-Kurve: Kohlendioxidkonzentration auf dem Mauna Loa. (Quelle: Scripps Institution of Oceanography (2019), https://scripps.ucsd.edu/)
Abbildung 1 zeigt die sogenannte Keeling-Kurve, die seit 1958 die CO2-Konzentration in der Atmosphäre misst. Trotz jahrzehntelanger Bemühungen um Klimaschutz nimmt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre weiter zu. Nirgendwo ist der Effekt der Rio-Konferenz (1992), des Kyoto-Protokolls (1997) oder des Pariser Klimaabkommens (2015) erkennbar! Von den jahreszeitlich bedingten Schwankungen abgesehen, nehmen die Werte seit sechs Jahrzehnten kontinuierlich zu. Es gibt lediglich zwei kurze Phasen, in denen die Zunahme etwas geringer ausfällt: nach der Ölkrise Anfang der 70er- Jahre und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu Beginn der 90er-Jahre.
Zeigt diese Kurve nicht das dramatische Versagen unserer Nachhaltigkeitspolitik? Oder stellt es vielleicht sogar das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung generell in Frage? Was sind all die politischen Vereinbarungen und gutgemeinten Aktionen wert, wenn sie keine Ergebnisse zeigen? Machen wir uns nicht selbst etwas vor?
Dabei ist die Klimakrise natürlich bei weitem nicht das einzige ökologische Problem, möglicherweise noch nicht einmal das gravierendste. Der Artenschwund, der vielleicht noch bedrohlicher als der Klimawandel ist, wie verschiedene Studien nahelegen (Rockström et al. 2009; Steffen et al. 2015b), hat in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen. Der vom WWF veröffentlichte Living Planet Index dokumentiert einen Rückgang von 60 Prozent in den letzten 40 Jahren (WWF 2018).
Abbildung 2: Planetare Grenzen. (Quelle: Steffen et al. 2015b)
Wir »plündern den Planeten« und beuten seine Rohstoffe aus (Bardi 2013), wir zerstören die tropischen Regenwälder und gefährden ihre indigenen Völker (Martin 2015) und unsere Ozeane werden wärmer, saurer und vermüllen (World Ocean Review 2017).
Zwar gibt es global gesehen Fortschritte bei der gesellschaftlichen Entwicklung – der Human Development Index (HDI)1 hat sich zwischen 1990 und 2017 verbessert –, doch gibt es bei genauerem Hinsehen noch immer große Probleme: Während die menschliche Entwicklung im globalen Mittel bei einem HDI von 72,8 Prozent liegt, ist dieser Wert für das Afrika südlich der Sahara mit 34,9 Prozent erheblich niedriger. Auch gibt es noch ein signifikantes »gender-gap«: Der HDI für Frauen liegt im globalen Mittel mehr als sechs Prozent unter dem der Männer. Und nicht zuletzt werden auch Fortschritte beim HDI durch ökonomische Disparitäten zunichte gemacht: Berücksichtigt man soziale Ungleichheiten, liegt der weltweite HDI nur noch bei 58,2 Prozent (UNDP 2018). Mehr als 60 Prozent der Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen, 30 Prozent keinen Zugang zu sauberer Trinkwasserversorgung (UNESCO 2019).
Das ernüchternde Resümee des Sustainable Development Report von 2019 lautet, dass vier Jahre nach der Verabschiedung der Nachhaltigkeitsziele und des Pariser Klimaabkommens kein einziges Land auf dem richtigen Weg ist, alle Ziele zu erreichen. In vielen Bereichen verschlechtert sich die Situation sogar (Sachs et al. 2019, viii).
Und während die wissenschaftlichen Analysen von Klimakrise, klimabedingter Migration, Artenschwund, Entwaldung und Plastikmüll entschlossenes Handeln immer dringlicher machen (vgl. Steffen et al. 2018), wird die Diskussion um Nachhaltigkeit von einer völlig unerwarteten Seite torpediert: Populismus. Populistische Agitation zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich, führt zu Rückschlägen bei internationalen Verhandlungen, zieht solide wissenschaftliche Kenntnisse in Zweifel, verunglimpft die Medien und heizt die gesellschaftliche Polarisierung weiter an.
Während die Fachwelt noch darauf hingewiesen hat, dass die im Pariser Klimaziel vereinbarten nationalen Selbstverpflichtungen (Nationally Determined Contributions, NDCs) nicht ausreichen, um das 2-Grad-Ziel auch wirklich zu erreichen (»Ambitionslücke«) und selbst diese unambitionierten Ziele nicht eingehalten werden (vgl. das Verfehlen der deutschen Klimaziele für 2020), muss konstatiert werden, dass die größte Gefahr für das Klima möglicherweise gar nicht aus unambitionierten NDCs resultiert, sondern aus der Tatsache, dass wir vorher den gesellschaftlichen Zusammenhalt verlieren oder geopolitische Konflikte erleben.
Dabei hat der Aufstieg des Rechtspopulismus in vielen Regionen der Welt möglicherweise sogar dieselben Ursachen wie unsere Nicht-Nachhaltigkeit. Denn ein Gefühl von Verunsicherung, das viele Menschen für populistische Vereinfachung empfänglich macht, ist mitverursacht durch die raschen Veränderungen heutiger Lebenswelten, zunehmende Ungleichheiten, hohe Problemkomplexität und das Gefühl, dass eine als elitär empfundene politische Klasse unfähig ist, die »wirklichen Probleme« zu adressieren (vgl. z. B. J.-W. Müller 2016; Dibley 2018; Lockwood 2018). Dies wird in Abschnitt 4.3 thematisiert werden.
Wie ist es zu beurteilen, dass das Konzept Nachhaltigkeit allgemein anerkannt und politisch de jure gewollt ist, es aber faktisch zu wenig Wirkmacht entfaltet? Dreierlei mögliche Reaktionen darauf seien nachfolgend kurz skizziert.
Das Konzept Nachhaltigkeit aufgeben?
Dennis Meadows, einer der Ko-Autoren des ersten Berichts an den Club of Rome, The Limits to Growth (Meadows et al. 1972), bemerkte schon im Jahr 2000, dass es für eine nachhaltige Entwicklung zu spät sei, wir sollten uns stattdessen lieber darum bemühen, unser Überleben zu sichern (survival development anstelle von sustainable development) (Meadows 2000, 147 f.).
Die US-amerikanischen Wissenschaftlerinnen Melinda Benson (Umweltgeographie) und Robin Craig (Umweltrecht) proklamieren das Ende des Konzepts der Nachhaltigkeit. »Es ist Zeit, das Konzept Nachhaltigkeit hinter sich zu lassen. Die Realitäten des Anthropozäns (Crutzen 2002), die ein nie dagewesenes und irreversibles Maß an anthropogenem Artenschwund, exponentiellem Pro-Kopf-Verbrauch an Ressourcen und globalem Klimawandel mit sich bringen, führen zu dieser Schlussfolgerung. Denn diese Entwicklungen zusammen machen rasche, nichtlineare Veränderungen unserer sozialen und ökologischen Systeme wahrscheinlicher. … In einer Welt, die durch solch extreme Komplexität, grundlegende Unsicherheit und einen Mangel an Beständigkeit gekennzeichnet ist, müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass es nicht möglich ist, das Ziel von ›Nachhaltigkeit‹ zu bestimmen, geschweige denn, es zu verfolgen« (Benson & Craig 2014, 777). Die Autoren schlagen stattdessen »Resilienz-Denken« als Orientierung gebende Alternative vor.
Dem Umweltsoziologen Ingolfur Blühdorn zufolge ist Nachhaltigkeit als Wegweiser für eine strukturelle Transformation der sozial wie ökologisch selbstzerstörerischen Konsumgesellschaften ein »erschöpftes Konzept«, wir würden stattdessen eine Politik der Nichtnachhaltigkeit auf dem Vormarsch sehen (Blühdorn 2017), eine »nachhaltige Nichtnachhaltigkeit« (Blühdorn & Deflorian 2019).
Die genannten Autoren haben selbstverständlich gute Gründe für ihre Argumente – gemessen sowohl an dem, was nötig wäre, als auch an dem, was bereits möglich ist, gibt es bisher bei weitem zu wenig Fortschritt. Sollten wir aber deshalb das Ideal einer Welt, in der Menschen in Harmonie miteinander und mit der Natur leben können, aufgeben? Haben wir vielleicht die Komplexität der Problemlagen unterschätzt? Haben wir uns vielleicht zu sehr auf den Gedanken verlassen, dass Einsicht zu Veränderung führt, obwohl wir doch in unserem persönlichen Leben tagtäglich das Gegenteil erfahren?2 Haben wir vielleicht noch nicht das richtige Governance-Modell für Nachhaltigkeit gefunden? Haben wir vielleicht die Trägheit von Systemen unterschätzt und ihren Widerstand gegen Veränderung? Fehlen uns vielleicht institutionelle Anreize für sektor- und disziplinübergreifende Kooperationen und Initiativen?
Die Antworten auf all diese Fragen müssen bejaht werden. Aber wird dadurch das Ziel als solches schon zweifelhaft? Das Ziel der Nachhaltigkeit aufzugeben, weil es zu spät dafür oder unrealistisch wäre, klingt für mich wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Es ist eine traurige Ironie, dass sich die Frustration über das Konzept der Nachhaltigkeit zu einer Zeit Bahn bricht, in der wir einen globalen Konsens darüber erreicht und diesen mit konkreten Zielen verbunden haben. Sowohl das Pariser Klimaabkommen als auch die Agenda 2030 sind bedeutende Meilensteine in der Geschichte globaler Kooperation – so unrealistisch und schwierig ihre Erreichung im Einzelnen auch sein mag.
Dieses Buch plädiert daher dafür, das Konzept der Nachhaltigkeit als Ideal festzuhalten; ein Ideal, das wir vielleicht nie erreichen werden, das vermutlich utopisch ist, aber das wir als solches dringender benötigen denn je.
Das Konzept der liberalen Demokratie aufgeben?
Angesichts der globalen Herausforderungen lasten einige Wissenschaftler den mangelhaften Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit der Regierungsform westlicher liberaler Demokratien an. Da Letztere offensichtlich nicht in der Lage wären, die genannten Probleme wirkungsvoll zu adressieren, wären stärker autoritär ausgerichtete Regime gefordert, die Herausforderungen zu bewältigen. Das reicht von dem Plädoyer für einen »starken Staat« bis zu mehr oder weniger unverhohlen gefordertem environmental authoritarianism, was im Prinzip einer Öko-Diktatur gleichkommt (Chen & Lees 2018; Blühdorn 2019; Beeson 2010)3. Die Tatsache, dass schon die Diskussion um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen Boulevardpresse wie Politiker reflexartig von »Öko-Diktatur« sprechen lässt, zeigt zum einen die Maßlosigkeit der Kommunikation, zum anderen offenbart sich darin die Schwierigkeit, die diesen Ruf nach einem »starken Staat« entstehen lässt.
Die Sozialwissenschaftler Blühdorn und Deflorian attestieren den vorherrschenden Ansätzen der Nachhaltigkeitspolitik schlichtweg Versagen. Diese sollten eher als gemeinschaftliches Management von nachhaltiger Nichtnachhaltigkeit (the collaborative management of sustained unsustainability) angesehen werden (Blühdorn und Deflorian 2019). Die Autoren drücken die feste Überzeugung aus, dass eine radikale sozial-ökologische Transformation dringend erforderlich ist. Sie könnten zwar (noch) keine wirkliche Alternative anbieten, doch wollten sie diese Transformation vorantreiben, indem sie die herrschenden Narrative analysieren (Blühdorn & Deflorian 2019, 13).
In seinem Buch TheSustainable State äußert sich Chandran Nair, Gründer der in Hongkong ansässigen Denkfabrik Global Institute for Tomorrow, ebenfalls kritisch zum »Laissez-faire-Modell« westlicher Gesellschaften, das nicht nachhaltig sei. Nair hält es zur Lösung der großen Zukunftsfragen für erforderlich, dass Regierungen wesentlich stärker eingreifen. In Auseinandersetzung mit der chinesischen Politik, deren Vorgehen er zwar nicht rechtfertigen möchte, für das er aber gewisse Sympathien erkennen lässt, betont er gleichwohl ihr großes Potenzial gegenüber dem Ansatz westlicher Gesellschaften (Nair 2018). Man möge mit dem nichtdemokratischen Charakter der chinesischen Politik nicht übereinstimmen, aber es bleibe wahr, dass China eine erheblich bessere Erfolgsbilanz für die Verbesserung der Lebensbedingungen der allgemeinen Bevölkerung aufweise – in einer sehr viel kürzeren Zeit – als die meisten anderen Entwicklungsländer. Das sei nur möglich geworden durch staatliche Intervention (Nair 2018, 177).
Mit den meisten dieser Beobachtungen stimme ich überein, aber ich teile nicht alle Schlussfolgerungen. Als ein privilegierter Bürger eines westlichen Landes, das es nur bedingt geschafft hat, seine Umwelt zu schützen – und dies zu einem Großteil nur deshalb tun kann, weil es ökologische und soziale Wirkungen in andere Bereiche der Welt ausgelagert hat (vgl. 5.1; Peters, Davis & Andrew 2012, 3273) –, halte ich es für wichtig, die Frage zu reflektieren, wie freiheitliche demokratische Gesellschaften globale Herausforderungen wirkungsvoll adressieren können. Ich teile die Sorge der oben genannten Autoren bezüglich der Frage, ob liberale Demokratien in der Lage sind, globalen Herausforderungen wirkungsvoll zu begegnen. Aber wir sollten uns daran erinnern, dass Freiheit immer dort endet, wo sie die Freiheit anderer gefährdet, was schon John Stuart Mill erkannt hat: »The only freedom which deserves the name is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it« (Mill 1869, 16).
Westliche Gesellschaften haben diese Herausforderung innerhalb ihrer nationalen Grenzen für soziale Probleme teilweise überzeugend gelöst. Die zentrale Aufgabe für uns heute besteht darin, dass die Herausforderungen nicht mehr nur nationaler, sondern globaler Natur sind, und dass es nicht mehr nur genügt, die gegenwärtig lebenden Menschen in den Blick zu nehmen, sondern auch künftige Generationen zu berücksichtigen sind. Auf dem Weg dorthin gilt es große praktische Hürden zu überwinden, doch scheint mir das Problem nicht grundsätzlich anders zu sein als dasjenige, das der demokratische Rechtsstaat heute schon mit der Einschränkung von Freiheitsrechten zugunsten des Gemeinwohls hat.
Es werden wohl exzessiv-luxuriöse Konsummuster, die zu Lasten des Gemeinwohls gehen, stärker zu hinterfragen sein. Der Ruf nach einer »Öko-Diktatur« würde das Problem allerdings wohl nicht lösen. Erstens kann man durchaus bezweifeln, dass Diktaturen generell besser darin sind, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Auch ein globaler Diktator hätte viele Milliarden Menschen zu ernähren, Gesellschaften zu stabilisieren und die Stabilität von Ökosystemen zu sichern. Und das Schicksal vergangener oder gegenwärtiger real existierender Diktaturen gibt wenig Grund zur Hoffnung, dass ein solches Modell für Mensch oder Umwelt grundsätzlich besser wäre.
So formuliert auch der Politikwissenschaftler Harald Müller eine Reihe theoretischer Bedenken gegen die Vorstellung, dass eine globale Diktatur auf Dauer funktionieren könnte (vgl. H. Müller 2008). Wichtiger als solche pragmatischen Einwände erscheint mir allerdings, dass der Weg zu einer humanen Gesellschaft nicht mit inhumanen Mitteln bestritten werden kann. Es gibt unveräußerliche Rechte und Freiheiten, die nicht um vermeintlich höherer Ziele willen geopfert werden dürfen, wie sie eine Öko-Diktatur ggf. zur Disposition stellen würde.
Es wäre inkonsistent, für Frieden und Freiheit in einer künftigen Welt zu streiten und diese dabei heute zu opfern. Da nur der Staat den Rahmen gewährleisten kann, in dem persönliche Freiheiten geschützt werden können, ist das Verhältnis dieser Freiheiten zu dem ebenfalls vom Staat zu schützenden Gemeinwohl eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung. Offensichtlich gestaltet sich, besonders auf globaler Ebene, das Verhältnis von Freiheit und Gemeinwohl derzeit so, dass es die Freiheiten Weniger sind, die das Gemeinwohl aller gefährden, denn die öffentlichen globalen Güter werden allerorten übernutzt. In Kapitel 7 wird diese Frage wieder aufgenommen. Für den Moment genügt festzuhalten, dass die Aufgabe freiheitlich-demokratischer Werte um anderer Ziele willen nicht grundsätzlich eine konsistente Option darstellt. Es braucht daher eine andere Antwort auf die oben genannte Frage.
Starke Polarisierung – dramatischere Appelle und unverblümte Leugnung des Klimawandels
Um sich angesichts des mangelnden Fortschritts in Richtung Nachhaltigkeit Gehör zu verschaffen, gibt es immer dramatischere Appelle, immer radikalere Maßnahmen und schrillere Tonlagen. Einfache Demos genügen in Zeiten skandalgewöhnter bzw. auch skandalisierender Medien nicht mehr, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Der Einsatz muss schon höher sein, wofür Fridays for Future zum Symbol geworden ist. Der Ton wird schärfer. In dem distinguiert-elitären Kontext des Davoser Weltwirtschaftsforums 2019 forderte etwa der niederländische Historiker Rutger Bregman sehr vehement, angesichts der zunehmenden Ungleichheiten in der Gesellschaft endlich über Spitzensteuersätze zu reden: »Taxes, taxes, taxes – all the rest is bullshit« (YouTube 2019).
Auch die Forderungen werden extremer. In ihrem Bericht an den Club of Rome, Ein Prozent ist genug, schlagen Jorgen Randers und Graeme Maexton vor, Frauen 80.000 US-Dollar zu zahlen, wenn sie bis zum Alter von fünfzig Jahren keine Kinder (oder maximal eines) bekommen haben (Randers & Maxton 2016, 221 ff.). Angeregt durch diese Idee formuliert die deutsche Lehrerin und Autorin Verena Brunschweiger sogar, Kinder seien das Schlimmste, was man der Umwelt antun könnte (Der Westen 2019).
Mit Blick auf Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung ist es fraglos richtig, dass die Menschheit insgesamt verheerende Wirkungen auf die Ökosysteme zeitigt – und dass jede und jeder Einzelne dazu beiträgt, besonders in reichen Ländern. Doch so sehr ich auch die sich in solcherlei Argumentation ausdrückende Sorge nachvollziehen kann, scheint mir deren Logik aus mehrfachen Gründen problematisch und fehlerhaft. Nicht nur deshalb, weil gerade viele reiche Länder jetzt schon ein massives Demografieproblem haben, das sich durch derlei Initiativen verschärfen würde und gewiss nicht einfach durch Migration zu beheben wäre, sondern vor allem auch wegen des damit negierten positiven Blicks auf das Leben, der aus meiner Sicht für eine verantwortungsvolle Weltgestaltung unabdingbar ist. Was würde es in Kindern und Jugendlichen auslösen, wenn man ihnen sagt: »Eigentlich wäre es besser, es gäbe Dich gar nicht!«? Zudem scheint mir hier ein fragwürdiges Gesellschaftsverständnis zugrunde zu liegen. Menschliches Verhalten und gesellschaftliche Systeme lassen sich nicht in dieser quasi-technischen Weise steuern (vgl. zu dieser Diskussion auch Berg 2018).
Auf der anderen Seite des gesellschaftlichen Spektrums stehen Populisten, die sich aus noch zu thematisierenden Gründen (vgl. Abschnitt 4.3) in die irrige Ablehnung des anthropogenen Klimawandels verstiegen haben. Deren Verhalten lässt sich wohl eher in soziologischen und psychologischen, wenn nicht sogar religiösen Kategorien beschreiben, als dass Hoffnung bestünde, sie durch rationalen Diskurs von ihren Vorstellungen abzubringen (vgl. dazu z. B. Jaspal et al. 2016; Hobson & Niemeyer 2012).4 Es entbehrt nicht einer gewissen bitteren Ironie, dass es gerade die mutmaßlich aus allerbesten Absichten entspringenden, aber eben besonders extremen Forderungen wie der des Kinderverzichts sind, die den Populisten Auftrieb geben und im Ergebnis vielleicht mehr schaden als nützen.
Die eingangs geschilderten globalen Krisensituationen, von denen die Klimakrise nur das prominenteste Beispiel ist, sind deshalb noch weitaus vertrackter, als sie es in der Sache ohnehin schon sind. Denn es genügt eben nicht die Einsicht, dass eine radikale Dekarbonisierung unserer Zivilisation erforderlich ist, um beim Klimabeispiel zu bleiben. Aus Einsicht allein folgt leider nur selten Handeln. Wir haben es darum nicht einfach nur mit einer Frage der Umsetzung zu tun, so als wäre im Prinzip klar, was zu tun sei (Dekarbonisierung). Wir haben es vielmehr, wie bereits erwähnt, mit einem Erkenntnisproblem zweiter Ordnung zu tun, mit der Frage nämlich, unter welchen Bedingungen es der Menschheit gelingen kann, die erforderlichen Maßnahmen auch umzusetzen.
In einer sich immer stärker ausdifferenzierenden Gesellschaft, in der es beinahe vollständig disjunkte »Blasen«-Welten mit ihren »alternativen Fakten« gibt, wird die Klimakrise nicht überwunden, wenn man nur die Klimakrise im Blick hat. Das würde die Komplexität der Herausforderungen fundamental unterschätzen. Und doch ist es genau das, was häufig passiert und was nach meiner Überzeugung dem fehlenden Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit zugrunde liegt: eine Vernachlässigkung komplexer Zusammenhänge und eine eindimensionale Verengung der Probleme, häufig verbunden mit dem Propagieren einiger weniger, zum Teil sehr umstrittener Maßnahmen – so jedenfalls wird das vorliegende Buch argumentieren.
Die Klimakrise ist keineswegs neu – und sie war auch in den Jahren 2015 und 2016 schon da, wurde aber in Deutschland von der »Flüchtlingskrise« überschattet. Unterbrochen von der Diskussion um andere Krisenherde (z. B. Artensterben, Abholzen und Abbrennen der Regenwälder oder Plastikmüll) hangelt sich der öffentliche Diskurs so von Krise zu Krise.
Flüchtige massenmediale Kommunikation mit ihrem Bedarf, Komplexität zu reduzieren, trägt dazu bei, die öffentliche Aufmerksamkeit auf bestimmte, isolierte Themen zu lenken. Durch die vordergründige Fokussierung auf das Dringliche, Dramatische wird der Blick verstellt auf die dahinterstehenden Barrieren, die einem Mehr an Nachhaltigkeit den Weg versperren (vgl. Abbildung 3).
Abbildung 3: Krisenfokus verhindert umfassenden Blick auf Nachhaltigkeitsbarrieren. (Quelle: Eigene Darstellung)
Themen der Nachhaltigkeit, der Klimawandel insbesondere, sind zu lange primär als naturwissenschaftliches Thema betrachtet worden – nicht zuletzt deshalb, weil naturwissenschaftliche Zusammenhänge häufig den Ausgangspunkt bilden. Deshalb hat wohl kaum jemand die Gefahr kommen sehen, die der Populismus für Klima- und Nachhaltigkeitspolitik darstellt. Auch heute noch sind wir mutmaßlich deutlich besser darin, die sozialen Folgen des Klimawandels zu verstehen als die sozialen Bedingungen dafür, ihn zu begrenzen.5
Was ist angesichts dessen zu tun? Wie in diesem Buch gezeigt werden soll, besteht eine vielversprechende Alternative darin, zunächst möglichst umfassend auf die unterschiedlichen Barrieren auf dem Weg zur Nachhaltigkeit zu schauen und diese zu analysieren. Es gibt so viele unterschiedliche Gründe dafür, dass wir nicht nachhaltiger sind, und erst wenn man viele dieser Barrieren zugleich in den Blick nimmt – sozusagen eine Vogelperspektive einnimmt –, werden Lösungen erkennbar. Aus diesem Grund werden im zweiten Teil des Buchs Prinzipien nachhaltigen Handelns vorgeschlagen, die Akteuren unterschiedlichster Art Orientierung anbieten und den Übergang in eine nachhaltigere Gesellschaft befördern (vgl. Abbildung 4).
Abbildung 4: Umfassender Blick auf Barrieren eröffnet Spielräume auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Multiple Akteure adressieren multiple Barrieren. (Quelle: Eigene Darstellung)
Offenkundig kommen wir mit der Komplexität der Herausforderungen noch nicht zurecht. Komplexe Systeme lassen sich nicht einfach »steuern«. Die Reduktion auf einige wenige Parameter ist umso problematischer, je komplexer das System ist. Verändern lassen sich komplexe Systeme am ehesten dann, wenn eine möglichst große Zahl von Parametern in der gewünschten Weise zusammenwirken. Dieses ist vergleichbar mit einem Phasenübergang (wie in der Physik), der nun betrachtet werden soll.
1.2 Phasenübergang zur Nachhaltigkeit
Für einen Übergang in eine nachhaltigere Gesellschaft braucht es gewaltige Veränderungen, schrittweise Verbesserungen hier und dort werden nicht genügen (vgl. z. B. Kanger & Schot 2018). Es wird zum Beispiel neue Formen von Produktion und Konsum, veränderte Rahmenbedingungen des Markts, eine bessere Global Governance, eine gerechtere Verteilung von Gütern erfordern, um nur ein paar zu nennen.
Der in Manchester Systeminnovation lehrende Frank Geels untersucht gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Ihm zufolge sind unsere gegenwärtigen ökologischen Probleme wie Klimawandel, Artenschwund oder Ressourcenverknappung gewaltige gesellschaftliche Herausforderungen, die nicht nur eine zehnfach bessere Öko-Effizienz, sondern auch grundlegende strukturelle Veränderungen beispielsweise in den Bereichen Transport, Energie sowie Landwirtschaft und Ernährung erfordern. Geels spricht von sozio-technischen Übergängen (socio-technical transitions), da sie ein komplexes Geflecht von Veränderungen in technischen wie sozialen Systemen voraussetzen. Veränderungen würden dabei stets Akteure aus Wirtschaft und Politik, aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Technik betreffen. »Übergänge sind daher stets komplexe und langwierige Prozesse, die eine Vielzahl von Akteuren einbeziehen.« (Geels 2011, 24)
Dass ein Phasenübergang, wie der in eine nachhaltigere Gesellschaft, verhindert wird, wenn wir nicht berücksichtigen, dass er von verschiedenen Parametern (und Akteuren) abhängt, sei durch folgende Analogie aus der Physik verdeutlicht: Wenn Wasser gefriert, verändert es seinen Aggregatzustand von flüssig zu fest und hat dann in Form von Eis offensichtlich ganz andere physikalische Eigenschaften. Auch eine nachhaltigere Gesellschaft wird sich von unserer heutigen grundlegend unterscheiden. Doch wie kann man nun den Phasenübergang beschleunigen? Selbstverständlich durch Veränderung der Temperatur, das weiß jedes Schulkind. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Der Übergang von fest zu flüssig oder von flüssig zu gasförmig hängt nicht nur von der Temperatur ab, sondern auch vom Umgebungsdruck. Auch flüssiges Wasser kann bei Zimmertemperatur verdampfen, wenn man den Umgebungsdruck herabsetzt. Umgekehrt kann das Sieden des Wassers verzögert werden, wenn der Druck erhöht wird, was im Schnellkochtopf ausgenutzt wird. Der Grund dafür ist, dass das Phasendiagramm des Wassers von zwei unabhängigen Variablen abhängt, der Temperatur und dem Umgebungsdruck. Das bedeutet, dass ein Phasenübergang unterstützt und sehr viel schneller erreicht werden kann, wenn beide Variablen zugleich in entsprechender Weise verändert werden. Umgekehrt wird das Verdampfen des Wassers verhindert, wenn man die Temperatur beständig erhöht, während jemand anderes zugleich den Umgebungsdruck erhöht.
Für die Unterstützung von Phasenübergängen ist also die Kenntnis sämtlicher Parameter entscheidend. Wenn dies schon in der Physik gilt, um wie viel mehr sollte dann für hochkomplexe gesellschaftliche Veränderungsprozesse gelten, dass sie nur durch synergetisches Zusammenwirken unterschiedlichster Akteure möglich werden?
Wenn ein Übergang in eine nachhaltigere Gesellschaft daher befördert werden soll – und das zu erreichen ist zentrales Anliegen dieses Buchs –, dann wird dies entscheidend davon abhängen, die Parameter zu kennen, die verhindern, dass das System einen anderen Zustand einnimmt. In der Terminologie des vorliegenden Buchs bedeutet das, die Nachhaltigkeitsbarrieren zu analysieren.
Dass die gleichzeitige Erfüllung unterschiedlicher, voneinander unabhängiger Bedingungen für gesellschaftliche Transformationen erforderlich ist, ist auch ein Ergebnis ganz unterschiedlicher Forschungen zu gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Geschichtliche Transformationen können nie einem Akteur, einem Ereignis oder einer Entwicklung zugeschrieben werden, sondern werden durch gleichzeitige, ganz unterschiedliche Veränderungen hervorgerufen (vgl. Osterhammel 2009; WBGU, 2011, 5). Dies bestätigen die Arbeiten ganz unterschiedlicher Gruppen von Forschenden.
Martin Hirschnitz-Garbers vom Ecologic-Institut untersucht mit seinen Ko-Autoren den nicht-nachhaltigen Ressourcenverbrauch des globalen sozio-industriellen Metabolismus; die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass dieser die Folge eines dynamischen Prozesses komplexer Interaktionen unterschiedlicher Treiber sei (Hirschnitz-Garbers et al. 2016, 25).
Geels und Schot (2007) sowie Geels (2011) schlagen eine Mehrebenenbetrachtung vor (multi-level perspective), um Nachhaltigkeitsübergänge zu verstehen, die einfache Kausalitätszusammenhänge hinter sich lässt. »Es gibt nicht eine einzige ›Ursache‹ oder einen Treiber. Vielmehr gibt es Prozesse in vielfältigen Dimensionen und auf verschiedenen Ebenen, die miteinander verknüpft sind und sich wechselseitig verstärken (zirkuläre Kausalität)« (Geels 2011, 29).6
Auch Paul Raskin et al. analysieren in ihrem Buch The Great Transition die unterschiedlichen Ursachen historischer Transformationen: »Geschichtliche Übergänge sind komplexe kritische Augenblicke, in denen das gesamte kulturelle Gefüge (cultural matrix) und die Beziehung der Menschheit zur Natur verändert werden. Beim Erreichen kritischer Grenzwerte verstärken sich graduelle Veränderungen wechselseitig, die sich in einer Vielzahl von Dimensionen abspielen – in Technik, allgemeinem Bewusstsein und Institutionen. …Ausgehend von Keimzellen des Neuen strahlen Veränderungsprozesse durch Eroberung, Nachahmung und Anpassung in die Umgebung ab« (Raskin et al. 2002, 3).
Ganz analog beschreibt auch eine Gruppe niederländischer Forscher um John Grin langfristige Übergänge in eine nachhaltigere Gesellschaft (Zeitraum 40 bis 50 Jahre). Solche Übergänge seien von ko-evolutiven Prozessen abhängig, die multiple Veränderungen in sozio-technischen Systemen mit sich brächten und durch Prozesse multipler Akteure, den Interaktionen zwischen sozialen Gruppen, wissenschaftlichen Communities, Politik-Gestaltern, sozialen Bewegungen und Interessengruppen bestimmt seien (Grin, Rotmans & Schot 2010, 11; vgl. auch Köhler et al. 2019).
Petra Künkel, die das Collective Leadership Institute gegründet hat, fordert schließlich in ihrem Buch Stewarding Sustainability Transformation einen systemischen Ansatz und ein neues Verständnis von Führung (Leadership), um komplexen adaptiven Systemen gerecht zu werden. Es gäbe nicht den einen richtigen Weg, um Veränderung möglich zu machen. Angesichts der Komplexität der betreffenden Systeme seien multiple Anstrengungen auf zahlreichen Ebenen und Quellen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen erforderlich (Künkel 2019, 14).
Zusammenfassend können wir festhalten, dass ein Übergang in eine nachhaltigere Gesellschaft eine multidimensionale Herausforderung darstellt, die einen sehr umfassenden und differenzierten Ansatz auf verschiedenen Ebenen erfordert – einen Ansatz, der
mehrere Dimensionen umfasst, d. h. soziale, ökologische und wirtschaftliche Belange beinhaltet;
auf verschiedenen Ebenen operiert, d. h. von der lokalen bis zur globalen Ebene alles einschließt;
multi-sektoral ist, d. h. Regierungen, Zivilgesellschaft und NGOs ebenso einschließt wie Wissenschaft und Wirtschaft; und schließlich auch
zahlreiche Akteure auf verschiedenen Ebenen einschließt (vgl. Künkel 2019, z. B. 14.263).7
Im Unterschied zu wohl allen bisherigen Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte ist es das erste Mal, dass ein solcher Übergang in globalem Maßstab und als Ergebnis planvollen Handelns vonstatten zu gehen hat – und zwar in (relativer) Abwesenheit von externem Druck, allein durch Antizipation künftiger Bedrohungen.
1.3 Nachhaltigkeitsbarrieren verstehen
Trotz zahlreicher Jahrzehnte von Nachhaltigkeitsforschung gibt es kaum umfassende systematische Untersuchungen über die Gründe für unsere Nicht-Nachhaltigkeit. Mike Hulmes Buch Why we disagree about Climate Change (Hulme 2009) ist eine wichtige Ausnahme. Hulme zufolge gibt es mehrere unterschiedliche Antworten auf die mit seinem Buch gestellte Frage. Sein Ausgangspunkt ist die Betrachtung des Klimawandels aus der Perspektive verschiedener sozialer Akteure: Wissenschaft, Religion, Medien etc. Unterschiedliche Konzeptionen von Wissenschaft, unterschiedliche Werte und Glaubenssysteme, unterschiedliche Prioritäten und Interessen wie auch unterschiedliche Vorstellungen von Verantwortung für künftige Generationen würden Uneinigkeit und mangelnden Fortschritt bei der Bekämpfung des Klimawandels erklären. Dies ist ein interessanter und wichtiger Ansatz. Im vorliegenden Buch soll zwar ein ähnliches Ziel verfolgt werden, nämlich aus verschiedenen Perspektiven auf die Differenzen bzw. Nachhaltigkeitsbarrieren zu schauen, es folgt allerdings einer mehr systematischen, konzeptionellen Sicht. Zudem konzentriert sich Hulme auf den Klimawandel, während es hier allgemeiner um Fragen der Nachhaltigkeit gehen soll.
Andere Autoren haben auch die Frage der Nicht-Nachhaltigkeit untersucht, führen sie aber primär auf Probleme bei der Implementierung bestimmter Politiken zurück, wie zum Beispiel Michael Howes und eine Gruppe australischer Forschender aus Umwelt- und Sozialwissenschaften (Howes et al. 2017). Wie bei jeder Implementierung politischer Maßnahmen gibt es eine Reihe von Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Nachhaltigkeitspolitiken wirkungsvoll werden können: Die Ziele müssen klar definiert sein, sie müssen messbar sein, der Leistungsverlauf muss verfolgt werden und es muss hinreichend budgetiert werden und auch dokumentiert sein, was im Fall einer Zielverfehlung geschehen soll. Solche Implementierungsprobleme sind zweifellos auch bei der Umsetzung von Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit vorhanden, doch werden sie hier im Folgenden ausgeblendet, weil sie nicht spezifisch für das Thema Nachhaltigkeit sind. Hier soll es um Herausforderungen gehen, die konzeptionell mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden sind.
Das ist auch der Grund, warum nicht alle faktischen Barrieren der Nachhaltigkeit zur Sprache kommen werden, obgleich sie in der Praxis gravierend sein mögen. Das weltweite Bevölkerungswachstum, zum Beispiel, ist eines davon. Beinahe jedes Problem der Nicht-Nachhaltigkeit wird durch eine rasch zunehmende Bevölkerung erschwert, doch soll der Schwerpunkt im Folgenden auf den konzeptionellen Barrieren der Nachhaltigkeit liegen. Gleichwohl wird, um bei diesem Beispiel zu bleiben, das Thema Bevölkerungswachstum indirekt durchaus angesprochen, weil eine Reduktion des menschlichen Umwelteinflusses direkt von der Bevölkerungsgröße abhängt.
In seinem Hauptgutachten 2011 (Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation) hat der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) verschiedene Hindernisse bzw. Barrieren zur Nachhaltigkeit diskutiert. Um eine große Transformation zu erreichen, sei es »vordringliche politische Aufgabe«, die Blockaden einer solchen Transformation und vielfältige Pfadabhängigkeiten zu überwinden (WBGU 2011, 1). Der Bericht fordert dann als ersten Schritt zu dieser »Großen Transformation«, die Transformationsbarrieren zu überwinden und benennt folgende fünf: Pfadabhängigkeiten, enge Zeitfenster, globale Kooperationsblockaden, rasante Urbanisierung und günstig verfügbare Kohlevorräte (6) – Barrieren also, die bezüglich ihrer Natur offensichtlich sehr unterschiedlich sind und teils systemischer (Pfad-Abhängigkeiten), teils sozialer (Urbanisierung), teils wirtschaftlicher Natur sind (billige Kohle; WBGU 2011, 6.22.82 ff.).
Darüber hinaus geht der WBGU nicht genauer auf eine Analyse der Barrieren ein, obgleich die Autoren bekunden, dass sich eine Eigendynamik in Richtung Transformation entfalten könne, sobald erst einmal die »entscheidenden Hürden genommen« worden seien (6).
Doch was sind diese Barrieren? Wie kann ein strukturiertes wachsendes Verständnis der Barrieren gewonnen werden? Dies ist der Ausgangspunkt für das vorliegende Buch. Ein umfassender und strukturierter Blick auf die Nachhaltigkeitsbarrieren kann insofern als Möglichkeitsbedingung für einen Umbau zu einer nachhaltigen Gesellschaft verstanden werden. Anders gesagt, ohne ein solches Verständnis wird eine entsprechende Transformation zumindest nicht befördert werden können. Auch der in Neuseeland lehrende Umweltjurist Klaus Bosselmann argumentiert in seinem Buch zum Prinzip der Nachhaltigkeit, dass es zunächst um das Verständnis des Problems, erst dann um die Erwägung von Lösungsansätzen zu gehen habe (Bosselmann 2017, 42 f.).
1.4 Prinzipien für nachhaltiges Handeln entwickeln
Blickt man aus einer systemischen Perspektive auf Barrieren der Nachhaltigkeit – was aus sachlichen Gründen unabdingbar ist –, kann man danach fragen, welche Rollen einzelne Akteure dabei spielen. Der Spielraum einzelner Akteure bei der Veränderung der Marktbedingungen oder bei der Gestaltung globaler Ordnungsstrukturen ist sehr begrenzt, selbst wenn man Regierungen oder Unternehmen zu diesen Akteuren zählt.
Dieses Problem haben alle Ansätze, die einen systemischen Blick auf die globalen Herausforderungen und die erforderlichen Transformationen werfen, was meist auch offen zugestanden wird (vgl. etwa Geels & Schot 2007, 414; Geels 2011, 29; Kanger & Schot 2018). Auch Wittmayer et al. (2017) kommen bei ihrer Analyse von Nachhaltigkeitstransformation aus soziologischer Sicht zu dem Schluss, dass die Rolle der Akteure meist zu wenig Aufmerksamkeit erfährt (Wittmayer et al. 2017, 53).
So wichtig eine systemische Betrachtung also aus sachlichen Gründen auch ist, ist sie doch durch eine starke Einbeziehung der Akteure zu ergänzen. Denn Veränderung beginnt immer mit einzelnen Akteuren, und auch die mächtigsten Politiker benötigen den Rückhalt aus der Bevölkerung, wie auch die Unternehmensvorstände den ihrer Anspruchsgruppen (Stakeholder). Und ohnehin ist nur eine verschwindende Minderheit in Positionen tätig, die eine aktive Gestaltung wirtschaftlicher oder politischer Rahmenbedingungen ermöglichen.
Vor allem aber können komplexe Systeme nicht einfach wie eine Maschine gesteuert oder reguliert werden. Aufgrund von Interdependenzen und Rückkopplungen von Komponenten führen Steuerungsversuche oft keineswegs zu dem beabsichtigten Ergebnis (vgl. 2.2). Das heißt aber nicht, dass solche Systeme überhaupt nicht zu beeinflussen sind. Nur erfolgt die Beeinflussung sozusagen »von unten«, from the bottom up, über die Systemkomponenten und ihre Wechselwirkungen (vgl. Stroh 2015, 15).
Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung, die systemische Betrachtung durch eine akteursspezifische Betrachtung zu ergänzen, denn es sind die Akteure und ihr Zusammenwirken, die das Verhalten von Systemen bestimmen. Es gibt nicht den einen Steuermann, sondern es ist ein sehr komplexes Geflecht von Akteuren unterschiedlicher Ebenen und ihren Interaktionen, welches das Systemverhalten bestimmt. Und selbstverständlich sind auch Entscheidungsträger auf die Unterstützung ihrer Stakeholder angewiesen.
Die Einbindung von Akteuren sollte jedoch nicht nur aus systematischen, sondern auch aus praktischen Gründen erfolgen. Wer sich um Nachhaltigkeit bemüht, möchte sein Handeln bereits heute darauf ausrichten und konkret werden lassen. Es ist in konkreten Handlungssituationen aber häufig gar nicht einfach bzw. sogar unmöglich zu sagen, welche von mehreren Handlungsoptionen die nachhaltigere ist. Das ist aus meiner Sicht auch eine Schwierigkeit der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Sie bestimmen zwar Ziele, geben aber wenig Orientierung bei der Frage, welche von zwei konkreten Handlungsalternativen die nachhaltigere ist. Das wichtige Ziel, den Hunger zu bekämpfen, beantwortet nicht die Frage, wie das konkret geschehen kann – darüber streiten Entwicklungspolitiker und Ökonomen seit Jahrzehnten (vgl. 4.2).
Es braucht daher Handlungsunterstützung, die in konkreten Entscheidungssituationen die nachhaltigere von mehreren Alternativen zu identifizieren hilft – und dies gilt nicht etwa nur für individuelles Konsumverhalten, sondern ebenso für Fragen von Beschaffungsprozessen der Öffentlichen Hand oder von Unternehmen, für die Formulierung von Gesetzen oder Regulierungen oder Initiativen der Zivilgesellschaft.
Die Schwierigkeit besteht darin, Prinzipien zu entwickeln, die einerseits hinreichend allgemein sind, um für einen weiten Bereich von Akteuren und Kontexten gültig zu sein, doch zugleich hinreichend konkret, um in Entscheidungssituationen Orientierung zu geben.
Das sei mit Blick auf zwei Extreme verdeutlicht. Auf der einen Seite des Spektrums gibt es allgemeine Prinzipien, die universelle Gültigkeit beanspruchen, wofür Kants Kategorischer Imperativ sicher ein herausragendes Beispiel ist. »Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.« (Kant KpV A 54)8 Hans Jonas hat dieses Prinzip auf die heutige »technologische Zivilisation« übertragen und gefordert, so zu handeln, »dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden« (Jonas 1984, 36). Doch diese universalen Prinzipien helfen kaum bei Fragen des täglichen Konsums, wenn es etwa darum geht, welche Produkte die bessere Klimabilanz aufweisen. Ihr allgemeiner Geltungsanspruch erschwert die konkrete Anwendung. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es eine Vielzahl von Ratgebern, die für die vielfältigsten Zusammenhänge konkrete Empfehlungen geben (vgl. Berg und Hartung 2008). Doch auch sie stehen vor zwei wichtigen Herausforderungen.
Zum einen müssen sie die enorme Komplexität des Themas Nachhaltigkeit auf sehr wenige Indikatoren reduzieren, wie zum Beispiel den Verweis auf eine bessere Klimabilanz. Eine solche Reduktion ist naturgemäß immer selektiv und subjektiv. In der öffentlichen Diskussion wird dann aus »klimafreundlich« sehr schnell »nachhaltig« – dies ist jedoch ein Anspruch, der kaum für irgendeine Handlung mit Recht vertreten werden kann, wie im Verlauf des Buchs noch deutlich werden wird.
Zum zweiten müssen die Empfehlungen natürlich zutreffend sein – was zunächst trivial klingt, es aber keineswegs ist. Was auf den ersten Blick als nachhaltig erscheint, ist es bei genauerer Betrachtung nicht immer. Der einfache Rat »lokal einkaufen« geht in vielen Fällen in die richtige Richtung. Doch wenn die ökologischen Auswirkungen bei der Produktion deutlich größer sind als während des Transports, in anderen Regionen aber umweltverträglicher produziert werden kann, dann mag auch eine Beschaffung aus anderen Weltregionen ökologisch vertretbar sein (vgl. 13.4).9
Im Zusammenhang mit einer Analyse, wie Nachhaltigkeit angesichts der Komplexität der Welt erreicht werden kann, fordert Casey Brown, dass Menschen dazu zu bewegen sind, die richtigen Handlungen auszuführen, die das System in der gewünschten Weise beeinflussen (Brown 2008, 149). Wissenschaft und Politik hätten die Aufgabe, die richtigen Handlungen zu identifizieren und die Menschen entsprechend zu motivieren, damit das System Mensch-Natur durch das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure in Richtung von mehr Nachhaltigkeit beeinflusst werden kann.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine systemische Betrachtung in der Tat notwendig ist, um systemische Herausforderungen zu adressieren, dass Systeme jedoch stets durch ihre Komponenten und deren Interdependenzen beeinflusst werden. An dieser Stelle wird die Rolle der Akteure bedeutsam. Da es keinen »Steuermann« gibt, hängt alles von den Akteuren ab – Akteure verschiedener Art, Individuen, NGOs, Unternehmen, Regierungen etc. Sie alle haben Entscheidungen zu treffen und benötigen Orientierung. Nicht jeder von ihnen sorgt sich um Nachhaltigkeit. Doch denjenigen, die es tun, sollte Orientierung gegeben werden, die hinreichend konkret ist, um operabel zu sein, und hinreichend generisch, um einen großen Gültigkeitsbereich zu haben.
Solche Handlungsprinzipien sollten Akteure verschiedener Art und auf verschiedenen Ebenen ansprechen. Jede und jeder von uns hat viele Rollen inne – private, berufliche, öffentliche, gesellschaftliche. Es wäre wohl schon viel erreicht, wenn jede und jeder die Spielräume der jeweiligen Rolle nutzen und sich für nachhaltigeres Handeln einsetzen würde. Wenn sich zum Beispiel ein Manager mit seiner »rebellischen« Tochter auseinandersetzen muss, die ihm beim heimischen Abendessen Vorhaltungen macht, warum sein Unternehmen so wenig für den Klimaschutz unternimmt. Persönliche Betroffenheit ist fast immer Ausgangspunkt für veränderte Sichtweisen. Plötzlich erscheinen Dinge in einem anderen Licht und es wird »uncool«, sich auf Kosten anderer zu bereichern. Plötzlich reklamieren dann auch Politiker, denen man das nie zugetraut hätte, neue Themen für sich und treiben Veränderung von oben voran.10 Dies ist der Hintergrund für die Handlungsprinzipien, die im zweiten Teil des Buchs entwickelt werden.
1.5 Das Konzept Nachhaltigkeit
Eine hitzige Debatte
Zu Beginn wurde kurz auf die Erfolgsgeschichte des Konzepts Nachhaltigkeit eingegangen, doch was meinen wir eigentlich, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen?
Die wohl am meisten verbreitete Bestimmung des Konzepts Nachhaltigkeit ist die bereits eingangs zitierte Brundtland-Definition, nach der eine Entwicklung anzustreben ist, die »die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigt, ohne die der künftigen Generationen zu gefährden« (vgl. 1.1; WCED 1987, Abschnitt 27). So verbreitet diese Definition auch ist, es gibt darum seit Jahrzehnten eine hitzige Debatte, die hier nur kurz angedeutet werden kann.
Der Soziologe Karl-Werner Brandt kritisiert die entschieden anthropozentrische Perspektive der Brundtland-Definition, die die Frage des Naturschutzes in eine Frage der Naturnutzung transformiere (Brandt 1997, 13). In ähnlicher Weise bemängelt der US-amerikanische Poltikwissenschaftler James N. Rosenau, dass der Grundgedanke der Nachhaltigkeit einen wichtigen Bedeutungswandel erlebt hätte. Bei nachhaltiger Entwicklung würde man vor allem an den Erhalt der Wirtschaft, weniger an den Erhalt der Natur denken (Rosenau 2003, 13).
Wolfgang Sachs, ehemals Ökonom am Wuppertal Institut, kritisiert etwas anderes. Er spricht von der »Zwickmühle der ›Nachhaltigkeit‹« (Sachs 1997, 98), die sich insbesondere aus der Brundtland-Definition ergeben würde. Es sei kaum übertrieben zu sagen, dass in der Brundtland-Definition »das Dilemma Gerechtigkeit vs. Natur zugunsten der Natur aufgelöst« werde. Denn zwei entscheidende Fragen blieben offen: »Welche Bedürfnisse? Und: wessen Bedürfnisse? … Soll Entwicklung sich auf den Wunsch nach Wasser, nach Land, nach Einkommenssicherheit richten oder auf das Verlangen nach Flugreisen und Aktien? … Die Brundtland-Definition suggeriert ein Sowohl-Als-Auch – und vermeidet damit, sich der Gerechtigkeitskrise wirklich zu stellen« (Sachs 1997, 98 f.).
Noch deutlicher wird Dennis Meadows. Ihm zufolge wären die meisten Menschen, »die Gebrauch von der Brundtland-Definition machen, um ihre Arbeit zu rechtfertigen (…) an einem doppelten Betrug beteiligt: Erstens sind nämlich heutzutage keineswegs die Bedürfnisse aller befriedigt. Zweitens vermindern die wirtschaftlichen Aktivitäten, die wir unternehmen, um gegenwärtige Bedürfnisse zu befriedigen, definitiv und in vielerlei wesentlichen Hinsichten die Zahl der Optionen, über die zukünftige Generationen verfügen werden« (D. L. Meadows 2000, 126). Meadows fährt fort: »In meinem Land, den Vereinigten Staaten, ist ein ›developer‹ jemand, der ein Stück Land kauft, dort alle Bäume umschlägt und darauf Gebäude und Straßen baut. Daher ist im Englischen der Ausdruck ›sustainable development‹ in Wirklichkeit ein Oxymoron …« (D. L. Meadows 2000, 127).
Nachhaltigkeit wird oft mit dem Begriff des Kapitals beschrieben, welches erhalten und nicht zerstört werden dürfte, wobei es zahlreiche Kapitalformen gibt, etwa Finanz-, Natur-, Sozial- oder Humankapital. Eine entscheidende Frage, an der sich viele Wege im Verständnis von Nachhaltigkeit scheiden, liegt darin, ob bzw. zu welchem Grad eine Substitution zwischen verschiedenen Kapitalformen für legitim erachtet wird, wenn eine andere Kapitalform reduziert wird (Figge 2005, 185).
Während Anhänger einer sogenannten schwachen Nachhaltigkeit meinen, Verluste im Bereich einer Kapitalform durch Zuwächse bei einer anderen ausgleichen zu können, sind Vertreterinnen der sogenannten starken Nachhaltigkeit der Ansicht, dass jede Kapitalform nur innerhalb gewisser Grenzen genutzt werden darf (vgl. Daly 1996; Neumayer 2003; Ott 2014).
Allerdings sind der Substituierbarkeit der Kapitalformen selbstverständlich Grenzen gesetzt, wie auch etwa Frank Figge von der Universität Leeds argumentiert. Eine zu starke Substitution bestimmter Kapitalformen würde die damit verbundenen Risiken erhöhen, wohingegen die Diversifizierung von Kapitalformen einen Risiko reduzierenden Effekt hätte (Figge 2005).
Auch der Physiker und Ökonom Robert Ayres diskutiert die Substituierbarkeit kritisch. Es habe sich die Einsicht durchgesetzt, dass bestimmte Ökosystemleistungen prinzipiell nicht ersetzt werden können – weder durch menschliche Arbeit noch eine andere Form menschengemachten Kapitals (Ayres 2008, 291).
Schließlich setzt Klaus Bosselmann sich in seinem Buch The Principle of Sustainability kritisch mit der Brundtland-Definition auseinander. Durch ihre Vagheit habe sie dazu beigetragen, das Thema Nachhaltigkeit kleinzureden. Regierungen würden deshalb die Botschaft verkünden, dass alles gleichzeitig zu haben sei – wirtschaftliches Wachstum, florierende Gesellschaften und eine intakte Umwelt. Dieses bei Regierungen wie Unternehmen beliebte schwache Konzept der Nachhaltigkeit sei grundlegend falsch, denn es gäbe nun einmal keine Alternative zum Erhalt der ökologischen Integrität der Erde (Bosselmann 2017, 2). Bosselmann hält es für zentral, am ökologischen Kern des Konzepts festzuhalten. »Es gibt entweder eine ökologisch nachhaltige Entwicklung oder gar keine nachhaltige Entwicklung« (21). Es sei eine große Fehleinschätzung zu meinen, dass ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte in gleicher Weise wichtig seien.
Das grundlegende Problem, das eine Reihe von Autoren in der Brundtland-Definition sehen (sie befördere nämlich Entwicklung zu Lasten der Natur), braucht auf konzeptioneller Ebene hier nicht weiter diskutiert werden. Bei aller konzeptionellen Vagheit scheint mir nämlich ein nicht geringer Teil dieser Kontroverse in der Sache begründet zu sein, nämlich in den Zielkonflikten zwischen ökologischer und sozialer bzw. wirtschaftlicher Dimension, in den konfligierenden Interessen von globalem Norden und globalem Süden und in der Frage, was eine faire bzw. gerechte Verteilung von Ressourcen ist.
Einen Großteil dieser Fragen hat jedes Konzept zu beantworten, das beansprucht, gegenwärtige wie künftige Bedürfnisse zu befriedigen. Auch die Agenda 2030 der UN teilt dieses Problem, indem sie versucht, einen Aktionsplan für »Mensch, Natur und Wohlstand« (people, planet and prosperity) – in der Präambel noch durch Frieden und Partnerschaft (peace and partnership) ergänzt – zu entwerfen. Sie ruft dazu auf, wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimensionen auszubalancieren. Ihre 17 SDGs mit ihren 169 Unterzielen seien ganzheitlich und unteilbar (integrated and indivisible, UN 2015).
Doch was bedeutet es zu sagen, dass die SDGs »ganzheitlich und unteilbar« sind? Es muss doch wohl heißen, dass keines der 17 SDGs für sich alleine schon beanspruchen kann, nachhaltig zu sein. Es müsste demnach so sein, dass Nachhaltigkeit erst dann verwirklicht wäre, wenn alle SDGs gemeinsam erreicht werden. Da es allerdings keinen zentralen Koordinierungs- oder gar Steuerungsmechanismus gibt und kein einzelner Akteur in der Lage ist, 17 Ziele gleichzeitig zu verfolgen, geschweige denn ihre 169 Teilziele, wird es notwendigerweise darauf hinauslaufen, dass verschiedene Akteure sich auf verschiedene Teilmengen der SDGs konzentrieren. Und während sie dies tun, können sie mit Fug und Recht behaupten, Nachhaltigkeit zu befördern. Doch ist keineswegs gesagt, dass alle 17 SDGs überhaupt gleichzeitig erreichbar sind! Gewiss ist jedes der 17 Ziele für sich wünschenswert, und es wäre wunderbar, wenn sie sich alle gemeinsam erreichen ließen. Doch woher der Optimismus, dass dies auch möglich ist? Wünschen kann man sich viel. Vor allem ist die Frage, ob (und ggf. wie) verhindert werden kann, dass gutgemeinte Maßnahmen zur Erreichung bestimmter Teilmengen der SDGs das Erreichen anderer Teilmengen vereiteln. Niemand kann garantieren, dass dies nicht geschieht.
Das oben erwähnte Beispiel des Phasenübergangs von Wasser hat verdeutlicht, dass ein Übergang von einer Phase zu einer anderen nur bei bestimmten Konstellationen der entscheidenden Parameter (Druck und Temperatur) möglich ist. Beim Wasser kann man diese Parameter-Konstellationen in einem exakten Diagramm angeben. Doch wie soll ein solches Diagramm für 17 Ziele und 169 Teilziele aussehen? Wie kann man sicherstellen, dass diese Ziele alle gemeinsam erreicht werden können? Die Antwort ist: Man kann es nicht! Und zwar nicht etwa deshalb, weil es praktische Hürden dafür gäbe, sondern weil man nicht einmal theoretisch sagen kann, ob das möglich ist.
Um es ganz deutlich zu sagen: Es ist eine Sache, 17 Ziele zu formulieren und ihr gleichzeitiges Erreichen anzustreben, aber eine völlig andere, ob das überhaupt möglich ist; und es ist schließlich eine dritte Sache, dieses in die Praxis umzusetzen. Im Fall der 17 SDGs gibt es ernsthafte Zweifel, dass sie sich alle gleichzeitig erreichen lassen, wie verschiedene Untersuchungen folgern (vgl. Scherer et al. 2018; IASS 2015). Eine Studie des Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam formuliert sogar pointiert, die Nachhaltigkeitsziele der UN könnten auf nachhaltige Weise nicht erreicht werden – they cannot be met sustainably (IASS 2015, 4).
Arbeitsdefinition
Der große Vorteil der Brundtland-Definition ist ihre globale Verbreitung und die große Zustimmung, die sie erfährt, zumindest außerhalb akademischer Kreise. Im Folgenden wird diese Definition deshalb gelegentlich referenziert. Die Agenda 2030 ist ebenfalls in einem ähnlichen Geist geschrieben. Allerdings müssen auch die gravierenden Mängel eines schwachen Konzepts der Nachhaltigkeit gesehen werden, da ein solches nicht die ökologischen Belastungsgrenzen (wie z. B. die »planetaren Grenzen«) des Planeten berücksichtigt. Ich stimme deshalb mit Bosselmann überein, der ökologische Integrität, also den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen als zentrale Voraussetzung dafür konstatiert, dass die Bedürfnisse gegenwärtiger wie künftiger Generationen erst befriedigt werden können (Bosselmann 2017, 10). Die Forderung nach Erhalt ökologischer Integrität macht mein eigenes Verständnis damit zu einem Konzept starker Nachhaltigkeit. Viele der Aussagen dieses Buchs sind aber unabhängig davon, ob ein schwaches oder starkes Konzept der Nachhaltigkeit vertreten wird, denn oft genug sind wir noch nicht einmal auf dem Weg, uns einer schwachen Nachhaltigkeit zu nähern.
Ohnehin haben wir, wie sogleich zu zeigen sein wird, ein deutlich besseres Verständnis von dem, was nicht nachhaltig ist, als davon, was nachhaltig ist. Dies hat sowohl mit der vieldimensionalen Natur des Konzepts Nachhaltigkeit als auch mit der Vielzahl an Barrieren zu tun, die den Weg dorthin versperren, wie nun zu diskutieren sein wird.
Warum wir nicht wissen, wie Nachhaltigkeit zu erreichen ist
Die Brundtland-Definition geht stillschweigend davon aus, dass wir wüssten, welches die Bedürfnisse künftiger Generationen sind und wodurch wir die Befriedigung derselben gefährden. Beides ist allerdings durchaus nicht selbstverständlich.